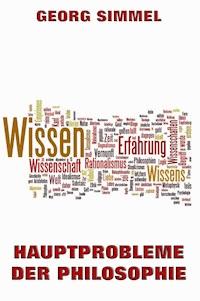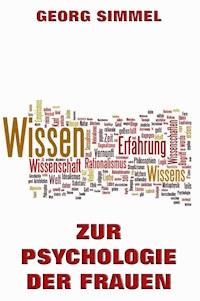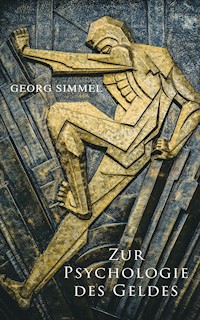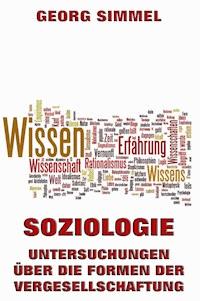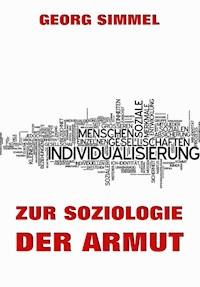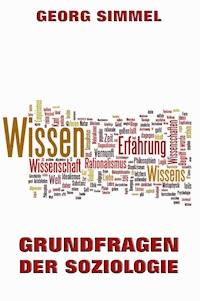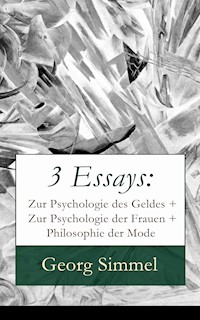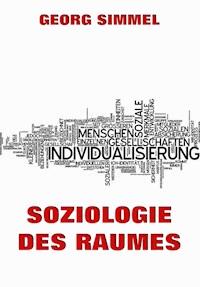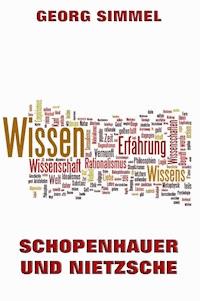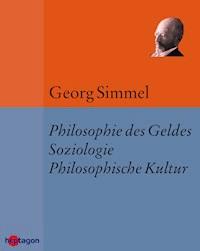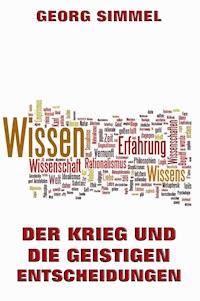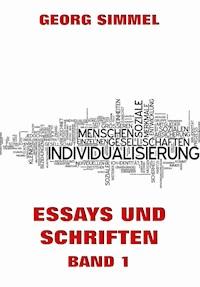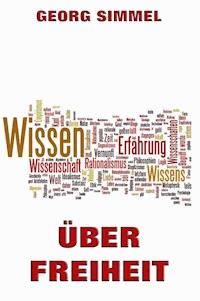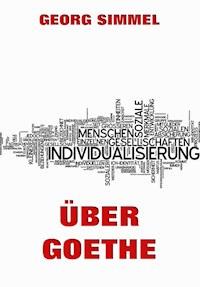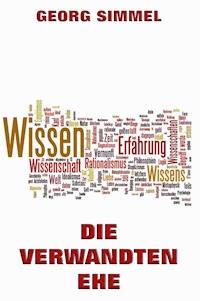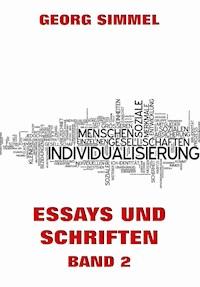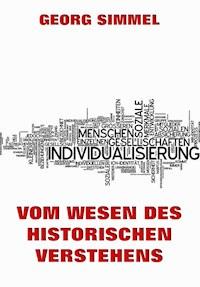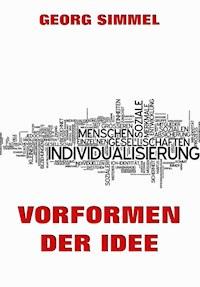1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hauptprobleme der Philosophie, von Georg Simmel, Philosoph und Soziologe :- Vom Wesen der Philosophie- Sein und Werden- Vom Subjekt und Objekt- Von den idealen Forderungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Table of Contents
copyright
Georg Simmel
Hauptprobleme der Philosophie
Einleitung
Vom Wesen der Philosophie
Sein und Werden
Vom Subjekt und Objekt
Von den idealen Forderungen
copyright
Copyright © 2014 / FV Éditions
Bild © http://www.snap2objects.com
ISBN 978-2-36668-171-0
Alle Rechte Vorbehalten
Georg Simmel
Philosoph und Soziologe, 1858-1918
Hauptprobleme der Philosophie
1927
Einleitung
Man hat das Verständnis der Kunst so gedeutet, dass der Beschauer den Schaffensprozess des Künstlers in einer bestimmten Art wiederhole.
Und wie tatsächlich das große Kunstwerk das ganze Strahlenbündel des Lebens, das zu ihm als zu seinem Gipfel führt, fühlbar macht und damit den ganzen Verdichtungs- und Erhöhungsprozess des künstlerischen Schaffens gleichsam in uns überträgt, so ist der große philosophische Gedanke das sublimierteste Resultat eines weitausgreifenden Lebens, das uns jener Gedanke nachzuerleben, bis es in ihn selbst mündet, veranlasst.
Wie aber mit jenem innerlich nachschaffenden Begreifen des Kunstwerks doch erst eine lange und hingebende Werbung um die Kunst belohnt wird, so öffnen die abstrakten und starren Begriffe der philosophischen Systeme ihre innere Bewegtheit und die Weite des Weltfühlens, das sich in sie hineingelebt hat, nur dem Blick, der sich lange um sie und die Erregungen ihrer Tiefen bemüht hat.
Dieses Verständnis der Philosophie von dem inneren Prozess her, dessen Lebendigkeit in ihr die Kristallform des Begriffes angenommen hat - dieses Verständnis zu erleichtern haben sich die Darstellungen der Geschichte der Philosophie, wenn ich mich nicht täusche, nicht allzuhäufig zum Problem gemacht; sie pflegen vielmehr das Letzte und Zugespitzteste der Resultate des Denkens darzubieten, deren logisch geschlossene Formung sich in dem weitesten Abstand von der lebendig-kontinuierlichen Strömung des Schaffensprozesses hält.
Indem das Recht solcher Darstellung, die die Resultate des Denkvorganges, gleichsam in deren eigner Ebene verbleibend, erfassen will, unangetastet bleibt, erscheint mir daneben doch der Versuch gerechtfertigt, zu jenem andern Verständnis anzuleiten, das mehr unmittelbar auf die geistige Bewegung, als auf das von ihr gestaltete Gebilde, mehr auf den geistigen Zeugungsvorgang, als auf das schließliche Erzeugnis geht und das bisher, im großen und ganzen, nur der Philosoph dem Philosophen gegenüber besessen hat, weil seine eigne Produktivität das Organ jenes inneren Nachschaffens voraussetzt und ausbildet.
Dieser Aufgabe, das innerliche, miterlebende, die Bedingungen der Produktion nachfühlende Verständnis außerhalb des Kreises der Profession zu fördern, will ich hier durch Darstellung und Erwägung einiger hauptsächlicher, historisch vorliegender Probleme und Lösungsversuche dienen, und zwar unter Zugrundelegung einer gewissen Fiktion.
Ich möchte die Bilder dieser großen Philosopheme so geben, wie sie sich etwa einem Philosophen darstellen, der eine eigne Lösung ihrer Probleme sucht und zu diesem Zwecke die bereits vorliegenden Lösungen sich vergegenwärtigt und erwägt.
Die Absicht eines solchen wäre keine historische, sondern eine sachliche, d.h. das Problem wäre ihm nicht wichtig, weil Plato und Hegel es behandelt haben, sondern Plato und Hegel sind ihm wichtig, weil sie das Problem behandelt haben.
Darum werden in dem Fluss seines Denkens ihre Lehren gewissermaßen nur als besonders geformte Wellen auftauchen, ohne, als Selbstzwecke, dessen Kontinuität zu unterbrechen.
Da sie jetzt nur Stationen seines eignen Gedankenweges sind, so legen sie die systematische Form ab, deren starre Geschlossenheit so oft das Eindringen in ihr inneres Leben hindert und die als dessen vergänglichste Hülle sowieso von der geistesgeschichtlichen Entwicklung desavouiert wird.
So wird am ehesten die eigne Geistesbewegung die Konturen des überlieferten Gedankens nachzeichnen und sich in ihn ergießen können, der ohne diese Transfusion und Einfühlung im letzten Grunde unzugängig bleibt.
Über die Darstellung, die sich aus dieser Fiktion ergibt, greife ich nicht hinaus und biete für die Probleme keine eigne Lösung an, deren unvermeidliche Einseitigkeit der Objektivität meiner hier gestellten Aufgabe widersprechen würde.
Vom Wesen der Philosophie
Wenn man zu den Gedankenmassen, die unter dem Begriff der Philosophie gesammelt sind, einen Eingang sucht, eine Bestimmung dieses Begriffes von einem Orte der geistigen Welt her, der nicht selbst schon in den philosophischen Bezirk hineingehört, so kann sich dieses Bedürfnis an der gegebenen Struktur unseres Erkennens nicht befriedigen.
Denn was Philosophie ist, wird tatsächlich nur innerhalb der Philosophie, nur mit ihren Begriffen und Mitteln ausgemacht: sie selbst ist sozusagen das erste ihrer Probleme.
Vielleicht richtet keine andre Wissenschaft ihre Fragestellung in dieser Art auf ihr eignes Wesen zurück. Der Gegenstand der Physik ist doch nicht die physikalische Wissenschaft selbst, sondern etwa optische und elektrische Erscheinungen, die Philologie fragt nach den Plautushandschriften und der Kasusentwicklung im Angelsächsischen - aber nach der Philologie fragt sie nicht.
Die Philosophie, und vielleicht also sie allein, bewegt sich in diesem eigentümlichen Zirkel: innerhalb ihrer eignen Denkweise, ihrer eignen Absichten, die Voraussetzungen dieser Denkweise und Absichten zu bestimmen.
Es gibt von außen keinen Zugang zu ihrem Begriff, weil nur die Philosophie selbst ausmachen kann, was die Philosophie sei, ja, ob sie überhaupt sei oder etwa mit ihrem Namen nur ein geltungsloses Phantasma decke.
Dieses einzigartige Verhalten der Philosophie ist die Folge oder vielleicht nur der Ausdruck ihrer grundlegenden Bemühung: voraussetzungslos zu denken.
Wie es dem Menschen überhaupt nicht gegeben ist, ganz und gar »von vorn anzufangen«, wie er in sich und außer sich immer eine Wirklichkeit oder eine Vergangenheit vorfindet, die seinem Verhalten einen Stoff, einen Ausgangspunkt oder wenigstens ein Feindseliges und zu Vernichtendes bietet - so ist auch unser Erkennen von irgendeinem »Vorgefundenen« bedingt, von Realitäten oder inneren Gesetzen; von ihnen, die der Denkprozess selbst nicht erzeugen kann, hängt, in mannigfaltigster Beschränkung seiner Souveränität, sein Inhalt und seine Richtung ab - und seien es auch nur die Regeln der Logik und der Methode oder das Faktum einer bestehenden Welt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!