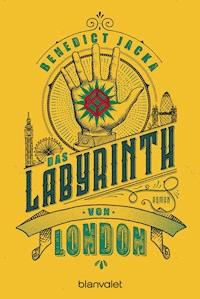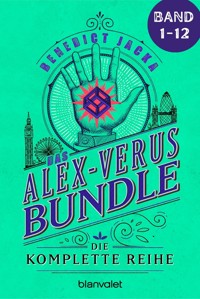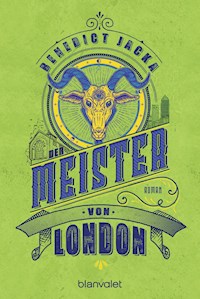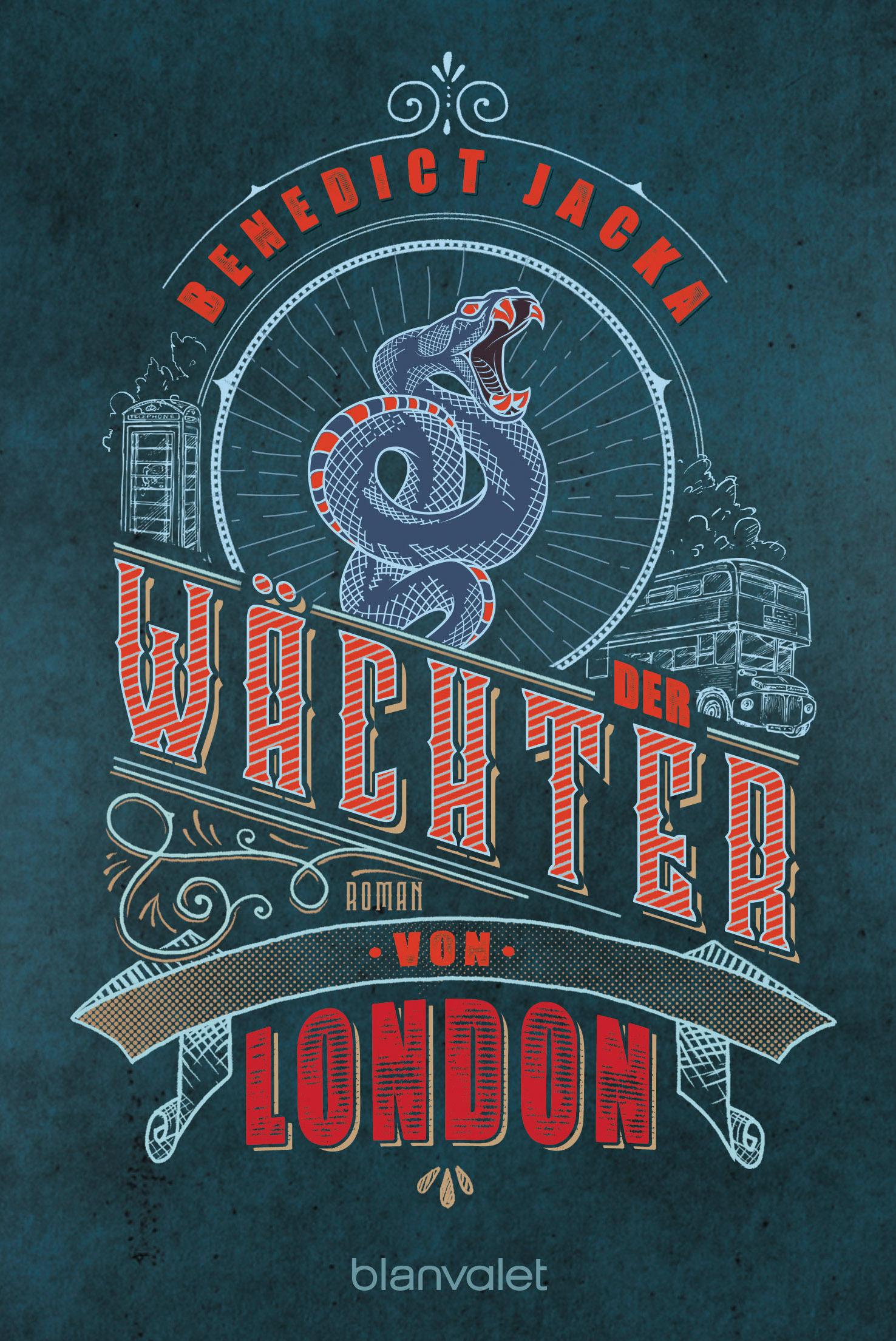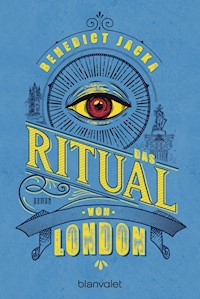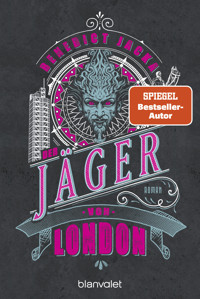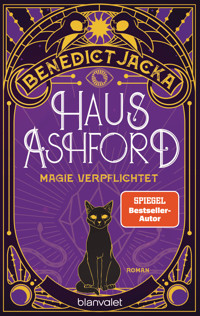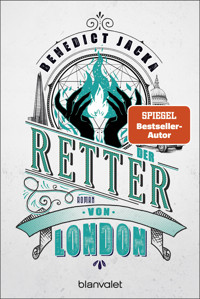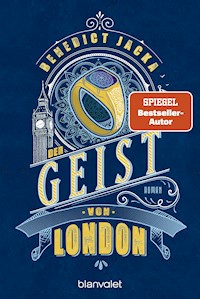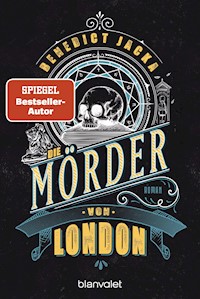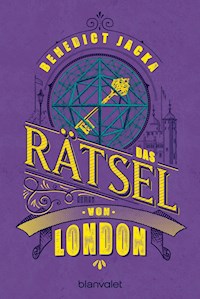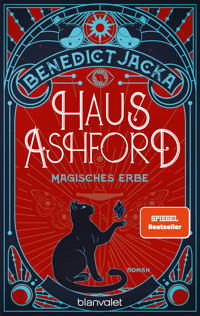
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Stephen Oakwood
- Sprache: Deutsch
Mit seinem magischen Erbe kommt leider auch eine verdammt snobistische Familie – der neue Haus-Ashford-Roman von Bestsellerautor Benedict Jacka.
Stephen Oakwood will weiter in die Geheimnisse der Magie eindringen. Doch dafür benötigt er Geld. Ausgerechnet Calhoun, der Erbe von Haus Ashford, bietet ihm einen lukrativen Job als Leibwächter. Eigentlich will Stephen nichts mehr mit seiner hochmütigen und intriganten Familie zu tun haben, doch ihm bleibt kaum eine andere Wahl. Bis der geheimnisvolle Byron aus dem Schatten tritt und vorgibt, Stephen unterstützen zu wollen. Doch auch das hat seinen Preis. Als dann auch noch ein alter Feind wieder auftaucht, gerät Stephen endgültig zwischen die Fronten und muss all seine Fähigkeiten aufbieten, wenn er überleben will.
Verpassen Sie auch nicht die 12-bändige, bereits abgeschlossene Serie um den Hellseher Alex Verus, die mit »Das Labyrinth von London« beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Stephen Oakwood will weiter in die Geheimnisse der Magie eindringen. Doch dafür benötigt er Geld. Ausgerechnet Calhoun, der Erbe von Haus Ashford, bietet ihm einen lukrativen Job als Leibwächter. Eigentlich will Stephen nichts mehr mit seiner hochmütigen und intriganten Familie zu tun haben, doch ihm bleibt kaum eine andere Wahl. Bis der geheimnisvolle Byron aus dem Schatten tritt und vorgibt, Stephen unterstützen zu wollen. Doch auch das hat seinen Preis. Als dann auch noch ein alter Feind wieder auftaucht, gerät Stephen endgültig zwischen die Fronten und muss all seine Fähigkeiten aufbieten, wenn er überleben will.
Autor
Benedict Jacka (geboren 1980) ist halb Australier und halb Armenier, wuchs aber in London auf. Er war 18 Jahre alt, als er an einem regnerischen Tag im November in der Schulbibliothek saß und erstmals, anstatt Hausaufgaben zu machen, Notizen für seinen ersten Roman in sein Schulheft schrieb. Wenig später studierte er in Cambridge Philosophie und arbeitete anschließend als Lehrer, Türsteher und Angestellter im öffentlichen Dienst. Das Schreiben gab er dabei nie auf, doch bis zu seiner ersten Veröffentlichung vergingen noch sieben Jahre. Er betreibt Kampfsport und ist ein guter Tänzer. In seiner Freizeit fährt er außerdem gerne Skateboard und spielt Brettspiele.
Die Haus-Ashford-Saga:
Magie verpflichtet
Magisches Erbe
Eine Frage der Magie (in Vorbereitung)
Die zwölfbändige Alex-Verus-Serie von Benedict Jacka bei Blanvalet:
Das Labyrinth von London · Das Ritual von London · Der Magier von London
Der Wächter von London · Der Meister von London · Das Rätsel von London
Die Mörder von London · Der Gefangene von London · Der Geist von London
Die Verdammten von London · Der Jäger von London
Der Retter von London
Deutsch von Michelle Gyo
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »An Instruction in Shadow (2)« bei Orbit, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Benedict Jacka
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: Shutterstock (Evgenia Pichkur, Tanya K, Thhattaya, Peratek)
HK · Herstellung: fe
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31497-2V001
www.blanvalet.de
Zur Erinnerung an Siranus Ojeni Dermen
1942–2023
1
Es war nass, es war kalt, und ich machte mir Sorgen.
Regen fiel in Schleiern herab, zu heftig, als dass man es als Nieseln hätte bezeichnen können, und zu wenig für einen Wolkenbruch. Im gelbweißen Schein der Lichter des Olympic Park sah man die Regentropfen diagonal vom dunklen, wolkenverhangenen Himmel fallen. Ich hatte Schutz unter einem Baum gesucht, aber der Wind trieb die Regenböen unter die Äste, und kalte Tropfen trafen mein Gesicht.
Es war ein Samstagabend in Ostlondon, und ich stand in Stratford auf einer grasbewachsenen Böschung oberhalb einer Straße namens Marshgate Lane. Eine kleine Baumgruppe ragte hier neben einem Maschendrahtzaun auf, und wären Passanten unterwegs gewesen, hätten sie sich wohl gefragt, was so besonders war an diesem speziellen Gehölz, dass ich meinen Samstagabend im Kalten und Nassen verbrachte. Die Antwort war einfach: Unter einem der Bäume befand sich eine Quelle.
Quellen sind Orte, an denen sich Essentia sammelt, die Rohenergie, die für Drucraft genutzt wird. In den letzten sechs Monaten war ich ziemlich gut darin geworden, die Stärke einer Quelle einzuschätzen, und diese hier ordnete ich am unteren Ende der Skala bei D+ ein. Was hieß, dass Linford’s, das Unternehmen, für das ich arbeitete, mir siebenhundert Pfund dafür bezahlen würde. Diese siebenhundert Pfund bekäme ich aber nur, wenn die Quelle noch da wäre, wenn sie eintrafen. Als ich diese hier entdeckt hatte, hatte dort jemand herumgelungert, ein Junge in einem dicken Anorak mit Kapuze. Er hatte sich zurückgezogen, als ich näher gekommen war, hatte sich dann aber noch ein wenig zu lange in der Nähe herumgetrieben, bevor er endgültig verschwunden war. Und deshalb war ich hier draußen, ließ mich nass regnen und sorgte dafür, dass noch eine Quelle da war, für die man mich bezahlen konnte, sobald das Team von Linford’s eintraf.
Der Wind drehte und trieb mir eine weitere Regenbö in die Augen. Ich schauderte und schob mich um den Baum herum, auch wenn das nicht viel brachte – mein Fleece und die Hose waren mittlerweile ziemlich durchnässt. Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass seit meinem Anruf siebzig Minuten vergangen waren. Man wusste nie, wie lange ein Drucraft-Unternehmen brauchte, um auf die Meldung einer Quelle zu reagieren; es konnte Stunden dauern oder Tage, und man bekam keine Informationen dazu.
Ich wünschte mir, ich könnte einfach nach Hause gehen. Normalerweise tue ich das auch, wenn ich eine Quelle gemeldet habe; die Firmen entlohnen einen nicht fürs Warten; sie zahlen, damit man ihnen die Koordinaten gibt und sich dann verkrümelt. Doch etwas an diesem Jungen hatte meine Alarmglocken schrillen lassen. In der Theorie ist die Quelle, sobald man sie gemeldet hat und die Information beim Quellenregister hinterlegt ist, Eigentum des Hauses oder des Unternehmens, für das man arbeitet. Doch ein Teil der Quellenjäger schert sich nicht um das Quellenregister oder das Eigentumsrecht anderer Leute im Allgemeinen, und genau aus diesem Grund blieb ich lieber draußen in der Kälte und im Regen stehen.
Es war erst gut eine Stunde vergangen, also machte ich mir vielleicht umsonst Sorgen. Die Quelle war nur eine D+ – das reichte kaum, um Plünderer in Entzücken zu versetzen, besonders nicht bei so miesem Wetter. Die Ashfords würden für so etwas nicht mal den Finger rühren.
An die Ashfords zu denken, war ein Fehler, denn meine Gedanken wanderten wieder zu den Ereignissen vom Nachmittag zurück.
Fünf Stunden zuvor
Ich entdeckte sie, sobald sie auftauchte. Sie trug einen dunkellila Blazer über einem schmalen Kleid und zog einen kleinen Koffer hinter sich her, die Absätze ihrer Schuhe klickten auf dem polierten Boden. Hinter ihr war eine große Reklametafel, und als sie vorbeilief, ragte ihre Gestalt einen Moment als Silhouette vor einem stilisierten Drachen auf der Anzeige auf, Lila vor Gold.
Ich folgte ihr bis zum Ende des Geländers und daran vorbei. Sie wandte sich dem Ausgang zu, zog immer noch ihren Handgepäckkoffer und bemerkte mich aus dem Augenwinkel. Sie wollte wegsehen, dann schien etwas ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und sie wandte sich mit einem leisen Stirnrunzeln zu mir um.
»Hi, Mum«, sagte ich.
Meine Mutter öffnete den Mund, immer noch stirnrunzelnd, doch mit einem Mal zuckte Erkennen in ihren Augen auf. Sie erstarrte.
Wir standen in der Terminalhalle. Menschen liefen um uns herum, begrüßten einander, umarmten und unterhielten sich, und wenn die Unterhaltung beendet war, sammelten sie sich in Gruppen und strömten aus dem Flughafen hinaus, um sich auf den Weg nach Hause zu machen. Nur wir beide rührten uns nicht.
»Was machst du hier?«, fragte meine Mutter endlich. Sie wirkte geschockt.
»Ich habe auf dich gewartet.«
Meine Mutter sah sich um. Ein wenig verwirrt tat ich das auch; das Terminal war voll, aber niemand beachtete uns.
»So etwas darfst du nicht tun«, sagte meine Mutter. »Du darfst nicht hier sein. Wenn mein Vater das erfährt …«
»Er hat nur gesagt, ich soll mich vom Haus fernhalten und Calhoun nicht umbringen«, erwiderte ich. »Er hat nichts von einem Treffen mit dir gesagt.«
»… was?«
»Er hatte mich nach der Plünderung zu einem Gespräch gebeten«, erklärte ich.
Meine Mutter starrte mich an.
Ich hatte meine Mutter nie persönlich gesehen, zumindest nicht, dass ich mich erinnern konnte. Um sie aufzuspüren, hatte ich nur ein paar alte Fotos gehabt, und als ich sie entdeckt hatte, wie sie den Gang vom Ankunftsterminal entlanglief, hatte sich nichts in mir gerührt, keinerlei Erkennen. Sie hatte für mich einfach ausgesehen wie eine attraktive vierzigjährige Frau in einem Kostüm. Jetzt, als ich länger mit ihr sprach, regte sich vorsichtig etwas in mir. Diese kleinen Bewegungen, wenn sie den Kopf drehte … Sie erinnerten mich irgendwie an mich selbst, wie ich mich manchmal aus dem Augenwinkel im Spiegel sah.
»Ich könnte dir erzählen, was passiert ist«, bot ich an, als sie immer noch nichts sagte.
»Nicht hier«, entgegnete meine Mutter und schien eine Entscheidung zu treffen. Sie zog eine Karte aus der Innentasche ihrer Jacke, zögerte, schüttelte den Kopf, holte einen Stift heraus und kritzelte etwas auf den Karton. »Rede mit niemandem, bis wir uns getroffen haben. Okay?«
»… okay.«
»Ich muss los.« Ohne eine Antwort abzuwarten, packte sie den Griff ihres Koffers und lief mit klickenden Absätzen davon. Nach vielleicht fünfzehn Metern blickte sie zurück. Ich winkte; sie sah mich eine Sekunde lang an, dann verschwand sie in der Menge.
Der Wind drehte, wehte mir erneut kalten Regen ins Gesicht und brachte mich zurück in die Gegenwart. Ich schüttelte mich kurz, duckte mich wieder unter den Baum und sah mich erneut um. Der Olympic Park war so leer wie zuvor.
Vielleicht machte ich mir ja nicht nur Sorgen um die Quelle. Am Nachmittag war ich aus dem Flughafen Heathrow getreten und war – nun, nicht unbedingt froh gewesen, aber ich hatte zumindest das Gefühl gehabt, etwas erreicht zu haben. Und als ich beschlossen hatte, den Abend mit der Jagd nach Quellen zu verbringen, hatte ich gedacht, es würde eine Siegerrunde werden.
Doch nachdem die Euphorie verpufft war und die Stunden verstrichen, hatte ich angefangen, mich … wie zu fühlen? Irritiert? Unbehaglich?
Frustriert. Ich war frustriert.
Wenn man sich wirklich lange auf ein Kennenlernen freut, bauscht man es innerlich auf. Man geht das Treffen im Geiste durch, spinnt sich zurecht, wie es ablaufen wird. Wenn es wirklich so weit ist, scheint es aber nie so zu verlaufen wie gedacht. Natürlich hat man sich alles zurechtgelegt, was man selbst sagen wird, aber man weiß eben nicht, was die andere Person tun wird. Und so führt die Begegnung eben in eine Richtung, mit der man nicht gerechnet hat.
Ich hatte nicht erwartet, dass meine Mutter auf mich zurennen und mich umarmen würde. Trotzdem hatte ich auf etwas … na ja, etwas mehr gehofft. Inzwischen hatte ich die Unterhaltung in meinem Kopf wieder und wieder ablaufen lassen, und je öfter ich es tat, desto mehr wurde mir klar, dass meine Mutter zu keinem Zeitpunkt besonders glücklich gewirkt hatte, mich zu sehen. Oder in meiner Nähe zu sein.
Dass sie nicht mal daran gedacht hatte, dass mein Geburtstag war, hatte auch nicht geholfen.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr beschäftigte es mich. Man sollte meinen, dass das Wetter mich ablenkte – im eisigen Regen zu stehen und zu warten, ist fies, aber wenigstens ist man so im Hier und Jetzt –, doch es richtete nicht so viel aus, wie ich gehofft hatte. Und langsam beschlich mich das vage beunruhigende Gefühl, dass ich mit der Begegnung mit meiner Mutter etwas aufgeschreckt haben könnte, das ich vielleicht besser hätte ruhen lassen sollen.
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, damit die Angelegenheit aus meinen Gedanken zu verdrängen. Eine Stunde und zwanzig Minuten waren vergangen, seit ich die Quelle gemeldet hatte. Vielleicht sollte ich einfach heimgehen. Hier war keine Spur von …
… Moment.
Zwischen mir und dem Stadion befand sich ein Parkplatz. Gelbweißes Licht spiegelte sich im nassen Asphalt, und in seinem Schein konnte ich schattenhafte Gestalten ausmachen, die in meine Richtung kamen.
Sofort war ich in höchster Alarmbereitschaft. Ich bewegte die Finger, prüfte meine Sigl-Ringe und rief mir in Erinnerung, welcher an welchem Finger saß. Schlag-/ und Licht-Sigl an meiner linken Hand, Blitz und Chaos an meiner rechten. Meine Kraft-Sigl war unter meinem T-Shirt verborgen, hing mir an einem Band um den Hals, und ich lenkte etwas Essentia hinein. Sofort strömte Energie in meine Brust und breitete sich von dort bis in meine Muskeln aus. Nachdem ich die Kraft einmal in sie hineingechannelt hatte, würde sie ohne weiteres Zutun von mir Essentia ziehen.
Ich warf wieder einen Blick auf die herankommenden Gestalten.
Es waren vier, und alle trugen Hoodies. Ich konnte ihre Gesichter nicht erkennen, aber aus der Kombination aus schnellem und zugleich aufschneiderischem Gang schätzte ich ihr Alter auf die späten Teenagerjahre oder die frühen Zwanziger, genau wie ich. Da es in diesem Teil des Olympic Park sonst nur eine Baustelle und eine Laufbahn gab, fiel mir genau ein einziger Grund ein, aus dem die vier sich auf diese Stelle hier zubewegten.
Ich konzentrierte mich auf die vier Umrisse vor mir und öffnete meine Sinne.
Seit April war ich in der Lage, Essentia zu sehen. Alle Drucrafter können sie spüren, aber ich kann sie sehen, ihre Bewegung als Farbwirbel wahrnehmen. Der rötlich braune Schein der Quelle hinter mir dominierte mein Sehfeld, ergoss sich über meine Füße und den Hügel hinab. Sogar eine so schwache Quelle wie diese besaß sehr viel mehr Essentia als jeder Mensch und jede Sigl, aber ich konnte immer noch durch sie hindurchsehen und mich auf die Umrisse der vier Jungs konzentrieren, doch da erblickte ich … nichts. Keinerlei aktive Sigls.
Was sowohl gut als auch schlecht war. Gut, weil es hieß, dass diese Jungs vermutlich Kleinkriminelle waren. Schlecht, weil es hieß, dass meine Chaos-Sigl nutzlos sein würde. Ich hatte sie hergestellt, um damit die Kraft-Sigls meines Gegners zu sabotieren, und in den Kämpfen letzte Woche war sie mein Trumpf gewesen. Gegen einen Gegner ohne Sigls richtete sie aber nichts aus … und meine Fähigkeit, Essentia zu sehen, würde mir auch nicht viel nutzen.
Die vier Typen überquerten die Straße und hielten am Fuß der Böschung inne, jedoch nicht so nah, dass es bedrohlich wirkte. Sie starrten zu mir auf. Ich starrte zurück.
»Wieläuftsn?«, rief einer.
»’n Ordnung«, sagte ich vorsichtig.
»Alles gut?«
Ich stieß ein vages Geräusch aus.
Kurz herrschte Stille. Der Regen fiel weiter herab.
»HasteFeuer?«, fragte der Junge.
»Was?« Wenn man in meinem Bezirk von London lebt, gewöhnt man sich an seltsame Dialekte, aber dieser Typ hatte eine so heftige Londoner Multikulti-Aussprache, dass nicht einmal ich ihn verstand.
»Hastn Feuerzeug?«
Ich schüttelte den Kopf. Der Typ brummte enttäuscht.
Keiner der drei anderen hatte sich gerührt. Ihre gesamte Haltung wirkte seltsam freundlich. Sie verhielten sich nicht, als wären sie hier, um zu …
Moment. Argwohn durchzuckte mich. Warum taten sie so freundlich?
Ich warf einen Blick über die Schulter.
Der Typ hinter mir stürmte bereits auf mich zu, und ich sprang gerade noch rechtzeitig zur Seite. Seine ausgestreckten Arme erwischten meine Fleecejacke und brachten mich aus dem Gleichgewicht, bevor er, von seinem eigenen Schwung getragen, den Hang hinunterstolperte. Ich wirbelte erneut herum und sah, dass der Typ, der sich mit mir unterhalten hatte, die Entfernung zwischen uns überwunden hatte; ich streckte den linken Arm aus und schickte Essentia durch meine Muskeln in die Sigl an meinem Zeigefinger. Diese sandte einen Kegel aus grellem blauweißem Licht aus, und für den Bruchteil einer Sekunde wurde die Nacht zum Tag. Der Typ und der neben ihm schrien auf und fassten sich an die Augen. Ich löste meine Schlag-Sigl aus und sandte zwei Schläge aus komprimierter Luft gegen seinen Kopf; geblendet und aus dem Gleichgewicht gebracht, kippte er um.
Kurz spürte ich Befriedigung in mir auflodern, als ich ihn die Böschung hinabrollen sah, aber als ich mich umdrehte, erlosch sie sogleich wieder. Es waren mehr, als ich gedacht hatte. Fünf, sechs …
Schatten näherten sich mir bedrohlich. Ich ließ den Arm schnell vorzucken und traf einen von ihnen mit meiner Schlag-Sigl; er taumelte davon, schirmte den Kopf ab, aber bevor ich meinen so gewonnenen Vorteil ausnutzen konnte, musste ich herumwirbeln zu einem Kerl, der hinter mir herangeschlichen war. Er trat den Rückzug an, doch jetzt war ich umstellt. Ich wich zum Baumstamm zurück, damit sie mir nicht so leicht in den Rücken fallen konnten, aber der Kreis hatte sich geschlossen. Ich blinzelte gegen den Regen an, und endlich gelang es mir, sie zu zählen. Sieben.
Ich stand mit dem Rücken am Baum, während es immer noch nieselte. Die Typen, die mich umringten, rückten vor, offenbar selbstbewusst genug, um den Kampf aufzunehmen, aber zugleich vorsichtig, denn keiner wollte der Erste sein. Eine eisige Windbö fuhr mir durch die Kleidung. Adrenalin pumpte durch mich hindurch, schärfte meine Sinne. Meine Lage war übel und hatte das Potenzial, noch viel, viel übler zu werden. Tief in mir fragte ich mich ungläubig: Und das alles für siebenhundert Pfund?
Einer der Jungs rief mir etwas zu, dann ein anderer. Ich blendete ihre Worte aus, wollte mir nicht anmerken lassen, wie viel Angst ich hatte. Stattdessen konzentrierte ich mich, erlaubte mir nicht, an irgendetwas anderes zu denken als an die nächsten paar Sekunden. Meine gesamte Aufmerksamkeit galt der Frage, wer sich zuerst rühren würde. Würden sie von links oder rechts kommen?
Der Typ links rief mir eine Beleidigung zu. Ich wandte mich ihm ein wenig zu, behielt aber den zweiten Kerl zu meiner Rechten dabei im Auge. In einer Gang gibt es immer einen, der ein wenig gemeiner und aggressiver ist als der Rest, also beobachtete ich ihn weiter aus dem Augenwinkel, tat so, als würde ich nicht mitbekommen, wie …
Er stürzte auf mich zu.
Ich löste meine Blitz-Sigl aus. Grelles Licht erwischte ihn und noch zwei andere, sodass sie zurücktaumelten. Ein Kerl kam von der anderen Seite heran, ich schlug nach seinem Gesicht und beförderte ihn ins nasse Gras. Als ich mich umsah, verspürte ich einen Funken Hoffnung – alle wichen zurück. Moment, ich konnte nur sechs sehen, waren es nicht …?
Arme packten mich von hinten.
Verzweifelt wehrte ich mich, aber der Kerl hinter mir war größer als ich und hatte mich vom Boden gehoben, sodass ich in der Luft hing. Die anderen drängten jetzt heran; ich trat aus und erwischte einen, dann waren sie über mir. Fäuste trafen meine Schultern, meine Brust, meine Seiten; eine streifte mich am Kopf, und Schmerz durchzuckte meinen Nacken.
Ich wand mich und trat um mich. Ein Schlag traf mich voll in den Bauch, sodass ich aufkeuchte; der Typ hinter mir zog an mir, und Entsetzen durchfuhr mich, als ich begriff, dass er mich zu Boden ringen wollte. Meine Füße berührten das Gras, und für einen Augenblick konnte ich die Hebelwirkung ausnutzen.
Meine Panik verlieh mir Kraft, und ich riss einen Arm los, rammte dem Typ den Ellbogen in die Seite; ich hörte ein Schnappen und ein Aufkeuchen, und sein Griff lockerte sich. Schläge regneten auf mich ein; es gelang mir, meine Arme so weit zu heben, dass die meisten auf meinen Unterarmen und Handgelenken landeten, dann kniff ich die Augen zusammen und löste die Blitz-Sigl wieder und wieder aus.
Schreie und Flüche erklangen, und für den Moment hörten die Schläge auf. Ich öffnete die Augen, sah eine Lücke zwischen meinen Angreifern und stürzte mich hinein.
Hände packten mich, aber da war ich schon hindurch, hastete in vollem Lauf die grasbewachsene Böschung entlang. Ich hörte Rufe, konnte aber nicht sagen, ob mir jemand folgte. Ich rannte von der Quelle weg, bis meine Füße den Betonweg des Greenways berührten, und dann rannte ich immer noch weiter. Erst als ich dreißig oder vierzig Meter weit weg war, riskierte ich einen Blick zurück.
Niemand verfolgte mich. Ich wurde langsamer, joggte und sah zwei oder drei Umrisse auf den Greenway treten, aber sie waren nicht schnell genug, um mich einzuholen. Einer zeigte in meine Richtung und rief den anderen etwas zu.
Ich warf einen letzten frustrierten Blick zur Quelle zurück, dann lief ich weiter.
An der Pudding Mill Lane verfiel ich in einen langsamen Trab und schließlich in Schritttempo, als ich die A11 erreichte. Autos zischten in beide Richtungen vorbei und wirbelten den Regen auf. Ich lief Richtung Stratford und sah dabei gelegentlich über die Schulter, aber der Gehsteig war leer, und als die Abzweigung hinter einem kleinen Hügel verschwand, wusste ich, dass ich in Sicherheit war.
Im Gehen ebbte das Adrenalin langsam ab, und ich war nur noch müde, hatte Schmerzen und war unglücklich. Ich hatte schon heftigere Prügel bezogen, aber rumgeschubst zu werden, ist eine Sache. Rumgeschubst zu werden und zu verlieren, ist viel schlimmer.
Was mich wirklich schmerzte, war, dass es nicht einmal gute Plünderer waren. In den letzten sechs Monaten hatte ich eine Reihe Begegnungen mit Schwergewichten der Drucraft-Welt gehabt, von Haus-Security bis hoch zu den Soldaten von Konzernen … nicht ganz das Drucraft-Äquivalent zur obersten Liga, aber nahe daran. Und ja, gut, aus den meisten dieser Begegnungen war ich nicht direkt als Sieger hervorgegangen, aber ich hatte mich behauptet. Nach all dem, was ich so durchgemacht hatte, war ich mir langsam ziemlich tough vorgekommen.
Doch ich hätte es besser wissen müssen. Übermut ist in einem Straßenkampf immer ein Fehler. Trotz all meiner Sigls und meines Trainings verfügte ich über keine gute Waffe gegen einen Schlägertrupp, der sich auf mich stürzte und mir die Scheiße aus dem Leib prügelte.
Ich zog mich in den Schutz eines Durchgangs an einem der Wolkenkratzer in Stratford zurück und meldete den Angriff, wobei mir klar war, dass es vergeudete Zeit war. Die App, mit der ich Quellen registrierte, hat keinen Button für einen »Angriff durch Plünderer«. Ich konnte nur die Lokatoren-Hotline von Linford’s anrufen, so wie immer, und bekam eine automatische Antwort zu hören, die mir sagte, dass ich eine Nachricht hinterlassen solle. Ich wusste nicht, ob sich irgendjemand diese Nachrichten jemals anhörte; in der Theorie hatte ich einen Vorgesetzten, aber den hatte ich nie kennengelernt. Am wahrscheinlichsten war, dass Linford’s meine Nachricht ignorieren, in ein oder zwei Tagen an der Quelle auftauchen und sie ausgeschöpft vorfinden würde, woraufhin sie mir vorwerfen würden, dass ich sie zu einer Quelle gelotst hätte, die nicht existierte.
Mit einem Seufzer trat ich wieder hinaus in den Regen und machte mich auf den Weg nach Hause. Dieser Geburtstag erwies sich als wirklich bescheiden.
Als ich in meine Straße abbog, hatte der Regen nachgelassen. Aus Gewohnheit scannte ich die Gegend. Keine verdächtig aussehenden Autos, keine Gruppe von Männern, niemand vor meiner Tür …
Da war jemand vor meiner Tür.
Sofort war ich auf der Hut, aber nach einem zweiten Blick entspannte ich mich wieder. Die Gestalt war eher klein und hatte Schutz gesucht unter einem weißblauen Golfschirm, der fast so groß war wie sie selbst. Ich erkannte die Silhouette gerade so und den Regenschirm definitiv. »Was machst du hier?«, rief ich.
»Auf dich warten, was denkst du denn?«, schrie die Gestalt unter dem Schirm.
Ich seufzte innerlich auf. Ich wusste, weshalb er hier war.
Colin ist ein paar Monate jünger als ich; äußerlich ist er eine Mischung aus seinem chinesischen Vater und seiner englischen Mutter. Wir treffen uns nicht mehr ganz so häufig, seit er an der Uni ist, aber er ist immer noch mein engster Freund, und als ich früher in diesem Jahr in Schwierigkeiten geraten war, hatte ich ihn um Hilfe gebeten. Colin hatte mir einen großen Gefallen getan, doch ich hatte ihm versprechen müssen, ihm die Wahrheit über alles zu erzählen, wenn es vorbei war. Zu der Zeit schien es mir ziemlich sicher, ihm dieses Versprechen zu geben, da ich ihm schon mehrmals etwas geschildert und er mir nicht geglaubt hatte, aber das war vor dem letzten Samstag gewesen, als ein Sturmtrupp eines Unternehmens eine der Ashford-Quellen geplündert hatte. Colin und ich waren mitten hineingeraten, und ich hatte meine Unsichtbarkeits-Sigl benutzt, um vor Colins Augen zu verschwinden.
Es überraschte mich nicht, dass er jetzt ein paar Erklärungen hören wollte.
»Hör mal, es war ein echt langer Tag«, versuchte ich, ihm auszuweichen. »Können wir vielleicht morgen oder …?«
»Nein«, sagte Colin und blickte mich unter seinem Schirm finster an. »Du hast mich die ganze Woche vertröstet. Du hast versprochen, du sagst mir die Wahrheit, und das wirst du jetzt tun, sonst trete ich dich so lange in den Hintern, bis du mir alles erzählst.«
»Schon gut, schon gut. Ich muss mich bloß erst mal waschen und umziehen, okay?«
Ich öffnete die Tür, und wir gingen hinein. Das Haus an der Foxden Road ist klein und eng, und ich teile es mir mit einem Haufen Litauer. Der Fernseher plärrte im Schlafzimmer im Erdgeschoss – wie bei den meisten dieser Häuser hatte man das eigentliche Wohnzimmer zu einem zusätzlichen Schlafzimmer umgebaut, um die maximale Mieteranzahl unterzubringen. Mein Zimmer befindet sich im ersten Stock; ich schickte Colin hinein, dann schnappte ich mir ein paar Klamotten und ging Richtung Bad.
Es war besetzt. Ich klopfte an, hörte eine Männerstimme antworten, dann lehnte ich mich ans Treppengeländer und wartete. Ein paar Minuten später ging die Tür auf, und Ignas stand da, in einem ärmellosen Unterhemd mit Handtuch um den Hals. Er sah mich an und stutzte dann.
Ignas ist der älteste der Litauer, ein tougher, grobschlächtiger Kerl mit einem Mehrtagesbart und grau meliertem Haar. Ich kenne ihn, seit ich in die Foxden Road gezogen bin, und er war immer sehr freundlich zu mir gewesen, bis letzte Woche ein paar von den Wachen der Ashfords mich entführt und den Rest der Litauer mit Waffen bedroht hatten, um sicherzugehen, dass sie nicht eingriffen.
Die anderen beiden Litauer, Matis und Vlad, hatten es ziemlich gut verkraftet, so alles in allem. Sie waren jünger als Ignas und eher dazu geneigt, die ganze Sache als Abenteuer abzuhaken, zumindest, nachdem es mir gelungen war, sie davon zu überzeugen, dass ich nicht in Drogendeals oder Menschenhandel oder dergleichen verwickelt war. Ignas jedoch hatte während dieser Unterhaltung geschwiegen, und seither bedachte er mich mit gewissen Blicken. Ich wusste, dass er noch etwas loswerden wollte.
Ignas quetschte sich an mir vorbei, dann wandte er sich um. »Letzte Woche«, sagte er. »Diese Männer. Machen mehr Ärger?«
»Nein«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Nicht mehr Ärger.«
»Gut«, sagte Ignas, hielt aber wieder inne.
Unbehaglich standen wir noch einen Moment herum.
»Meine Frau, sie ist arbeiten«, sagte Ignas plötzlich.
»Ich dachte, sie arbeitet tagsüber«, sagte ich. Ich war ein wenig überrascht; Ignas sprach normalerweise nicht über seine Frau.
»Sie hat zwei Jobs«, sagte Ignas. »Ich sage ihr, ist es nicht wert, sie soll zu Hause bleiben, aber …« Er zuckte mit den Schultern. »Wir wollen dieses Jahr ein Kind bekommen.«
»Oh«, sagte ich. »Äh … herzlichen Glückwunsch.«
»Danke«, sagte Ignas, dann schwieg er wieder. »Wenn wir das tun – dann muss das Haus sicher sein.«
Oh, dachte ich, und mein Herz wurde schwer.
Ignas sah mich an. »Du verstehst?«
Ich nickte.
»Keine Männer mit Waffen mehr«, sagte Ignas. »Okay?«
Ich wollte sagen, dass es nicht meine Schuld war, aber ich wusste, dass Ignas recht hatte. Diese beiden Wachen waren meinetwegen da gewesen. Ich hatte sie nicht hierhaben wollen, aber hätten sie den Abzug gedrückt, wäre das nicht von Bedeutung gewesen. »Okay«, sagte ich.
Ignas nickte und ging davon. Ich betrat das Bad.
Ich hatte heiß duschen wollen, bekam stattdessen aber nur lauwarmes Wasser – die Heizung im Haus war seit letztem Winter kaputt und der Vermieter zu knauserig, um sie reparieren zu lassen. Als ich mir Shampoo in die Haare rieb, beschäftigte mich aber weniger die Kälte als Ignas.
Ich bin daran gewöhnt, dass mich meine Fehler in Schwierigkeiten bringen. Aber dass sie andere Leute in Schwierigkeiten bringen, war ein neues Gefühl und eines, das mir nicht sonderlich gefiel. Das Schlimmste daran war, dass ich nicht wusste, wie ich es verhindern sollte. Ich hatte die Sache mit den Ashfords beigelegt – mehr oder weniger –, aber wenn sie oder wer auch immer seine Schläger zu einer Neuauflage von »Kidnap III: Die Rache« herschickten, könnte jemand aus Versehen – oder auch absichtlich – ins Kreuzfeuer geraten, selbst wenn ich entkommen sollte.
Das alles schien mir wirklich unfair. In Filmen geraten die Helden in Kämpfe und gehen danach einfach davon. Sie müssen nicht dableiben und das Chaos beseitigen. Gerade war alles ruhig, aber falls sich das änderte, was konnte ich dann tun? Umziehen? Dafür fehlte mir das Geld, und es würde auch nicht wirklich etwas ändern …
Ich beendete die Dusche, zitterte beim Abtrocknen und zog meine Kleider an, wobei ich zusammenzuckte. Ich konnte die roten Male von den Schlägen sehen, die ich eingesteckt hatte, und ich wusste, dass es wirklich wehtun würde, wenn meine Muskeln erst steif würden. Ich wünschte, meine Flick-Sigl könnte auch Prellungen heilen. Sie ist zur Behandlung von inneren Blutungen gedacht, weshalb man meinen sollte, sie würde auch bei Prellungen wirken, aber so ist es anscheinend nicht.
Ich rubbelte meine Haare noch ein wenig länger, bis sie vollständig trocken waren, und damit gingen mir die Verzögerungstaktiken aus.
Ich machte mich auf den Weg zurück in mein Zimmer.
Colin saß mit erwartungsvoller Miene auf dem einzigen Sessel. Mein Zimmer ist sogar für mich allein klein; mit Colin darin blieb nicht mehr viel Platz. Er hatte die Vorhänge bereits zugezogen. Draußen wehten die Geräusche der Londoner Nacht über die Dächer, aber hier drinnen waren wir allein.
»In Ordnung«, sagte ich. Ich verriegelte die Tür, dann warf ich meine nassen Kleider in den Wäschekorb. »Wie sollen wir es machen?«
»Fang von Anfang an«, sagte Colin.
Ich setzte mich auf mein Bett und begann.
2
»Was du neulich Samstag gesehen hast, nennt sich Drucraft«, erklärte ich Colin. »Man nutzt eine Quelle namens Essentia, um … na ja, um etwas zu bewirken, das du wohl einen Zauber nennen würdest.«
»Zauber«, sagte Colin.
»Ja.«
»Aber du hast keine magischen Worte gesprochen.«
»Nein.«
»Also … ist das was? Wie bei einem Psi-Kämpfer bei D&D?«
»So etwas in der Art.«
Colin saß da und sah mich an. »Wie funktioniert das?«, fragte er schließlich.
»Durch Essentia.«
»Was ist Essentia?«
»Das ist … hmm.« Colin studiert Naturwissenschaften am Imperial College in London; in der Schule waren seine Lieblingsfächer Chemie und Physik. Ich dachte darüber nach, wie ich es in Worten beschreiben könnte, die er verstehen würde. »Stell dir Essentia als eine Art unsichtbares, nicht nachweisbares Gas vor. Eines, das man nicht berühren kann und das feste Objekte durchdringt.«
»Wie das?«
»Essentia reagiert nicht wirklich mit Materie. Größtenteils fließt sie einfach hindurch.«
»Hat sie eine Masse?«
»Nicht wirklich, nein.«
»Na, dann kann sie kein Gas sein.«
»Ich sagte, sie ist wie ein Gas.«
»Und wo ist dieses Gas?«
»Hier«, sagte ich und zeigte in die Luft vor uns. »Und hier und hier.« Ich konnte die Strömungen erkennen, auf die ich zeigte, grauweiße Wirbel in der Luft, die heller wurden, wenn sie flossen. »Sie ist überall um dich herum und in dir, gerade jetzt in diesem Moment.«
»Was ist sie dann? Besteht sie aus Partikeln?«
»Ich … Das weiß ich nicht so richtig.«
»Bewegt sie sich schneller als Lichtgeschwindigkeit?«
»Ich glaube nicht?«
»Kann man Wellen hindurchleiten?«
»Hörst du jetzt mal auf damit?«, sagte ich ärgerlich. »Ich versuche dir hier eine Einleitung in die Drucraft für Dummies zu geben, und wir sind erst auf Seite eins. Bei dem Tempo sitzen wir noch die ganze Nacht hier.«
Zögerlich hielt Colin die Klappe.
»Essentia versorgt Drucraft-Zaubersprüche mit Energie, aber meist funktionieren sie nicht von selbst.« Ich nahm einen meiner Sigl-Ringe heraus und hielt ihn Colin hin. »Siehst du das kleine Ding im Ring, das einem Edelstein ähnelt?«
Colin betrachtete den Ring mit zusammengekniffenen Augen. Er war aus Stahl, und darauf war etwas befestigt, das aussah wie ein winziger Edelstein. Anders als bei den meisten meiner Ringe war die Sigl aufgesetzt und nicht in das Metall eingelassen.
»Ja.«
»Diese kleine Kugel nennt sich Sigl«, sagte ich. »Menschen können freie Essentia nicht einfach so nutzen. Wir sind zwar andauernd von dieser Energiequelle umgeben, haben aber keinen Zugriff darauf. So wie man keinen Zugriff auf die chemische Energie in einem Materieklumpen hat.«
»Man kann sie in Brand setzen.«
»Das funktioniert nicht immer.«
»Das bedeutet nur, dass man nicht genug Feuer verwendet.«
Ich widerstand dem Drang, Colin eine runterzuhauen. »Also, Sigls ziehen die freie Essentia aus der Umgebung an und wandeln sie um in einen Zauber«, sagte ich. »So.« Ich schickte einen kleinen Strom Essentia durch meinen Arm in die Sigl auf dem Ring.
Blauweißes Licht flutete den Raum. Diese Sigl war die zweite, die ich je erschaffen hatte, eine einfache Sigl, die Essentia in blassblaues Licht verwandelte. Das ist in etwa die einfachste Sigl, die man herstellen kann, aber sie ist trotzdem nützlich.
Colin hatte gerade eine weitere, vermutlich genauso nervige Frage stellen wollen, aber der Anblick der aktiven Sigl fegte sie beiseite. Er beugte sich vor und starrte darauf, und ich regelte die Helligkeit etwas herunter, damit er nicht geblendet wurde.
»Du trägst den Ring nicht mal«, sagte Colin endlich.
»Brauche ich nicht. Die Sigl muss mir nur nahe genug sein.«
Colin starrte weiter darauf. Ich hielt die Sigl noch eine Weile aktiv, und als er immer noch nichts sagte, ließ ich den Essentia-Strom verrinnen. Das Licht schwand, und Colin blinzelte, starrte auf die Sigl, als erwachte er aus einem Traum.
»Glaubst du mir jetzt?«
Colin ließ den Ring nicht aus den Augen. »Ja«, sagte er irgendwann.
Es war witzig, dass meine kleine schwache Licht-Sigl einen so großen Eindruck machte. Anscheinend ist keine Erklärung auch nur halb so überzeugend wie eine einfache Demonstration.
»Wie hast du das gemacht?«, wollte Colin wissen.
»Wenn Essentia in dich hineinfließt, stimmt sie sich auf dich ein und wird zu persönlicher Essentia. Und persönliche Essentia reagiert auf deinen Willen. Mit ausreichend Übung kann man sie in eine Sigl channeln.«
»Kann das jeder lernen?«
»Irgendwann ja. Man muss zuerst lernen, sie zu spüren.«
Colin runzelte die Stirn. »Moment mal. Der ganze Kram, den du früher mit deinem Dad gemacht hast, wo du nur rumgesessen hast …«
»Das waren Spür- und Channel-Übungen.«
»Ich hatte das für so spirituellen Esokram gehalten«, beschwerte Colin sich. »Warum hast du mir nicht erzählt, dass es eine Bewandtnis hatte?«
»Das habe ich. Du hast mir bloß nie geglaubt.«
»Verdammt«, sagte Colin. Kurz dachte er nach. »In Ordnung, was hat es dann mit deinem neuen Job auf sich?«
»Um eine Sigl herzustellen, braucht man eine sehr hohe Konzentration an Essentia«, sagte ich. »Diese Orte nennt man Quellen, und sie stellen einen Engpass bei der Sigl-Erschaffung dar. In unserem Land werden Quellen hauptsächlich von Adelshäusern kontrolliert – im Grunde eine magische Aristokratie – oder von Drucraft-Konzernen. Eines dieser Unternehmen heißt Linford’s, und sie haben mich als Lokator angestellt. Ich finde Quellen, melde sie in einer App, und sie bezahlen mir eine Provision.«
»Und dann machen sie … was? Benutzen die Quellen, um Sigls herzustellen?« Ich nickte, und Colin deutete auf den Ring in meiner Handfläche. »Hast du deine so bekommen?«
»Nein, die habe ich selbst gemacht.«
»Kann das jeder lernen?«
»Ja, aber in der Praxis ist es den meisten das nicht wert, und sie kaufen sie stattdessen einfach. Dass ich Sigls manifestieren kann, hat mir im Frühjahr den ganzen Ärger eingebracht.«
»Moment mal«, sagte Colin. »Diese reiche Familie, mit der du Probleme hattest, diese Ashfords … Sind die eine dieser Adelsfamilien?«
»Sie sind ein Niederes Haus, und ich bin mit ihnen verwandt, ja«, sagte ich. »Nicht, dass mir das etwas gebracht hätte.« Ich schob den Ring wieder auf meinen Finger und verzog ein wenig das Gesicht; meine Muskeln hatten sich versteift, während ich geredet hatte. Es zeigte, wie abgelenkt Colin war, dass ihm meine jüngste Verletzung nicht aufgefallen war.
Er fragte mich weiter aus über das Haus Ashford und Drucraft-Organisationen im Allgemeinen, was uns auf das Thema brachte, wie man Quellen fand, was wiederum dazu führte, dass ich ihm erzählte, was im Olympic Park geschehen war.
»Mann«, sagte Colin, nachdem ich geendet hatte. »Als du meintest, es gäbe einen Wettstreit um die Quellen, hätte ich nicht gedacht, dass es so rau zugeht.«
»Es ergibt nicht einmal Sinn«, beschwerte ich mich. »Für diese Quelle gab es eine Provision von siebenhundert Pfund. Bei der Anzahl der Plünderer wären das hundert pro Kopf! Wie zur Hölle soll es das wert sein?«
»Na ja, du setzt voraus, dass es ihnen ums Geld geht«, meinte Colin. »Wenn sie wie die Typen sind, die am Stratford Park herumhängen, müsste man ihnen nichts zahlen, damit sie einem hübschen weißen Jungen die Scheiße aus dem Leib prügeln. Das würden die gratis machen.«
»Danke, du mich auch.«
»Was willst du jetzt tun?«
Ich lehnte mich gegen die Wand und verzog ein wenig das Gesicht, als Schmerz meine Schulter durchzuckte. »Den größten Teil dieses Jahres waren meine Hauptziele, meine Drucraft zu verbessern, meinen Vater zu finden und mich mit den Ashfords auseinanderzusetzen. Die Plünderung, die du miterlebt hast, war der Höhepunkt davon, sich ›mit den Ashfords auseinanderzusetzen‹. Das ist noch nicht vorbei, liegt aber gerade auf Eis.«
»Moment. Bei dem Kampf heute ging es nicht um die Ashfords?«
»Nein, das war nur das normale Jobrisiko.«
»Das ist normal? Ich finde, die bezahlen dir nicht genug.« Colin runzelte die Stirn. »Was meintest du, von wegen deinen Dad finden?«
»In den letzten sechs Monaten habe ich Puzzleteile zusammengesetzt und ein paar Hinweise gefunden«, erzählte ich. »Jetzt, wo ich einen festen Job habe und ich die Ashfords fürs Erste losgeworden bin, kann ich ihnen nachgehen.«
Die Unterhaltung lief noch eine Weile, und Colin stellte mir weiter Fragen über die Mechanismen von Drucraft. Ich gab mein Bestes, sie zu beantworten, auch wenn ich bei einigen am liebsten die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hätte – woher zur Hölle sollte ich wissen, ob es einen Erhaltungssatz in der Drucraft gab? –, bis es etwa zwei Uhr nachts war. Dann sagte ich, dass ich ihn jetzt offiziell rauswerfen würde und er mich an einem anderen Tag im Pub weiter ausfragen müsste, wenn er das wollte, wo es warm war und etwas zu trinken gab.
»Oh, ja«, sagte Colin und schnappte sich sein Zeug. »Fast vergessen.« Er reichte mir einen Umschlag.
Ich öffnete ihn und zog eine Karte raus. Auf der Vorderseite war ein Bild von einem zwanzigseitigen Würfel mit der 20 oben, und darunter stand: »LEVELUP! +1 AUFWEISHEIT!«
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, sagte Colin.
Ich lachte, klappte die Karte auf und sah, dass unsere gesamte Clique unterschrieben hatte. Felix hatte ein paar Zeilen hinzugefügt, dass ich jetzt nur noch fünf oder zehn weitere Jahre vor mir hätte, bevor ich ein Bier kaufen könnte, ohne meinen Ausweis vorzeigen zu müssen. Kiran hatte geschrieben, dass ich es mir besser nicht zur Gewohnheit machen sollte, mir sein Auto zu leihen. Colins Text besagte, dass man wüsste, man sei alt, wenn man mehr als einen 20-seitigen Würfel brauchte, um sein Alter zu ermitteln, und Gabriel hatte ein Bild von mir für den Anlass gemalt – angehängt war eine ziemlich realistische Skizze von einem Penis.
»Danke«, sagte ich zu Colin und lächelte.
»Geh einfach ran, wenn ich dich das nächste Mal anrufe, ja?«
»Mache ich.«
Colin ging, und ich stellte die Karte auf meinem Nachttisch auf. Bei ihrem Anblick machte sich ein warmes Gefühl in mir breit, das anhielt, während ich mir die Zähne putzte und ins Bett stieg, das Licht ausmachte und es mir gemütlich machte, um zu schlafen.
Als ich so in der Dunkelheit lag, dachte ich darüber nach, was ich als Nächstes vorhatte. In vielerlei Hinsicht war dieses Gespräch mit Colin der letzte lose Faden in der Ashford-Sache gewesen. Jetzt, da er verknotet war, stand es mir endlich frei, mich mit etwas anderem zu befassen.
Und womit ich mich jetzt befassen wollte, war die Suche nach meinem Dad. An diesem Vorhaben hatte ich seit langer, langer Zeit immer größeren Gefallen gefunden, aber bis vor Kurzem hatte ich nicht die Möglichkeit gehabt, viel zu unternehmen. Ich war zu sehr in die tägliche Plackerei des Geldverdienens eingespannt gewesen, und selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, mich auf die Suche zu machen, hätte ich nicht die nötigen Mittel besessen.
Und das stimmte jetzt nicht mehr ganz. Ein Lokator zu sein, war zwar nicht leicht, aber es verschaffte mir sehr viel mehr Freizeit als meine letzten paar Jobs, und es war besser bezahlt, sodass ich ein wenig hatte zur Seite legen können. Wichtiger noch, ich hatte angefangen, mir eine Sigl-Sammlung aufzubauen. Stärke, Unsichtbarkeit, Heilung, Blitz und Schlag – ich hatte immer noch einen langen Weg vor mir, aber wenn ich jetzt in Schwierigkeiten geriet, war ich deutlich besser ausgerüstet.
Die größte Veränderung hatte sich jedoch während der Plünderung ergeben. Auf den Dächern der Chancery Lane war mir ein Mann begegnet, der sich Byron nannte und behauptet hatte, er wüsste, was meinem Vater zugestoßen sei. Er hatte mir eine Karte mit seiner Nummer gegeben und gesagt, ich solle mich melden, falls ich mehr wissen wolle. Diese Karte lag jetzt in meiner Nachttischschublade.
Das Problem war allerdings, dass mein flüchtiger Eindruck von Byron mir das Gefühl gab, dass er nur Ärger bedeuten würde. Die Karte schien mir kein Angebot, sondern ein Köder.
Aber es war auch meine erste vernünftige Spur seit drei Jahren …
Über eine Stunde warf ich mich hin und her, zerrissen zwischen Hoffnung und Vorsicht. Endlich traf ich eine Entscheidung. Spontan fielen mir vielleicht drei oder vier andere Herangehensweisen bei der Suche nach meinem Dad ein, die eine Chance auf Erfolg haben könnten. Ich würde sie alle ausprobieren und nicht aufhören, bis jede Einzelne gescheitert war. Erst dann würde ich die Nummer auf dieser Karte anrufen.
Einen Plan zu haben, beruhigte mich. Ich sank in mein Kissen und schlief ein.
Am nächsten Morgen wachte ich von lautem Miauen auf.
»Ach, komm schon«, murmelte ich und öffnete mühsam ein Auge. Im September geht in London um sechs Uhr dreißig die Sonne auf. Ein Blick zu dem grauen Licht, das durch mein Fenster fiel, verriet mir, dass es auf jeden Fall noch viel zu früh war.
Schaudernd rappelte ich mich auf und hebelte das Fenster auf. Eine eisige Bö strömte herein, gefolgt von einer relativ großen Katze, dann knallte ich das Fenster schnell wieder zu. »Hast du eine Ahnung, wie viel Uhr es ist?«
»Mrau«, verkündete Hobbes.
Hobbes ist ein grau-schwarz getigerter Kater mit gelbgrünen Augen. Ich bekam ihn etwa ein Jahr, bevor mein Dad verschwand, und er hat mir durch einige ziemlich miese Zeiten hindurchgeholfen, auch wenn er mich gern im Morgengrauen weckt. »Du hättest letzte Nacht reinkommen können«, sagte ich. »Was hast du da draußen überhaupt getrieben?«
Hobbes stieß noch ein Miau aus und rammte mir den Kopf so heftig gegen das Bein, dass ich taumelte. Ich nahm das grüne Leuchten seiner Lebens-Essentia wahr, die aus der Sigl in seinem Halsband floss und in seine Muskeln strömte. Ich bin nicht der Einzige in London, der weiß, wie man Kraft-Sigls herstellt, aber ich bin vielleicht der Einzige, der eine für seine Katze gemacht hat.
Ich gab Futter in Hobbes’ Schüssel, woraufhin er sofort das Interesse an mir verlor, und während er drauflos mampfte, ging ich nach unten und machte mir einen Stapel Toast. In London kann man ziemlich billig Brot in anständiger Qualität bekommen, solange man die Eigenmarken im Supermarkt nimmt – und selbst wenn man die Kosten für Marmelade oder einen Aufstrich dazurechnet, kommt man immer noch auf eine ordentliche Mahlzeit für unter 50 Pence. Heutzutage bin ich nicht ganz so abgebrannt wie früher, aber wenn man lange genug arm war, achtet man auf so etwas. An Arbeitstagen besteht mein Frühstück üblicherweise aus Toast, einer Karotte oder einem Apfel und einem großen Glas Wasser, und damit halte ich bis zum Nachmittag durch.
Heute hatte ich jedoch andere Pläne. Ich ging wieder nach oben, stellte meinen Teller auf den Nachttisch und legte mich mit meinem Notizbuch aufs Bett. Hobbes sprang neben mich, schnüffelte an dem Essen, bis ich ihn verscheuchte, dann rollte er sich neben meinen Knien zusammen.
Ich schlug eine neue Seite auf und begann, all die Hinweise aufzulisten, die ich für die Suche nach meinem Vater hatte.
Der erste und offensichtlichste war mein Kontakt zu einem Privatdetektiv. Diesen Weg hatte ich mit einigem Erfolg früher im Jahr ausprobiert, aber der »Erfolg« hatte zu einem kurzen, üblen Kampf in Hampstead mit einem Sigl-schwingenden Jungen geführt, einem der fieseren Gegner, denen ich bisher begegnet war. Ich hatte das Gefühl, er stünde irgendwie mit Byron in Verbindung, was zum Teil der Grund dafür war, dass ich zögerte, die Nummer auf der Karte anzurufen.
Eine sehr viel sicherere Herangehensweise wäre über meine Mutter. Ich hatte immer noch nichts von ihr gehört, aber ich hatte das Gefühl, wenn mir jemand etwas Nützliches sagen konnte, dann sie. (An diesem Punkt legte ich den Stift weg und sah auf mein Telefon, ob sie mir eine Nachricht geschrieben hatte. Hatte sie nicht.)
Eine etwas weniger offensichtliche Herangehensweise war über meinen Arbeitgeber. Linford’s war ein Drucraft-Unternehmen, kein Detektivbüro, aber soweit ich in Erfahrung gebracht hatte, hatten Drucraft-Unternehmen ihre Finger in vielen Angelegenheiten, und im Fall Linford’s hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die Firma Kontakt zu Geheimdiensten der Regierung hatte. Wenn Linford’s Leute etwas wirklich herausfinden wollten, konnten sie das vermutlich. Das Problem würde sein, sie davon zu überzeugen, dass es wichtig genug für sie wäre. Ich war nicht optimistisch, dass ich sie dazu bewegen könnte, mir zu helfen, aber ich sollte es wenigstens versuchen.
Ich ging weiter meine Liste durch und – jetzt kratzte ich schon wirklich am Boden des Fasses – landete bei meiner Tante. Sie war die Schwester meines Dads, und sie und ihr Ehemann hatten mich eine Weile bei sich aufgenommen, nachdem mein Dad verschwunden war. Die Beziehung war gegen Ende ziemlich angespannt gewesen, aber abgesehen von mir war sie die nächste lebende Verwandte meines Dads. Es gab eine Chance, dass sie etwas wusste.
Und endlich stand da, ganz unten, Byron. Anders als bei den anderen war ich mir völlig sicher, dass Byron etwas über das Verschwinden meines Dads wusste. Das Problem war, ich war mir auch ziemlich sicher, dass er daran beteiligt gewesen war. Ihn zu kontaktieren, schien mir fast so gefährlich, wie zurück zu diesem Jungen in Hampstead zu gehen.
Aber ganz egal, wie ich es auch betrachtete, Byron zu kontaktieren, schien mir der Plan zu sein, der mich am wahrscheinlichsten weiterbrachte.
Ich klappte mein Notizbuch zu, streckte mich und stand auf. Es war an der Zeit, zu Maria zu gehen.
Maria Noronha wohnt etwa fünfzehn Minuten zu Fuß entfernt, in einem hübsch ausgebauten Haus in Upton Park. Sie arbeitet für Linford’s als Essentia-Analystin, was eine Mischung aus Vertriebsleitung und mittlerer Führungsebene zu sein scheint, und sie war eine meiner ersten Lehrerinnen in der Drucraft-Welt. Ich hatte meine Karriere in der Drucraft mit einem Mangel an jeder Menge Grundwissen begonnen, das Drucraft-Profis für selbstverständlich halten, und Maria hatte mir geholfen. Gegen Bezahlung.
Leider stellte sich Maria, je weiter ich mich vom ahnungslosen Neuling entfernt hatte und je näher ich dem aufstrebenden Profi gekommen war, als immer weniger hilfsbereit heraus. Während sie über jede Menge Insiderwissen verfügte, stand das meiste davon in Verbindung mit dem Verkauf und dem Management. Außerdem war sie zwar gern bereit gewesen, mich als Lokator einzustellen, aber ihre Reaktion, als ich mehr wollte als das, war … nicht gerade ermutigend gewesen.
So wie jetzt.
»Ich fürchte, ich weiß einfach nicht genau, was ich tun kann, um dabei zu helfen«, meinte Maria.
»Wie ich schon sagte, ich will jemanden finden«, erwiderte ich. »Und ich habe mich gefragt, ob Linford’s vielleicht etwas ausrichten kann.«
»Wie meinst du das?«
Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man keine klare Antwort bekommt. »Ich meine damit, dass Linford’s Leute kennt, die wissen, wie man etwas finden kann«, sagte ich. »Richtig?«
»Ach ja?«, fragte Maria vage zurück.
»Hat Linford’s keinen Kontakt zu Geheimdiensten?«
»Wer hat dir das erzählt?«
»Ein paar Leute im Netz.«
»Nun ja, die sagen alles Mögliche. Dem würde ich an deiner Stelle nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.«
Ich schwieg, doch innerlich zweifelte ich. Verlässliche Informationen über Drucraft-Unternehmen sind schwer zu finden, aber ich hatte eine Menge Hinweise bekommen, dass Linford’s über diese Kontakte verfügte. Maria sollte wenigstens die Gerüchte kennen.
Und mir fiel natürlich auch auf, dass sie meine Frage nicht wirklich beantwortete.
»Na dann«, sagte Maria fröhlich. »Wie läuft’s mit dem Lokalisieren?«
»Gut, denke ich. Obwohl …«
Maria sah mich fragend an.
»Gab es in letzter Zeit mehr Plünderungen?«, fragte ich. »Leute, die Quellen jagen, die ihnen normalerweise egal wären?«
»Oh.« Maria setzte sich gerade hin und sah plötzlich sehr viel interessierter drein. »Davon hast du also gehört?«
»Nicht direkt ›gehört‹ … Also bilde ich mir das nicht ein?«
»Wir hatten tatsächlich ein Meeting dazu am Freitag«, sagte Maria. »Bei all der Verknappung und den Versorgungsengpässen wird es für unsere Branche wirklich herausfordernd, und es scheint, als würden einige Leute das ausnutzen. Anscheinend gab es gerade erst letzte Woche eine richtig große Plünderung in der Chancery Lane. Die Verbrecherbanden, die so etwas machen, werden eindeutig dreister!«
Ich achtete darauf, keine Miene zu verziehen. »Verbrecherbanden?«
»So habe ich das gehört. Aber du könntest Glück haben. Sie sagten gerade, dass es eine unternehmensweite Initiative gebe, um den Nachschub zu erhöhen. Ich könnte deinen Namen ins Spiel bringen, wenn du möchtest.«
»Den Nachschub erhöhen … wie das?«
»Nun, der Bedarf an Essentia ist gestiegen, und sie versuchen, ihn zu befriedigen.«
»Okay«, erwiderte ich langsam. »Aber … ich melde die Quellen doch schon, die ich finde.« Okay, nicht alle, aber das brauchte Maria nicht zu erfahren.
»Ich kenne keine Einzelheiten«, gab Maria zu. »Aber es wäre eine gute Gelegenheit für dich. Soll ich sie fragen?«
Ich hatte meine Bedenken, doch ich hatte nichts zu verlieren. »Sicher, schätze ich.«
»Toll«, erwiderte Maria. »Oh, und wo wir beim Thema sind, hast du einen Findestein bekommen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Findesteine sind Licht-Sigls, die in Gegenwart von Quellen leuchten. Sie haben eine extrem kurze Reichweite – diejenigen, die mir untergekommen waren, konnten eine Quelle nur innerhalb von vielleicht zehn Schritten zuverlässig aufspüren, und selbst dann verrieten sie einem nichts über die Art der Quelle. »Weil sie Mist sind.«
»Sie sind die kosteneffizienteste Art, Quellen zu finden.«
»Mein Gespür ist in jeder Hinsicht besser als ein Findestein«, erklärte ich Maria. »Das war schon besser, bevor ich mit diesem Job anfing, und das, noch bevor ich ein halbes Jahr als Lokator gearbeitet habe.«
»Ich verstehe ja, dass es frustrierend ist«, sagte Maria mitfühlend. »Aber manchmal ist es wichtig, diese Dinge mitzumachen, um zu zeigen, dass man ein Teamplayer ist.«
»Ich soll zweitausend Pfund bezahlen, um zu beweisen, dass ich ein Teamplayer bin?«
»Ich denke, es sind eigentlich zweitausendvierhundert.«
»Seit wann?«
»Das war wohl noch im Juli …« Maria wandte sich ihrem Computer zu und tippte etwas ein. »Oh, ja. Unser günstigstes Modell kostete zweitausend Pfund, aber das nur, wenn man vor Ende des Sommers bestellte.«
Ich sah Maria an.
»Lieferprobleme«, erklärte sie. »Die Kosten sind gestiegen.«
»Klingt, als würdest du mir noch mehr Gründe nennen, keinen zu kaufen.«
»Nun, dank der Zunahme von Plünderungen bemüht man sich, hart gegen unregulierte Drucrafter vorzugehen«, sagte Maria. »Und da Lokatoren ohne Findesteine nicht auf die gleiche Art reguliert sind …«
»Du sagtest, dass Linford’s Verträge ohne Findesteine anbietet.«
»Ich denke, die Lokationsabteilung soll diese nicht mehr ausgeben«, gab Maria zu. »Fürs Erste kommst du damit vielleicht noch durch, weil du im Frühjahr unterschrieben hast, aber ich weiß nicht, wie lange das noch geht.«
»Ich will keinen.«
»Manchmal muss man Dinge kaufen, selbst wenn man sie nicht wirklich will.«
Schlecht gelaunt verließ ich Marias Haus. Linford’s erinnerte mich mehr und mehr an Versicherungsgesellschaften. Selbst wenn man sich gegen das entschied, was sie einem verkaufen wollten, versuchten sie einen unter Druck zu setzen, damit man es sich anders überlegte.
Mein Telefon klingelte, und ich vergaß Maria und alles andere sofort. Ich zog es aus der Hosentasche und sah, dass es eine unbekannte Nummer war. Ein Hoffnungsschimmer glomm in meiner Brust auf. Meine Mutter?
Ich drückte auf den grünen Hörer. »Hallo?«
Es war nicht meine Mutter, doch sobald ich den Oberschichtakzent der Frau hörte, wusste ich, dass es jemand von den Ashfords war. »Hallo? Kann ich bitte mit Stephen Oakwood sprechen?«
»Ich bin dran.«
»Oh, hallo, hier ist Clarissa. Ich rufe im Auftrag der Familie Ashford an. Passt es gerade?«
»Rufen Sie im Auftrag eines bestimmten Mitglieds der Familie an?«
»Ja, woher wusstest du das?«
Meine Stimmung hob sich. »Nur geraten.«
»Okay, ich soll vorschlagen, ein privates Treffen zu vereinbaren«, sagte Clarissa. »Zu welchen Zeiten wärest du verfügbar?«
»So bald wie möglich.«
»Perfekt. Ich spreche mit ihm und bestätige dann einen Termin.«
»Das klingt to… Moment, wen meinen Sie mit ›ihm‹?«
»Nun … Calhoun Ashford. Tut mir leid, ich hätte seinen Namen erwähnen sollen. Nach dem, wie du reagiert hast, dachte ich, du wüsstest das …«
Ich starrte mein Telefon an, und meine gute Laune verpuffte.
»Hallo?«
»Ja«, sagte ich. »Tut mir leid, ich habe meine Meinung geändert.«
»Äh … entschuldige, das habe ich nicht ganz verstanden. Was sagtest du, wann es gut passen würde?«
»Nie«, antwortete ich. »Tschüss.«
Ich beendete das Gespräch, schob das Telefon in meine Tasche und machte mich auf den Weg nach Hause. Ein kleiner Teil von mir fragte sich, was zur Hölle der Erbe des Hauses Ashford von mir wollte, doch größtenteils war ich sauer. Was mich betraf, war das einzige Mitglied des Hauses Ashford, mit dem ich reden wollte, meine Mutter; der Rest konnte gern zur Hölle fahren.
Aber Tag um Tag verging, und meine Mutter rief nicht an.
3
»Okay, wie werden Sigls hergestellt?«,fragte Colin.
»Man formt sie«, erklärte ich. »Man sucht einen Ort mit ausreichend Essentia – also eine Quelle –, dann kondensiert und formt man die zu einer Sigl. Wobei man dafür einiges an Übung haben muss.«
»Kann das jeder lernen?«
»Ja, aber zuerst muss man wirklich gut sein im Spüren und Channeln.«
Wir waren im Admiral Nelson, unserem Stamm-Pub. Gläserklirren und Unterhaltungen füllten den Raum; die Luft trug den angenehmen Duft nach Bier und altem Holz heran. Wir saßen in einer Nische und waren früher gekommen; Felix, Kiran und Gabriel würden später dazustoßen, aber vorerst waren wir unter uns.
»Das klingt, als wäre dieses Spüren echt nützlich«, sagte Colin. »So findet man Quellen, so formt man Sigls, und es funktioniert wie ›Erkennungsmagie‹, wenn man einem anderen Drucrafter begegnet. Richtig?«
»Sollte man meinen, aber alle, denen ich begegne, scheinen zu glauben, dass es die am wenigsten nützliche Fähigkeit ist.«
»Warum?«
»Die Ashfords suchen keine Quellen, denn wenn sie Sigls wollen, kaufen sie sie einfach. Und Maria sagt, dass Spürenlernen Zeitverschwendung ist, weil man einfach einen Findestein benutzen kann«, sagte ich. »Um ehrlich zu sein, verstehe ich das nicht. Vielleicht ist es wie Fußarbeit bei Martial Arts? Den Teil wollen alle auslassen und lieber gleich zum spannenden Kram übergehen.«
»So klingt es für mich nur noch wichtiger«, meinte Colin, dann schwieg er kurz. »Könnte ich das lernen?«
Ich hatte mich schon seit einer Weile gefragt, worauf er hinauswollte. »Vielleicht.«
»Vielleicht?«
»Ich meine, die kurze Antwort lautet Ja. Du willst aber eigentlich wissen, ob du lernen könntest, ein Drucrafter zu sein, richtig?«
»… ja.«
»In der Theorie kann das jeder«, sagte ich. »Aber es erfordert viel Zeit und Arbeit, und in der Praxis kommen die meisten nicht so weit.«
»Hmm«, machte Colin nachdenklich, dann trank er einen Schluck Bier und sah mich an. »In Ordnung. Du hast mir alles darüber erzählt, was es ist und wie es funktioniert. Was hast du jetzt damit vor?«
»Ich will stärker werden«, entgegnete ich sofort.
»Was heißt …?«
»Bessere Sigls haben. Stärkere Fähigkeiten besitzen, breiter gefächert. Im Augenblick ist alles ruhig, aber so wird es nicht bleiben.«
»Warum nicht?«