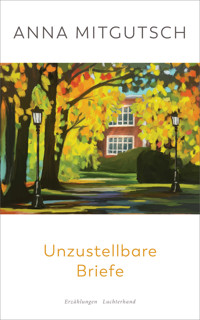6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Fotografie eines Hauses in einer österreichischen Kleinstadt hatte die Mutter von Max so sehr geliebt, daß sie diese in jeder neuen Wohnung in New York aufstellte, in jeder weiteren, immer ärmlicher werdenden Station ihres Exils. Zurück wollte sie jedoch nie. Daß ihre Schwester den Nazis nicht entkommen konnte, hat sie für immer von ihrem Zuhause abgeschnitten. Und auch Max zieht nichts zurück in die alte Heimat seiner Eltern: Er hat in New York Erfolg als Restaurator, und er führt ein ungebundenes Leben. Dennoch bleibt in ihm eine heimliche Sehnsucht nach Europa wach. Knapp dreißig Jahre nach Kriegsende reist er zurück nach Österreich, findet dort allerdings nicht das in den Träumen seiner Mutter immer verlockender gewordene Haus, sondern trifft auf Beamte, die, unempfindlich gegenüber seiner jüdischen Familiengeschichte, ihn danach fragen, mit welchem Recht er die Rückgabe seines Besitzes überhaupt fordere. Bis ans Herz ernüchtert bricht Max seinen ersten Aufenthalt ab und kommt erst Jahre später wieder zurück.
Rätselhaft für ihn selber ist die Sehnsucht nach dem Ort, an dem seine Mutter für wenige Jahre glücklich war, und auch bei seinem zweiten Aufenthalt findet er keine Erklärung für dieses Gefühl. Dafür trifft er einige Menschen wie Spitzer, den alten Vorsteher der kleinen jüdischen Gemeinde, und eine Frau, die ihn einst sehr geliebt hat. Und er stößt auf eine unsichtbare Stadt, die verborgene Geschichte der Juden, aber in allen diesen Vergangenheiten kann er auf Dauer nicht leben.
Anna Mitgutsch hat einen Roman über Suchen und Finden geschrieben, eine im höchsten Maß aktuelle Geschichte der Liebe zu einer Heimat, die nur noch in der Erinnerung betreten werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Die Fotografie eines Hauses in einer österreichischen Kleinstadt hatte die Mutter von Max so sehr geliebt, dass sie diese in jeder neuen Wohnung in New York aufstellte, in jeder weiteren, immer ärmlicher werdenden Station ihres Exils. Zurück wollte sie jedoch nie. Dass ihre Schwester den Nazis nicht entkommen konnte, hat sie für immer von ihrem Zuhause abgeschnitten. Und auch Max zieht nichts zurück in die alte Heimat seiner Eltern: Er hat in New York Erfolg als Restaurator, und er führt ein ungebundenes Leben.
Dennoch bleibt in ihm eine heimliche Sehnsucht nach Europa wach. Knapp dreißig Jahre nach Kriegsende reist er zurück nach Österreich, findet dort allerdings nicht das in den Träumen seiner Mutter immer verlockender gewordene Haus, sondern trifft auf Beamte, die, unempfindlich gegenüber seiner jüdischen Familiengeschichte, ihn danach fragen, mit welchem Recht er die Rückgabe seines Besitzes überhaupt fordere. Bis ans Herz ernüchtert bricht Max seinen ersten Aufenthalt ab und kommt erst Jahre später wieder zurück.
Autorin
ANNA MITGUTSCH, 1948 in Linz geboren, unterrichtete Germanistik und amerikanische Literatur an österreichischen und amerikanischen Universitäten, lebte und arbeitete viele Jahre in den USA. Sie ist eine der bedeutendsten österreichischen Autorinnen und erhielt für ihr Werk zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Solothurner Literaturpreis sowie den Adalbert-Stifter-Preis. Sie übersetzte Lyrik, verfasste Essays und zehn Romane, die in mehrere Sprachen übertragen wurden. Zuletzt erschienen bei Luchterhand der Essayband »Die Welt, die Rätsel bleibt« sowie der Roman »Die Annäherung«.
Anna Mitgutsch
HAUS DER KINDHEIT
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2000 Anna Mitgutsch
Luchterhand Literaturverlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung buxdesign | München
unter Verwendung eines Motivs von © Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-26012-5V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
I
1
DASFOTOstand auf der Kommode, solange Max sich zurückerinnerte. Es machte jede neue Wohnung, in die sie einzogen, zu einem weiteren Ort des Exils. Im Unterschied zu allen anderen Gegenständen, die sie nach jeder Übersiedlung auspackten, reichte seine Bedeutung weit in die Vergangenheit, und wie ein Schwur verpflichtete es dazu, ein Versprechen einzulösen. Mitten in ihrem Leben verwies es auf die eine Gegenwart, die schmerzlich fehlte. Das ist unser Haus, sagte seine Mutter und nahm das Foto andächtig in die Hand, in ein paar Jahren fahren wir vielleicht dorthin zurück.
Von seiner Mutter hatte Max gelernt, dass die Erinnerungen das Einzige waren, was einem nicht verlorengehen konnte. Man durfte sie nur nicht ziehen lassen, wie die Schiffe, die sie als Kinder gebannt beobachteten, wenn sie über den fernen Rand des Atlantiks kippten und verschwanden. In ihren ersten Jahren nach der Emigration gingen sie oft ans Meer, und Mira, ihre Mutter, wies mit dem Finger auf jene graue, manchmal unsichtbare Linie, die den Himmel vom Wasser trennte: Dort drüben liegt Europa.
Die Grenze war eine gerade Linie in einer Ferne, die nie näher rückte. Hätte er ein Bild für die Trauer seiner Mutter finden müssen, dann wäre es jenes unsichtbare Haus gewesen, das über den Horizont des Ozeans entschwunden war.
Doch drüben, in einer österreichischen Kleinstadt, stand das Haus und wartete. Und dessen auf die Größe eines Schwarzweißfotos geschrumpftes Ebenbild wartete auf Miras Kommode in der Delancy Street, später in Brooklyn, und als sie die Kommode verkaufen musste, auf einem Küchenregal am Crotona Park. Dann verschwand es und lag lange, gerahmt, aber mit dem Gesicht nach unten am Grund des Wäschefaches. Erst nach ihrem Tod stellte Max es neben das Farbfoto, das er inzwischen, Jahre später, bei einem Besuch in H. aufgenommen hatte. Aber das neue Foto hielt der sepiafarbenen Melancholie des alten Bildes nicht stand. Es wirkte nackt, beinahe anstößig und so beliebig wie ein Urlaubsfoto. Er nahm es weg.
Das Haus, in dem er irgendwann in der Zukunft wohnen wollte, war nicht jenes heruntergekommene Gebäude aus den zwanziger Jahren, als dessen Besitzer er sich fühlte, sondern ein Kindheitstraum, gespeist aus der lebenslangen Sehnsucht seiner Mutter nach einem endgültigen Nachhausekommen.
Max hatte beschlossen, an ihrer Statt zurückzukehren, nicht gleich, auch nicht in absehbarer Zeit, sondern wenn das Leben in der Gegenwart sich verlangsamte, vielleicht zum Stillstand käme, in einer Zukunft, die mit dem Fortschreiten der Jahre jedoch nicht näher rückte.
Später, im Ruhestand, sagte er, das läuft mir nicht davon. Denn die Vergangenheit, die ihn sein ganzes Leben begleitet hatte, blieb gegenwärtig, sie würde eintreten, wenn er sie rief.
Ich bin ein Reisender, sagte er manchmal, wenn ihn jemand zu ausdauernd nach seinen Plänen fragte, es ist angenehm, so zu leben. Man muss sich nur für die eigenen Fehler verantworten, und man hat jederzeit die Freiheit zu gehen.
Das gab ihm in den Augen anderer den Anschein einer Leichtigkeit dem Leben gegenüber, einer ironischen Verachtung jedes Anspruchs auf Endgültigkeit, als sei es ihm gelungen, die Last vielfältiger Verpflichtungen auf Distanz zu halten.
Es waren ferne, bruchstückhafte Bilder, umgeben von der undurchdringlichen Dunkelheit des Vergessens, wie Gegenstände, die eine Welle sekundenlang ans Sonnenlicht hebt, aufblitzen lässt und in der Unendlichkeit des Atlantiks begräbt. Wie konnte er wissen, ob es die sehnsüchtigen Geschichten seiner Mutter waren, die Nachbilder seiner oder ihrer Träume, oder jene kostbaren Fundstücke, die das Bewusstsein eines Fünfjährigen für immer in seinem Gedächtnis bewahrt hatte? Da ragte ein weißes Haus wie eine Festung über einem Fluss. Kühle schwarze Eisenstäbe. Gehörten sie zu einem Zaun, zum Gartentor? Steinstufen zwischen dunkler, lockerer Erde, schwer zu erklimmen. Ein knirschender Kiesweg und ein vages Gefühl freudiger Erwartung, eine schemenhafte Erinnerung an Menschen, deren Erscheinen wie Gerüche im Gedächtnis geblieben waren, wie ein Geschmack an Süßes oder Bitteres. Die Endgültigkeit einer Haustür, die ins Schloss fiel. Eine Lichtpfütze, bunt und funkelnd am Fuß der Treppe, und die Regenbogenfarben der geschliffenen Glasfenster über dem Treppenabsatz. Ein heller großer Raum mit weißen Flügeltüren, ein bunter Teppich mit geschwänzten und gehörnten Tieren, der die Wärme speicherte, lange, nachdem die Sonne den Raum verlassen hatte. Ein dunkler Marmortisch, an dessen Kante er sich das Kinn aufgeschlagen hatte. Die Narbe war lange sichtbar gewesen, bis in die Pubertät, bis er begonnen hatte, sich zu rasieren. Er erinnerte sich an eine Tischlampe mit langen moosgrünen Fransen und an das Sofa mit den Löwenfüßen. Es musste Winter gewesen sein, in seiner Erinnerung hingen helle Decken über der Lehne, die seine Tante Sophie sich um die kalten Beine wickelte. Auf der Balustrade der Terrasse saß ein venezianischer Löwe, der das Maul aufsperrte. Wenn er, der Dreijährige, Vierjährige, nach einem Regenguss die Hand hineinlegte, wurde sie feucht. Er hatte keine Vorstellung von sich als Vierjährigem, obwohl es Fotos gab. Erwachsene erschienen und verschwanden, körperlos, gesichtslos und dennoch deutlich zu erkennen. Sie trugen die Gesichter, die die wenigen Fotos aus jener Zeit ihnen gegeben hatten. Sie trugen sie wie Masken, die sie später gegen deutlich erinnerte Gesichter eintauschen oder in der unwandelbaren Jugend ihres frühen Todes als ihr einziges Gesicht aufbewahren würden.
Es gab ein Foto, auf dem sie alle auf den breiten Stufen vor der Eingangstür versammelt waren, fünf Erwachsene und drei kleine Kinder, drei Generationen. Am Beginn der zwanziger Jahre musste es gewesen sein, denn die Frauen, Sophie und Mira, trugen Hüte wie umgestürzte Blumentöpfe und lose, um die Hüften geraffte Sommerkleider. Ihre Gesichter waren verschwommen, von tiefen geheimnisvollen Schatten halb gelöscht. Die Männer sehr aufrecht und steif in dunklen Anzügen mit ernsten Gesichtern. Nur Mira trug das triumphierende Lächeln, das Max von anderen Fotos aus ihrer Jugend kannte, ein Leuchten, als habe ihr Gesicht das ganze Licht des Bildes an sich gezogen. Daneben wirkte das schmale Gesicht ihrer älteren Schwester wie ein zarter Schatten. Auch auf dem Hochzeitsfoto, auf dessen Hintergrund sich die Kulissenwolken eines Fotostudios ballten, stand Mira in dieser stolzen Selbstgewissheit inmitten ihrer Familie, herausgehoben durch das Weiß einer langen Schleppe zu ihren Füßen und das Strahlen ihres Lächelns, die starken Zähne und einen breiten Mund mit vollen Lippen. Saul, ihr Bräutigam, hielt sich verlegen im Hintergrund, als sei er nur ein scheuer Gast auf dieser Hochzeit, und auch auf dem Foto vor dem Haus war sein Gesicht zur Seite gewandt, als strebte er weg, ein ungeduldiger Fremder mit einem anderen Ziel. In dem länglichen, bärtigen Gesicht seines Großvaters Hermann glaubte Max immer eine Ähnlichkeit mit den eigenen Zügen zu erkennen, wohl weil Mira ihm erzählt hatte, wie ähnlich er ihrem Vater wäre. Jedoch an den Dritten, den Ehemann Sophies, hatte Max keine Erinnerung, und es gab auch keine weiteren Fotos, er war ein Schemen, der unscheinbar, fast ohne Spur durch sein kurzes Leben gegangen war.
Es gab noch andere Fotos, die Max später, nach Miras Tod, mitsamt der marmorierten Schachtel, den vergilbten, verblassten Briefen und Glückwunschkarten, an sich nahm. Von seinen beiden Brüdern Victor und Ben als Kinder vor dem Haus in H. auf einem Schlitten, Mira in einem breiten Fuchskragen, übermütig mit einem Schneeball in der Hand. Mira in einem hellen Badeanzug auf der Terrasse, die Kinder, nackt und voneinander nicht zu unterscheiden, um eine Badewanne im Freien. Aber Max war das Foto der versammelten Familie auf den Stufen des Hauses immer wie ein Dokument erschienen, weniger zufällig und privat als die anderen Fotos, so als markiere es ein Innehalten, eine stolze Selbstbesinnung in der Geschichte dieser drei Generationen.
Das Haus war damals neu, die Fassade von moderner Schlichtheit mit klaren, sparsamen Linien. Sein Großvater hatte es für seine beiden Töchter und Schwiegersöhne bauen lassen, auf einem großen Grundstück, einer Wiese, die so steil zum Fluss hin abfiel, dass der Bauer, dem die umliegenden Äcker gehörten, sie billig als Baugrund abstieß. Diese Wiese war in seiner Erinnerung eine summende Wildnis voll flirrenden Lichts und einem Duft, den er mitunter und immer unerwartet glaubte wiederzuerkennen, aber nie kam er ihm auf den Grund. Es war wohl diese Wiese, die in ihm den Eindruck hinterlassen hatte, in seiner frühen Kindheit auf dem Land gelebt zu haben, bevor ihn Manhattan als der Inbegriff der Stadt als Fünfjährigen überwältigte. Dagegen waren die wenigen Bilder seiner frühen Jahre die eines ländlichen Marktfleckens mit hellen Straßen, zweistöckigen Häusern und weiten, leeren Plätzen, einer Holzbrücke, die sich vor seinem kindlichen Auge in den Himmel wölbte wie eine Jakobsleiter ohne Sprossen. Dort auf der Brücke und an manchen föhnigen Tagen auf der Terrasse des Hauses füllte die Weite sich mit Unendlichkeit und machte das ferne Ziel der Eltern greifbar: Amerika. Der glitzernde Fluss, der die Stadt in großem Bogen teilte, und der farblose Himmel verschmolzen zu einem durchsichtigen Leuchten, und dieses Bild blieb Max im Gedächtnis haften als das Lebensgefühl seiner frühen Kindheit, nach dem er sein ganzes Leben strebte: Helligkeit, Weite, die festtägliche Stille eines nie zu Ende gehenden Sommernachmittags.
Die wichtigen Personen seiner frühen Jahre waren die Mutter und der Großvater. Mira war älter, als die Fotos vermuten ließen. Sie hatte einige Jahre Biologie studiert und dann geheiratet. Max war ihr jüngstes Kind, der dritte Sohn statt der ersehnten Tochter. Solange sie in H. lebten, blieb Mira die Lieblingstochter ihres Vaters, die sie seit dem frühen Tod ihrer Mutter gewesen war. Jedes auch noch so flüchtige Talent hatte er voll Überzeugung von ihrer Einzigartigkeit gefördert. Als sie sich in den mittellosen polnischen Medizinstudenten Saul Berman verliebte, finanzierte Hermann auch dessen Studium und richtete ihm später eine Arztpraxis in H. ein, um seine Kinder bei sich zu haben.
Tabor in Böhmen, der Geburtsort seiner Mutter, lag für Max in biblischer Ferne. Dort hatte sein Urgroßvater eine Weberei besessen. Hermann optierte nach dem Ersten Weltkrieg für Österreich und zog nach H., doch dem Textilhandel blieb er treu. In Miras Erzählungen war er überlebensgroß, gerecht und großzügig, von einer natürlichen Autorität, die selbst seine Widersacher respektieren mussten, kein Mann reichte in ihren Augen an ihn heran, auch Saul nicht. Seine ganze Kindheit lang stand er vor Max als das Vorbild, dem er ähnlich sah und dessen er sich würdig erweisen sollte. Dein Großvater hätte nie ein Hemd mit schmutzigen Manschetten angezogen, sagte Mira, dein Großvater hatte schmale Hände wie du, aber sie waren immer sauber und gepflegt, oder sie erinnerte sich mit einem verträumten Lächeln: Für schöne Schuhe hatte mein Vater eine Schwäche. Ihr Vertrauen in ihn musste grenzenlos gewesen sein, so groß, dass sie seiner politischen Hellhörigkeit nachgab und mit Saul und den Kindern emigrierte, obwohl es ihr in H. an nichts fehlte und sie geahnt haben musste, dass sie die Geborgenheit, in der sie bisher gelebt hatte, mit ihrem Vater zurückließ. Sie war es gewohnt gewesen, bei jedem geringfügigen Problem nach ihm zu rufen.
Am Schabbatabend und an Feiertagen saß Hermann am Ende des weiß gedeckten Tisches und sang den Kiddusch, segnete den Wein, er war das Oberhaupt, gegen das Saul sich hinter seinem Rücken spöttelnd auflehnte. Aber er war auch der Großvater, der an diesen Abenden die Kinder zu Bett brachte und ihnen geduldig Wort für Wort die Gebete vorsagte. Er war nicht fromm, aber hielt streng an den Traditionen fest, und auf dem Platz vor der Synagoge war er ein geachtetes Vorstandsmitglied, von dessen Glanz ein Schimmer warmen Wohlwollens auf seine Enkel fiel.
Viele Jahre später fand Max den Namen seines Großvaters in den Lokalzeitungen der Stadt H. aus jener Zeit unter den Gründungsmitgliedern eines Vereins für mittellose Bräute und eines Hilfsfonds für Flüchtlinge aus Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg. Seine politischen Beziehungen schützten Miras Vater jedoch lediglich vor der ersten Welle der Deportation nach Hitlers Einmarsch. Einige Monate länger als die anderen Mitglieder der Gemeinde lebte er vereinsamt und verarmt in einer Stadt, in der es offiziell keine Juden mehr geben durfte. Er wollte nicht mehr auswandern. Er war vierundachtzig Jahre alt, als er in einem polnischen Ghetto verhungerte.
Das Bild des Vaters aus jener fernen Zeit vor der Emigration war ein seltsam verschwommenes, auf ein paar Fotos reduziert, als wäre Saul selber nicht anwesend gewesen oder als Fremder in seinem Haus ein und aus gegangen, als Miras Liebhaber, als Gast, unruhig, mit dem gehetzten Blick eines Entwurzelten. Nie hatte er von seiner Herkunft gesprochen, die Geschichten, die ihn verständlicher hätten machen können, fehlten. Es gab keine Großeltern, keine Verwandten auf seiner Seite. Er war wie aus dem Nichts erschienen, als einer, der sein Leben ganz und gar aus eigener Kraft entworfen hatte und keine Vergangenheit benötigte, keine Herkunft, die ihn erklärte. Vielleicht waren Frau und Kinder, die Arztpraxis, das Haus einmal ein Anfang gewesen, den er nach kurzer Zeit verwarf. So wenig wie er auf seine Kindheit in Przemyśl, die er mit siebzehn Jahren hinter sich ließ, zurückblickte, hing er Europa nach, kaum dass sie in New York an Land gegangen waren. Aber das Bild, das Max von seinem Vater hatte, war verzerrt durch die Bitterkeit der Mutter, deren spätere Verlassenheit er teilte, als wäre es seine eigene.
Gab es Abschiede, Aufbruchsstimmung, Räume, die sich leerten, Holzkisten, in denen vertraute Gegenstände verschwanden, letzte Besuche, Tränen und Wiedersehensschwüre? Es fehlte Max jede Erinnerung daran. Nur das inhaltsleere Wort Amerika war ihm geläufig, und jeder von ihnen füllte es mit anderen Erwartungen. Für den Vierjährigen war Amerika das mit glänzendem Geschenkpapier verpackte Geburtstagspaket, die große Überraschung. Sie gingen am 10. Juni 1928 in Bremerhaven an Bord. Eine Woche später verbrachte Max seinen fünften Geburtstag seekrank in seiner Koje, und das versprochene Land war nicht in Sicht.
Nichts aus den Wochen und Monaten nach der Ankunft blieb Max so deutlich im Gedächtnis haften wie die Verzweiflung seiner Mutter. Es war unmöglich, sich ihr zu nähern, vor allem Neuen, vielleicht Bedrohlichen bei ihr Schutz zu suchen, ihre Stimmung wechselte zwischen Trauer, zornigen Beschuldigungen gegen Saul und Selbstbezichtigungen. Von Anfang an habe sie es gewusst, von dem Augenblick an, als die norddeutsche Küste ihrem Blick entglitt, das Glück, die Jugend lägen nun endgültig hinter ihr, in der Geborgenheit der Kleinstadt, bei ihrem Vater, in den Räumen ihres Hauses, nach dem sie eine besessene Sehnsucht entwickelte, und im Verlust begann es sich allmählich bis zur Unkenntlichkeit zu verklären, sich in eine herrschaftliche Villa zu verwandeln, deren hohe stuckverzierte Räume sie lebhaft vor sich sah, auf dessen Terrasse sie an die Marmorbalustrade gelehnt über das Tal blickte, es war in ihren Träumen immer Sommer, ein kühler Sommermorgen, und sie war sorglos und geliebt, die Morgensonne lag wie vom Widerschein des Flusses schimmernd über den Fußböden und Möbeln, der Wind blähte die Spitzenvorhänge, es war das Versprechen eines heiteren Tages lang wie ein Leben, das jäh zu Ende gegangen war. Und mit der Zeit verschmolzen die wenigen, verschwommenen Bilder, die Max aus eigener Erinnerung besaß, mit Miras Phantasien, und wenn sie abends an seinem Bett saß, reihten sie alles, Wünsche und Träume und verklärte Erinnerungen wie Bausteine aneinander, reichten sich gegenseitig Bilder zum Bestaunen und bauten daraus einen prunkvollen Palast mit einem marmornen Säulengang über dem weiten Bogen eines Flusstals in einer fernen hügeligen Landschaft, in deren Dunst eine Stadt lag, friedlich, in einem ewigen Dornröschenschlaf.
Als Max älter wurde und seine neue Umgebung sein Leben füllte, blieb sie allein mit ihrer Sehnsucht und ihrer Trauer, und niemand half ihr mehr dabei, den Traum von ihrem Haus aufrecht zu halten. Aber erst als die Nachrichten vom Tod ihrer engsten Familienmitglieder und Verwandten sie erreichten, hörte sie auf, davon zu reden und ihre hartnäckigen Hoffnungen darauf zu richten. Es gab nichts mehr für später zu bewahren. Sie fiel auf den harten Boden der Gegenwart, dankbar, dass die politische Wachsamkeit ihres Vaters und Sauls rastloses Drängen nach Veränderung zumindest ihren Kindern das Leben gerettet hatte.
Damals aber, in der schier unerträglich feuchten Hitze ihres ersten New Yorker Sommers, auf den sie nichts vorbereitet hatte, musste es Mira scheinen, als sei die hinterhältige Grausamkeit, mit der das Unglück sie verfolgte, die Verschwörung einer höheren Macht, die alles daransetzte, sie zu quälen. Bei ihrer Ankunft wusste niemand etwas von den Kisten, in denen sie ihren Hausrat, die wenigen unentbehrlichen Gegenstände von zu Hause, vorausgeschickt hatte. Sie waren verschwunden und tauchten auch im Lauf der nächsten Monate nicht mehr auf. Und das war erst der Anfang einer Kette von unglücklichen Zufällen und Hindernissen, die diese wandelbare, gewalttätige und rücksichtslose Stadt für sie bereithielt. Viel später, als Max längst die gereizte Erbitterung und die bedingungslose Zuneigung all jener mit New York verband, die in dieser Stadt aufgewachsen waren, erkannte er, dass Mira der Stadt nie etwas hatte abgewinnen können, weil sie nie bereit gewesen war, sich wie sein Vater vom amerikanischen Traum mitreißen zu lassen. Sie war zeitlebens Europäerin geblieben, klassenbewusst, der Vergangenheit und einem gepflegten, mitunter dünkelhaften Lebensstil zugewandt, neben dem die neuen Umgangsformen krud und beleidigend erscheinen mussten. Es fiel ihr schwer, die englische Sprache zu erlernen, obwohl sie Französisch konnte und später, in Brooklyn, mit ihren Freundinnen jiddisch sprach. Die lebenslustige, gebildete Mira mit dem gewinnenden Lächeln und ihrem selbstgewissen Charme reagierte auf die fremde Stadt mit Panik und der verstörten Überzeugung, dass all die rohe Rücksichtslosigkeit, die Blindheit New Yorks für das Wohl des Einzelnen, ausschließlich gegen sie gerichtete böse Absicht sei. Für wen zum Teufel hältst du dich, und was hast du hier zu suchen, schienen ihr die Leute zuzurufen, die an ihr vorbeihasteten, sie anrempelten, sie in den Geschäften zur Seite drängten. Sie fühlte sich allein und übergangen und zugleich angegriffen, sie wurde ignoriert oder angeherrscht, und die Methoden, mit denen sie gelernt hatte, sich zu wehren, gehörten in eine andere Welt.
Einige Wochen nach ihrer Ankunft auf Ellis Island bezogen sie ihre erste Wohnung in der Delancy Street, ein angemessener Übergang von einem geräumigen Haus in einer Kleinstadt, mit hohen, straßenseitigen Räumen im zweiten Stock eines Backsteinhauses aus der Zeit der Jahrhundertwende, als die Williamsburg-Brücke erbaut und die Delancy Street zu einem Boulevard verbreitert wurde. All diese Räume seiner Kindheit trugen ohne sein Zutun wohl zu seinem unfehlbar feinen Gespür für Proportionen, Licht und Schatten bei, die hohen Fenster mit ihren kleinen gusseisernen Balkonen, die wie Körbe über dem Gehsteig hingen, der Ausblick auf die Pfeiler und Stahlseile der großen Hängebrücke, der breite Boulevard, die dunkel getäfelten Wände der Herrenschneiderei im Erdgeschoss des Hauses mit ihrer düsteren Eleganz hinter schattigen Markisen. Die große Wohnung im zweiten Stock dagegen war hell und leer, offen für alle Möglichkeiten, ein großes Wohnzimmer oder eine Arztpraxis, sobald sein Vater seine Prüfungen geschafft hätte, für die er ungestörte Ruhe brauchte. Aber in Wirklichkeit ging eine vibrierende Unruhe von seinem Vater aus, New York schien ihn zu elektrisieren, ihn mit Plänen und Energie zu füllen, die Spannungen und Streit ins Haus brachten. Auch Max spürte die nervöse Rastlosigkeit, die seinen Vater überkommen hatte, den Sog der Stadt, die ihn herausforderte, verlockte, täuschte, auch wenn er noch nicht begriffen hatte, dass sie seine Grenzen niederriss, alle Verbote und Regeln, nach denen er bisher gelebt hatte, in Frage stellte. New Yorks Versprechen grenzenloser Freiheit stieg Saul zu Kopf, er traf sich hinter dem Rücken seiner Familie mit russischen, polnisch-jüdischen Emigranten voll wahnwitziger Ideen, die nach einer durchwachten Nacht völlig vernünftig und folgerichtig erschienen. Zu Hause saß er im leeren Wohnzimmer, das einmal seine Praxis werden sollte, und starrte blicklos in die Bücher, hielt sich so Frau und Kinder vom Leib, während von unten, vom belebten Boulevard, New York mit seinen Verführungen in aufdringlich grellen Tönen und Farben hinaufdrang, bis er die Bücher weglegte und sich Manhattans heißen Atem ins Gesicht wehen ließ, schwindlig von neuerwachter Lebensfreude.
In einem optimistischen, vielleicht auch nur verzweifelten Versuch, seine Familie an seinem großen Abenteuer teilhaben zu lassen, unternahmen sie viel in jenem ersten Sommer, an den sich Max erinnerte als an eine ausgelassene, lange Vergnügungsfahrt. Meist fuhren sie mit der Subway zum Central Park, mieteten ein Ruderboot und paddelten unter hellen Weidenästen über den See vor der zartblauen Kulisse der Hochhäuser, die so fern erschien wie eine Bergkette bei Föhn. Sie wanderten durch den Central Park mit einer Ausdauer, die sie für die Umgebung von H. nie aufgebracht hatten, vom Belvedere Castle nach Süden zwischen Rhododendronbüschen, wilden Kirschbäumen und dem betäubend süßen Geruch der Rinde von Sassafrassschösslingen durch künstlich angelegte Schluchten, wo sich an Wochenenden der Strom der Spaziergänger staute. Der Zoo war erst vor kurzem eröffnet worden, mit Fischottern und einem trägen Bärenpärchen namens Gus und Priscilla. Bevor sie den Park verließen, bekamen die Kinder an einem der zahlreichen Limonadenstände eine große Tüte der ihnen völlig neuen Köstlichkeit heißen Popcorns. An solchen Tagen tauchten sie alle einträchtig nach einer langen Fahrt Downtown an die dampfende Oberfläche der Lower East Side, von Eindrücken gesättigt und von der Hitze müde, und weder Sauls nervöse Rastlosigkeit noch Miras unterschwelliger Zorn trübte die Harmonie.
Das Fest, das sich mit Kaufhausbummel und sonntäglichen Vergnügungsfahrten zum Luna Park auf Coney Island oder ins klimatisierte Foyer des Roxy-Kinos mit seinem Feuerwerk aus bunten Lampen und Springbrunnen bis in den milden Spätherbst fortsetzte und mit neuen Schlittschuhen für die ganze Familie einen weiteren Höhepunkt im winterlichen Central Park versprach, begann bereits in der schneidenden Kälte des Winters an Glanz zu verlieren.
Streit lag in der Luft, Türen fielen mit einem harten, unversöhnlichen Knall ins Schloss, mitten in der Nacht blieb Mira weinend in der Küche sitzen. Am Morgen war der Vater immer noch nicht da, die Mutter fahrig und unbeherrscht. Nachts hörte Max die Eltern wieder streiten. Alles passierte in diesem einen Herbst: Max kam in die Schule, und während der schier unendlichen Vormittage erlebte er zum ersten Mal Verlassenheit und Angst vor dem Gespött der Gleichaltrigen. Er kannte ihre Spiele nicht, und in der Panik und Verwirrung sprach er deutsch. Ende Oktober wurde seinen Eltern klar, dass das mitgebrachte Vermögen verloren war und dass auch die Ersparnisse des Großvaters, der versuchte, ihnen beizustehen, sie nicht mehr vor der drohenden Armut retten konnten. Der Börsenkrach und die Trennung der Eltern verschmolzen in seinem Gedächtnis zu einer Katastrophe, die seine sorglose Kindheit beendete und sein Vertrauen in Ersparnisse und Besitz für immer erschütterte. Selbst dreißig Jahre später, als er selber zu Wohlstand gekommen war, schien ihm Geld zu horten als Dummheit und Vergeudung jeder Chance auf Glück.
Die Wirtschaftskrise entfesselte in Saul endgültig jenen revolutionären Funken, den er so lange der Familie zuliebe unterdrückt hatte, seine Wut auf alles Bürgerliche, das sich für ihn in Mira verkörperte, und seine Visionen von einer freien, besseren Welt. Saul wurde Zionist, er hatte endlich die Berufung gefunden, die er gesucht hatte, ohne zu wissen, dass er sich darauf vorbereitete: die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina. In einer Zeit, in der es Mira und den Kindern an allem fehlte, woran sie gewöhnt gewesen waren, erinnerte sich Max später voll Bitterkeit, habe Saul seine Patienten behandelt, ohne zu fragen, ob sie bezahlen konnten. Um einen symbolischen Dollar pro Visite habe er sie behandelt, und Max hatte es ihm nie verziehen.
Im Winter 193o verließen sie die helle Wohnung in der Delancy Street, weil sie die Miete nicht mehr aufbringen konnten. Saul half bei der Übersiedlung, aber bevor der Hausrat noch in den beiden kahlen Räumen in Brooklyn untergebracht war, nahm er seinen an der Tür abgestellten Koffer, um nach Manhattan zurückzufahren und fern von der Familie ein möbliertes Zimmer zu beziehen, das er in einem der heruntergekommenen Tenement-Houses der Lower East Side gefunden hatte.
In Brooklyn konnte Mira die Kinder nicht mehr vor der vulgären Umwelt behüten, die ihre Berührungsängste und ihren Widerwillen mit gleichgültiger, fast spielerischer Brutalität beantwortete. Max war auf sich gestellt und wuchs in eine Welt, die anders war als seine Welt bisher, und sie gefiel ihm. Verrußte, eng aneinandergebaute Sandsteinhäuser mit dunklen, immer ein wenig feuchten Seitengassen, in denen man nie genau wusste, woher der Gestank kam, rostige Feuerleitern, die den Fassaden ihre heruntergekommene Geometrie aufprägten, und kleine Lebensmittelläden, finstere Löcher im Souterrain, deren einzige Quelle von Tageslicht die stets offene Tür war. Noch war es eine vertraute Welt mit jüdischen Geschäften und vorwiegend ostjüdischen Einwanderern, eine Welt, die für Mira einen gewaltigen sozialen Abstieg bedeutete, einen Rückfall um Generationen, aber auch einen gewissen Schutz und ein Anknüpfen an alte, abgelegte Traditionen. Sie ging wieder wie früher, als sie noch die folgsame Tochter ihres Vaters war, jeden Freitagabend in die Synagoge, weniger aus einer neuerwachten Frömmigkeit, sondern um der Wärme vertrauter Rituale willen, die ihr in ihrer Einsamkeit Trost spendeten. Hier knüpfte sie in den nächsten beiden Jahren Freundschaften, die bis zu ihrem Tod nicht abrissen, eine Ersatzfamilie von Immigrantinnen, die mit ihr älter wurden, derentwegen sie Jiddisch lernte, um ihnen näher zu sein, und die sie nie im Stich ließen, auch wenn ihre Hilfe nicht immer wirksam war. Max, der als Jüngster der Mutter näherstand als seine Brüder, begleitete sie, wenn sie ihre Freundinnen besuchte. Da saßen sie dann in winzigen, muffigen Stuben, die mit dem bunten Kitsch aus Osteuropa und mit Familien- und Hochzeitsfotos überladen waren. Die nach außen zur Schau gestellte Verachtung für The Old Country, das ihnen das Lebensrecht entrissen hatte, schien in diesen Wohnzimmern und Küchen in nostalgische Sehnsucht umzuschlagen. Max wurde gefüttert und bewundert und saß schweigend dabei, wenn seine Mutter weinte und ihre Freundinnen ihr rieten, die Scheidung zu verweigern; wenn sie erzählte, dass er mit dieser Frau zusammenlebte und sie und seine Kinder verhungern ließe, während er seine Patienten umsonst behandelte, und immer hatte jemand ein neues Gerücht gehört, dass Saul bei dieser oder jener sozialistischen oder zionistischen Versammlung gesehen worden sei, und wie die neue Lebensgefährtin aussehe, was sie gesagt habe, dass sie stets an seiner Seite erscheine, als sei sie schon seine Ehefrau, und angeblich schrieb sie sogar seine Artikel um, damit sie englisch klängen. Hier, bei diesen Frauen, die älter waren als Mira und deren Rat sie suchte, wurde Max Zeuge der zornigen Fassungslosigkeit seiner Mutter, dass der Mann sie verlassen hatte, dem ihr Vater die geliebte Tochter und obendrein ein Vermögen anvertraut hatte. Er fing die Erschütterung ihrer Existenz mit seiner kindlichen Liebesfähigkeit auf, er hätte sie gern entschädigt und gerächt. Wenn er, um ungestört zu sein, mit seinen Aufgaben auf der Feuerleiter oberhalb des Küchenfensters saß und das Leben auf der Straße zu seinen Füßen beobachtete, träumte er von dem Tag, an dem er Zeuge sein würde, dass sie in ihr Haus zurückkehrte. Er würde erwachsen sein und ihr Geld nach Europa schicken, sie würde in dem Haus mit seinen hohen hellen Räumen wohnen, morgens auf der weißen Terrasse in einem Korbstuhl frühstücken und über den Fluss in die Ferne blicken und an ihn denken, dem sie dies alles verdankte.
Allmählich kehrte in ihrem Leben die schweigsame Ruhe der Niederlage ein, die Scheidung wurde ausgesprochen, und Mira wurde stiller und gefasster. Max sah seinen Vater an Sonntagen, mitunter auch an Samstagnachmittagen, wenn er seine Söhne abholte, um ihnen angedeihen zu lassen, was er für wichtig hielt: frische Luft und Bildung. Max fühlte sich zu seinem Vater hingezogen, aber seine Feindschaft, die er im Namen seiner Mutter hegte, erlaubte ihm nicht, dass er seine Zuneigung zeigte, und so wandte der Vater sich Victor zu, der seine Bewunderung für Sauls neue politische Ziele nicht verhehlte. Oft paddelten sie zu viert über den Conservatory Lake, die frische Brise kräuselte das Wasser und ließ Lichtfunken tanzen, im jungen Grün der Lichtungen am Ufer picknickten Familien, und Max fühlte sich elend wie ein Verräter. Wenn er nach Hause kam, konnte er seiner Mutter nicht in die Augen sehen. War es schön?, fragte sie, aber er rannte an ihr vorbei zu seinem Versteck auf der Feuerleiter.
Dennoch wurden die Nachmittage, an denen Saul mit der puritanischen Strenge des europäischen Bildungsbürgers, der er gar nicht sein wollte, seine Söhne in Museen und Kunstausstellungen mitnahm, für Max prägender als für seine Brüder. Auch wenn die bereits Halbwüchsigen gelangweilt an den Wänden der Ausstellungsräume entlangtrotteten und die Besucher betrachteten, ließ Saul sich nicht entmutigen und nahm sie stur in jede Ausstellung mit, ins Metropolitan Museum, The Cloisters, aber vor allem ins neue skandalös avantgardistische, trotzig anti-europäische Whitney Museum. Damals interessierten Max die Bilder an den Wänden und die Gegenstände in den Vitrinen genauso wenig wie seine Brüder, aber er nahm wahr, welche Stimmungen in großen Räumen herrschten, er sah, wie das Licht, das durch die Fenster fiel, Gegenstände verschwinden und verdämmern lassen konnte oder hervorhob, als schwebten sie im Raum. In diesen Sälen lernte er, auf die Wirkung des Lichts zu achten, wie es im Lauf der Stunden über Böden und Oberflächen glitt und sie verwandelte – Details hervorhob und sie fallenließ, Vorstellungen weckte und sie so unvermittelt zum Erlöschen brachte, wie sie erwacht waren. Er beobachtete, dass unvermittelt etwas Unheimliches in die Ecken kroch, um in ihnen zu nisten, und er fühlte, dass sich in Spiegeln eine fast unentrinnbare Einsamkeit verbarg. Er konnte sich daran ergötzen, wie unbeachtet von den Besuchern die Stuckverzierungen an den Decken ihr unabhängiges, ausschweifendes Eigenleben führten. Schon damals spürte Max jene Vertrautheit großer, leerer Räume und das Bedürfnis, ihnen eine unverwechselbare Atmosphäre zu geben. Er ahnte noch nicht, dass er seine Begabung entdeckt hatte, aber er wusste bereits, dass ein Raum viel mehr war als ein Ort zum Wohnen, eine bestimmte Weise, sich in der Welt zu orientieren, Ausdruck eines Lebensgefühls.
Zu Hause herrschten Armut und Mangel. Die Unterkünfte, die auf die Wohnung in der Delancy Street folgten, hatten alle etwas Provisorisches. Sie glichen mit ihren Pappkartons, die in den Ecken der Zimmer ineinander gestapelt waren, eher Notquartieren. Die Kartons und Koffer standen von Anfang an bereit für den nächsten Umzug, der nie lange auf sich warten ließ. Mira verachtete die billigen Möbel aus den Kaufhäusern, und die alten Möbel mussten Stück für Stück in Trödlerläden und Auktionshäusern zu Bargeld gemacht werden. Mit ihrem hartnäckigen Bestehen auf der Vorläufigkeit ihres gegenwärtigen Lebens verweigerte sie sich einem Los, das sie nicht als das ihr zugedachte angenommen hatte. Es musste ein Irrtum des Schicksals sein, den sie nicht anerkannte. Mit elf unternahm Max seinen ersten Gestaltungsversuch. Er litt darunter, dass er Mitschüler nie nach Hause mitbringen konnte, denn es gab nur die enge Küche und zwei Schlafzimmer. Von Erspartem und auch von gestohlenem Haushaltsgeld kaufte er ein gebrauchtes Sofa von einem samtenen Blau und einen gleichfarbenen Überwurf für das zweite Bett, stellte ein Messingtablett auf einen selbstgebastelten Zeitungsständer und hatte einen Nachmittag lang sein Wohnzimmer. Die Mutter ließ das Sofa abholen und stellte die alte Ordnung wieder her, aber die Träume von großzügig eingerichteten Räumen, von Licht, Weite und einer spröden Eleganz der Gegenstände konnte ihm niemand nehmen.
Sein Möblierungsversuch ihrer Zweizimmerwohnung in Brooklyn war die einzige Verstimmung zwischen Max und seiner Mutter gewesen, die ihm aus der Kindheit im Gedächtnis blieb. Max war »der Kleine«, das Kind, an dem sie mit der meisten Liebe hing und das sich ihrem Liebesbedürfnis am wenigsten entzog. Mit dem schmalen Gesicht, dem rötlichbraunen, leicht gewellten Haar, der runden Stirn und den nachdenklichen graubraunen Augen sah er ihr auch ähnlicher als die beiden Brüder. Die Nähe zwischen ihnen bedurfte keiner Worte. Sie war in der schwärmerischen Verehrung für die in seinen Augen konkurrenzlos schöne Mutter verankert, in ihren gemeinsamen Träumen und Geschichten aus einer Vergangenheit, in der es nur glückliche Tage gegeben hatte, und in dem lebhaften Wunsch des Sohnes, ihr dieses Glück zurückzugeben. Aber es war wohl auch die Harmonie, zu der Menschen mit verwandten Seelen mühelos finden können, weil sie sich wohl fühlen in der Gegenwart des anderen.
Im Sommer, nachdem Saul sie verlassen hatte, ging Mira mit den Kindern zum ersten Mal allein zur Feier des Unabhängigkeitstages am vierten Juli zum Battery Park, um das nächtliche Feuerwerk zu sehen. Sie standen dicht an der Mole mitten in der erwartungsvollen Menge, als ein Fremder Max eine rote Rose in die Hand drückte. Gib das der schönen Dame mit dem Hut, sagte er und deutete auf Mira, die sich gerade mit ihrer neuen Freundin Faye unterhielt. Da sah er seine Mutter zum ersten Mal mit den Augen eines fremden Mannes: ihre stattliche, nicht mehr schlanke, aber sehr weibliche Figur mit der schmalen Taille und dem weiten Rock, das dunkle in der Mitte gescheitelte Haar mit dem spanischen Knoten auf dem Hinterkopf und dem etwas lächerlichen kecken Hütchen, das ihr aufs Ohr gerutscht war, den vollen rot geschminkten Mund und die leicht schrägen mandelförmigen Augen. Max war sehr stolz auf seine schöne Mutter, und er war es, zu dem sie sich hinunterbeugte, um ihn zu küssen, als er ihr die Rose überreichte, den fremden Mann streifte sie nur mit einem flüchtigen, unbeteiligten Blick. Seit Saul sie verlassen hatte, erschien Max ihre Schönheit zerbrechlicher und schutzlos, er war ihr Ritter, auf den sie zählen konnte. Spätnachts, halb im Schlaf hörte er ihre Nähmaschine, mit der sie in schlechtbezahlter Heimarbeit Badeanzüge zusammennähte, um sich und die Kinder durchzubringen. Er brannte darauf, endlich erwachsen zu werden, für sie wollte er einmal reich sein, um ihr alles, was sie sich nun versagen musste, geben zu können.
Victor, sein ältester Bruder, war Max so fremd, als sei er kein Mitglied der Familie, sondern ein entfernter Verwandter, der bei ihnen wohnte, ein Eigenbrötler, der wenig mitteilsam seiner eigenen Wege ging, rechthaberisch und detailversessen, und mit seinem Altersvorsprung von sechs Jahren einschüchternd wie ein Erwachsener. Saul war Victors Vorbild, die Vereinnahmungsversuche seiner Mutter wehrte er kühl ab, und in der Zeit der Krisen und Gefühlsausbrüche während der Scheidung stellte er sich trotzig auf die Seite des Vaters, um den er warb, soweit es ihm sein sprödes Naturell erlaubte. Er war ein mittelmäßiger Schüler, trotz seines Ehrgeizes und seiner verbissenen Arbeitsdisziplin, er wolle nach dem College in die Politik gehen, erklärte er, so wie sein Vater. Victor war noch keine achtzehn, als er auszog, um aufs College zu gehen. Wenn seine Mutter wissen wollte, wie es ihm ging, musste sie Saul anrufen, er ließ sich nur mehr selten zu widerwilligen Pflichtbesuchen bei ihr blicken.
Benjamin, zwei Jahre älter als Max, war der Spielgefährte seiner Kindheit, mit dem er jedes Geheimnis teilte und den er überallhin begleitete. Es war natürlich, zu Ben aufzublicken, er war das Genie der Familie, das jedes Jahr eine Klasse übersprang, dessen Denkgeschwindigkeit sie alle mit Stolz erfüllte, denn Intelligenz, davon war Max überzeugt, war eine Sache der Denkgeschwindigkeit. Er selber war ein Grübler, und seine Gedanken kamen nie zu einem Ende, sie verliefen sich im Ungefähren, wurden zu Möglichkeiten, die andere Möglichkeiten nach sich zogen, sich verästelten, bis er aufgab. Ben dagegen hatte sie, diese Eleganz des Geistes, die sich wie transparente Flügel über die Dinge legte und sie ordnete, und er war phantasiebegabt, ein Jongleur mit Träumen, an denen er Max teilhaben ließ. Doch nie verbiss er sich in seine Phantasiegespinste, er ließ sie ziehen wie bunte Luftballons, er wusste, dass sie sich in der Wirklichkeit nicht behaupten konnten, aber sie ließen die beiden Brüder die beengte, ärmliche Umgebung für Stunden, oft ganze Nachmittage, vergessen.
Keine der Wohnungen, die ihren Abstieg markierten, verließen sie freiwillig. Jedes Mal zogen sie aus, weil die Miete erhöht worden und sie in Rückstand geraten waren, weil die Hausbesitzer zu jeder Tageszeit anriefen und mit der Delogierung drohten oder die Heizung abschalteten, so dass sie im Winter in ihren Mänteln schlafen mussten. Die Kälte in Winternächten war eine Grunderfahrung von Max’ Jugend, eine Gegebenheit, die ihm bald als ein Normalzustand erschien. Die Hausbesitzer lebten in ihren Villen auf Long Island und spürten die Kälte nicht. Am frühen Morgen, gegen fünf, erwachte die Heizung zischend, klopfend und gurgelnd zum Leben. Dann konnten sie die Mäntel ausziehen und noch zwei angenehme Stunden lang schlafen. Um acht, halb neun, gerade, wenn sie das Haus verließen, hatte die Hitze ihren tropischen Höhepunkt erreicht. Aber wenn sie am frühen Nachmittag von der Schule nach Hause kamen, war von der Hitze nur noch ein lauwarmer Rest zu spüren, und gegen neun Uhr abends zogen sie sich an wie für eine Expedition in die beißende Kälte der nächtlichen Stadt.
Mira gelang es in all diesen Jahren nie, Menschen zu finden, die genügend Macht besaßen, ihr wirksam zu helfen. Mit ihrem starken Akzent und ihrem zornigen Gestammel – in der Aufregung verließ sie jede Sicherheit in der fremden Sprache, die Wörter fielen ihr nicht mehr ein, die Sätze verdrehten sich – setzte sie sich verzweifelt zur Wehr, konnte nur an Gerechtigkeit und menschliches Mitgefühl appellieren, das man ihr vorenthielt. Manchmal setzten die Ehemänner ihrer Freundinnen sich für sie ein, manchmal gelang es ihr, einen Beamten zu rühren, einen Gläubiger zu entweihen, aber meist verlor sie und erwartete auch mit der Zeit nichts Besseres in ihrer Überzeugung, dass die Katastrophe längst angefangen hatte und nun unbeirrbar ihren Lauf nahm. Saul war ihr wenig Hilfe, auch er lebte ja in den ersten Jahren nach der Scheidung in Armut, und je stärker ihn die Politik in ihren Bann zog, desto mehr empfand er die kleinen Sorgen seiner früheren Familie als Belästigung. Die beiden jüngeren Söhne machte er sich endgültig zu Feinden, als er einem Lehrer, den Ben mit seinem Spott gereizt hatte, erlaubte, den Vierzehnjährigen zu züchtigen.
Von Brooklyn zog Mira mit den Kindern in die East Bronx, in eine Wohnung am Crotona Park, die einen Stock unter dem Niveau der Straße auf der anderen Seite des Gebäudes lag. Dass sie damit von der untersten Sprosse der sozialen Leiter auf dem harten Boden städtischer Verwilderung aufgeschlagen waren, wurde den beiden Brüdern kaum bewusst und wenn, dann nicht so schmerzlich und ohne Hoffnung wie ihrer Mutter. Max war damals zwölf und prügelte sich mit den jugendlichen Banden irischer Katholiken, schloss sich selber den Banden italienischer Einwandererkinder an und prahlte noch viele Jahre, nachdem er die Bronx verlassen hatte, mit den Schlägereien, aus denen er ohne gebrochene Nase hervorgegangen war. Zwei Straßen weiter fing das schwarze Ghetto an. Sich auf der Straße zu behaupten, war die einzige Möglichkeit zu existieren.
Meine Mutter hat uns mit Soja, Seetang und Körnern großgezogen, erzählte er, lange bevor das Zeug in Mode kam. Wir sollten groß und stark davon werden, Stadtwölfe, Bronx-Guerilla.
Sie wandte das Wissen ihres Biologiestudiums, mit dem sie sich nie einen Unterhalt hatte verdienen können, auf die Ernährung ihrer Kinder an und konnte doch nicht verhindern, dass es ihnen an allem mangelte.
Max musste sich für zwei schlagen, denn Ben war kein Kämpfer, Ben war ein Denker, ein Intellektueller, ängstlich, wenn es um körperliche Auseinandersetzung ging: Selbst freundschaftlicher Berührung, wie sie unter Jugendlichen üblich war, ging er aus dem Weg. Seine Furcht zog Spott und Hänseleien an, die er mit einer Scharfzüngigkeit quittierte, auf die unweigerlich ein Angriff folgte. Bei jeder Rauferei blieb er als Opfer liegen.
Die glücklichsten Erinnerungen an Ben verband Max mit dem fauligen Graben hinter dem fünfstöckigen holzverschalten Haus in der Bronx, in dem sie wohnten. Es war der stinkende Hinterhof, auf den ihre Fenster gingen, wo unter einer Treppe aus morschen Brettern fette bleiche Unkrautranken wuchsen, Brennnesseln und magere wilde Schösslinge, die nie zu Bäumen wurden. Dazwischen häuften sich Müll, Blechdosen, zerbrochenes Glas, kaputter Hausrat und manches Brauchbare, verrostete Fahrradteile, ausgeweidete Radios und Dinge, deren Wert sich nur Bens Phantasie erschloss. Es war der erste Spielplatz in der Natur, den die beiden seit ihrer Emigration erlebten, und Bens Erfindungsreichtum verlieh ihm Magie. Das gegenüberliegende Haus stand so dicht an ihrem Hinterhof, dass dieser Spielplatz nur eine schmale Schneise war und bis auf die Mittagsstunden im Schatten lag. Die Häuser ragten zu beiden Seiten über ihnen wie Festungen auf, und in den Wohnungen brannte auch tagsüber Licht, dort spielte sich schamlos und unschuldig das geheimnisvolle Leben eines Proletariats ab, mit dem Mira nichts zu schaffen haben wollte.
Jeden Freitagnachmittag machten sie sich auf den weiten Weg nach Brooklyn, übernachteten in Schlafsäcken auf dem Boden von Fayes kleiner Wohnküche und fuhren am Samstagabend in die Bronx zurück. In der Synagoge, in der sich Mira in ihrer verlassensten Zeit nach Sauls Auszug Trost geholt hatte, machte Max seine Bar Mizwa, weit weg von seinen gleichaltrigen jüdischen Klassenkameraden in der Bronx. Er kannte niemanden außer einigen alten Leuten, er musste vor niemandem glänzen außer vor seiner Mutter. Wie so oft in seinem Leben setzte er seinen ganzen Ehrgeiz daran, sie glücklich zu machen. Zu jenem Zeitpunkt lebte Victor längst nicht mehr bei ihnen, und Saul hatte just an jenem Schabbat im Juni zu einer wichtigen Besprechung mit Chaim Weizmann nach Washington reisen müssen.
Wenige Jahre später blieben Max auch von Ben nur ein paar Fotos und die Erinnerung an die gemeinsame Kindheit. Das letzte Foto, das Max von seinem Bruder Benjamin besaß, war am Tag seiner Graduation vom City College aufgenommen worden. Er steht etwas schief, als müsse er sich gegen einen seitlichen Windstoß stemmen, vor dem Liberal Arts-Gebäude in der Sonne, sein schmales, sanftes Gesicht so weich, als hätten die Knochen noch nicht ihre endgültige Form gefunden. Nichts deutet darauf hin, dass ein Jahr später in der psychiatrischen Abteilung eines Brooklyner Hospitals die Diagnose Schizophrenie allen Erwartungen einer strahlenden Zukunft ein Ende setzen würde.
Der langsame Abstieg in die Hoffnungslosigkeit vollzog sich über viele Jahre in einer Zeit, als weder Schockbehandlung noch Psychotherapie Erleichterungen brachten, und die Psychopharmaka setzten allmählich Bens Gesundheit zu. Es gab Zeiten, in denen ein fast normales, wenn auch eingeschränktes Leben möglich schien, Zeiten voll hektischer Pläne und kurzlebiger Erfolge, eine Lehre bei einer Zeitung in Manhattan; aber nach ein paar Monaten kam er mitten am Tag nach Hause: Er hielt dem Termindruck nicht stand, hielt die Leistungsanforderungen nicht aus. Er brauchte seine ganze Kraft, um die Angst in Schach zu halten, die Unruhe, den Tumult der Stimmen in seinem Kopf. Er ließ sich gehen, verwahrloste, wurde von der Polizei aufgegriffen, von Stadtstreichern verprügelt, endete früher oder später immer wieder in der geschlossenen Abteilung.
Selbst zu den Zeiten, die er zu Hause verbringen durfte, lebte Ben als Fremder mit seiner Familie unter einem Dach, reizbar und verschlossen. Da war nichts mehr von dem Bruder, mit dem Max im Graben hinter dem Haus gespielt hatte. Am schwersten war es, ihm zuzusehen, wie er litt, und keine Worte zu finden, die ihn erreichten. Die Psychopharmaka veränderten sein Aussehen, schwemmten ihn auf, sammelten ein weißliches Sekret um Mund- und Augenwinkel, beeinträchtigten seine Bewegungen. Er litt stumm und vorwurfsvoll, warf Max das Leben vor, das er später haben würde, er, nicht Ben, der Intelligentere, das Genie.
Eigentlich müsste ich dich hassen, sagte er, wenn du nicht mein kleiner Bruder wärst.
Mira und Max hielten ihren Schmerz voreinander geheim.
Eine Weile nahm einer von Bens ehemaligen Lehrern sich seiner an, holte ihn ein paarmal aus der Anstalt zu sich nach Mount Kisco, außerhalb der Stadt, wo es Pinienwälder gab und kleine flache Seen rund um das Hudson Valley. Dort bemalte Ben buchdeckelgroße Blätter aus weißer Pappe und war schließlich von seiner Berufung zum Künstler überzeugt. Auf Hunderten solcher Pappdeckel übte er sich in allen Techniken, mit Kohle, Aquarellfarben und Buntstiften. In seinen manischen Phasen lief er durch New York, drängte seine Pappdeckel Freunden und Bekannten auf, läutete an Wohnungstüren, erschreckte Unbekannte mit seinen ungebetenen Gaben, spürte ihre Angst und geriet in Panik, bat, flehte, ließ nicht locker, bevor er nicht ein paar signierte Zeichnungen losgeworden war. Zu Hause ließ er seiner Enttäuschung und seiner Panik freien Lauf. Am Ende war es Max, der hilflos und schuldbewusst nach dem Telefonhörer griff, weil er die erbarmungslose Selbstzerstörung seines geliebten Bruders nicht mehr ertrug.
An einem Novemberabend, nachdem sie Ben im Bellevue Hospital zurückgelassen hatten, saßen sie einander nach dem Essen am Küchentisch gegenüber. Mira gab vor, im Forward zu lesen, und Max füllte Sozialhilfeformulare für den Bruder aus. Als er aufblickte, schaute er direkt in ihre dunklen, bekümmerten Augen. Sie musste ihn schon eine Weile so angesehen haben, und obwohl sie schwieg, wusste er, was sie dachte, und spürte die Zärtlichkeit ihrer Trauer. So deutlich, als sei er in ihr Bewusstsein geschlüpft, sah er sich selber und seine Brüder als kleine Kinder auf der sommerlichen Wiese vor der Veranda in H., sah sich und Ben als Halbwüchsige an diesem Tisch, an dem sie einander nun allein gegenübersaßen. Ihre Augen glitten über seine Hände, bevor sie lächelte und ihren Blick auf die Zeitung senkte. Auch er schaute auf seine Hände, die auf den Formularen lagen wie auf etwas, dem er noch nie Beachtung geschenkt hatte: die langen, kräftigen Finger, den im Licht der Tischlampe rötlich schimmernden Flaum. Nur sie konnte sich erinnern, wie klein diese Hände einmal gewesen waren. Er lächelte zurück, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Nun hatte sie nur noch ihn, nun konnte nur noch er sie für alles, was sie gelitten hatte, entschädigen.
Im darauffolgenden Jahr trat Amerika in den Krieg ein. Mira und Saul unternahmen den zweiten Versuch, Sophie und Albert ein Affidavit und Schiffskarten nach New York zukommen zu lassen. Victor und Max wurden zum Militär eingezogen.
2
ALSMAXzum ersten Mal seit seiner Emigration wieder nach H. zurückkam, war er zweiundzwanzig und trug die Uniform eines Corporal der US-Armee. Im Herbst 1945 war H. eine von Bomben zerstörte Stadt wie viele andere, die er gesehen hatte. Die Kriegswunden, die Armut und der feindselige Trotz der Besiegten bedrückten ihn. In den Straßen gab es kaum zivile Autos, nur Militärfahrzeuge und abgemagerte Gestalten auf Fahrrädern und mit Handwagen. Er betrachtete ihre grauen müden Gesichter mit Neugier und auch mit Abneigung. Die Brücke war nicht dieselbe wie in seiner frühen Kindheit, aber wie damals war sie eine Grenze: diesmal die Zonengrenze zum russischen Sektor. Er wohnte in einem von der amerikanischen Militärregierung requirierten Hotel im Stadtzentrum. Das Haus daneben war zur Hälfte eingestürzt, man konnte die Muster der zerfetzten Tapete sehen. Das Straßenpflaster war aufgerissen. Aber selbst die unversehrt gebliebenen Häuser und Straßen strahlten dieselbe graue Müdigkeit aus wie die Gesichter der Passanten.
Es war ein diesiger Herbsttag, als er mit der Adresse seines Elternhauses in der Uniformtasche den Berg hinaufstieg. Die Häuserzeile unten am Hang, wo der Eingang zum Luftschutzstollen gewesen war, schien unbewohnt: vom Luftdruck geplatzte Fensterscheiben, die Dächer abgebrannt, nur die verkohlten Dachstühle hockten noch auf den Mauern. Die herabgefallenen Trümmer waren bereits von den Straßen fortgeräumt.
Oben auf dem Berg waren die Häuser unversehrt geblieben. Das Rascheln der braunen Herbstblätter auf dem Kopfsteinpflaster vertiefte die Stille des Villenviertels. Alles schien so friedlich und unberührt, als hätte es hier keinen Krieg gegeben.
Das Haus erkannte er sofort: die niedrige efeuüberwachsene Mauer, die die Straßenböschung stützte, die hohen Steinstufen, die Erker, die wuchtige Haustür. Die Bäume, die rund um das Haus wuchsen, waren vor seiner Geburt, als das Haus noch im Bau stand, gepflanzt worden. Jetzt waren sie in die Höhe gewachsen und legten eine melancholische Düsternis um das Haus, breiteten feuchte Schatten über die bemoosten Steinplatten, und ihre dicken Äste berührten und verfingen sich ineinander im Kampf ums Sonnenlicht. Die Blätter des Ahorns und die feinen Lärchennadeln glühten in ihren Herbstfarben.
Das Pflanzen der jungen Bäume damals musste eine hoffnungsvolle Zeremonie des jungen Paares gewesen sein. Es gab ein Foto: Mira und Saul, ein wenig älter als Max jetzt war, vielleicht Mitte Zwanzig, beide in sportlich heller Kleidung, halten einen dünnen Setzling über eine flache Grube, wie zur Demonstration, bevor sein Wurzelballen in die Grube versenkt und vergraben werden würde. Das Bäumchen besaß eine einzige Astgabelung und einen Stamm, dünner als Miras Handgelenk. Nun waren über zehn Meter hohe Bäume daraus geworden, und keiner der beiden hatte ihr Wachsen miterlebt. Nur Fremde freuten sich an ihren Herbstfarben.
Vor dem Haus standen ein alter Tretroller, ein Brett mit einer Lenkstange und zwei Gummirädern, rot angestrichen, und ein hellblauer Kinderwagen aus Holz mit den gleichen Rädern wie der Roller. Eine junge, füllige Frau bearbeitete mit einem Teppichklopfer einen Flickenteppich über einer Stange, die den Zugang zur Terrasse versperrte.
Ob sie hier wohne, fragte er und wusste, dass es eine ganz und gar überflüssige Frage war.
Sie schaute ihn feindselig an und schwieg. Er war in Uniform, ein amerikanischer Soldat, sein fehlerfreies Deutsch rief nicht die geringste Spur freundlichen Erstaunens hervor.
Im Frühjahr 1938 hatte Sophie an ihre Schwester in New York geschrieben: Albert ist verhaftet worden. Wenn wir wegmüssen, hinterlege ich einen Reserveschlüssel bei den Nachbarn.