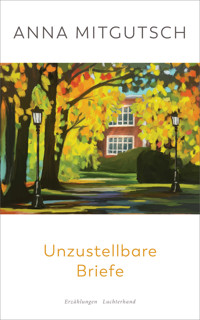7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die berührende Geschichte einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung.
Als er wegen eines Schwächeanfalls in ein Krankenhaus eingeliefert wird, spürt Theo, dass er am Ende seines Lebens angekommen ist: Er ist alt und fortan pflegebedürftig, was ihn eine Ohnmacht und Hilflosigkeit spüren lässt, die er bisher nicht kannte. Er zieht Bilanz, ist in Gedanken oft bei seiner früh verstorbenen ersten Frau, deren Sterben er erst jetzt richtig begreift, und er erinnert sich an nicht mehr gut zu machende Versäumnisse, während ihm die Gegenwart und die bisher glückliche Ehe mit Berta aus dem Gleichgewicht geraten. Aber auch dieses letzte Lebensjahr bringt noch einmal Glück und einen Neuanfang durch die junge ukrainische Pflegerin Ludmila, die sein Herz erreicht, wie weder Berta noch seine seit Jahrzehnten entfremdete Tochter Frieda es vermögen. Ludmila wird zu Theos letzter Liebe, sie wird ihm zur Tochter, wie Frieda es nie war.
Für Frieda ist Theos liebevoller Umgang mit Ludmila, die Nähe zwischen den beiden, unbegreiflich und schmerzlich. Und doch erfüllt sie seine Bitte und reist in die Ukraine, um Ludmila zu ihm zurückzubringen. Im Gegenzug darf sie zum ersten Mal Einblick in Theos Kriegstagebuch nehmen, von dem sie sich die endgültige Antwort darauf verspricht, ob ihr Vater, entgegen seinen lebenslangen Beteuerungen, sich als Wehrmachtsangehöriger schuldig gemacht hat. Die Reise wird zu einer Spurensuche in die Vergangenheit, zu einem Versuch der nie geglückten Auseinandersetzung zwischen der Kriegsgeneration und den Nachgeborenen. Anna Mitgutschs Figuren balancieren auf dem schmalen Grat zwischen Nähe und Ferne, Zuneigung und Ressentiment, Schuld und Schuldlosigkeit auf eine Lösung – vielleicht Erlösung – zu, die es niemals geben kann. Bis sie begreifen, dass das Glück ein Schwebezustand ist, der niemals enden muss, und ihr gespanntes Schweben ein Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Als Theo wegen eines Schwächeanfalls in ein Krankenhaus eingeliefert wird, spürt er, dass er an das Ende seines Lebens angekommen ist: Er ist alt und fortan pflegebedürftig, was ihn eine Ohnmacht und Hilflosigkeit spüren lässt, die er bisher nicht kannte. Er zieht Bilanz, ist in Gedanken oft bei seiner früh verstorbenen ersten Frau, deren Sterben er erst jetzt richtig begreift, und er erinnert sich an nicht mehr gut zu machende Versäumnisse, während ihm die Gegenwart und die bisher glückliche Ehe mit Berta, seiner zweiten Frau, aus dem Gleichgewicht geraten. Aber auch dieses letzte Lebensjahr bringt noch einmal Glück und einen Neuanfang: Die junge ukrainische Pflegerin Ludmila erreicht sein Herz, wie weder Berta noch seine seit Jahrzehnten entfremdete Tochter Frieda es vermögen. Ludmila wird zu Theos letzter Liebe, sie wird ihm zur Tochter, wie Frieda es nie war. Für Frieda ist Theos liebevoller Umgang mit Ludmila, die Nähe zwischen den beiden, unbegreiflich und schmerzlich. Und doch erfüllt sie seine Bitte und reist in die Ukraine, um Ludmila zu ihm zurückzubringen. Im Gegenzug darf sie zum ersten Mal Einblick in Theos Kriegstagebuch nehmen, von dem sie sich die endgültige Antwort darauf verspricht, ob ihr Vater, entgegen seinen lebenslangen Beteuerungen, sich als Wehrmachtsangehöriger schuldig gemacht hat. Die Reise wird zu einer Spurensuche in die Vergangenheit, zu einem Versuch der nie geglückten Auseinandersetzung zwischen der Kriegsgeneration und den Nachgeborenen.
Anna Mitgutschs Figuren balancieren auf dem schmalen Grat zwischen Nähe und Ferne, Zuneigung und Ressentiment, Schuld und Schuldlosigkeit auf eine Lösung – vielleicht Erlösung – zu, die es niemals geben kann. Bis sie begreifen, dass das Glück ein Schwebezustand ist, der niemals enden muss, und ihr gespanntes Schweben ein Glück.
Zur Autorin
Anna Mitgutsch, 1948 in Linz geboren, unterrichtete Germanistik und amerikanische Literatur an österreichischen und amerikanischen Universitäten. Für ihr literarisches Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Solothurner Literaturpreis, den Würdigungspreis (Staatspreis) für Literatur der Republik Österreich und das Ehrendoktorat der Universität Salzburg. Seit den siebziger Jahren übersetzt sie Lyrik und verfasste bisher neun Romane, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Bei Luchterhand erschienen die Romane »Ausgrenzung« (1989), »In fremden Städten« (1992), »Haus der Kindheit« (2000), »Familienfest« (2003), »Zwei Leben und ein Tag« (2007) und »Wenn du wiederkommst« (2010) sowie zuletzt der Essayband »Die Welt, die Rätsel bleibt« (2014).
Anna Mitgutsch
Die Annäherung
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
© 2016 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
© 2016 Anna Mitgutsch
Umschlaggestaltung: Buxdesign
Umschlagmotiv: Johner/Plainpicture
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-16005-0V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.de/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Inhalt
Winter
1
2
3
4
Frühling
1
2
3
Sommer
1
2
3
4
Herbst
1
2
3
4
5
6
Winter
Winter
1
Es war ihm, als höbe er vom Boden ab, so leichtfüßig glitt er über den weichen Rasen, er spürte das Gras noch kühl vom Tau unter seinen Füßen, die Morgensonne schien mit der funkelnden Frische mancher Frühsommertage damals, vor mehr als neunzig Jahren. Er war wieder zu Hause und lief über die Wiesen hinunter ins Dorf, nahm die Hügelwellen fast wie im Flug, die Hänge waren von einem leuchtenden Grün, und mit der Leichtigkeit kehrte ein Glück in seinen Körper zurück, wie es ihn seit seiner Kindheit nicht mehr erfüllt hatte.
Ein lautes Krachen schreckte ihn aus seinem schwerelosen Zustand auf, lang genug, um von der hereinbrechenden Katastrophe in bodenlose Schwärze gestürzt zu werden.
Als Theo zu sich kam, lag er auf dem Schlafzimmerboden und sein Flanellnachthemd entblößte die dünnen Beine, aus denen die Kniescheiben hervorragten. Die Deckenlampe erhellte den Raum und Berta stemmte sich gegen seinen Rücken, sie hatte ihn unter den Achseln gefasst und versuchte, ihn aufzurichten und von der Bettkante, gegen die er gestürzt war, wegzuziehen. Er spürte den reißenden Schmerz in seinem Hinterkopf, er erinnerte sich mit Bedauern an den grünen Wiesenhang und hätte sich auf dem weichen Gras gern noch ein wenig ausgeruht. Lass mich, wollte er sagen, ich komm schon allein hoch, aber zwischen Gedanken und Worten war eine Sperre und der Satz verhedderte sich im Mund zu einem dumpfen Lallen. Da erst packte ihn Entsetzen und sein Magen verkrampfte sich bei der jähen Gewissheit, die als fertiger Satz aus einer fernen Erinnerung aufstieg: Das ist der letzte Steilhang vor dem Ende. Nun würde alles diesen Hang hinunterrasen und es gab nichts mehr, das den Sturz aufhalten konnte. Wie das Kind, als das er sich eben noch gefühlt hatte, robbte er auf seinem linken Ellbogen zu seiner Bettseite zurück. Dort blieb er erschöpft liegen und dort hoben ihn die inzwischen eingetroffenen Sanitäter auf die Bahre und trugen ihn die Außentreppe hinunter zum Rettungswagen.
Zwei Wochen lang lag er in einem weißen Bett über den Dächern der Stadt. Draußen wirbelte der Schnee, es wurde hell, eine wässerige Wintersonne stand eine Weile am Himmel und verschwand, es dämmerte, es wurde wieder Nacht, er zählte die Tage nicht, sie gingen gleichförmig dahin. Er war nie allein, er döste in einem angenehmen Halbschlaf, zufrieden und schmerzlos, und sah den Schwestern zu, wie sie hin- und hergingen, Infusionsbeutel wechselten, Tee brachten, ihm halfen, den Löffel zum Mund zu führen, sich mit geschulten Händen an seinem Körper zu schaffen machten, junge, energische Frauen, sie taten es mit einem Lächeln, das keine Dankbarkeit forderte. Er war ein guter Patient, er war geduldig und beklagte sich nicht. Nur das Reden fiel ihm schwer, und so sehr er sich auch bemühte, sein Mund brachte nichts Verständliches hervor. Als Berta, seine Frau, ihn besuchen kam, starrte sie entsetzt auf sein asymmetrisch verzerrtes Gesicht, seine schlaffe rechte Wange, den feuchten, herabhängenden Mundwinkel.
Ich kann dich nicht verstehen, jammerte sie, als er sie begrüßte. In ihrem Blick lag hilflose Panik.
Aber du musst doch gar nichts verstehen! Das hätte er ihr gern gesagt, sie hatten nie Worte gebraucht, um einander zu verstehen, das war ja gerade das Wunderbare an ihrer Beziehung. Um Erklärungen ging es nicht, darum war es in ihrer Ehe nie gegangen. Die Hauptsache war, dass sie da saß, an seiner Seite, das war ihm tröstlich genug. Bleib einfach da, bei mir, versuchte er zu sagen, und sie beugte sich zu ihm, ganz nah an seinen Mund, um ihn so besser zu verstehen. Er tastete mit seiner rechten Hand, die ihm nicht recht gehorchen wollte, nach ihrer warmen festen Hand, er spürte sie durch die Bettdecke irgendwo in Reichweite auf seinem Oberschenkel. Den Zeigefinger der Linken legte er auf seinen Mund und versuchte ihr zuzuzwinkern, sie schenkte ihm ein verschmitztes Lächeln. Wir müssen nicht reden, hieß das. Diesmal verstand sie ihn. Ihre Gegenwart hüllte ihn mit einer beruhigenden Müdigkeit ein. Er hatte es immer als angenehm empfunden, dass sie keine Frau war, mit der man sich stundenlang über Dinge unterhalten musste, die über das Notwendige hinausgingen. Berta war einfältig in dem Sinn, dass sie nur interessierte, was für sie und den Menschen, den sie liebte, im Augenblick notwendig und nützlich war. Sie grübelte nicht, sie handelte, sie fand immer einen Ausweg, auf krummen oder geraden Wegen, und verlor nicht viele Worte darüber. So ist das Leben, pflegte sie zu sagen. Es mochte eine bodenständige Art von Egozentrik sein, aber er konnte nichts Schlechtes daran finden.
Seine erste Frau Wilma war komplizierter gewesen, intelligenter, belesener, mag sein, ständig mit Gedanken beschäftigt, aber nach einer Anzahl von Ehejahren kreisten auch sie stets um dieselben Themen, während Berta immer noch Eigenschaften entfalten konnte, die ihn erstaunten. Jetzt, im Spital, wo die Zeit langsam verging und er in den leeren Stunden seinen Erinnerungen nachhängen konnte, dachte er wieder öfter an Wilma. Er dachte daran, wie viel Zeit sie im Spital verbracht hatte und wie oft sie so dagelegen, wie verlassen sie sich gefühlt haben musste, als junge Frau, während für ihn, am Abend nach der Arbeit, die Besuche im Krankenhaus eine lästige Pflicht gewesen waren und er nicht die Ruhe gefunden hatte, auf ihre Klagen, ihre Bedürfnisse einzugehen. Zu diesem Zeitpunkt trennte sie schon eine zu große Kluft von Missverständnissen und Schweigen, als dass er sie noch hätte erreichen können, selbst wenn er die Kraft dafür aufgebracht hätte. Jetzt, fünfzig Jahre nach ihrem Tod, erschien sie ihm wie eine Fremde in einem fremden Land, die durch ihr kurzes Leben gegangen war und auf ihrer flüchtigen Durchreise keinen Anlass gesehen hatte, sesshaft zu werden.
In den frühen Jahren ihrer Ehe hatte Wilma ihn mit nächtelangen, seelenzerfasernden Gesprächen am Schlaf gehindert, und am Ende war immer er als der Schuldige hervorgegangen, der sie zu wenig liebte, jedenfalls nicht so, wie es ihr zustand. Erst nach ihrem Tod war ihm bewusst geworden, dass das, was die Ärzte damals ihre Gemütskrankheit nannten, ein langsames Ersticken an ihrem von Mangel eingegrenzten Leben gewesen war. Für ihre Träume von einem anderen Leben hatte er keine Geduld gehabt. In den ersten Jahren hatte sie noch versucht, ihm zu erklären, was ihr fehlte, sie sprach über ihre unrealistischen Pläne. Ein Studium wollte sie nachholen, immer noch träumte sie davon, Lehrerin zu werden, das Haus war ihr zu klein, reisen wollte sie, die Welt sehen, Konzerte, Theater, ein wenig Luxus, zu viele Wünsche an das Leben und keine Kraft, auch nur einen einzigen zu verwirklichen. Er hörte ihr zu, wie man den Phantastereien eines Kindes zuhört, er hatte nicht viel beizusteuern. Hie und da verrannte sie sich so sehr, dass er sie auf die Realität hinweisen musste, auf sein Monatsgehalt und die beschränkten Mittel, und dass man sich die Theaterstücke auch in der Stadtbücherei ausborgen und zu Hause lesen konnte. Er kaufte ihr ein Klavier, weil sie in ihrem Elternhaus eines gehabt hatte, einen Plattenspieler für ihre Schellacksammlung, aber alles, was er für sie tat, tröstete sie nur eine Weile, es war nie genug, nichts machte sie glücklich.
Später richteten sie sich in einem Schweigen ein, wo sie einander nicht mehr erreichen konnten, das selbst einem wortkargen Mann wie ihm unheimlich war, weil das Unheil sich spürbar in ihm verdichtete. Am Ende waren sie zwei zutiefst unglückliche Menschen gewesen, die glaubten, dass das Wenige, was sie hatten, schon alles gewesen sei, was das Leben ihnen jemals zuteilen würde. Wilma ging daran zugrunde. Sie sah keinen Ausweg aus ihrem Leben und litt mit einer Hingabe an ihrem eigenen Unglück, dass er es in seiner Hilflosigkeit kaum ertragen konnte. Es vergiftete jede noch so kurze Freude. Am Schluss war ihr Leben nur noch ein Warten darauf gewesen, dass endlich alles vorbei sei, die unerträglichen Kopfschmerzen, die Müdigkeit, ihr tagelanges Weinen, ihr barsches Lass-mich-allein, ich will in Ruhe gelassen werden, nur um dann laut nach ihm zu rufen und ihm Vorwürfe zu machen, er schliefe friedlich, er lese stillvergnügt, während sie unglücklich sei. Glück war zu einer fernen Erinnerung geworden, etwas, das er sich nicht mehr vorstellen konnte.
Als sie tot war, wurde ihm klar, dass er auf ihren Tod gewartet, ihn manchmal herbeigesehnt hatte, aber er hatte es nie gewagt, es sich einzugestehen. Danach träumte er wiederholt, sie käme nach Hause, nicht als verweinte, nörgelnde Kranke mit dem ewigen Tuch über der Stirn, um die Kopfschmerzen zu lindern, sondern wie sie als Siebzehnjährige gewesen war, mit der kühlen, selbstsicheren Ausstrahlung, die ihn fasziniert und eingeschüchtert hatte, ihrem üppigen kastanienbraunen Haar und dem scheuen und zugleich herausfordernden Lächeln. Ihr Haar, ihre bernsteinfarbenen Augen, ihr schlanker Körper mit den schmalen Hüften, er hatte vergessen, wie schön sie einmal gewesen war. Nach ihrem Tod träumte er öfter von ihr und wachte mit einem Gefühl der Dankbarkeit auf. So musste es gewesen sein, ganz am Anfang, als sie sich durch einen unwahrscheinlichen Zufall kennenlernten, denn sie gehörten verschiedenen Welten an, und ihre Wege hätten sich unter normalen Umständen nie gekreuzt. Die Prinzessin und der Holzfäller heiraten. Als er den sarkastischen Satz in einer Reihe hinter sich flüstern hörte, während ihr Aufgebot in der Kirche verlesen wurde, hatte es ihn nicht gekränkt, es hatte ihn mit Genugtuung erfüllt. Es gab etwas, worum man ihn beneidete. Meine Frau, hatte er triumphierend gedacht. Er hatte keine Gelegenheit ausgelassen, es laut zu wiederholen: meine Frau Wilma, die Enkelin des Bürgermeisters. Er hatte vor allem ihre Kühnheit bewundert, mit der sie sich über Regeln und Konventionen hinwegsetzte, doch selbst als von der trotzigen Auflehnung, mit der sie ihre Familie durch die nicht standesgemäße Heirat brüskiert hatte, nur noch resignierte Unzufriedenheit übrig war, hatte er Fremden gegenüber von ihr gesprochen, als zeichne die Ehe mit ihr ihn aus. Im Grunde aber hatte er nie gewusst, ob sie ihn liebte oder ob sie ihn genommen hatte, weil nur mehr wenige junge Männer aus dem Krieg zurückgekommen waren und sie nicht als alte Jungfer mit nicht ganz einwandfreiem Ruf übrig bleiben wollte. Er hatte um sie geworben und sie hatte seine unbeholfene Liebe erwidert, aber die unschuldige Glückseligkeit, die er ganz am Anfang, als sie bloß Freunde waren, in ihrer Nähe empfunden hatte, war in den sechs Kriegsjahren mit so vielem anderen, das unberührt gewesen war, untergegangen. Vielleicht waren es auch die Jahre des Wartens gewesen, die die großen Gefühle aufgezehrt hatten.
Erst seit er mit Berta zusammenlebte, konnte er es sich eingestehen, dass er seine schwersten Jahre mit Wilma geteilt hatte, weil er vor dem Altar gelobt hatte, alles mit ihr zu teilen, in guten und in schlechten Zeiten. Er hatte diesen Schwur ernst genommen und wenn Beständigkeit im Unglück Liebe war, dann hatte er sie wohl bis zum Schluss geliebt. Berta war anders, sie war aus einem Stück und vorbehaltlos dem Leben zugewandt wie manche Pflanzen, die mit ihren Blütenkelchen dem Stand der Sonne folgen, und allmählich hatte Berta seine erste Frau so vollständig aus seinem Gedächtnis verdrängt, dass sie zu einer vagen Erinnerung an freudlose Jahre verblasste.
Er hatte Berta im ersten Winter nach Wilmas Tod kennengelernt, es war das erste Faschingsfest seines Lebens im großen Verkaufsraum der Gärtnerei. Er kam früh, um beim Dekorieren mitzuhelfen, befestigte Lampions an elektrischen Kabeln und stand gerade auf der Leiter, als sie hereinkam, oder vielmehr ein Fuchsweibchen mit einer grünen Halbmaske, in einem engen Trikot mit einem buschigen Fuchsschwanz am Gürtel von der Farbe ihres Haars. Sie war Hilfskraft in einer Filiale. Theo arbeitete in der Gärtnerei und hatte sie noch nie zuvor gesehen. Am Fuß der Leiter blieb sie stehen, nahm ihre Maske ab und rief lachend zu ihm hinauf: Soll ich Sie festhalten? Wie lange sie sich angesehen hatten, hätte er nicht sagen können. Wenn er sich an diesen Augenblick erinnerte, kam es ihm vor, als sei ein Stromschlag durch seinen Körper gefahren, und ein Schwindelgefühl habe ihn ergriffen, sodass er sich tatsächlich mit beiden Händen an der Leiter festhalten musste.
Sehen Sie!, rief sie und er lachte verschämt in ihr zu ihm erhobenes Gesicht. Als er zu ihr hinunterstieg und sich vorstellte, tat er es bereits mit der irrationalen Gewissheit, dass das, was jetzt folgen musste, sein bisheriges Leben außer Kraft setzen würde. Wenn er in Romanen von dem unerklärlichen Magnetismus gelesen hatte, der zwei Menschen zueinander hinzog, gegen jede Vernunft und gegen ihren eigenen Willen, hatte er es für eine romantische Übertreibung gehalten. Er hatte später keine Erinnerung, was an diesem Abend sonst noch geschehen war, er hatte nur Augen für diese Frau gehabt, ihre geschmeidigen Bewegungen, wenn sie mit anderen Männern tanzte, denn er hatte nie tanzen gelernt und war zu gehemmt es zu versuchen, und wie sie trotzdem immer wieder zu ihm zurückkam, ihre runde, fast kindliche Kehle, wenn sie beim Trinken den Kopf leicht zurückbog, wie sich die Muskeln ihrer Schenkel unter dem engen Jersey-Rock abzeichneten, wenn sie die Beine kreuzte. Die Unverfrorenheit, mit der sie ihm Fragen stellte überrumpelte ihn, so dass er fast gegen seinen Willen, jedenfalls gegen seine Gewohnheit, die Geschichte seines Lebens vor ihr ausbreitete. Noch nie hatte er so viel an einem Stück geredet, er kannte sich selber nicht mehr, wie er sich ihr auslieferte, und es erstaunte ihn, dass ihn das Erzählen erleichterte. Er erzählte von Wilma und wie sie gestorben war, von seiner Tochter und seiner Unsicherheit, wie ein alleinerziehender Vater ein pubertierendes Mädchen erziehen solle, und gleichzeitig war das alles in dieser Nacht so weit entfernt wie die Geschichte eines anderen, es berührte ihn kaum. Am Ende des Fests begleitete er sie nach Hause und sie erlaubte ihm, sie an ihrer Wohnungstür auf die Wange zu küssen.
In den frühen Morgenstunden in seinem Schlafzimmer, beim Anblick der leeren Betthälfte und Wilmas Foto auf der Kommode, in der seit elf Monaten unberührt ihre Wäsche lag, forderte das gewohnte Leben wieder Nüchternheit und kühlte seine Erregung. Er musste um halb sieben Uhr aufstehen, um Frieda zu wecken und das Frühstück herzurichten, dann fuhr er zur Arbeit. Aber die Gewissheit, dass etwas Unumkehrbares mit ihm geschehen sei, hielt an. Ein neues Leben, dachte er, Worte, so leicht hingesagt, aber sie erfüllten ihn mit einer wilden Freude.
Als Theo immer öfter die Abende und Nächte von zu Hause fort war und Frieda einmal nach der Schule in die Küche kam, während Berta gerade das Mittagessen zubereitete, konnte er sein neues Leben nicht länger vor seiner Tochter geheimhalten.
Frieda!, sagte er feierlich. Das ist Berta und sie wird von nun an in unserem Leben einen wichtigen Platz einnehmen.
Er fühlte sich auf sicherem Boden, wenn er Sätze wiederholte, die er in einem Roman gelesen oder in einem Film gehört hatte. Wenn sie zur Situation passten, konnte er in sie hineinschlüpfen und dabei etwas von seiner Verantwortung abgeben.
Frieda ließ nicht erkennen, ob sie ihn gehört hatte. Beleidigend nah fegte sie mit ihrer Schultasche an Berta vorbei und schlug krachend die Tür ihres Zimmers zu.
Als Berta gegangen war, klopfte er vorsichtig an Friedas Tür und sagte: Sie ist jetzt weg, machst du bitte auf?
Und mit einem um Verzeihung heischenden Blick: Ich weiß, das kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber ich hab mich halt verliebt.
Und das so kurz nach Mutters Tod, sagte sie und schlug die Tür wieder zu.
Berta und Wilma waren in ihrem Wesen und ihrem Äußeren so verschieden, dass Theo nicht auf die Idee kam, die beiden zu vergleichen. Berta war mehr als zehn Jahre jünger als Wilma. Sie verließ sich auf ihre Weiblichkeit und ihre Intuition. Die gelassene Selbstgewissheit, mit der sie in ihrem Körper ruhte, war neu für ihn und gab ihm das Gefühl einer großen Sicherheit. Berta war schon früh auf sich allein gestellt gewesen und sie hatte eine klare, realistische Vorstellung davon, was sie vom Leben erwartete. Sie war nicht ehrgeizig, aber wenn sie ein Ziel ansteuerte, konnte sie hartnäckig und bis zur Skrupellosigkeit durchtrieben sein. Sie ging an die vierzig, hatte einige Beziehungen hinter sich, die ein illusionsloses Misstrauen Männern gegenüber zurückgelassen hatten, sie wollte endlich eine eigene Familie, einen Mann, finanzielle Sicherheit. Und sie war entschlossen, diesen schüchternen, ernsthaften Witwer, den sie schon am ersten Abend als verlässlich, treu, häuslich und formbar eingeschätzt hatte, zu heiraten. Daran würde nichts sie hindern, auch nicht die Anhänglichkeit an seine erste Frau und seine besitzergreifende Tochter. Sie hielt den unschätzbaren Trumpf in der Hand, dass er ihr bedingungslos ergeben war und alles tun würde, um sie nicht zu verlieren.
Berta war damals nicht nur in Theos verliebten Augen eine auffallende Erscheinung. Sie hatte den trägen, üppigen Körper einer reifen Frau, die sich ihrer Wirkung bewusst ist. Keine zehn Jahre später war sie dick geworden, und ihr Körper wurde gedrungen, die Taille verschwand als Erstes, am längsten blieben ihre Beine mit den schmalen Fesseln jung. Aber Theo sagte ihr, sooft sie es hören wollte: Ich liebe jedes Kilo auf deinen Hüften.
Erst nach und nach hatte er zu ahnen begonnen, dass Berta, ohne ein Wort darüber zu verlieren, sein Leben fest im Griff hatte und ihn dahin brachte, wo sie ihn haben wollte. Und wenn schon, hatte er jedesmal gedacht, wenn sie ihn mit einem schelmischen Grinsen vor vollendete Tatsachen stellte, seine Vorsätze zunichtemachte und seine Pläne durchkreuzte. Nach Wilmas Tod hatte er sich vorgenommen, von nun an unbeschwert zu leben, und wenn er wieder heiraten würde, dann sollte es eine Frau sein, mit der er das versäumte Leben nachholen konnte. Im Augenblick leben, als gebe es kein morgen, denn er hatte schon mehr als ein halbes Leben versäumt. Er war Mitte fünfzig und fürchtete, es könnte bald zu spät sein. Hätte ihm damals jemand prophezeit, dass das neue Leben mehr als doppelt so lange dauern würde wie seine erste Ehe, er hätte es sich nicht vorstellen können.
Theo hatte keine intellektuellen Ambitionen, aber er las viel und hatte bis ins hohe Alter ein gutes Gedächtnis. Er las unsystematisch wie jeder Autodidakt, und die vielen Sachbücher, Romane, Biographien und zusammengetragenen Informationen hatten sich in seinem Kopf nie zu einem System geordnet. In seiner Jugend hatte er von einem Studium geträumt, und auch als die Armut und später der Krieg seine Hoffnungen zerschlagen hatten, gab er nicht auf, bildete sich auf seine Art weiter, las alles, was ihm in die Hände fiel und verblüffte manchen Gesprächspartner, der ihn für einen ungebildeten Tölpel hielt, mit der Behauptung, Dostojewski sei sein Lieblingsschriftsteller. Was am Anfang, als sie sich kennenlernten, seine Bewunderung für Berta bis zur Ehrfurcht gesteigert hatte war ihre Bibliothek. Erst allmählich, als er sich ein Buch nach dem anderen ausborgte und sich mit ihr darüber unterhalten wollte, stellte sich heraus, dass sie die Bücher, die sie besaß, nicht kannte.
Als Berta dabei gewesen war, ihre erste Wohnung einzurichten, hatte zufällig der Vertreter eines Buchclubs an ihrer Tür geläutet und sie davon überzeugt, dass zu einer schönen Wohnung ein Bücherschrank gehörte. Sie hatte ihm ein Abonnement für unbegrenzte Zeit abgekauft und anfangs die schönen neuen Bücher voll Freude in den Schrank gestellt, hinter Glas, damit die glänzenden Einbände nicht verstaubten. Eine richtige Sammelleidenschaft hatte sie eine Zeit lang bei dem Anblick erfüllt, wie sich Buchrücken an Buchrücken reihte. Anfangs versuchte sie, die Bücher, die sie sich nicht selber hatte aussuchen können, so wie sie kamen zu lesen, zwang sich, selbst wenn sie ihr nicht gefielen, wenigstens bis zur Hälfte durchzuhalten, schließlich hatte sie dafür bezahlt. Aber die meisten Bücher langweilten sie, sie hatten nichts mit ihr und ihrem Leben zu tun, und sie fragte sich, was außer einer Art Pflichtgefühl sie dazu zwingen sollte, ihre Zeit damit zu vergeuden. Manche Bücher waren bebildert und zeigten Landschaften und Städte, die in ihr eine Sehnsucht nach einem anderen Leben weckten, die sah sie sich immer wieder an, wenn sie sich einsam fühlte. Aber dann hörte die Bücherflut nicht mehr auf, alle paar Monate kamen neue Bücher, und sie musste sie in doppelten Reihen aufstellen und übereinanderstapeln. Schließlich schaffte sie es, das Abonnement loszuwerden, aber die Bücher verstellten weiterhin den Platz, den sie nun für andere Dinge wie ein vollständiges Service hätte brauchen können. Jeder Besucher werde ihre Bildung bewundern, hatte der Vertreter gesagt, aber der Erste, den sie mit ihren Büchern beeindrucken konnte, war der Witwer gewesen, der ihr Ehemann wurde. Das Buch stammt aus der Bibliothek meiner Frau, sagte er am Anfang ihrer Ehe manchmal zu Bekannten und verschwieg, was er inzwischen wusste, dass sie kaum eines davon gelesen hatte.
Trotzdem hatte er sich nie Bertas bodenständiger Beschränktheit überlegen gefühlt. Am Lesen Freude zu haben war nichts, worauf er stolz war. Genau genommen war es Müßiggang, ein Laster, dem man leicht verfallen konnte. Man musste aufpassen, dass man darüber nicht die Arbeit vernachlässigte. Er wusste, er konnte von Berta nicht verlangen, dass sie las, weder Zeitungen noch Bücher. Was in der Zeitung stand, erzählte er ihr. Für die wenigen Bücher, die er kaufte und ihrer Sammlung hinzufügte, zeigte sie nicht einmal höfliches Interesse. Die meisten Bücher borgte er sich in der Stadtbibliothek aus und manchmal schenkte ihm jemand ein Buch, das er loswerden wollte, weil Theo dafür bekannt war, dass er alles las, was ihm in die Hände fiel. Den nötigen Schriftverkehr erledigte er für sie, als er merkte, dass sie keine fehlerfreie Postkarte schreiben konnte und die ungelenke Handschrift einer Volksschülerin hatte. Es war etwas Liebenswertes an ihrer naiven, mit einem Schuss Vulgarität gewürzten Einfalt. Sie war siebzehn Jahre jünger als er, und mit ihren unbändigen rotblonden Haaren, ihrer arglosen Freundlichkeit und dem hübschen weichen Gesicht, in dem alles rund war, die lebenslustig funkelnden, grün gesprenkelten Augen, das Kinn, die Grübchen in den Wangen, war sie die personifizierte Glücksverheißung gewesen.
Theo betrachtete sie, wie sie jetzt an seinem Bett saß, immer noch siebzehn Jahre jünger, aber es schien, als sei der Altersabstand im Lauf der Jahre geschrumpft. Er hatte sich noch mit achtzig gut gekleidet, auf Qualität legte er großen Wert. Schlank mit grau meliertem, gepflegtem Haar und einem vom Frühjahr bis in den Winter gebräunten faltenlosen Gesicht war er für keine siebzig gehalten worden, während sie schon mit sechzig eine übergewichtige, ein wenig schlampig wirkende Frau mit hängenden Bäckchen und Doppelkinn gewesen war, mit Haaren, die vom vielen Färben wie Stroh abstanden. Jetzt, an seinem Krankenbett, drohte ihr faltiges und vom Weinen gedunsenes Gesicht vor Verzagtheit und zurückgehaltenen Tränen zu zerfließen. Schutzbedürftig saß sie da und fragte: Hast du alles, isst du genug, musst du aufs Klo?, weil ihr sonst nichts einfiel und sie die eigentliche, die einzige Frage nicht stellen konnte: Wirst du sterben und was soll dann aus mir werden? Vor so viel Hilflosigkeit und Verantwortung nahm er die Mühen, die man ihm abverlangte, wieder auf sich, versuchte aufzustehen, sich den Forderungen des Physiotherapeuten unterzuordnen, wieder gesund zu werden.
Der Physiotherapeut kam zweimal am Tag und führte Theo den ganzen endlos scheinenden Spitalsgang auf und ab, und Theo setzte gehorsam und vorsichtig den rechten Fuß, den er fast nicht spürte und der ihm nicht gehorchen wollte, vor den linken, mit einer Konzentration, die ihm den Schweiß aus den Poren trieb, und er gab erst auf, wenn er vor Anstrengung zu zittern begann. Der junge Mann kommentierte jeden Schritt, feuerte ihn an, lobte seine Willenskraft, und Theo wurde wieder zum Musterschüler, der das Lob wie Gutpunkte des Lehrers einheimste, als ginge es darum, in kürzester Zeit mit einer Bestnote abzuschneiden. An der Seite des Therapeuten stakste er jeden Tag zweimal durch die Gänge, vormittags und nachmittags. Schon nach ein paar Tagen gelang es ihm ohne Hilfe aufzustehen und mit seiner Gehhilfe allein zum Bad zu gehen. Er hielt viel auf Sauberkeit und darauf angesprochen sagte er, je älter man werde, desto wichtiger werde es, auf sein Äußeres zu achten. Auch jetzt, im Spital, versuchte er, wie er es gewohnt war, sich mit Rasierpinsel und Klinge zu rasieren, was ihm nicht gelang, und zwängte sich anschließend mitsamt seiner Gehhilfe in die Duschkabine, aus der er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Ich bin unverwüstlich, versuchte er zur Stationsschwester zu sagen, als sie ihn zu zweit lachend und ihn scherzhaft für seine Selbstständigkeitsversuche tadelnd aus seiner Zwangslage befreiten, aber ein Wort wie unverwüstlich ging ebenso sehr über seine Kräfte wie die Rasierklinge am Kinn entlangzuführen. Deshalb sparte er sich den nächsten Satz, der ihm auf der schwerfälligen Zunge lag: Ich habe immer gewusst, dass ich hundert werde.
An einem Nachmittag steckte Frieda, seine Tochter, vorsichtig ihren Kopf zur Tür herein, als müsse sie erst das Terrain erkunden. Sie kam unerwartet, er fragte sich, woher sie wusste, dass er im Spital war. Theo erinnerte sich nicht mehr genau, wann er sie das letzte Mal gesehen hatte. Frieda hatte Hausverbot, schon seit vielen Jahren, Berta hatte es so gewollt. Von Zeit zu Zeit hatte er seine Frau überreden können, es zu lockern, aber Frieda war aufsässig oder unvorsichtig, und es hatte bald wieder Wortwechsel gegeben, Sätze, die Berta missfielen.
Sie tut doch, was ihr passt, dachte er, immer die Ordnung auf den Kopf stellen. Jetzt kam sie außerhalb der Besuchszeit. Er mochte keine Überraschungen, aber er ließ sich nichts anmerken.
Wir haben es besser ohne sie, hatte Berta gesagt, wenn Theo einwandte, Frieda gehöre doch auch zur Familie. Er hatte immer versucht, Bertas Unnachgiebigkeit abzumildern. Früher hatte er Frieda oft angerufen, wenn Berta zu ihrer Familie auf Besuch gefahren war: Wenn du möchtest, könntest du auf eine Stunde kommen, sie ist gerade weggegangen. Sie vermieden es beide, den Namen seiner Frau auszusprechen. Er schämte sich seiner Schwäche, aber er wusste keinen Ausweg. Er hätte Berta verloren, und das wäre ihm erschienen, als verlöre er sein Leben. Dieses Opfer konnte er selbst seiner Tochter zuliebe nicht bringen. Er wäre allein geblieben und hätte nichts mehr besessen, wofür es sich zu leben lohnte. Bertas Forderung, nicht einmal heimlich, hinter ihrem Rücken, sein Kind zu sehen, hatte er nach einigen Jahren gehorsamer Unterwerfung so gut es ihm gelang, missachtet.
Frieda war von Anfang an aufsässig gewesen. Das Weibchen hatte sie Berta genannt. Woher nahm eine Dreizehnjährige einen solchen Ausdruck? Sprich nicht so über meine Frau!, hatte er sie zurechtgewiesen. Sie hatte ihn überrascht angestarrt, diesen Ton kannte sie nicht an ihm.
Später hatte er gequält geschwiegen, wenn Berta Friedas verzweifelte Anrufe an seiner statt beantwortet hatte: Dein Vater will nicht mehr mit dir reden. Du bist nicht mehr seine Tochter. Schließlich hatte sie den Hörer wortlos aufgelegt, wenn Frieda gefordert hatte: Ich will mit meinem Vater sprechen. Nie hatte er seiner Frau den Hörer aus der Hand genommen und gesagt, hier bin ich. Nie hatte er aufbegehrt, er hatte nicht gewagt, sich Berta entgegenzustellen, weiß Gott, was passiert wäre, sie war eine temperamentvolle Frau. Aber er hatte gelitten. Warum machten die beiden Frauen ihm das Leben schwer? Warum vertrugen sie sich nicht? Heimlich, wenn er allein im Haus war, hatte er seine Tochter dann von Zeit zu Zeit angerufen. Aber Berta hatte einen sechsten Sinn für seinen Ungehorsam. Hast du sie wieder angerufen?, hatte sie gleich beim Hereinkommen gefragt. Nein, wie kommst du darauf, hatte er gelogen, aber er hatte sie dabei nicht ansehen können. Seither waren mehr als vierzig Jahre vergangen, es hatte Versöhnungen und neue Zerwürfnisse gegeben, Zeiten eines fast freundschaftlichen Waffenstillstands, in denen sie in vorsichtiger Eintracht bei Tisch saßen und Feste feierten, und Theo war von ihnen dreien der glücklichste gewesen. Aber das, wonach er sich sehnte, ein Familienleben, hatte es nie gegeben. Der geringste Anlass reichte für ein neues Zerwürfnis aus, eine ironische Bemerkung, Friedas versteckter Vorwurf, um das Erbe ihrer Mutter geprellt worden zu sein, eine Anspielung, dass sie wieder einmal in Geldnot war. Und manchmal brach der alte Hass bereits auf einen ärgerlichen Blick hin so unvermittelt hervor, dass sie erschrocken auseinandergingen.
In letzter Zeit war Berta träge geworden. Sie verließ das Haus seltener und nur für kurze Zeit um einzukaufen, und so rief Theo seine Tochter nur noch gelegentlich an, um den Kontakt nicht abbrechen zu lassen und weil er wusste, sie würde niemals seine Nummer wählen, wenn sie nicht sicher sein konnte, dass er es war, der abhob. Einmal, vor einigen Jahren, waren er und Berta der Tochter in der Stadt begegnet. Er hatte einen Schritt auf sie zu gemacht, ganz unwillkürlich, aber Berta hatte ihn am Arm zurückgehalten. Er hatte gewusst, er würde dafür büßen, wenn er eine Begrüßung erzwang, und es würde einzig im Ermessen Bertas liegen, wie lange sie ihn büßen ließ. Also war er grußlos an Frieda vorbeigegangen, hatte einen Augenblick lang in ihr fassungsloses Gesicht geschaut, bevor er die Augen niederschlug. Den ganzen Tag hatte er vor Kummer an nichts anderes denken können.
Frieda war keine junge Frau mehr, sie hatte ihren Teil an Schicksalsschlägen abbekommen, eine unüberlegte Ehe und den erbitterten Kampf um Kinder und Unterhalt bei der Scheidung. Dann Fabians Radunfall in Schottland mit fünfunddreißig Jahren. An seinem Grab war Theo seiner Tochter für Augenblicke näher gewesen als jemals zuvor oder danach. Der Schmerz um den Verlust des Enkels war ein starkes Gefühl, das eine neue Bindung hätte herstellen können, aber jeder hatte sich eifersüchtig in seine eigene Trauer zurückgezogen. Friedas Tochter, Melissa, stand ihrem Vater und dessen zweiter Frau näher als ihrer Mutter. Auch das war eine Kränkung, über die Frieda nie gesprochen hatte. In ihrem Portemonnaie trug sie ein Foto, auf dem die zwanzigjährige Melissa in Shorts und T-Shirt an einem Strand in die Kamera lacht, ein unauffälliges, unbeschwertes Mädchen, dessen rechte Schulter von einer Hand umfangen ist, aber das Foto war in der Mitte entzweigeschnitten und der Besitzer der Hand unsichtbar. Ein Foto jüngeren Datums habe ich nicht, hatte sie mit einem ironischen Lächeln gesagt. Inzwischen musste Melissa Mitte dreißig sein. Hinter dem Foto verbarg sich eine Geschichte, über deren Einzelheiten Theo wenig wusste, sie auch nicht erfahren wollte.
Friedas Leben war nicht so geradlinig verlaufen, wie ihre Erfolge in der Schule es versprochen hatten. Er hatte ihre schulischen Leistungen mit dem Stolz des Vaters verfolgt, dem alles verwehrt geblieben war, wozu sie leichten Zugang hatte, die höhere Schule, Gesangunterricht, Klavierunterricht, Tanzstunden. Das Universitätsstudium blieb seiner Vorstellung so weit entrückt, dass er sie von da an mit Scheu betrachtete, mit dem Respekt des Ungebildeten, der sich seiner mangelnden Bildung schmerzlich bewusst ist, und sie kehrte ihre Überlegenheit hervor, wenn es darum ging, Berta herabzusetzen. Dann erfüllte ihn Friedas überheblich ausgespieltes Wissen mit Verdruss. Schon als Kind war sie ihm manchmal ein wenig fremd gewesen mit ihrem Eigensinn, wenn sie ihn mit ihren hellgrauen schrägen Augen fixierte, seinen Blick festhielt und ihn zwang nachzugeben. Als Mädchen war sie unter Gleichaltrigen aufgefallen, größer als die anderen, pummelig, ernst, fast abweisend und immer ein wenig abseits. Während sich bei ihren Mitschülerinnen in Verhalten und Figur ihre beginnende Weiblichkeit bemerkbar machte, erschien sie wie ein altkluges, ungelenkes Kind. Sie war schnell gewachsen und ihre Bewegungen waren ungeschickt und gehemmt, alles an ihr war eckig, unrund, wie Berta sagte. In der Schule hatte es immer wieder Konflikte mit Lehrern und Mitschülern gegeben und Theo war zum Direktor gerufen worden. Aber ihre direkte, kompromisslose Art hatte auch Sympathien gefunden. Sie sucht immer nach der Gerechtigkeit und findet sie nicht, hatte einmal eine Lehrerin beim Abschied zu ihm gesagt. Sie hatte sich für Frieda eingesetzt und ihre besorgte Zuneigung zu seinem Kind war so unerwartet gekommen, dass er seiner Stimme nicht traute und ihr nur gerührt und stumm die Hand drücken konnte.
Du wirst es einmal schwer haben, hatte er Frieda prophezeit, aber er hatte insgeheim gehofft, dass die geradlinige Sturheit ihr helfen würde, ihre Ziele zu erreichen. Gescheit ist sie ja, hatte Berta widerwillig zugegeben, das ist das einzig Positive, das man über sie sagen kann. Aber für das Leben hatte es nicht ausgereicht. Aus einer begonnenen Universitätslaufbahn waren einige befristete, schlecht bezahlte akademische Jobs geworden und schließlich war sie Lehrerin geworden und hatte bis zur Pensionierung in einer Mittelschule auf dem Land Geschichte unterrichtet. Soviel er wusste, lebte sie seit vielen Jahren allein. Männer habe sie längst weit hinter sich gelassen, Beziehungen würden überbewertet, behauptete sie. In ihren alten Trotz hatte sich viel Bitterkeit gemischt. Wenn Theo von Bekannten erzählte, von deren Kindern und Enkelkindern, ihren Erfolgen und Problemen, fiel sie ihm ins Wort, fremder Leute Geschichten interessierten sie nicht. Früher, als Jugendliche, hatte sie ihn erschreckt, wenn sie sagte, ich habe alles so satt, am liebsten wäre ich tot. Du wirst dir doch um Himmels willen nichts antun, hatte er besorgt gesagt. Aber seit sie erwachsen war, hatten sie keine Gespräche über Gefühle mehr geführt, so nahe waren sie sich nicht mehr gekommen. Im Grunde wusste Theo nicht, wie sie lebte, ob sie glücklich war, womit sie ihre Tage füllte. Er fragte nie nach Dingen, die sie nicht freiwillig erzählte.
Sie hat auch kein leichtes Leben, verteidigte er sie, wenn Berta schlecht über sie sprach.
Sie hat sich ihr Leben selber ausgesucht, warum sollte man sie bedauern? Sie hat alles gehabt, einen Mann, ein Haus, wunderbare Kinder, und was hat sie daraus gemacht? Den Mann hat sie nicht halten können. Nicht einmal die Tochter hat es bei ihr ausgehalten.
Sie ist doch nicht an allem schuld, hatte Theo vorsichtig eingewandt.
Wie man sich bettet, so liegt man. Berta hatte für jede Situation ein Sprichwort.
Seit ihrer Pensionierung lebte Frieda wieder in der Stadt. Sie fühle sich in der kleinen Bezirksstadt wie im Exil, hatte sie oft gesagt, und nach Fabians Tod war ihr das Unterrichten dort schwergefallen. In letzter Zeit war sie sichtbar gealtert, so als habe etwas in ihr nachgegeben, als verlöre sie von innen her an Dichte. Von einem Gegenstand, der von seiner Spannkraft lebte, hätte er gesagt, eine Feder sei gesprungen. Von Dingen verstand er mehr als von Gefühlen. Sie tat ihm leid, weniger weil sie sein Kind war, dessen Kummer ihn bedrückte, sondern eher wie eine Fremde, deren Elend er sah und wusste, er konnte ihr nicht helfen. Er fragte sich manchmal, ob Wilma wie ihre Tochter ausgesehen hätte, wenn sie alt geworden wäre. Aber Frieda hatte nie Wilmas Anmut besessen. Es war ihm aufgefallen, dass ihr Gesicht im Lauf der Zeit immer mehr die ergebene Gelassenheit annahm, die ihn an seine eigene Mutter erinnerte, die weichen Linien um Kinn und Mund, die Fältchen in den Augenwinkeln, das alles gab ihr etwas von der Resignation einer Frau, die aufgehört hat, sich selbst im Zentrum ihrer Welt zu wähnen. Vielleicht war sie auch nachsichtiger geworden.
Als Jugendliche war Frieda in ihrer Wahrheitssuche gnadenlos gewesen. Die Kompromisslosigkeit, mit der sie die Ideologien ihrer Generation vertreten hatte, stand Theo noch deutlich in Erinnerung. Die reinigende Härte der Revolte. Trau keinem über dreißig. Die Phantasie an die Macht und das Gerede vom Alltagsfaschismus. Vermutlich hatte sie unter ihren Altersgenossen viele Gleichgesinnte gefunden, aufgebracht wie sie waren in ihrem Eifer, alles Alte abzuschaffen und eine neue Weltordnung zu erzwingen. Die Jugend rebellierte und die Generation, die sie erzogen hatte, stand unter Generalverdacht. Mitunter hätte Theo sogar eine heimliche Genugtuung über ihre Rebellion verspürt, wenn sie nicht auch in seinem eigenen Haus stattgefunden hätte. Ihr werdet noch einmal dafür büßen, hatte er früher gedacht, wenn die ehemaligen Frontsoldaten unter sich waren und am Abend nach der Arbeit im Wirtshaus beim Bier zusammengesessen waren und damit geprahlt hatten, wie viele sie eigenhändig umgelegt hatten. Meist hatte er dazu geschwiegen und versucht, der angeheiterten Nostalgie seiner Kollegen aus dem Weg zu gehen. Schweigen und sich abseits halten, mit dieser Strategie war er gut durchs Leben gekommen. Jetzt waren es die Kinder, auf Fronturlauben gezeugt, die, erschrocken über ihren eigenen Mut, die Väter zur Rede stellten und dem drohenden Liebesentzug trotzten. Der Fahrer, mit dem er oft Setzlinge ausfuhr, beklagte sich, dass sein Sohn den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte, weil er als nationalsozialistisch Belasteter in Glasenbach, dem Anhaltelager der Alliierten für NSDAP-Mitglieder, interniert gewesen war. Theo hatte mit heimlicher Schadenfreude gedacht, recht geschieht ihm. Er selber hatte sich nicht zu jenen gerechnet, die seine Tochter die Täter nannte. Aber Frieda hatte nicht bloß Zeitgeschichte studiert, um einen Universitätsabschluss zu erlangen, sie war besessen gewesen von ihrer Suche nach den grausamsten Details der Kriegsvergangenheit, sie hatte nicht genug davon bekommen können, es war wie eine Sucht gewesen. Sie schien von nichts anderem reden zu können, wenn sie mit ihm allein war, was selten genug vorkam. Für sie gab es nur Schuld oder Unschuld, Opfer oder Täter. Dass es Grauzonen zwischen Wahrheit und Lüge gab, dass etwas so sein konnte, wie es schien oder auch ganz anders, das verstand sie nicht.
Sie hatte es sich zu leicht gemacht, sie war selbstgerecht. Damals hatte er ihr das schlechte Gewissen übel genommen, das sie ihm aufzwang. Mit einer Mischung aus Überdruss und Furcht hatte er auf ihre Verhöre gewartet, wenn ihre Pupillen sich verengten und sie ihn mit ihrem prüfenden Blick fixierte. Sie musste nichts sagen, er kannte sie gut genug, dass sie nur mit den Augen fragen musste: Was hast du mir bis jetzt verheimlicht? Was hast du im Krieg verbrochen? Sie behauptete, sie müssten darüber reden, er sei es ihr schuldig. Warum? Weil er ihr Vater sei. In solchen Augenblicken sah sie ihn an wie einen Fremden, dem sie grundsätzlich misstraute, und bevor er irgendetwas begriffen hatte, wusste er schon nicht mehr, was stimmte, ob auch er seinen Erinnerungen misstrauen musste. Unterstell mir nichts, sagte er dann, ich weiß doch, was war. Aber in Wahrheit konnte er sich keiner seiner Erinnerungen sicher sein.
Begonnen hatte es, als Berta ins Haus kam, mit Fragen, die er anfangs bereitwillig beantwortet hatte. Sie sagte, sie wolle später einmal Geschichte studieren, damit erklärte er sich ihre Neugier auf seine Kriegserfahrungen.
Was war, als ich noch nicht auf der Welt war? hatte sie als Kind oft gefragt. Der Gedanke, dass die Welt existiert hatte, lange bevor sie geboren war und weiter existieren würde, wenn sie tot sei, faszinierte sie schon früh. Er hatte ihr davon erzählt, dass er gegen jede Wahrscheinlichkeit Wilma zur Frau bekommen hatte. Wilma war ein bürgerliches Mädchen, ihren Eltern war ich nicht gut genug, aber schließlich und endlich habe ich sie bekommen. Ich musste deinetwegen aus dem Krieg zurückkommen, es war so vorbestimmt.
Er konnte sich genau daran erinnern, als sie ihn zum ersten Mal aufgefordert hatte: Erzähl vom Krieg. Sie war acht Jahre alt gewesen, er hatte das Bild vor sich, es war bei einer Wanderung mit Frau und Kind im Frühjahr, alles stand in Blüte, und sie war stehen geblieben und hatte festgestellt: Du warst doch im Krieg. Er hatte das Gefühl gehabt, als habe etwas Entsetzliches, das er endgültig abgeschüttelt und hinter sich gelassen hatte, ihn eingeholt.
Was sollte er einem ahnungslosen Kind vom Krieg erzählen? Ihr unvorbereitet die schreckliche Kehrseite ihrer heilen Welt enthüllen? Aber selbst wenn sie kein Kind mehr gewesen wäre, hätte er ihr nicht erklären können, wie es dort gewesen war, er hatte keine Worte dafür, er glaubte nicht, dass es Worte gab. Deshalb sagte er damals nur: Es war schrecklich. Ich hoffe, dass du nie etwas so Schreckliches erleben musst. Damit war das Thema für ihn erledigt, das war kein Gesprächsstoff für ein Kind. Aber er hatte nicht mit ihrer Hartnäckigkeit gerechnet und er hatte das Ausmaß der Entfremdung nicht vorhersehen können, als die Feindseligkeit zwischen ihr und Berta hinzukam und ihn einbezog. Später, als sie studierte, nahm sie ihre Seminararbeiten und Recherchen zum Vorwand. Einmal hatte sie ihm von einem Interview mit einem widerwärtigen Greis erzählt, einem nachweislichen Mörder der SS, der sich an nichts erinnern wollte, und Theo hatte nicht zu fragen gewagt, was willst du mir damit sagen? In der Erinnerung kam es ihm vor, als habe sie jahrelang hartnäckig immer die gleichen Fragen gestellt: Wo warst du im Krieg? Was hast du getan? Was hast du gesehen, wo hast du zugeschaut? Was hast du geschehen lassen? Und keine Antwort hatte sie zufriedenstellen können. Sie fiel ihm ins Wort, sie berichtigte ihn, so war es nicht, sie warf ihm Behauptungen hin, die sie sich angelesen hatte, sie mochten stimmen oder auch nicht.
Das kann ich nicht beurteilen, hatte er gesagt, da war ich nicht dabei. Ich kann dir nur erzählen, was ich weiß. Warum fragst du, wenn du alle Antworten schon parat hast?
Er hatte sich in die Enge getrieben gefühlt und sich insgeheim geärgert, dass er sich von ihrem Misstrauen einschüchtern ließ. Sobald er angegriffen wurde, wich er ängstlich zurück.
Wo genau in Russland warst du?
Er hatte die Namen der Städte einmal gewusst, durch deren Ruinen sie erst vorgedrungen waren und sich dann zurückgezogen hatten, im Häuserkampf, das Geschütz zwischen geborstenen Mauern eingeklemmt, von Deckung zu notdürftiger Deckung. Er versuchte es zu beschreiben, aber er war kein guter Geschichtenerzähler. Smolensk, Vjaz`ma, Orel, zählte er auf. Namen, die sich in sein Gedächtnis eingebrannt hatten. Die Flüsse hatten keine Ufer, es ging sofort in die Tiefe, eine Ebene von unvorstellbarer Ausdehnung, keine Deckung, die Flüsse und die Sümpfe, ein unbarmherziges Land.
Heeresgruppe Mitte?
Ihre Fragen ließen kein Interesse an seinen persönlichen Erfahrungen erkennen. Sie fragte, als sei ihr alles bekannt und sie wolle seine Antworten bloß mit ihrem Vorwissen vergleichen.
Warst du in der Ukraine oder in Weißrussland? In Minsk? In Kiew?
Wir wurden in Smolensk ausgeladen. Ich wusste nicht, in welchem Land ich war. Was nicht von uns besetzt war, das war Russland, Sowjetunion.
Und was hast du dort gemacht?
Wie meinst du, gemacht? Ich war Soldat, ich war an der Front, ich bin viermal verwundet worden, glaubst du, das war eine Vergnügungsreise, bei der man sich die Landschaft anschaut, glaubst du, von ein paar Büchern bekommst du eine Ahnung vom Krieg?
Ich will mir nur ein Bild davon machen, was dein Anteil war, sagte sie. Ohne die Fakten kann ich deine subjektiven Eindrücke nicht einordnen, ich will ja nur verstehen.
Subjektive Eindrücke. Ihre kalte Objektivität kränkte ihn. Die Todesangst beim Angriff, wenn der Feind zu Tausenden mit Geschrei über die Bodenwelle stürmt und die Luft erfüllt ist von Bersten und Gebrüll, die Läuse, die Kälte. Sollten seine Erlebnisse nichts anderes gewesen sein als subjektive Eindrücke? Wie genau sie sich auskannte, das nötigte ihm Respekt ab.
Du weißt wahrscheinlich mehr als ich, du siehst das Ganze vom Ende her, räumte er ein. Ich war mittendrin, weißt du, da hatten wir keinen Überblick.
Er hatte Remarques Im Westen nichts Neues in Bertas Bücherschrank gefunden und beim Lesen gedacht, dass dieses Buch von einem humaneren Leben und Sterben an der Front berichtete, als er es erlebt hatte. Er las von Soldaten, die sich zwischen den Angriffen eigene Gefühle erlauben durften und noch an anderes dachten als ans nackte Überleben. Die Freundschaft mit Mädchen im Feindesland, unvorstellbar.
Ich muss wissen, was du getan hast, verstehst du das nicht?
Nein, er verstand nicht, was sie damit meinte. Es war Krieg. Das Töten und Sterben war Alltag.
Es war eine andere Welt, sagte er in einem Versuch, sich verständlich zu machen, in einer solchen Welt wird der Mensch grausamer und abgestumpfter als ein Vieh. Ich habe nichts getan, wofür ich mich schämen müsste. Für die Verbrechen der anderen kann ich nichts.
Worüber hätte er ihr berichten sollen? Über die Verwundeten, aus denen das Blut sprudelte wie aus lecken Leitungsrohren, die ihre Eingeweide in den Händen hielten oder auf ihren Fuß starrten, der nicht mehr in Reichweite lag? Über die Tausenden von toten Rotarmisten in den Straßengräben und auf den Straßen, die von den darüberrollenden Fahrzeugen zu Brei zerquetscht worden waren? Die endlosen Gefangenentrecks? Die gefangenen Russen in ihren Pferchen aus Stacheldraht, die Erfrorenen? Wozu? Hätte sie dann den Krieg begriffen?
Und du?, drängte sie mit inquisitorischem Eifer. Ich muss wissen, was du getan hast im Krieg. Ich habe ein Recht, das zu erfahren. Deine Schuld geht auf mich über, ich trage an ihr, schwerer als du.
Ich habe keine Schuld auf mich geladen.
Alle haben sich schuldig gemacht.
Das verstand er nicht.
Es musste doch einen Unterschied geben zwischen der SS hinter der Front und einem gewöhnlichen Frontsoldaten, die Schuld konnte doch nicht die gleiche sein.
Ich habe nicht gemordet, sagte er inzwischen genauso erregt wie sie, es hat mich auch nie jemand zu einem Mord gezwungen, ich habe nur im Kampf getötet.
Ein feiner Unterschied, sagte sie sarkastisch, zwischen Morden und Töten. Ist der unschuldig, der bei einem Mord das Fluchtauto fährt?
Dazu schwieg er. Wie kam sie dazu, ihn zu richten? Sie hatte keine Ahnung, es lohnte sich nicht zu streiten. Manchmal suchte er nach den richtigen Sätzen, damit sie verstand, meist aber schwieg er, versuchte gar nicht erst zu erklären. Es gab nichts zu erzählen, das Gefühl von Vergeblichkeit und Schande, das sie vermisste, hatte er erst später empfunden, angesichts des zerstörten, besetzten Landes, in das er nach sechs Jahren zurückgekehrt war. Wie klein und alltäglich der Tod im Krieg geworden war. Es verletzte ihn, dass sie ihn nicht fragte, wie ist es dir ergangen im Krieg, an was erinnerst du dich, so wie man jemanden befragt, der etwas aus eigener Erfahrung kennt, nicht weil man die Antworten schon weiß, sondern weil der Befragte Dinge gesehen hat, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man darüber liest. Warum fragte sie ihn nicht, ob er vor Angriffen Todesangst gehabt hatte? Wie schwer er verwundet war? Wie es dazu kam, dass er den Lungendurchschuss wie durch ein Wunder überlebt hatte? Interessierte sie das alles nicht? Es kränkte ihn, wie wenig sie an seinem Leben Anteil nahm. Er hätte es ihr erzählt, wäre sie nicht so unbarmherzig darauf aus gewesen, ihn zu verurteilen. Vielleicht hätte er sogar versucht, Worte zu finden für das, worüber er nie gesprochen hatte, woran er später nie hatte zurückdenken wollen, die blinde Wut bei einem Angriff, die ihn dazu brachte, nicht wegzurennen, sondern hineinzuschießen in die anstürmenden Rotarmisten, die heranrollenden Panzer, das Tier im Menschen, das sich im Zivilleben tief ins Innere verkriecht. Gefechte waren wie der Ausbruch einer Naturgewalt gewesen. Das Abschießen eines Panzers war nicht wie das Zielen und Feuern in der Ausbildung, in der Schlacht brannte und krachte es rundherum, da gab es nur Reflexe, keine Gedanken. Vielleicht, wenn sie erwachsen wäre, hatte er damals gedacht, wenn ihr das Alter von sechsundzwanzig Jahren unvorstellbar jung erschiene, dann würden sie vielleicht ruhig reden können. Aber solange ihn ihre Fragen an Verhöre erinnerten, blieb er widerspenstig und verschlossen, und je öfter sie ihm die gleichen Fragen stellte, desto hartnäckiger schwieg er. Wenn sie ihn immer von Neuem der Verbrechen an Zivilisten verdächtigte, die er nicht begangen hatte, verstummte er. Kam sie nie auf den Gedanken, dass ihm einfach die Worte fehlten? Wie hätte er etwas beschreiben sollen, wofür es im zivilen Leben nichts Vergleichbares gab?
Die brennenden Dörfer beim Rückzug. Sie haben alles zerstört, was sie nicht mitnehmen konnten, sagte er.
Ich weiß, verbrannte Erde habt ihr das genannt. Habt ihr nicht gewusst, dass in den Häusern Menschen lebten?
Ich glaube, die Dörfer waren leer, die Menschen waren schon geflohen, aber das weiß ich nicht mit Sicherheit. Warum kannst du mir nicht wenigstens glauben, dass ich kein Menschenleben auf dem Gewissen habe, jedenfalls keines, von dem ich weiß.
Kein Menschenleben auf dem Gewissen in einem Krieg, wie soll das gehen? Du hast Panzer abgeschossen, sagst du, da saßen Menschen drin.
Was hättest du an meiner Stelle getan?
Ich wäre ausgewandert, sagte sie.
Ohne Sprachkenntnisse, ohne Schulbildung, ohne Geld? Mitten im Krieg? Wie stellst du dir das vor?
In solchen Augenblicken wurde ihm der unüberbrückbare Abstand zwischen ihrem und seinem Leben bewusst und bei aller Verbitterung, die er fühlte, war er froh, dass sie sich sein Leben nicht vorstellen konnte, weil sie weder Hunger noch Gewalt und Terror kannte.
Es war Krieg, sagte er immer wieder, als müsse sie verstehen, was das bedeutete. Aber sie verstand es nicht. Sie quälte ihn und sie quälte sich selber. Es schien, als würde sie von einem Zwang getrieben, während sie sich fürchtete, ein Geständnis zu hören, das sie nicht ertragen hätte. Er sah den Schrecken und die Angst in ihren Augen und wusste, sie konnte es sich nicht erlauben, ihn zu verstehen, es wäre ein Verrat an ihren Überzeugungen gewesen. Sie wollte ein Schuldgeständnis hören und hoffte gleichzeitig zu hören, dass er seine Unschuld beweisen könne.
Wenn Berta da war, stellte sie sich voller Empörung vor ihren Mann. In ihrer Anwesenheit gab es keine Verhöre und keine Diskussionen über den Krieg. Berta griff an, bevor Frieda eine Chance hatte, ihn in die Enge zu treiben: Was redest du da? Du hast ja keine Ahnung, warst du dabei? Schämst du dich nicht, deinen Vater zu beschuldigen, wenn er doch sagt, er hat nichts Schlechtes getan? Er hat genug durchgemacht, er war doch selber ein Opfer.
So groß war Friedas Berührungsangst allem gegenüber, was in ihren Augen auch nur entfernt als politisch rechts galt, dass sie im Lauf der Zeit alle linken Ideologien durchprobierte. Bedrückt, seine Tochter nicht vor diesem Mann gewarnt zu haben, erinnerte Theo sich an seinen Schwiegersohn Ferdinand, Fery, wie er sich nannte, dem rechthaberischen Maoisten aus bürgerlichem Haus. Sie habe den Mann fürs Leben gefunden, schrieb sie ihm, und ob sie ihm ihren Verlobten vorstellen dürfe. In einer Aufwallung der Erleichterung, dass sie endlich einmal glücklich verliebt war, hatte er geantwortet: deine Freunde sind auch meine Freunde. Zu Hause durfte er sie nicht empfangen, sie hatte wieder einmal Hausverbot, also trafen sie sich in einem Gastgarten. Theo gab sich Mühe, den jungen Mann sympathisch zu finden. Groß, streng und ungepflegt saß Fery ihm gegenüber, mit schütterem schulterlangem Haar, das er sich immer wieder mit ungeduldigen Bewegungen hinter die Ohren strich, als seien es nicht ein paar widerspenstige Strähnen, die ihn störten, sondern etwas Unsichtbares, das ihn in Wut versetzte. Er hatte auch bei der Begrüßung nicht gelächelt. Vielleicht war Lächeln unter seiner Würde.
Wir sind uns so ähnlich, sagte Frieda zärtlich und streichelte Fery vorsichtig über den Rücken, wir lieben dieselbe Musik und wir begeistern uns für dieselben Ideen.
Habt ihr denn schon Zukunftspläne? Für später?, hatte Theo freundlich gefragt.
Es geht doch überhaupt nicht um uns, hatte Fery ihn zurechtgewiesen. Er sprach in schnellem Stakkato, dem zu folgen Theo schwerfiel. Es ginge um die Gerechtigkeit für die Menschheit. Die Umverteilung der Produktionsmittel. Mit einem abschätzigen Blick auf sein Gegenüber und einer wegwerfenden Geste gab er auf, als Theo ihm mit verständnislosem Blick die Wörter von den Lippen las. Das könne man nicht mit ein paar Sätzen erklären, das sei zu kompliziert, ergänzte Frieda. Auf Theos fragenden Blick holte Fery dann widerwillig zu einer langen, unverständlichen Rede aus über reaktionäre Kräfte, Gesellschaftsmodelle, Dinge, unter denen Theo sich nichts vorstellen konnte und die ihn nicht interessierten. Ein Intellektueller, dachte Theo, den ich nicht verstehe. Er wagte auch nicht nachzufragen, um sich vor seiner Tochter keine Blöße zu geben. Die beiden schüchterten ihn ein.
Fery holte ein kleinformatiges rotes Buch aus der Innentasche seines Parkas.
Die kleine rote Bibel des großen Vorsitzenden, hier steht alles drin, erklärte Fery, irritiert von Theos mangelndem politischem Bewusstsein.