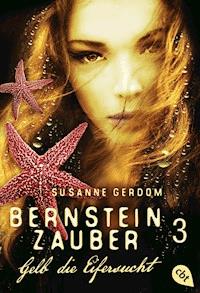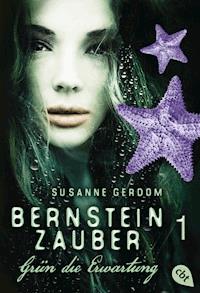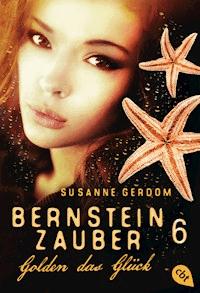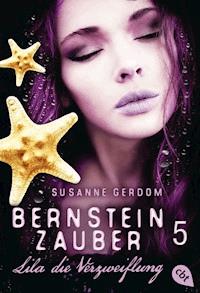4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die junge Hexe Annik steht vor einem Rätsel, das über ihr ganzes Leben entscheiden wird: Sie hat den Auftrag, das Geheimnis um die Familie van Leuwen zu lüften. Doch kaum ist sie auf dem majestätischen Anwesen angekommen, machen ihr die Bewohner, Gabriel und Daniel, eindeutige Avancen. Und Annik macht eine finstere Entdeckung nach der nächsten. Ist hier tatsächlich ein mächtiger Spiegelzauber am Werk, gewirkt von einer bösen Hexe? Die sich die Seele und Liebe der van Leuwens auf ewig sichern will? Kann Annik sie besiegen? Denn langsam aber sicher verliebt sie sich, und das Ende ist vollkommen ungewiss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DIE AUTORIN
Foto: © Picture People
Susanne Gerdom lebt und arbeitet als freie Autorin und Schreibcoach mit ihrer Familie und fünf Katzen am Niederrhein. Sie schreibt seit mehr als einem Jahrzehnt Fantasy und Romane für Jugendliche und Erwachsene.
Susanne Gerdom
Haus der
tausend
Spiegel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe Oktober 2016
© 2016 by Susanne Gerdom
© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe by
cbt Kinder- und Jugendbuchverlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und -illustration:
© Isabelle Hirtz, Inkcraft
MG · Herstellung: kw/ang
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-18287-8V001
www.cbt-buecher.de
1
Annik brach früh am Morgen auf, nachdem sie eine Weile prüfend vor dem Spiegel gestanden hatte. Es war ein schöner, frischer Morgen, die Dächer glänzten in der Sonne, und die Luft war noch nicht so voller Straßenstaub, wie sie es in ein paar Stunden sein würde. Der Wind, der von der Schelde kam, roch nach Salz, und Möwengeschrei hing in der Luft.
Die schmalspurige Straßenbahn ratterte an ihr vorbei und kreischte durch die Kurve, dann verschwand sie im engen Gewirr der Altstadtgassen.
Einen Moment lang dachte Annik darüber nach, ein Stück mit der Straßenbahn zu fahren, um nicht verschwitzt zu ihrem Vorstellungstermin zu erscheinen, aber dann entschied sie sich dagegen. Der Fußmarsch würde sie beleben.
Annik verließ das Hexenviertel und lief am Bahnhof vorbei, auf dessen Vorplatz die Tauben pickten. Sie hörte das Brüllen einer Raubkatze aus dem Zoo. Annik liebte den Bahnhof, er sah aus wie ein Theater oder ein Ort, an dem wunderbare Dinge geschehen konnten. Als sie noch klein gewesen war, hatte ihr Vater sie immer gefragt: »Möchtest du in den Zoo, Annik?«, und sie hatte jedes Mal geantwortet: »Lieber in den Bahnhof, Papa.« Die eingesperrten Tiere machten sie traurig, aber die hohe, schöne Bahnhofshalle, durch deren prachtvolle Fenster bunt das Sonnenlicht brach, war für Annik ein Ort voller Zauber.
Heute war der Bahnhof jedoch nicht ihr Ziel, sie war auf dem Weg zum Zurenborg. Ihr Vater nannte es immer ein bisschen abfällig das »pompöse Operettenviertel«. Dort wohnten ausschließlich reiche Leute, die sich die riesigen, prunkvollen Stadthäuser mit ihren barock verschnörkelten und vergoldeten Giebeln und Erkern, den bunt bemalten Backsteinen und Mosaiken, Jugendstilfenstern und marmornen Treppenaufgängen leisten konnten. Wer dort wohnte, hatte Personal und einen schicken, großen und teuren Wagen.
Annik hatte weder die Zeit noch die Nerven, sich in Ruhe umzusehen und über all den Luxus zu staunen. Sie überprüfte den Zettel mit der Adresse und suchte nach der richtigen Hausnummer.
Diese hier musste es sein. Zwischen einem ockerfarbenen Haus mit weit vorspringendem Erker, auf dem sich steinerne Blumenranken um geflügelte Amoretten rankten, und einem mehrgeschossigen Haus mit vergoldeten Giebelverzierungen und runden Fenstern in der obersten Etage erstreckte sich eine lange Mauer. Eine hohe Mauer, hinter der Büsche und Bäume und keine Spur von einem Haus zu sehen waren. Aber die Hausnummer, die auf Anniks Zettel stand, musste zu diesem Grundstück gehören.
Sie lief an der Mauer entlang und suchte nach einem Eingang, als ein berittener Polizist ihr auf der Straße entgegenkam und bei ihrem Anblick sein Pferd zügelte. »He, du«, rief er laut. »Hexe. Du hast hier nichts zu suchen.«
Annik blieb wie erstarrt stehen. Die Angst vor der Schutzpolizei saß tief. Sie atmete durch und fischte ihren roten Passierschein aus dem Brustbeutel. »Hier, bitte«, sagte sie atemlos. »Ich habe ein Vorstellungsgespräch bei Mijnheer van Leuven.«
Der Polizist schnalzte mit der Zunge. Sein Schimmel schnupperte neugierig an Ybbas, der sich auf Anniks Schulter aufrichtete, um den großen Pferdekopf ebenso neugierig zu beschnüffeln. Der Polizist war ein Tumber, er konnte den Chamäleon-Gny nicht wahrnehmen. Er studierte den Passierschein, überprüfte den Stempel mit seinem Lesegerät, das er am Gürtel hängen hatte, und reichte ihr den Schein dann zurück. »Wehe, ich erwisch dich abseits des erlaubten Weges«, knurrte er dann und zerrte am Zügel.
Annik steckte den Passierschein ein und atmete langsam und kontrolliert aus. Diese Demütigungen schmerzten immer, obwohl sie sich langsam daran gewöhnt haben sollte. Verdammt, sie hätte den Polizisten fragen sollen, wo der Eingang zu diesem Anwesen war …
Mit einem Seufzen ging sie weiter und wurde nach einigen Metern mit dem Anblick eines in die Mauer eingelassenen Tores belohnt. Annik suchte und fand einen Klingelknopf, den sie betätigte.
Ein Lautsprecher knackte und eine Frauenstimme bellte: »Ja?«
»Annabelle Joncker«, antwortete Annik. »Ich bin wegen der Stelle …«
Ehe sie ausreden konnte, knackte es erneut. »Kommen Sie herein«, herrschte die Stimme sie an, und das Tor schwang auf.
Ein Kiesweg führte in einem sanften Bogen in ein Wäldchen, und Annik stand wie verzaubert in dem grünen Paradies, das sich unerwartet vor ihr aufgetan hatte.
Einige Atemzüge lang blieb sie stehen und genoss den Anblick. Sie holte tief Luft, sog das würzige Aroma der Bäume tief in ihre Lungen. Wie schön es hier war. Das Hexenviertel bot wenig Grün, bis auf efeuberankte Hausfassaden und kümmerliche Pflanzen in Kübeln und Töpfen. Es war einfach kein Platz für Gärten oder Bäume in dem übervölkerten Stadtteil.
Ein scharfes Gefühl von Neid überrumpelte sie. Annik hatte sich nie für einen neidischen Menschen gehalten, aber jetzt, in diesem Moment, neidete sie den Bewohnern dieses Hauses ihren Reichtum, das Privileg, einen riesigen Park ganz für sich alleine zu haben, jeden einzelnen Baum, jeden Busch und jeden Grashalm.
Sie ballte die Fäuste. Es brachte nichts. Ihr Zorn würde die Welt nicht verändern. Sie erwartete, eine faire Belohnung für ihre Arbeit zu bekommen, und das war alles, was eine Hexe sich vom Leben erhoffen konnte.
Entschlossen setzte sie sich in Bewegung und betrat den Park. Zwischen den Bäumen war es still und schattig, irgendwo murmelte Wasser und Vögel sangen. Dieser Ort war magisch. Annik spürte die Unruhe, die Ybbas erfasste, in ihrem eigenen Inneren. »Ruhig«, murmelte sie. »Hier ist nichts Böses. Ganz ruhig, Ybb.«
Es stimmte. Der Zauber, den sie zu spüren meinte, war sanft und freundlich. Er ließ Wasser plätschern und eine Amsel singen und malte Kringel aus Sonnenlicht auf dunkles Moos. Nichts deutete auf eine Bedrohung hin.
Der Weg beschrieb eine jähe Kurve und führte sie hinaus ins helle Licht, auf eine weite, hügelige Rasenfläche. Sie sah endlich das Haus und staunte. Es war ein Schloss, ein riesiges, düsteres Märchenschloss. Wie konnte all dies zwischen zwei normalen Stadthäusern in einer eng bebauten Stadt wie Antwerpen Platz finden? Es war wunderbar und erschreckend zugleich.
Annik überquerte das Gelände und betrat die kiesbestreute Auffahrt. Eine breite, geschwungene Freitreppe führte zu einem einschüchternden Portal. Ganz sicher würde der Hausherr nicht wollen, dass sie sein Anwesen durch den Haupteingang betrat. Annik wandte sich von der Treppe ab und ging an der Fassade entlang, um den Dienstboteneingang zu finden.
Die tausend Fenster des Hauses starrten sie an. Annik ignorierte das Kitzeln, das sich in ihrem Nacken regte, und marschierte weiter. Sie bog um die Hausecke und betrat den Schatten, den das Gemäuer warf. Mit einem Mal war es eisig kalt. Ybbas ringelte seinen langen, geschuppten Schwanz um ihr Handgelenk und kroch in ihren Ärmel.
Ein frischer Wind kam auf, ließ ihre Jacke flattern und blies ihr Haarsträhnen in die Augen. Sie hielt den Kragen ihrer Jacke mit der Hand zusammen, fluchte leise und sprach einen Windstill-Zauber. Das war ein Spruch, den jedes Kind beherrschte, aber hier versagte er.
Mit einer Hand an der Jacke und mit der anderen ihre Haare bändigend, gelangte sie zu einer kleinen Pforte, die sehr viel weniger herrschaftlich wirkte als das Hauptportal. Voller Erleichterung flüchtete sie sich unter das Vordach und klopfte an.
Es dauerte einige Zeit, bis sich etwas rührte. Dann erklangen drinnen energische Schritte, ein Riegel schnappte, und die Tür ging auf.
Die Frau, die vor Annik aufragte, trug ein dunkles Kleid und einen ordentlichen ingwerfarbenen Dutt. Sie war von imposanter Statur, hatte ein strenges, ebenmäßiges Gesicht und durchdringend graue Augen.
»Annik«, sagte Annik, verwirrt von der bohrenden Musterung. »Die Stelle als Kindermädchen.«
Ein Lächeln erwärmte die strenge Miene. Die Frau schob die Tür weit auf und winkte Annik hinein. »Wouters«, sagte sie. »Wir haben telefoniert. Kommen Sie, Juffrouw.« Sie lenkte Annik durch einen schmalen, langen Korridor in ein fensterloses Gemach neben der Küche. Annik konnte einen Blick durch die halb offene Tür werfen und sah einen großen Gasherd und Schränke.
Dies hier schien der Aufenthaltsraum oder das Esszimmer des Personals zu sein. Ein langer Tisch mit mehr als einem Dutzend Stühle und hohe Schränke an den Wänden bildeten die einzige Einrichtung. Eine Neonröhre an der Decke verbreitete kaltes, gleichmäßiges Licht.
Frau Wouters sah Annik missbilligend an. »Sie sind sehr jung«, sagte sie.
Annik schälte sich aus ihrer Jacke. Ybbas’ Krallen kratzten leicht über die Haut ihres Nackens, und sie sah im Augenwinkel, dass seine lange Zunge nervös vor- und zurückschnellte.
Sie fuhr mit den Fingern glättend durch ihr Haar und lächelte die Haushälterin an. »Neunzehn, Mevrouw. Und ich habe bereits Erfahrung als Kindermädchen.«
Frau Wouters nickte, ohne das Lächeln zu erwidern, und musterte Annik eingehend. »Sie sehen nicht sehr kräftig aus«, sagte sie.
»Für diese Aufgabe sollte es reichen«, erwiderte Annik ein wenig spitz. »Wie alt ist das Kind?«
»Elias ist fünf«, sagte die Haushälterin und wies auf eine Tür, die in ein kleines, ordentliches Arbeitszimmer führte. »Setzen Sie sich, wir trinken eine Tasse Kaffee und besprechen alles.« Sie schien nicht in Betracht zu ziehen, Annik zu fragen, ob sie vielleicht lieber Wasser oder Tee haben wollte. Sie ging hinaus und kehrte nach kurzer Zeit mit einer Kaffeekanne und Bechern zurück, die sie auf den Schreibtisch stellte. »Nehmen Sie Milch oder Zucker?«, fragte sie und füllte beide Becher.
»Schwarz, danke«, erwiderte Annik und schloss ihre Hände um den Becher. Sie musterte die Haushälterin genauso eindringlich, wie Frau Wouters es gerade mit ihr getan hatte.
Die Haushälterin war eine beeindruckende Erscheinung. Sie trug ein schmuckloses, dunkles Kleid, an dem nur ein weißer Kragen und Manschetten kleine Akzente setzten. An ihrem Gürtel hing ein Schlüsselbund und sie trug praktische, flache Schuhe. Eigentlich hätte sie vollkommen unauffällig wirken müssen, aber ihr herbes Gesicht mit den klaren, kühlen Augen, den dunklen Augenbrauen und dem kräftigen Kinn, einer großen Nase und einem energischen Mund strahlte große Kraft und Stärke aus.
»Nun?«, fragte Frau Wouters mit einem amüsierten Heben ihrer Mundwinkel. »Würden Sie mich wiedererkennen, wenn wir uns morgen sehen?«
»Ich denke schon«, erwiderte Annik und lächelte ebenfalls. »Wenn wir uns morgen sehen? Meinen Sie, Ihre Herrin wird mir die Stelle geben?«
Die Haushälterin rührte Zucker in ihren Kaffee und trank. Ihr Blick war nachdenklich. »Erzählen Sie mir ein wenig von sich«, sagte sie. Es war keine Bitte.
Annik trank ebenfalls einen Schluck und stellte den Becher ab. »Ich bin die jüngste Tochter des Buchhändlers und Antiquars Arian Joncker«, sagte sie. »Mein Vater hat ein Geschäft im Hexenviertel, in der Spoorstraat. Meine älteste Schwester ist verheiratet und hat Zwillinge, auf die ich gelegentlich aufpasse, und meine zweite Schwester ist Hebamme. Ich selbst plane, im Herbst ein Studium zu beginnen. Chaosmagie und Buchzauber.« Sie stockte. »Ist das ein Thema, das ich besser meiden sollte?«
Frau Wouters schüttelte sacht den Kopf. »Nein, nein. Fahren Sie fort, das interessiert mich sehr. Haben Sie einen Freund?«
Annik senkte den Blick und trank einen großen Schluck, um Zeit zu gewinnen. Es schmerzte immer noch. »Nein«, sagte sie dann. »Im Moment nicht.«
»Sehr schön«, sagte die Haushälterin. »Sie sind also nicht gebunden, bis Ihr Studium beginnt. Und Sie haben Erfahrung mit Kindern, weil Sie Tante sind. Das ist sehr gut.« Sie hob die Kaffeekanne und sah Annik fragend an.
»Nein, danke«, sagte Annik. »Wann werde ich mich Mevrouw van Leuven vorstellen?«
Frau Wouters hob die Brauen. »Gar nicht, denke ich.« Sie zog eine winzige Uhr an einer Kette aus dem Kleid und warf einen Blick darauf. »Möchten Sie Elias kennenlernen?«
»Gerne, natürlich.« Annik stand auf und rieb die Handflächen an ihrer Hose trocken. Wenn der Junge sie ablehnte, würde es nichts mit der Stelle.
Die Haushälterin steckte die Uhr wieder ein und wies auf die Tür, durch die sie eingetreten waren. Annik folgte ihr stumm durch den Korridor, dann eine Treppe hinauf und in eine weite, düstere Halle, von der mehrere Durchgänge und zwei große Treppen abgingen. Der Boden war aus schwarzem und weißem Marmor, an den getäfelten Wänden hingen nachgedunkelte Ölgemälde in reich verzierten Rahmen, und von der hohen Decke hing an schweren Ketten ein Kronleuchter herab, dessen Kristallprismen staubig und glanzlos erschienen. Die vorderen Fenster waren mit dicken Vorhängen bedeckt, das einzige Licht fiel durch die hohen, bleiverglasten Fenster der Treppenaufgänge. Das bunte Licht malte phantastische Bilder auf den Schachbrettboden, auf dem ihre Schritte laut hallten. Sie liefen eine Treppe hinauf und betraten den Durchgang zum Hauptteil des Hauses. Auch dieser Gang war düster und holzgetäfelt, die Bodendielen knarrten unter ihren Füßen. Frau Wouters sprach kein Wort, nur ihr Schlüsselbund klirrte bei jedem Schritt.
»Werde ich die Eltern des Jungen heute noch kennenlernen?«, beharrte Annik, die das alles recht merkwürdig fand.
Die Haushälterin warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. »Nein«, sagte sie.
»Aber …«, wandte Annik ein, die sich zu ärgern begann, »der lange Weg hierher …«
»Sie werden gleich eine Antwort bekommen«, unterbrach Frau Wouters sie schroff. »Sobald Elias Sie begutachtet hat.«
Annik presste die Lippen aufeinander. Es konnte doch wohl kaum angehen, dass ein fünfjähriger Junge darüber entschied, ob sie die Stelle als sein Kindermädchen bekam?
Die Haushälterin öffnete eine schmale, hohe Tür mit einem ihrer Schlüssel und ließ Annik hindurchgehen. Nun standen sie in einem Flur, der weniger abweisend, sogar recht anheimelnd wirkte. Die Decke war hoch, aber die Wände hell gestrichen, die Fenster zum Park hinaus ließen eine Flut von Licht herein, und auf dem Holzboden lagen schwere, abgetretene Teppiche und dämpften die Geräusche ihrer Schritte.
Vor einer dunkel gestrichenen Tür hielt Frau Wouters an und legte die Hand auf die breite Klinke. »Seien Sie nicht nervös«, sagte sie erstaunlich freundlich. »Er ist ein wenig seltsam. Wahrscheinlich, nein, sehr sicher wird er mit Ihnen nicht sprechen. Aber ihr müsst euch kennenlernen, ehe ich entscheide, ob Sie bleiben dürfen.«
Annik riss die Augen auf. Frau Wouters würde also die Entscheidung treffen? Damit hatte sie nicht gerechnet. »Die Mutter …?«, fragte sie beklommen.
»Elias hat keine Mutter«, sagte die Haushälterin und öffnete die Tür.
Sie betraten ein geräumiges Zimmer, auch hier lagen Teppiche auf dem dunklen Holzboden. Die Wände waren cremefarben gestrichen, in schmalen Rahmen hingen zartfarbene Aquarelle, die Blumen und Landschaften zeigten. Das Mobiliar war gediegen, dunkel und schwer. Das war ein seltsames Kinderzimmer, fand Annik. Sie blickte zu den Fenstern, die in tiefen Nischen lagen. Kissen und bunte Decken lieferten ein wenig von der Behaglichkeit und den fröhlichen Farben, die sie in einem Kinderzimmer erwartet hätte. Es war penibel aufgeräumt, nirgendwo war Spielzeug zu sehen, die Bücher standen ordentlich im Regal, es gab keine Stofftiere und keine herumliegenden Kleidungsstücke. Elias schien erschreckend ordentlich zu sein für einen Fünfjährigen.
»Das ist sein Zimmer?«, fragte Annik verblüfft.
»Ja.« Die Haushälterin bückte sich und hob eine Glasmurmel auf – das einzige Etwas, das darauf hindeutete, dass hier ein Kind lebte.
»Wo ist er?« Annik musterte die tiefen Sessel, die breite Couch, die Fensternischen.
Frau Wouters’ Lippen wurden schmal. Sie deutete auf einen großen Schrankkoffer, der seltsam deplatziert mitten im Zimmer stand. Annik sah sie verständnislos an.
Die Haushälterin beugte sich zu dem Koffer hinunter und sagte: »Elias, mein Schatz. Dein neues Kindermädchen ist da. Sag ihr Guten Tag.«
Annik hockte sich neben den Koffer und betrachtete die Öffnung, die jemand in die schmale Seitenwand geschnitten hatte. Ganz offensichtlich war das Kind in dem Koffer.
»Hallo«, sagte Annik und räusperte sich. »Ich bin Annik. Guten Tag, Elias.«
Nichts regte sich. Ybbas, der die ganze Zeit still an ihrem Nacken geruht hatte, krabbelte auf ihre Schulter und rutschte den Arm hinunter. Annik ließ ihn gewähren. Kein Tumber hatte je zu erkennen gegeben, dass er einen Vertrauten sehen konnte, also war es nicht weiter schlimm, dass Ybbas jetzt über den Teppich rannte, dabei kurz sein farbenfrohes Muster annahm und in dem Kofferloch verschwand.
Frau Wouters räusperte sich und hielt die Hand vor den Mund. »Er wird nicht herauskommen«, sagte sie bedauernd. »Elias macht eine schwierige Phase durch.«
»Wann ist seine Mutter …?« Annik flüsterte, um dem Jungen im Schrankkoffer keinen Schmerz zuzufügen.
Die Haushälterin schüttelte den Kopf. »Schon lange«, sagte sie. »Nein, es ist nicht deswegen.« Sie legte die Hand auf den Koffer und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Sie sah erschöpft aus und beinahe alt.
Dann richtete sie sich wieder auf und nickte energisch. »Elias, Schätzchen«, sagte sie laut, »wenn du brav Guten Tag sagst, dann bekommst du deinen Kakao und einen Keks. Möchtest du das?«
Im Inneren des Koffers bewegte sich etwas wie ein kleines, scheues Tier.
Annik blinzelte und hatte eine kurze, schemenhafte Vision von einem blassen Gesicht mit riesigen dunklen Augen unter weizenblondem Haar. Das Gesicht war schmal und elfenhaft, der Mund bebend verzogen, die Augen voller Angst und Trauer.
Sie schüttelte sich und richtete sich auf. »Er hat Angst vor mir«, sagte sie. »Lassen wir Elias besser in Ruhe, Frau Wouters. Ich möchte nicht, dass er sich fürchtet.«
Etwas bewegte sich im Koffer, dann gab es ein klickerndes Geräusch, und kurz darauf kullerte eine Glasmurmel vor Anniks Füße.
Sie hob die Murmel auf, in deren grünlichem Glas goldene Einsprengsel schimmerten. Die Haushälterin lächelte leicht und legte ihre Hand an Anniks Ellbogen. »Sehr schön«, sagte sie. »Er ist einverstanden. Gehen wir und sehen uns Ihr Zimmer an, Fräulein Annik.«
Annik schwieg, während die Haushälterin sie aus dem Zimmer und von dort ein paar Schritte den Gang hinunter führte. Sie folgte Frau Wouters in ein helles, hübsch eingerichtetes Zimmer mit einem großen Fenster, vor dem ein Fliederbusch blühte. Annik seufzte unwillkürlich. »Das ist aber schön«, sagte sie sehnsüchtig und dachte an ihre kleine Kammer unter dem Dach, die sie zu Hause bewohnte.
Ybbas kletterte an ihrem Bein hoch und ringelte seinen Schwanz um ihr Handgelenk. Dort baumelte er kopfüber und begutachtete mit seinen kugeligen Augen die Umgebung.
»Das ist Ihr Zimmer«, sagte die Haushälterin und löste einen Schlüssel von ihrem Bund. »Wenn Sie etwas benötigen, das Sie hier nicht finden, dann sagen Sie mir oder dem Hausburschen Bescheid. Ich stelle Sie nachher noch dem Personal vor.«
Annik erwachte aus der träumerischen Stimmung, in der sie sich ein Leben in diesem großen Haus, in diesem behaglichen Zimmer vorstellte. »Ich soll hier wohnen?«
Frau Wouters musterte sie belustigt. »Ja, natürlich. Wie wollen Sie sonst auf Elias aufpassen?«
Sie hatte recht, darüber hatte Annik nicht nachgedacht. Bisher hatte sie nur auf Kinder im Hexenviertel aufgepasst – aber um hierherzugelangen, musste sie ein Stück mit der Straßenbahn fahren, laufen und wurde ständig von Polizisten angehalten. Es war also mehr als vernünftig, gleich hier einzuziehen.
»Ich muss ein paar Sachen holen«, sagte sie. »Meiner Familie sagen, dass ich in den nächsten Wochen fort bin. Ein paar Dinge organisieren, damit zu Hause alles glatt läuft.« Sie runzelte die Stirn.
»Ja, natürlich«, erwiderte Frau Wouters geduldig. »Es reicht, wenn Sie morgen im Laufe des Tages hier anfangen.« Sie zog die Uhr aus dem Ausschnitt und blickte darauf. »Ich begleite Sie dann jetzt hinaus. Morgen also?«
»Morgen. Danke. Ich freue mich.« Annik lächelte. Sie freute sich wirklich.
Während die Haushälterin sie zur Tür brachte, sagte sie: »Sie lesen sicherlich gerne, wenn Ihr Vater Bücher verkauft. Es wäre schön, wenn Sie Elias vorlesen könnten und ihm vielleicht sogar das Lesen beibrächten. Ich werde den Herrn bitten, Ihnen Zugang zur Bibliothek zu gewähren.« Sie sah Annik eindringlich an. »Sie wird Ihnen gefallen, da bin ich sicher.«
Annik war sich ebenfalls sicher. Sie dankte und sagte impulsiv: »Wenn mein Vater sich die Bibliothek auch einmal ansehen dürfte – er wäre überglücklich.«
Frau Wouters wandte sich ab. »Das wird er nicht wünschen«, sagte sie zurückhaltend. Annik musste nicht fragen, wer »er« war. Natürlich meinte sie Mijnheer van Leuven, den Hausherrn.
2
Es war ihr erstaunlich schwergefallen, sich von ihrem Vater und ihren Schwestern zu verabschieden. Sie würde doch nur in einen anderen Stadtteil ziehen, und das auch nur so lange, bis sie ihre Aufgabe erledigt hatte – aber Annik war noch nie länger als zwei oder drei Tage von zu Hause fort gewesen. Es fühlte sich einfach falsch an.
Nun, da sie mit ihrem Rucksack und dem Köfferchen vor dem Seiteneingang des großen Herrenhauses stand und darauf wartete, dass ihr jemand öffnete, schlug ihr Herz jedoch vor Aufregung und Vorfreude. Sie freute sich auf den Jungen, auf ihr Zimmer, auf die verheißungsvolle Bibliothek. Sie war gespannt auf die anderen Angestellten und fürchtete sich ein wenig davor, dem Hausherrn zu begegnen. Aber nur ein wenig.
Sie musste lachen. Dora, ihre mittlere Schwester, hatte sie noch im Scherz vor dem »Duivel van Antwerp« gewarnt, der sicherlich ihr neuer Dienstherr war. Dora hatte dabei gelacht, aber Annik hatte die kaum verhohlene Sorge in ihrem Blick bemerkt. Der Teufel von Antwerpen war eine Sagenfigur, etwas, womit man Kinder erschreckte. Er wohnte in einem großen, düsteren Haus, fraß junge Mädchen zum Frühstück und hatte, wie es sich für einen Teufel gehörte, einen Bocksfuß und Hörner. Es war typisch für Dora, dass sie sich um Annik, das Nesthäkchen der Familie, sorgte.
Ein grobknochiger junger Mann mit kurzen braunen Haaren öffnete ihr und sah sie fragend an. Annik lächelte ihn an. »Annik Joncker«, sagte sie. »Ich bin das neue Kindermädchen.«
Der junge Mann nickte und öffnete die Tür. »Henk«, sagte er. »Hausbursche.« Er griff nach ihrem Koffer, und Annik ließ zu, dass er ihn ihr abnahm.
»Frau Wouters möchte mich sicher sprechen«, sagte sie.
Henk knurrte bestätigend. Annik wartete, ob der Bursche noch etwas sagen würde, aber anscheinend war Henk ziemlich maulfaul.
Das Zimmer war genauso hübsch und einladend, wie sie es beim ersten Besuch empfunden hatte. Sie warf ihren Rucksack auf einen Stuhl und sah sich um. Der Hausbursche stand geduldig an der Tür, wartete, bis Annik ihren Umhang in den Schrank gehängt hatte, und sagte dann: »Ich bringe dich zu Frau Wouters.«
Die Haushälterin saß an einem Schreibtisch voller Papiere und Rechnungsbücher und hakte eine lange Liste ab, während sie einen riesigen, schwarzen Hund kraulte, der neben ihr auf dem Boden hockte. Er reichte im Sitzen beinahe bis an ihre Schulter. Annik musterte ihn voller Respekt. Er erwiderte ihren Blick aus unergründlichen, möwengelben Augen und gähnte.
»Annik«, sagte Frau Wouters und nahm ihre Brille ab. »Schön, dass Sie da sind.« Sie wies auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Ich werde Sie heute in Ihre Pflichten einweisen. Wir haben hier ein kleines Büchlein mit Ihren Aufgaben, den Zeiten, zu denen Sie sich um Elias kümmern sollten, was zu tun ist, wann Mijnheer van Leuven Ihren Bericht erwartet und so weiter.« Sie schob ein Notizbuch zu Annik hinüber. »Es hat sich erwiesen, dass dies von Nutzen ist. Sie können selbstverständlich jederzeit fragen, wenn Ihnen etwas unklar ist.« Sie wartete, während Annik das Büchlein aufschlug und die ersten Seiten überflog. »Sie sollten das nachher in Ruhe studieren, Ihre Arbeit beginnt erst morgen früh. Sind Sie bereit für eine Führung durch das Haus?« Sie stand auf und der Hund erhob sich ebenfalls. Er war riesig, Annik hätte auf ihm reiten können, aber er war dabei nicht plump, sondern langbeinig und grazil. Annik fragte sich, was das für eine Rasse war.
»Wie heißt er?«, fragte sie.
Die Haushälterin sah sie beinahe verblüfft an. »Wer? Oh. Ja, natürlich. Ich hoffe, Sie haben keine Angst vor Hunden?«
Annik lachte und hielt ihm ihre Hand hin, damit er daran riechen konnte. »Nein, nur vor den kleinen, die kläffen und schnappen.«
Frau Wouters lächelte kurz. »Satan, bei Fuß«, befahl sie.
Das Haus war riesig, verwinkelt und düster. Frau Wouters zeigte ihr nur die Räume und Wege, die sie in den nächsten Tagen benötigen würde, um sich zurechtzufinden. »Wenn Sie sich auf eigene Faust umsehen, dann passen Sie einfach auf, dass Sie sich nicht verlaufen«, sagte sie. »Wir bewirtschaften nicht das gesamte Gebäude, der Ostflügel steht weitgehend leer. Sollten Sie sich dennoch einmal verirren, können Sie sich immer durch einen Blick nach draußen orientieren. Jeder der Flure führt irgendwann auf eins der Treppenhäuser zu.« Sie legte einen Finger an die Nase. »Was müssen Sie noch wissen? Ah, Sie werden etliche Türen verschlossen finden. Bitte stören Sie sich nicht daran. Die Räumlichkeiten dahinter sind unbenutzt. Der Westflügel ist für Sie tabu, dort wohnt Mijnheer van Leuven. Sie werden ihm regelmäßig Bericht erstatten, ich werde Sie die ersten Male dorthin bringen, danach wird Mijnheer Sie rufen lassen. Zu anderen Zeiten haben Sie dort nichts zu suchen.« Sie lächelte, um ihren Worten die Schärfe zu nehmen, und griff nach Anniks Ellbogen. »Möchten Sie jetzt die Bibliothek sehen?«
Annik war sprachlos. Sie hatte mit einem großen Raum voller Bücher gerechnet – eine Bibliothek in diesem Haus musste einfach groß sein –, doch der riesige, aus zwei zusammenhängenden Zimmern bestehende Saal, der bis in den ersten Stock hinaufreichte, mit umlaufender Galerie und einer Vielzahl von Tischen, Sitzgelegenheiten, Leitern und Nischen, übertraf all ihre Erwartungen. Überall standen Regale, an den Wänden, im Raum, und all diese Regale waren vollgestopft mit Büchern.
Der vordere Teil, in dem Arbeitstische, Lehnsessel und breite Sofas standen, war lichtdurchflutet, eine der Flügeltüren in den Garten stand sogar offen und ließ warme Luft hinein.
»Das hier ist ja größer als die öffentliche Bibliothek im Hexenviertel«, sagte Annik überwältigt.
Frau Wouters sah sich so zufrieden um, als hätte sie die Bibliothek eigenhändig hierhergeschafft. »Dies ist einem herrschaftlichen Haus angemessen«, sagte sie. »Satan, pfui.«
Der Hund hatte an einem ledergebundenen Buch geschnüffelt. Er wandte den Kopf und sah seine Herrin beinahe mitleidig an.
Ybbas sprang aufgeregt auf Anniks Schulter auf und ab. Ihr Vertrauter liebte Bücher beinahe genauso, wie er Wasser liebte. Er war wie Annik empfänglich für die magischen Resonanzen, die eine große Anzahl von Büchern an einem Ort aufzubauen pflegte. Diese Bibliothek war groß und alt, die Magie, die ihr innewohnte, war mächtig und ließ eine Gänsehaut auf ihren Armen wachsen. »Geh«, flüsterte sie dem Gny zu. »Aber mach keine Unordnung.«
Ybbas ließ sich das kein zweites Mal sagen, sondern sprang auf den Boden und huschte davon. Sie sah noch, wie er die Maserung des Holzbodens und die Farbe der goldgeprägten Buchrücken annahm, dann war er verschwunden.
Annik sah sich ehrfürchtig um. »Und ich darf die Bibliothek wirklich benutzen?«, vergewisserte sie sich. »Fühlt Mijnheer van Leuven sich dadurch nicht gestört oder belästigt?«
Frau Wouters erwiderte ihren Blick ausdruckslos. »Nun, ich denke, es geht in Ordnung«, sagte sie dann. »Mijnheer hatte nichts dagegen einzuwenden.«
»Wundervoll«, sagte Annik leise und streichelte ein Buch mit den Fingerspitzen. »Ich finde hier sicherlich auch Lektüre für Elias?«
Die Haushälterin nickte. »Kommen Sie mit.« Sie lenkte Annik mit einer sachten Berührung in den hinteren Teil der Bibliothek. Hinter ihnen klickten leise die Krallen der Hundepfoten über das Parkett.
Hier waren die Fenster mit Jalousien verdunkelt, nur an einigen Stellen drang Licht in dünnen Pfeilen durch die Aufhängung und streifte die Dunkelheit. Leselampen malten Inseln der Gemütlichkeit in den riesigen Raum.
Sie gingen zu einem der niedrigeren Regale an der Kopfseite, in dem Annik schon von Weitem bunte Schutzumschläge und großformatige Bilderbücher erkennen konnte. Sie kniete sich vor das Regal und zog einige Bücher heraus. »Andersen, das wird er lieben«, sagte sie versunken und stapelte die Bücher in ihrem Arm. »Und Diana Wynne Jones sicher auch.« Sie lächelte zu Frau Wouters auf. »Kinder lieben Märchen.«
Die Haushälterin nickte ernst. »Sehr schön«, sagte sie. »Finden Sie alleine in Ihr Zimmer zurück, Annik? Meine Pflichten rufen.«
Annik sprang auf. »Danke«, sagte sie. »Ich werde mich mit dem Aufgabenheft beschäftigen, damit ich weiß, was ich morgen zu tun habe.«
Frau Wouters neigte majestätisch den Kopf. »Sehr lobenswert«, sagte sie. »Abendessen gibt es um sieben, in der Küche. Soll der Bursche Sie abholen?«
Annik strich sich mit der freien Hand eine Haarsträhne aus der Stirn. »Nein, danke. Ich glaube, ich finde mich zurecht.«
3
Er stand oben auf der Galerie und beobachtete das neue Mädchen. Wenn sie ihn hätte sehen können, wäre sie sicherlich erschreckt, angewidert und abgestoßen zurückgewichen, aber er stand im Schatten eines hohen Regals und achtete darauf, sich nicht zu weit ins Licht zu beugen.
Das Mädchen war klein, zierlich und bewegte sich mit unbewusster Grazie. Sie trug eine dunkle Hose, Turnschuhe und eine helle Bluse, eben das, was junge Mädchen heutzutage so anzogen. Ihr schwarzes Haar war zu einem schlichten Pferdeschwanz gebunden, anscheinend war das wieder mal modern. Er seufzte leise und kniff die Augen zusammen. Glücklicherweise schien sie nicht zu denen zu gehören, die mit seltsamen Stammesabzeichen auf der Haut herumliefen oder sich Metallstücke durch das weiche Fleisch ihres Gesichtes stießen. Sie war so jung …
Er konnte nicht verhindern, dass er an andere junge Mädchen dachte, solche in zartfarbenen, knöchellangen Kleidern, mit geflochtenem und aufgestecktem Haar voller Blumen und Bänder, großen Hüten und langen Handschuhen, eleganter Haltung, einem sprechenden Spiel mit dem Fächer. Diese Zeiten waren lange vorbei, aber er sehnte sich mit einer Macht dorthin zurück, die ihm körperliche Schmerzen bereitete.
Als sie den Kopf wandte, um mit Wouters zu sprechen, konnte er ihr Gesicht im hellen Licht sehen. Es war oval und eigenwillig, nicht besonders hübsch, aber ausdrucksstark. Sie hatte große, lang bewimperte Augen, deren Farbe er von hier oben nicht erkennen konnte, und einen breiten, fröhlichen Mund.
Er zog sich tiefer in den Schatten zurück und rieb über seine Wange und die Lippen. Er wollte sie nicht erschrecken, nicht an ihrem ersten Tag. Sie sah aus wie jemand, dem Elias vertrauen würde. Es war wichtig, dass Elias Vertrauen fasste. Wie sollte sich sonst jemals etwas ändern?
Wouters schien seine Anwesenheit bemerkt zu haben, wie immer. Sie lenkte das Mädchen mit einem sanften, aber bestimmten Griff zur anderen Seite der Bibliothek. Er hörte, wie ihre Stimmen sich entfernten.
Satan, der mit dem Kopf auf den Vorderpfoten reglos neben seiner Herrin gelegen hatte, erhob sich träge. Er wandte den Kopf und sah zu dem stillen Beobachter auf der Galerie auf. Der blinzelte mehrmals, rieb sich über die brennenden Augen und erwiderte den Blick des riesigen Hundes. Es fiel ihm heute schwer, Satan zu sehen. Die schwarze Riesengestalt verschwamm, wenn er sie zu fixieren suchte, entzog sich, zwang ihn dazu, die Konzentration bewusst zu fokussieren, brachte ihn dazu, beiseitezusehen, seinen Blick über die Regale oder zum Fenster hinaus schweifen zu lassen.
Ich sehe dich, richtete er sich in Gedanken an den Hund, indem er ihn mit tränenden Augen anstarrte. Ich sehe dich …
Der Hund gähnte gelangweilt, wandte den Kopf ab und trottete seiner Herrin hinterher.
Der stille Beobachter trat vor und schloss seine Hände um das Geländer der Galerie. Er sah dem Mädchen nach, dessen Lachen immer noch melodisch an sein Ohr klang. Sie war jung und unschuldig. Sie sollte nicht hier sein, nicht in dieser düsteren, um sich selbst kreisenden Hölle von Haus. Seine Hände verkrampften sich und seine vernarbten Knöchel wurden weiß. Er würde sie beschützen müssen, aber die dunklen Mächte, die ihn hier gefangen hielten, lachten höhnisch über diesen hilflosen Entschluss. Er war der Letzte, der jemanden beschützen konnte – jemanden, der so lebendig, so voll frischer Lebenskraft war wie dieses Mädchen.
Er war doch nicht einmal in der Lage, sich selbst zu retten.
4
Nach dem Abendessen zog sie sich in ihr Zimmer zurück und legte sich auf das schmale Bett, um den Rest der Instruktionen zu lesen.
Das Abendessen war reichhaltig gewesen, die Gesellschaft angenehm. An dem langen Tisch im Aufenthaltszimmer des Personals hatten sich alle Bediensteten des Haushaltes versammelt. Es waren vielleicht zwei Dutzend – die Hausburschen, ein Chauffeur, zwei Kammerdiener, die Gärtner, fünf Hausmädchen, die Waschfrau und der Hausmeister, die Köchin mit ihren beiden Küchenhilfen. Frau Wouters, die Haushälterin, hatte Annik allen vorgestellt und sich dann verabschiedet, als eine Küchenhilfe das Essen auftrug.
»Die Gnädige diniert nicht mit dem gemeinen Personal«, hatte das jüngste der Hausmädchen ihr zugeraunt und eine Braue gehoben. »Das ist uns auch lieber so.«
Der erste Kammerdiener, ein distinguierter Herr von Mitte vierzig, hatte sie mit einem sanften Kopfschütteln gerügt und danach war nur noch über unverfängliche Themen geredet worden. Kinofilme, das Wetter, die Lebensmittelpreise, ein bisschen Klatsch und Tratsch.
In ihrem Zimmer war es ruhig und gemütlich. Sie entzündete die Leselampe am Bett und nahm sich das Aufgabenheft vor. Frau Wouters war gründlich, sie hatte jede Kleinigkeit notiert, die in Anniks Aufgabenbereich fiel, und eine Erläuterung dazu verfasst. Das Büchlein erschien recht zerfleddert, als hätten es vor ihr schon viele andere in den Händen gehalten. Auch die Anmerkungen, die hier und da zwischen den Abschnitten notiert waren, zeigten unterschiedliche Handschriften und Farben. Wie viele Kindermädchen konnte ein fünfjähriger Junge denn in seinem Leben schon gehabt haben? Mehr als drei oder vier doch wohl kaum?
Annik runzelte die Stirn und blickte von der Seite auf, die sie gerade las. Sie sah zum Fenster und betrachtete den dunklen Himmel, vor dem sich die schwarzen Silhouetten der Bäume abzeichneten.
Warum hatte der Weiße Rat sie hierhergeschickt? Sie wusste, dass jede junge Hexe, die ein Studium beginnen wollte, zuerst eine Aufnahmeprüfung absolvieren musste, und hatte immer geglaubt, dabei handele es sich um eine Prüfung der bis dahin erworbenen Fähigkeiten. Sie war keine gute Spruchweberin, aber das hatte sie bislang mit Fleiß und Hartnäckigkeit wettmachen können. Ihr theoretisches Wissen war exzellent, dafür hatte ihr Vater gesorgt. Deshalb war sie zuversichtlich gewesen, was die Prüfung anging – bis die Nachricht des Weißen Rates kam, die schlicht lautete: »Löse dies«, und dann noch die Adresse dieses Hauses nannte. Nun gut, sie würde also zuerst herausfinden müssen, welches Rätsel es zu lösen galt. Und bis dahin würde sie den Job tun, für den sie eingestellt worden war.
Sie las weiter. Morgen früh würde sie Elias wecken und ihm sein Frühstück bringen. Danach sollte sie einen Spaziergang mit ihm unternehmen, falls das Wetter es zuließ (nur im Park, das Gelände durfte auf keinen Fall verlassen werden!), und ihn dann zu einem Nickerchen ins Bett bringen. Sie sollte ihm vorlesen, dann würde er anderthalb Stunden schlafen, die sie nach eigenem Ermessen verbringen durfte.
Dann würde sie mit Elias zu Mittag essen und den Nachmittag damit verbringen, mit ihm zu spielen (je nach Wetterlage drinnen oder im Park) und ihm das Lesen beizubringen.
Abends sollte sie ihm beim Waschen und Zähneputzen beistehen, er durfte noch eine halbe Stunde spielen, und dann würde sie ihn mit einer Gutenachtgeschichte zu Bett bringen. Der restliche Abend stand zu ihrer freien Verfügung. Sie musste allerdings die Rufanlage zu seinem Zimmer anschalten, falls er nachts seine Albträume bekam, in diesem Fall sollte sie ihn wecken, ihm ein Glas heiße Milch machen und bei ihm bleiben, bis er wieder eingeschlafen war.
So weit, so simpel. Das sollte sie vor keine große Herausforderung stellen … vorausgesetzt, der Junge war bereit, seinen Koffer zu verlassen.
Annik legte das Aufgabenheft beiseite und streckte sich auf dem Bett aus. Es war spät, der Tag war aufregend gewesen, aber sie war nicht müde. Sie starrte eine Weile an die Decke, dann stand sie auf und schlüpfte in ihre Strickjacke. »Ybbas?«, fragte sie leise. »Gehst du mit mir ein Stückchen spazieren?«
Der kleine Gny, der es sich in einem Nest aus ihrer Wäsche gemütlich gemacht hatte, reckte den Kopf. Er gähnte herzhaft, wobei seine ellenlange Zunge sich einmal komplett entrollte, bevor sie wieder im Maul verschwand, streckte sich und sprang auf ihre Schulter.
Das Haus erschien unbewohnt, als sie durch die endlosen Gänge lief. Es war totenstill, nirgendwo schimmerte Licht. Waren etwa alle schon schlafen gegangen?
Sie zögerte an der Tür, durch die sie das Haus betreten hatte. Womöglich wurde es nicht gerne gesehen, wenn die Angestellten nachts durch den Park geisterten. Aber ihre Sehnsucht nach der frischen Luft und dem freien Himmel war übermächtig.
Ybbas drückte sich flach an ihren Nacken, als sie die Türklinke berührte. Einen winzigen Moment lang gab es einen Widerstand, der ihr zeigte, dass die Tür wirklich abgeschlossen war. Annik presste die Lippen zusammen, sah sich hastig um und legte dann die Hand energisch auf die Türklinke.
»Schloss und Riegel
Geben nach, weit geöffnet
Tür und Tor«,
flüsterte sie und drückte die Klinke hinunter. Die Tür schwang auf und kühle Luft fächelte Anniks Wangen.
Der Himmel war bewölkt und der Park so finster wie ein Kohlenkeller. Annik blieb eine Weile neben der offenen Tür stehen und wartete darauf, dass ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Hinter ihr ragte die schweigende Masse des Hauses auf, lichtlos und dräuend wie eine Felswand. Das Haus erschien ihr so leblos, tot und unbewohnt wie ein Mausoleum. Hatte sie heute wirklich mit einem Dutzend anderer Menschen am Tisch gesessen, ein Abendessen verzehrt und sich ihre Gespräche angehört? Und lag irgendwo dort hinter den Parkmauern eine große, lebendige Stadt voller Menschen und Lärm? Hätte sie nicht wenigstens den Abglanz der Lichter am Himmel erkennen müssen wie eine neblige Wolke, die über der Stadt hing? Aber da war nichts, nur tintenschwarze, tiefe Dunkelheit.
Nach und nach schälten sich Einzelheiten aus dem Dunkel. Hoch aufragende Bäume umringten das Haus, düstere Zypressen, knorrige Kiefern, alte Eichen, efeuüberwucherte Baumstämme zwischen dichtem Gebüsch voller Dornen und Ranken.
Annik fröstelte. Sie löste sich von der Schwelle und tauchte in den tiefen Schatten der Bäume ein. Dunkelheit und Stille, die im Haus eine so bedrückende Atmosphäre geschaffen hatten, wichen der belebten Ruhe eines nächtlichen Waldes. Getier raschelte im Gebüsch und in den Bäumen ließ ein Nachtvogel seinen melancholischen Ruf ertönen.
Annik war ein Stadtmensch. So viel urmächtige Natur auf einem Fleck, ein so großes Gelände voller Pflanzen und Tiere, war ihr fremd und unheimlich. Sie hätte sich fürchten müssen, aber stattdessen genoss sie es. Sie berührte die raue Rinde eines Baumes, fuhr mit den Fingern über Efeuranken und durch glattes, kühles Laub, spürte federndes Moos unter den Füßen, roch die schwere, feuchte Erde und horchte auf all die fremden Geräusche.
Wobei eins der Geräusche alles andere als fremd, sondern sogar recht vertraut erschien. Jemand weinte.
Annik lief los, ohne nachzudenken. Das Weinen klang so herzzerreißend, so einsam und verloren, dass sie keinen Gedanken daran verschwendete, wie sie sich in der Dunkelheit der Nacht auf vollkommen fremdem Terrain zurechtfinden sollte.
Sie stolperte über etwas auf dem Boden und stieß sich die Zehen, ein herabhängender Ast versetzte ihr eine brennende Schürfwunde im Gesicht, und sie wäre zweimal um Haaresbreite mit einem Baumstamm zusammengeprallt, als das Weinen abrupt aufhörte.
Sie stand in der atmenden Dunkelheit und lauschte. Knacken von kleinen Zweigen, Rascheln von Laub, das Fiepen eines kleinen Tieres. Wind zupfte an ihren Haaren. Annik hob die Hand und betastete die Abschürfung auf ihrer Stirn. Wie lächerlich von ihr, einfach so loszurennen. Jetzt, wo es verstummt war, war sie sich gar nicht mehr so sicher, das Weinen wirklich gehört zu haben. Vielleicht gab es ein Nachttier, das sich so anhörte? Sie kannte sich mit Tieren nicht aus, wenn es keine Haustiere waren.
Unschlüssig stand sie da und wartete. Worauf?
Das Weinen hatte sie tief ins Herz getroffen. Es hatte sie daran erinnert, wie sie geweint hatte, als ihre Mutter gestorben war, und wie sehr ihr Vater gelitten hatte, ohne eine einzige Träne zu vergießen. Er hatte sich noch mehr in sich zurückgezogen, war noch ein wenig stiller, noch ein wenig wunderlicher und zerstreuter geworden. Arian Joncker hatte seine Kinder nie etwas anderes spüren lassen als seine große Liebe – aber Annik wusste, dass ein Stück seines Herzens und seiner Seele an diesem schrecklichen Novembertag mit seiner Arabelle gestorben war. Mama hatte sich um ihn gekümmert. Pa war kein Geschäftsmann, er liebte seine Bücher und den Zauber, den sie woben.
Annik kniff die Augen zusammen. Das Weinen war endgültig verstummt, und sie stand irgendwo in diesem riesigen Park, der mehr ein Wald war, und musste den Weg zum Haus zurück finden. »Ybbas?«, rief sie leise.
Es raschelte zu ihren Füßen, dann kletterte der kleine Vertraute an ihr empor und klammerte sich auf ihrer Schulter fest. Sie drehte den Kopf und sah in eins seiner kugeligen Augen, das sich fragend auf sie richtete, während das andere ein Gebüsch neben ihnen musterte.
»Ybbas, ich will zum Haus zurück.«
Er züngelte unschlüssig. Anscheinend war ihm diese Umgebung ebenso unvertraut wie ihr. Annik seufzte. »Leih mir deine Augen.«
Kurz darauf verschwamm ihre Sicht, aber gleichzeitig schien es heller zu werden. Es war ein seltsam verzerrtes Bild, das sie empfing, und sie musste ihr Gehirn erst dazu bringen, diesen Blickwinkel, der von ihrer Schulter aus in zwei unterschiedliche Richtungen ging, als eine Wahrnehmung zu akzeptieren, die es verarbeiten konnte. Sie blinzelte mehrmals, schloss dann die eigenen Augen (manchmal war es leichter so) und orientierte sich in der perligen Helligkeit ihres Sichtfeldes.
»Gehen wir da lang«, schlug sie vor und zeigte auf einen Pfad, der zwischen den Bäumen zu erkennen war.
Nach ein paar Schritten verengte sich der schmale Weg und wurde zu einem Trampelpfad. Annik kämpfte sich schweigend zwischen zwei kratzigen Büschen hindurch und gelangte auf eine kleine Lichtung, um die herum dicht an dicht Bäume standen. Bei Tag war dies sicherlich ein idyllischer Ort, sonnenbeschienen und geschützt vor neugierigen Augen, aber jetzt in der Nacht standen die Bäume wie drohende Gestalten um eine düstere Senke, in der sich Nebel sammelte.
Annik zog ihre Strickjacke enger um sich und überquerte die Lichtung. Sie näherte sich dem verwilderten Fliederbusch, der den Durchgang zu einem Weg markierte, und wollte wieder in das Dämmerlicht der Bäume eintauchen, als ein unheimlicher Laut sie mitten in der Bewegung bannte. Hinter ihr schien etwas Großes durch das Unterholz zu brechen. Sie hörte ein bedrohlich anschwellendes Knurren, das in ein heiseres Belfern und dann in wölfisches Geheul überging.
Was auch immer sich ihr näherte, es musste riesig sein.
Annik blieb ruhig stehen, obwohl ihr Herz bis zum Hals schlug. Sie beobachtete die Richtung, aus der das Geheul kam, und formulierte in ihrem Kopf den Spruch, der eine kurze, heftige Windböe zwischen ihr und dem Verfolger erzeugen sollte. Das war eine schwache Gegenwehr, aber alles, was ihr auf die Schnelle zur Verfügung stand. Es musste ausreichen, damit sie sich ins Gebüsch retten konnte. Nicht zum ersten Mal verfluchte sie ihr fehlendes Talent für das Binden von Sprüchen. Mehr als einen holprigen Haiku bekam sie in der Regel nicht zusammen.
Ein letztes, lautes Krachen und Brechen von Zweigen, dann war das Untier auf der Lichtung und hetzte auf sie zu. Annik sah durch Ybbas’ Augen ein Monster aus der Hölle: rotglühende Augen, ein zahnstarrender, geifernder Rachen, von dem grünlicher Geifer troff, ein muskelbepackter, lang gestreckter Körper, lange Beine mit dolchähnlichen Klauen – und dieses Ungeheuer raste im gestreckten Galopp auf sie zu!
Sie keuchte und schrie den vorbereiteten Zauber:
»Herbststurm
Verweht die Blätter
Trüb wird die Luft.«
Vor ihr wirbelte ein heftiger Windstoß Laub und Erde auf, vernebelte ihr die Sicht und riss ihr den Atem von den Lippen. Ohne zu zögern warf sie sich herum und wollte flüchten.
»Satan, aus!« Der mit ruhiger Stimme gesprochene Befehl ließ Annik innehalten. Die mörderische Bestie stoppte und ließ sich nieder, der glühende Blick ihrer Augen ruhte starr auf Annik.
Annik riss ihre eigenen Augen auf und war für einen kurzen Moment nahezu blind. Die Schritte, die sich näherten, gehörten einem Menschen. Annik zwinkerte die Schleier fort und sah die hochgewachsene Gestalt der Haushälterin auf die Lichtung treten. Sie ging zu dem riesigen Hund, der vor Annik auf dem Boden kauerte, und griff nach seinem Halsband. Ihr Blick war belustigt. »Sie sollten nicht hier draußen sein, Kind«, sagte sie. »Mijnheer sieht es nicht gerne, wenn sein Personal sich nächtens im Park verläuft.«
Annik stieß den angehaltenen Atem aus. »Ich wollte nur vor dem Schlafen ein wenig Luft schnappen«, sagte sie. »Dann habe ich etwas gehört und wollte nachsehen …« Sie schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass wir den Park nicht betreten dürfen.«
Die Haushälterin nahm ihren Arm und führte sie auf das Haus zu, das nur wenige Schritte hinter dem Gebüsch auf sie wartete. »Nachts«, sagte sie ruhig. »Nur nachts. Tagsüber ist Ihnen erlaubt, sich frei auf dem Gelände zu bewegen.« Sie lächelte schwach. »Sie haben ja selbst gesehen, wie leicht man sich in der Wildnis verlaufen kann. Wenn Sie gestürzt wären und sich verletzt hätten, hätten wir sie so schnell nicht gefunden.«
Annik nickte und sah unbehaglich zu dem neben ihnen hertrottenden Hund. »Er hat mich zu Tode erschreckt.«
Ihre Begleiterin schien amüsiert zu sein. »Das ist seine Aufgabe. Satan bewacht das Anwesen.« Sie nahm ihren Schlüsselbund und öffnete die nun wieder verschlossene Hintertür. »Schlafen Sie gut, Annik.«
5
Als Annik das Haus betrat, war Frau Wouters schon verschwunden, noch nicht einmal der Klang ihrer Schritte war mehr zu hören.
Annik stand eine Weile in dem Gang, in dem ein kalter, seltsam muffig riechender Luftzug sie frösteln machte. Dieses Haus ist ein Grab, dachte sie unwillkürlich. Außer mir lebt hier keine Menschenseele. Ich bin ganz allein …
Sie schüttelte den absurden Gedanken ab und durchquerte schnellen Schrittes die Halle. Sie zögerte vor dem Durchgang zu dem Korridor, in dem ihr Zimmer lag, und wusste, sie würde keinen Schlaf finden. Kurz entschlossen machte sie kehrt und lief die Treppe hinauf, um sich noch etwas zu lesen aus der Bibliothek zu holen.
Erst als sie die Tür öffnete, dachte sie darüber nach, dass sie nicht wusste, wie sie in dem riesigen Raum Licht machen sollte. Dann trat sie ein und blieb verwundert an der Tür stehen: Genau wie bei ihrem ersten Besuch brannten überall kleine Leselampen, deren Licht Tischflächen und Sessellehnen beleuchtete. Kurz fragte sie sich, ob das Licht wohl Tag und Nacht brannte, und wenn ja, warum und für wen.
Sie ging an den hohen Regalen der Türseite vorbei und betrachtete die Buchrücken. Für diese Nacht wäre ihr sogar ein langweiliges, einschläferndes Buch recht gewesen, aber wie es aussah, hatte sie die Qual der Wahl zwischen ihren Lieblingsbüchern. Mit einem Lächeln zog sie einen Band mit flämischen Legenden aus dem Regal. Dieses Buch hatte sie noch vor Kurzem im Laden ihres Vaters in den Händen gehalten. Sie klemmte es unter den Arm und wandte sich zur Schmalseite des Raumes, dort lockte ein weniger repräsentativ gefülltes Regal mit zerlesenen Taschenbuchausgaben. Ein Krimi wäre fein, irgendetwas Englisches, das langatmig und gemütlich daherkam und am Ende einen dozierenden Detektiv präsentierte, der vor einer im Salon versammelten Schar von Verdächtigen den Täter identifizierte.
Sie griff relativ wahllos ein paar der Bücher und sah sich um. Noch einen Liebesroman? Oder Gedichte?
Ihr Nacken begann zu kribbeln, die Härchen stellten sich auf. Sie spürte das unruhige Kratzen von Ybbas’ kurzen Krallen, der sich von ihrer linken Schulter zur rechten bewegte. Er schien beunruhigt zu sein.
Annik atmete tief ein. Jemand beobachtete sie. Sie drehte sich langsam um, musterte den Raum, blickte zur Galerie hinauf. Dort oben war es dunkel. Wenn jemand dort stand, dann konnte er sie wie auf einer Bühne angestrahlt im Licht stehen sehen, ohne dass sie ihn bemerkte.
»Hallo?«, sagte sie. »Wer ist da?«
Sie glaubte, eine Bewegung in der Dunkelheit zu erkennen, aber das war womöglich eine Sinnestäuschung. Sie wartete noch einen Augenblick, dann nahm sie ihre Bücher und verließ den Saal.
Ihren Befürchtungen zum Trotz schlief sie tief, fest und traumlos in dieser Nacht. Das Bett hatte sich einladend und weich gezeigt, das Kissen war glatt und kühl unter ihrer Wange, und sie hatte kein Dutzend Seiten in dem wunschgemäß langweiligen Krimi gelesen, als ihr die Augen zufielen.
Ybbas weckte sie zur rechten Zeit und sie wusste sofort, wo sie sich befand. Die Vorfreude auf den Tag kribbelte in ihren Gliedern. Helles Sonnenlicht fiel ins Zimmer, durch den Fensterspalt drang der Gesang der Vögel.
Sie entschied sich für Jeans und ein T-Shirt. Das war vielleicht nicht ganz das Outfit, in dem der Hausherr sich das Kindermädchen wünschte, aber Elias war ein fünfjähriger Junge und wollte ganz sicher toben.
Ihr Frühstück, bestehend aus einer großen Tasse Milchkaffee und einem Stück Toast, nahm sie im Stehen ein. Sie war zu aufgeregt, um mehr hinunterzubringen. Dann machte sie sich auf den Weg zum Kinderzimmer.
Der freundliche, helle Raum sah genauso aufgeräumt, ja beinahe steril aus wie bei ihrem ersten Besuch. Das Bett war bereits gemacht, der Junge nirgendwo zu sehen. Annik stand ein wenig unschlüssig an der Tür, dann rief sie Elias’ Namen.
Sie durchsuchte das Zimmer. Hatte jemand den Jungen auf einen Spaziergang mitgenommen? War er bei seinem Vater? Warum hatte man ihr nicht Bescheid gesagt und ließ sie hier im Dunkeln tappen?
»Ybbas«, sagte sie, »such Elias.«
Der Gny sprang auf den Boden und rannte über den Teppich. Als er sich dem Schrankkoffer näherte, ging Annik ein Licht auf. Der Junge saß schon wieder in dem Koffer, spielte dort Mäuschen und lachte sein neues Kindermädchen aus. Sie grinste und schlich sich an das möbelgroße Gepäckstück an. »Ich hab dich«, sagte sie fröhlich und kniete nieder, um durch das Loch in der Seitenwand zu blicken. »Guten Morgen, Elias. Möchtest du dein Frühstück?«
Keine Antwort. Sie hörte leise Atemzüge, also war der Junge wirklich dort drinnen. Annik legte sich auf den Bauch und starrte in das Innere des Koffers. In der Ecke kauerte eine kleine Gestalt, das helle Oval eines Gesichtes zeigte in ihre Richtung. Kein Laut, kein Wort.
»Elias«, sagte sie sanft, um ihn nicht zu erschrecken, »ich bin Annik, dein neues Kindermädchen. Erinnerst du dich?«
Er schwieg und regte sich nicht.
»Magst du nicht herauskommen? Es ist schön draußen, wir könnten im Park spazieren gehen oder Ball spielen. Spielst du gerne Ball?« Anniks Verzweiflung stieg. Bisher hatte sie nur Kinder gehütet, die vor Tatendrang platzten und mühsam im Zaum gehalten werden mussten. Das hier war eine Situation, mit der sie nicht umzugehen wusste.
»Wir können auch ganz etwas anderes machen«, fuhr sie fort. »Möchtest du, dass ich dir vorlese? Oder wollen wir die Burg aufbauen?« Sie hatte die Kiste mit dem Spielzeug inspiziert, die Burg war der Traum jedes Kindes.
Keine Reaktion. Sie rappelte sich auf, sank auf die Fersen und starrte den Koffer an. Was sollte sie nun tun? Was wurde von ihr erwartet? Dieses Kind hatte offensichtlich ernsthafte Probleme, es brauchte einen Psychologen, kein Kindermädchen.
»Ich lese dir vor«, entschied sie. Sie nahm das oberste Buch von dem Stapel auf dem Tisch und schlug es auf. »Es war einmal …«, begann sie.
Eine Stunde später legte sie das Buch beiseite. Sie hatte einen trockenen Hals und war müde und frustriert. Elias hatte mit keinem Laut, keiner Bewegung zu erkennen gegeben, dass er ihr zuhörte, dass er anwesend war, dass er überhaupt lebte. Was tat sie hier? Sie stand auf, legte das Buch auf den Stapel zurück und murmelte: »Ich gehe einen Moment raus, Elias.«
Sie ging in Gedanken verloren in die Halle hinunter und stand eine Weile unter dem riesigen Kronleuchter. Am besten würde sie Frau Wouters fragen, was zu tun sei. Die Haushälterin kannte Elias, und sie wusste, wie die bisherigen Kindermädchen mit dem verschrobenen Verhalten des Jungen umgegangen waren. Sie begriff so langsam, wieso das Aufgabenheft so zerfleddert war. Wahrscheinlich hatte keine ihrer Vorgängerinnen länger als zwei oder drei Wochen durchgehalten, oder sie waren alle entlassen worden, weil sie mit Elias nicht zurechtkamen.
Annik straffte die Schultern. Sie würde nicht schon am ersten Vormittag das Handtuch werfen. Ein großes Glas Wasser, ein Apfel und ein paar Minuten Ruhe in der Bibliothek oder im Garten, dann würde sie den Kampf wieder aufnehmen. Außerdem war sie hier, um ein Rätsel zu lösen, und noch wusste sie nicht einmal, wie dieses Rätsel lautete.
In der Küche herrschte große Betriebsamkeit. Nach der Stille und Leere des großen Hauses, an die sich Annik beinahe schon gewöhnt hatte, war es ihr, als beträte sie eine vollkommen andere Welt. Sie schenkte sich ein Glas Wasser ein, nahm einen Apfel aus der Obstschale und verließ das dampfende, heiße, töpfeknallende Inferno fluchtartig.
Annik warf einen Blick in den Garten und entschied, ihren Imbiss lieber im Haus zu sich zu nehmen. Der Garten war einen längeren Ausflug wert, aber dieses Mal bei hellem Tageslicht, denn ihr steckte der nächtliche Ausflug immer noch in den Knochen.
Die Bibliothek war der nächste ihr bekannte Ort, außerdem hatten Bücher eine besänftigende Wirkung auf ihr aufgewühltes Gemüt. Sie schob die Tür auf und fand den Ort so beleuchtet und verlassen wie bei jedem ihrer Besuche.
Annik wählte eine Nische mit einem verschlissenen Lehnsessel, die unter der Galerie lag und auch vom Hauptraum aus nicht einsehbar war. Hier fühlte sie sich sicher und geborgen. Sie zog die Beine unter sich und verspeiste ihren Apfel, während sie nachdachte. Es war wenig wahrscheinlich, dass der weitere Verlauf des Tages sich großartig von seinem Beginn unterscheiden würde. Elias hatte vor, sie zu ignorieren. Sie musste Frau Wouters um Rat fragen, auch wenn ihr das zutiefst widerstrebte.
Annik leckte sich den Saft von den Fingern und seufzte leise. Noch ein paar Minuten, dann würde sie sich der zweiten Runde stellen.
Eine Tür klappte, Schritte und Stimmen waren zu hören. Annik erstarrte, als liefe sie Gefahr, bei etwas Verbotenem ertappt zu werden.
Die Stimmen waren gedämpft, aber gut zu verstehen. Stuhlbeine scharrten, etwas raschelte.
»Ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen«, sagte eine Männerstimme. Sie klang kühl und beherrscht, obwohl es doch Worte des Unmuts und Tadels waren. »Sie kennen doch meine Wünsche, Wouters. Wie konnten Sie dieses zerrupfte Küken einstellen? Schicken Sie es zurück in sein Nest. Geben Sie ihm meinetwegen den Lohn für die gesamte Woche, aber schicken Sie das hässliche Hühnchen weg.«
Annik hielt den Atem an. Redete der Mann etwa über sie?
Die Haushälterin protestierte höflich. »Mijnheer«, sagte sie so sanft, wie Annik die resolute Frau noch nie hatte sprechen hören, »glauben Sie mir, dass ich eine sehr wohldurchdachte und sorgfältige Wahl getroffen habe. Sie kennen mich …«
»Ich kenne Sie, Wouters, ja«, unterbrach der Mann schroff. »Deshalb bin ich umso verwunderter. Dieses Mädchen ist ungeeignet. Sie ist zu jung und zu unerfahren. Hat sie überhaupt schon die Schule verlassen?«
»Sie wird im Herbst mit dem Studium beginnen, Mijnheer. Und sie ist die Tochter eines Buchhändlers aus der Spoorstraat. Sprechen Sie doch erst einmal mit ihr, bevor Sie sie fortschicken.«
»Buchhändler.« Die Stimme des Mannes klang abschätzig. »Nun gut, dann kann sie wenigstens lesen. Meinetwegen, Wouters, schicken Sie das hässliche Hühnchen heute Nachmittag zu mir. Ich sehe sie mir an.« Schritte und Stimmen entfernten sich, dann setzten die beiden im Nebenraum die Unterhaltung fort. Es ging um die Unordnung in der Bibliothek und die Frage, wer vom Personal dazu abgestellt werden konnte, gründlich aufzuräumen.
Annik zitterte vor Empörung. Wie konnte dieser Mann so abfällig über sie reden und sie verurteilen, ohne je ein Wort mit ihr gesprochen zu haben? Einen Moment lang wünschte sie sich sehnlichst, ihm ihre Kündigung vor die Füße zu knallen. Dann fiel ihr ein, dass sie nicht aus eigenem Antrieb hier war, sondern eine Aufgabe zu erfüllen hatte, und wenn ihr das misslang, würde man ihr den Studienplatz verweigern. Sie biss die Zähne zusammen. Sie musste dafür sorgen, dass der arrogante Mijnheer sie mochte, sonst würde er sie entlassen. Das konnte sie sich nicht leisten und sie hatte nicht vor zu betteln.
Mit diesem Gedanken kehrte sie ins Kinderzimmer zurück und widmete den Nachmittag dem vergeblichen Versuch, das Kind aus seinem Koffer zu locken.
6
Mijnheer van Leuven saß mit lang ausgestreckten Beinen in einem Sessel, hielt ein Glas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit in den schlanken Fingern und sah sie an.
Seine Augen hatten eine undefinierbare Farbe, hellbraun und gleichzeitig tot wie kalter Tee. Sein Blick war so eisig, dass sie unwillkürlich fröstelte.
Das aschblonde Haar kontrastierte seltsam mit seinen dunklen Augenbrauen. Er war elegant gekleidet, aber seine gesamte Erscheinung wirkte vernachlässigt, genau wie das Haus. Das Haar war ein wenig zu lang und ein bisschen zu zottelig, die Wangen und das Kinn waren unrasiert, der dunkelblaue Anzug, so elegant er auch war, erschien zerknittert, das Hemd unter der Weste stand am Kragen offen, und die Ärmel waren ein Stück aufgekrempelt und zeigten ein Paar muskulöse Unterarme.
Der Zug um seinen Mund zeugte von Verdrossenheit und einem müden Zynismus, der sich im Blick seiner Augen zu arktischer Kälte verdüsterte. Er musterte sie unfreundlich und mit unverkennbarer Arroganz. Er war weitaus jünger, als sie vermutet hatte. Seine herrische Art hatte ihr suggeriert, er sei ein gutes Stück jenseits der dreißig, aber Gabriel van Leuven schien höchsten Ende zwanzig zu sein, nur zwei oder drei Jahre älter als Lily, ihre älteste Schwester.
Annik hob das Kinn und erwiderte den kalten Blick nicht minder hochmütig. Er wollte, dass sie ging? Nun, das würde er ihr ins Gesicht sagen müssen.
»Sie sind Annabelle Joncker.« Er warf einen gelangweilten Blick auf die Papiere, die neben seinem Ellbogen auf der Sessellehne lagen.
»Ja«, erwiderte sie kurz.
Er musterte sie nun unverwandt mit diesen toten Augen und nippte an seinem Drink. »Wie kommen Sie mit Elias zurecht?«
Diese Frage war ihr nach einem Tag voller vergeblicher Bemühungen äußerst unangenehm. Sie verankerte die Füße am Boden und erwiderte unbeirrt den eisigen Blick. »Er ist schwierig«, sagte sie unverblümt. »Ich habe den ganzen Tag versucht, ihn aus seinem Koffer zu locken, aber er redet nicht mit mir und reagiert auf keine Ansprache. Der Junge braucht einen Arzt, wenn Sie mich fragen.«
Er schnaubte ein humorloses Lachen aus. »Und habe ich Sie das gefragt?«
Annik presste die Lippen zusammen. Sie hielt seinem Blick stand, obwohl ihre Knie zu zittern begannen. Was für ein widerwärtiger Mensch dieser Gabriel van Leuven war!
»Habe ich Sie das gefragt, Fräulein Annabelle?«, insistierte er.
»Nein, Mijnheer«, knirschte sie zwischen den Zähnen hervor.
Er hob süffisant eine Braue. Es war verblüffend, dass keinerlei Regung seiner Mimik einen Funken Leben in seinen toten Blick brachte. Es war, als sähe man einer Puppe dabei zu, wie sie vorgab, ein Mensch zu sein. In seinem Blick lag keine Seele, keine Wärme und kein Schimmer eines menschlichen Empfindens. Eine Schlange würde sie so ansehen, ein Skorpion oder ein Tiefseefisch – fremd, kalt und ohne jede Sympathie. Sie raffte ihren schnell schwindenden Mut zusammen und sagte: »Mijnheer van Leuven, ich weiß, dass Sie mir nicht zutrauen, diese Arbeit zu tun. Ich möchte Ihnen versichern, dass ich sehr wohl dazu in der Lage bin, auf Ihren Sohn aufzupassen. Ich habe mit zwölf das erste Mal Nachbarskinder gehütet und seit meinem dreizehnten Lebensjahr führe ich meinem verwitweten Vater den Haushalt und seine Geschäftsbücher. Ich bin kein dummes Küken.« Sie schloss den Mund und sah ihn geradeheraus an. Wenn er sie hässlich fand, war das seine Sache, das ging sie nichts an. Sie wusste, dass sie keine Schönheit war wie ihre Schwestern und ihre Mutter. Der Gedanke schmerzte nur ein wenig, denn sie hatte sich mittlerweile damit abgefunden.
Er lächelte. Es war ein schmales, kühles Lächeln, aber immerhin die erste Regung, bei der sein kalter Blick sich beinahe unmerklich zu erwärmen schien. »Sie sind erstaunlich dreist«, sagte er. »Ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt.«
Annik hob die Braue und versuchte, ebenso arrogant und dünkelhaft zu blicken wie er. »Das müssen Sie wissen, Mijnheer«, sagte sie kühl. »Ich bin hier, um mich um Elias zu kümmern. Er wirkt vernachlässigt. Vielleicht braucht er seinen Vater?«
Sein Gesicht verschloss sich erneut. Er trank und sah an ihr vorbei. »Dann gehen Sie und tun Ihren Job«, sagte er schroff. »Ich erwarte täglich Ihren Bericht. Um diese Zeit, hier in meinem Arbeitszimmer.« Er senkte den Blick auf die Zeitung in seinem Schoß. Wie es schien, war sie entlassen. Für den Moment.
7
Er musste sie fortschicken. Wenn er jemals etwas klar gesehen hatte, dann war es das. Sie durfte nicht bleiben.