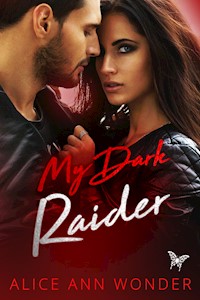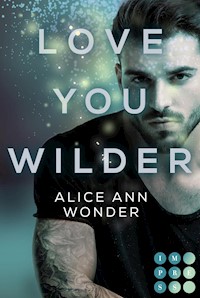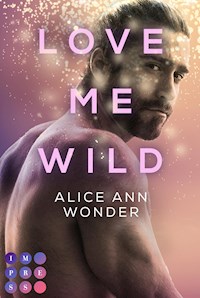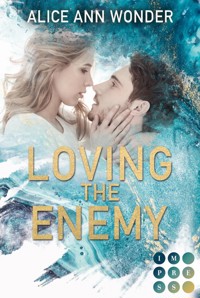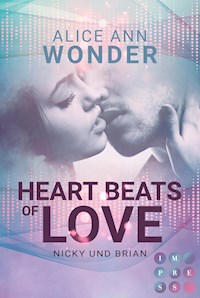
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Bad Boy oder Good Guy?** Nicky muss zur Strafe für einen Diebstahl, den sie eigentlich gar nicht begangen hat, sechs Wochen in ein Heim für Jugendliche. Mitten im Nirgendwo lernt sie nicht nur die Ruhe schätzen, die der Ort ausstrahlt, sondern auch die anderen Bewohner. Nur aus Brian wird sie nicht schlau. Der Halb-Ire geht ihr vom ersten Moment an unter die Haut. Immer wieder aufs Neue lässt er sie ein heiß-kaltes Wechselbad der Gefühle durchleben: In der einen Sekunde schroff, ist er in der nächsten zuvorkommend. Gerade noch wirft er ihr einen bösen Blick zu, kurz darauf rettet er sie aus einer brenzligen Situation. Und dann ist da noch dieses Geheimnis, das er mit sich trägt und Nicky fieberhaft zu ergründen versucht … //»Heartbeats of Love. Nicky und Brian« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Alice Ann Wonder
Heart Beats of Love. Nicky und Brian
**Bad Boy oder Good Guy?**Nicky muss zur Strafe für einen Diebstahl, den sie eigentlich gar nicht begangen hat, sechs Wochen in ein Heim für Jugendliche. Mitten im Nirgendwo lernt sie nicht nur die Ruhe schätzen, die der Ort ausstrahlt, sondern auch die anderen Bewohner. Nur aus Brian wird sie nicht schlau. Der Halb-Ire geht ihr vom ersten Moment an unter die Haut. Immer wieder aufs Neue lässt er sie ein heiß-kaltes Wechselbad der Gefühle durchleben: In der einen Sekunde schroff, ist er in der nächsten zuvorkommend. Gerade noch wirft er ihr einen bösen Blick zu, kurz darauf rettet er sie aus einer brenzligen Situation. Und dann ist da noch dieses Geheimnis, das er mit sich trägt und Nicky fieberhaft zu ergründen versucht …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Alice Ann Wonder, bürgerlich Anika Pätzold, wurde 1990 in Arnstadt geboren. Schon früh konnte sie ihr erstes Lieblingsbuch auswendig aufsagen. Seit 2019 veröffentlicht sie selbst Romane. Sie reist gern quer durch die Welt – am liebsten dorthin, wo es warm ist – hört jeden Tag Hörbuch und liebt es, zu tanzen.
Das Leben ist nicht das, was man gelebt hat, sondern das, woran man sich erinnert und wie man sich daran erinnert.
(aus: »Cien años de soledad«, (Hundert Jahre Einsamkeit) von Gabriel García Márquez)
Prolog
Es heißt, dass man die glücklichste Zeit seines Lebens erst dann zu schätzen weiß, wenn sie längst vorüber ist. Befindet man sich mittendrin, erkennt man den Wald vor lauter Bäumen nicht … Oder so ungefähr. Ich hielt das immer für Schwachsinn. Natürlich würde ich es merken, wenn mir etwas so Fantastisches widerfährt, dass ich mich auf einmal anders fühle als bisher. Wem würde so was schon entgehen?
Tja, so viel zur Theorie.
Heute, Jahrzehnte später, weiß ich, wie blind man oft für das Glück ist, wenn es direkt vor einem steht und einen an der Nase kitzelt, besonders, wenn man jung ist.
October. Wie sehr ich wünschte, die Zeit zurückdrehen zu können, um noch ein allerletztes Mal, diesen magischen Ort zu besuchen, so wie er einst war – wie wir waren.
Ich vermisse dich und das, was wir hatten. Damals im October, in der Nähe von Kassel, eingekesselt in einem schier endlosen Wald, habe ich dich gefunden.
1
Ich sah dem blonden Pferdeschwanz meiner Mutter zu, wie er von einer Seite zur anderen wippte, während wir den Schotterweg hinauf zum Ende der Welt fuhren.
Jana Dittel war genauso sportlich und jung, wie es die hohe Position ihres Zopfes vermuten ließ. Wenn man uns zusammen sah, kam man im Leben nicht auf den Gedanken, dass wir verwandt sein könnten. Meine Mutter – eine nordische Schönheit, die mit ihren einundvierzig Jahren noch immer viel vom Glanz eines Supermodels hatte – und ich, mit meinem rabenschwarzen Haar, der jungenhaften Figur und den viel zu großen Augen. Ob ich adoptiert sei, hatte Lena, meine beste und einzige Freundin damals gefragt. Nicht dass ich wüsste, hatte ich geantwortet, woraufhin Lena meinte, dass Mam die hübscheste Frau war, die sie jemals gesehen hatte. Zu dumm, dass sie mir die guten Aspekte ihres Genpools vorenthalten hatte!
Damals war mir das noch nicht so wichtig gewesen. Erst als ich älter wurde, hatte es mich ein bisschen geärgert, dass Tobias P., der einzige Junge, für den ich während der Mittelstufe geschwärmt hatte, bei Schulveranstaltungen nur Augen für meine Mutter statt für mich gehabt hatte.
»Hast du noch andere Schuhe mitgenommen? Nicky?«
Die Stimme von Jana drang von irgendwo weit weg an mein Ohr und riss mich aus meinen Gedanken. Mit einem kurzen Blick auf meine ramponierten Chucks sagte ich: »Ich gehe da nicht auf einen Schönheitswettbewerb!« Mam gab ein theatralisches Stöhnen von sich, so wie sie das immer tat, wenn sie enttäuscht war.
»Dieses Mädchen«, murmelte sie kopfschüttelnd, »lieber Herrgott! Womit habe ich das verdient?« Das war eine rhetorische Frage. Ich verdrehte die Augen, während ich mich ein bisschen tiefer in den Sitz sinken ließ und aus dem Fenster starrte.
Die strenge Gläubigkeit meiner Mutter war vielleicht das Interessanteste an ihr. Nicht dass ich ihre früheren Erfolge als Miss Deutschland, Miss Bayern und Miss Oktoberfest (auch »Wiesn-Playmate« genannt) nicht würdigte. Dann waren da noch ihre unzähligen Modeljobs und TV-Auftritte. Meine Mutter hatte es weit gebracht für ein ehemaliges Kleinstadtmädchen aus ärmlichen Verhältnissen. Trotzdem nervte es mich, dass sie ständig versuchte, ihre Besessenheit von Äußerlichkeiten auf mich zu übertragen. Wenn sie mir am Abend jedoch das Tagesgebet vorlas, waren all die Zankereien der vergangenen Stunden schnell vergessen. Zwar tat ich meistens, als wären mir die Psalmen zuwider, aber insgeheim mochte ich es, dass ihr Glaube an Gott genauso unerschütterlich war, wie ihr schwarzes ultra-starkes Taft-Haarspray. Davon abgesehen, dass ich im Moment wegen meiner Bänderdehnung eh keine hochhackigen Schuhe hätte tragen können, besaß ich auch keine.
»Schmollst du etwa?« Mam warf einen kritischen Blick in den Rückspiegel. »Nicky!«
Ich schüttelte den Kopf, ohne sie dabei anzusehen.
»Wieso sollte ich? Etwa, weil ich ins Heim abgeschoben werde?«
»Sei nicht albern!«, erwiderte sie. Die Schotterstraße wurde unterdessen immer schmaler und die Bewaldung dichter. Hätte ich gewusst, dass die Einrichtung mitten in der Pampa sein würde, hätte ich mich nie darauf eingelassen den Sommer an diesem Ort zu verbringen! Andererseits konnte ich nur hier das notwendige Übel mit einer Sache verbinden, die ich unbedingt vor dem Umzug nach England hinter mich bringen musste.
»Du wolltest doch immer ins Heim!«, kommentierte Jana mit einem Hauch Genugtuung in der Stimme.
Ich nagte an meiner Unterlippe, bevor ich »Kein Wunder, bei zwei Sozialpädagogen als Eltern!« grummelte. Richtig, Mam hatte vor einer Weile ein Fernstudium begonnen. Sie wollte Mal etwas Neues ausprobieren! Schließlich hatte sie gerade erst die Mitte ihres Lebens erreicht!, so ihre Begründung. Weshalb sie sich ausgerechnet die gleiche Profession wie Dad ausgesucht hatte, war mir ein Rätsel. Ihre Wahl hatte nicht bei allen Familienmitgliedern Anklang gefunden, so viel stand jedenfalls fest.
»Dein Vater fühlt sich bedroht«, hatte sie mir erklärt, nachdem vor einigen Wochen deswegen wieder einmal ein Streit ausgebrochen war. Dad hatte kein Verständnis für ihre Hirngespinste, wie er sie nannte. Seiner Meinung nach sollte Mam lieber das tun, womit sie bereits die erste Hälfte ihres Lebens zugebracht hatte: Kaffeeklatsch, hier und da eine Wohltätigkeitsveranstaltung und den Haushalt. Ich verstand nicht, was so schlimm daran sein sollte, dass sie sich weiterentwickeln wollte, aber das ging mich ja auch nichts an. Es ist einzig und allein meine Sache, hatte sie Dad an den Kopf geknallt und damit hatte sie vermutlich recht.
Der Anflug eines Lächelns huschte über das Gesicht meiner Mutter. Es gefiel ihr, dass ich ihre neue Berufung anerkannte und darüber war ich froh. Sosehr sie mich die meiste Zeit über auch nervte – sie verdiente es, unterstützt zu werden, so wie sie das bei Dad und mir auch stets getan hatte.
»Dein Vater und ich haben das zusammen entschieden«, schob sie jetzt noch hinterher, um wieder auf meinen sechswöchigen Aufenthalt im Heim zurückzukommen. »Wenn du wiederkommst, ist der Umzug gemacht und alles fix und fertig!« Ich atmete tief ein und wieder aus, weil ich jetzt keine weitere Rechtfertigung dafür gebrauchen konnte, dass ich für die nächste Zeit hier sein würde. Ich hatte meine Strafe akzeptiert.
Außerdem konnte ich gut auf die Streitereien meiner Eltern verzichten, während sie alles für unsere Reise über den Ärmelkanal vorbereiteten. Dad hatte vor einer Weile eine neue Stelle in einer Londoner Schule angenommen, weshalb sich nun für uns ein neuer Lebensabschnitt auftat.
Ich hatte Glück, dass das nächstgelegene Heim praktisch neben der Stadt lag, in der mein langjähriger Onlinefreund wohnte. Was ihn und England anging, hatte ich einen überlebenswichtigen Plan!
»Schon gut, Mam«, beschwichtigte ich sie und runzelte die Stirn, als langsam aber sicher eine Gebäudeformation aus drei sonnengelben Backsteinhäusern auf einer Lichtung auftauchte. Das ist es also, dachte ich und rutschte ein bisschen hoch, um einen besseren Blick auf meine neue Bleibe zu werfen.
»Wenigstens hast du hier genug Zeit, um deine Freundschaft mit dieser Lena einmal gründlich zu überdenken!« Ich biss die Zähne aufeinander und stöhnte. Warum musste sie nach all den Jahren von meiner besten Freundin immer noch so sprechen, als hätte ich sie eben erst kennengelernt?
»Sie ist kein guter Umgang! Deine Zukunft steht auf dem Spiel!« Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen und sog einen langen Atemzug ein, um nicht irgendetwas von mir zu geben, was ich später vielleicht bereute.
»Es wird nicht wieder vorkommen, das sagte ich doch bereits«, versicherte ich meiner Mutter. »Außerdem haben wir bald ein ganzes Meer zwischen uns. Du brauchst dir also nicht weiter den Kopf darüber zu zerbrechen!« Bei diesem Gedanken zog sich etwas in meiner Brust zusammen. Lena war mehr als nur eine Freundin für mich – sie war wie die Schwester, die ich nie hatte. Meine bessere Hälfte – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Im Gegensatz zu mir war Lena beliebt. Sie hatte eine Wahnsinnsausstrahlung, trug ihr Herz auf der Zunge und fürchtete sich vor nichts und niemandem. Ich bewunderte sie, das war schon immer so gewesen. Ihr allein hatte ich es zu verdanken, dass ich während unserer bisherigen Schulzeit nicht zum Mobbingopfer geworden war. Ich war ihre beste Freundin und stand unter ihrem Schutz. Es war nur logisch, dass mir der Arsch ganz schön auf Grundeis ging, wenn ich daran dachte, wie ich bald ohne sie in einer neuen Schule zurechtkommen musste.
»Das kannst du gar nicht oft genug sagen! Klauen! So habe ich dich nicht erzogen!«
Mam schnaubte und ich bohrte meine Fingernägel in meine Handflächen. So gingen wir, jeder für sich, mit unserem Ärger um. Ich war heilfroh, als sie den Wagen zum Stehen gebracht hatte, so dass ich aussteigen konnte.
»Das müsste es sein«, sagte Mam mehr zu sich selbst, als zu mir. »Nummer drei.«
»Ganz schön … gelb«, stellte ich mit kritischem Blick auf das fünfstöckige Gebäude vor uns fest. Es hatte rechts und links zwei kleine Türmchen und einen größeren in der Mitte, weshalb es wie eine Miniaturausgabe eines Schlosses aussah.
»Sieht doch hübsch aus!«, meinte Jana und stemmte die Hände in die Hüften. Ich lief unterdessen zum hinteren Teil unseres Wagens, um mein Gepäck zu holen.
»Wenn du meinst.«
Mit einem Ruck hievte ich meinen Koffer heraus und schnappte mir anschließend noch meine Umhängetasche von der Rückbank. So stand ich da und schaute bis ganz nach oben an die Spitze des mittleren Turms.
Ich hatte im Internet nicht viel über das Heim gefunden: Es gab keine Webseite, lediglich eine Adresse und eine Telefonnummer. Auch das Haus – besser gesagt die Häuser – wirkten, als wären sie zuletzt irgendwann Anfang der Neunziger überholt worden. Es gab drei Gebäude. Eins stand einzeln, die anderen beiden ihm gegenüber. Zwischen ihnen befand sich ein Schotterplatz. Umringt wurden die Häuser von einem dichten, gemischten Wald, in den – soweit ich das sehen konnte – nur ein Trampelpfad führte.
»Willst du nur dastehen oder gehen wir jetzt rein?«, fragte Mam und forderte mit einem Nicken in Richtung des Hauses Nummer drei, dass ich mich in Gang setzte.
»Komme ja schon«, entgegnete ich und wandte meinen Blick von dem Pfad ab, der ins Dunkle führte.
Ich lief einige Schritte hinter meiner Mutter auf den Pflastersteinen, die den Weg von den Parkplätzen zum Gebäude markierten. Auf halber Strecke fiel mir ein, dass ich meinen Comic auf der Rückbank hatte liegen lassen.
»Hab was vergessen«, rief ich Mam zu und machte eine Kehrtwendung, um noch einmal zum Auto zu rennen. Nach einigen Schritten stellte ich fest, dass ich noch den Schlüssel brauchte.
»Beeil dich«, ermahnte mich Jana, als sie ihn mir überreichte. »Ich will meinen Flieger nicht verpassen.«
Ich nickte und rannte los. Als ich das Heft hatte, schlug ich die Tür etwas zu kräftig zu, weshalb ich mir abermals einen Tadel von meiner Erzeugerin einhandelte.
»Langsam! Wie oft denn noch, Nicky?«, sagte sie im Ton einer strengen Oberschullehrerin, den sie sich schnell angelernt hatte.
»Ja, Mam«, pflichtete ich ihr bei und musste mir große Mühe geben, nicht zu genervt zu klingen.
Ich war damit beschäftigt, meinen gar nicht mal so leichten Koffer zu bugsieren, da tauchte plötzlich, wie aus dem Nichts, ein großer, dunkelblonder Typ auf, der quer über die Wiese gegangen sein musste und jetzt beinah mit mir zusammengestoßen war.
»Pass doch auf«, maulte er mich in aggressivem Tonfall an. Sein wütender Blick ging mir durch Mark und Bein.
»’tschuldigung«, sagte ich sehr viel leiser als er und leider nicht patzig genug, obwohl ich es nicht in Ordnung fand, dass er mich so dumm anmachte. Meine Tasche rutschte mir von der Schulter, als er – keinen Meter von mir entfernt – an mir vorbeistiefelte. Irgendetwas verleitete mich dazu, mich noch einmal nach ihm umzudrehen. Ich rechnete damit, seinen in ein schwarzes Hoodie gehüllten Rücken zu sehen.
Stattdessen traf mich sein langer kalter Blick, der mich glauben ließ, dass ihm meine bloße Existenz zuwider war. Was hatte dieser Kerl für ein Problem?
So schnell ich konnte, wandte ich mich wieder um und folgte meiner Mutter, der meine Beinahekollision mit der Unfreundlichkeit in Person entgangen zu sein schien.
Ich hoffte, ja ich betete inständig, dass nicht alle Heimkinder hier so aggro waren wie der Idiot eben.
»Du hast was verloren!«
Seine raue Stimme ließ mich erschaudern. Sie klang jetzt weniger wütend, weshalb mir auffiel, wie voll und reif sie wirkte. So als wäre er mindestens fünfundzwanzig und nicht siebzehn – was er aber höchstens sein konnte, denn sonst wäre er wohl kaum noch hier.
Jetzt schaute auch Jana zu mir. Sie wackelte auffordernd mit den Augenbrauen, weil ich ewig brauchte, bis ich mich rührte. Ich atmete ein und dann wieder aus, bevor ich mich langsam umdrehte.
Es stimmte wirklich. Ich hatte mir das eben nicht bloß eingebildet: Er sah aus wie ein Rockstar, den sein Äußeres nicht interessierte. Sein Kinn war markant, die Nase viel zu gerade und die Augen wiesen ein so intensives Grün auf, dass es regelrecht künstlich wirkte.
»Ist dir eben runtergefallen«, bemerkte er und reichte mir mein Witch-Comic. Oh nein, ausgerechnet das! Konnte es nicht wenigstens eins von den Avengers sein oder Superman – irgendetwas Cooleres? Jetzt hielt er mich bestimmt für ein unreifes, kleines Mädchen!
Ich versuchte ihn nicht zu auffällig anzustarren, während ich auf ihn zuging, aber das war wirklich schwer, denn er war einfach zu schön. Der war genau die Art von Junge, die mich zu Hause in G. nicht einmal mit dem Hintern angeguckt, geschweige denn mit mir geredet und mich darauf aufmerksam gemacht hätte, dass mir ein Comic aus der Gesäßtasche gefallen war. Vielleicht war er ja doch nicht so übel!
Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren, ermahnte ich mich, während ich gespielt lässig einen Schritt vor den anderen setzte. Innerlich war ich steif wie ein Brett und als ich ihn beinahe erreicht hatte, stolperte ich über einen herausragenden Stein und fiel mit den Händen zuerst auf die Pflastersteine.
»Autsch!«, stieß ich aus, während ich mich ungeschickt wieder aufrichtete. Diese blöde Bänderdehnung! Ich hatte sie mir beim Fußballspielen mit unseren Nachbarn zugezogen. Eine Bandage brauchte ich laut Arzt nicht mehr und normalerweise tat auch nichts mehr weh. Trotzdem war der Fuß wohl noch immer nicht wieder völlig in Ordnung. Anders konnte ich mir meine Tollpatschigkeit jedenfalls nicht erklären. Hinter mir hörte ich meine Mutter »Ist alles in Ordnung, Schatz?« rufen, was das Maß an Peinlichkeit zum Überlaufen brachte.
»Hier!«
Irritiert blickte ich nach oben und da war er – der viel zu attraktive, viel zu coole Typ, der mir die Hand entgegenstreckte. Als ich zögerte, sagte er: »Ist nur ne Hand.«
»Geht schon«, wehrte ich sein Angebot ab und richtete mich aus eigener Kraft wieder auf. »Hast du dir wehgetan?«, plärrte Mam und ich war heilfroh, dass sie nicht auch noch herkam.
»Nein!«, brüllte ich zurück, obwohl sie so weit nun auch wieder nicht entfernt stand.
»Neu?«, fragte der ganz in Schwarz gekleidete Kerl und seine Lippen umspielte ein Lächeln, als ich nach meinem Comic griff.
»Auf der Durchreise«, antwortete ich zögerlich und hielt mir das dünne Heft schützend vor den Oberkörper. Ich umklammerte es fest, während ich seinem Blick auswich, damit mir nicht noch schwindelig würde.
Es musste an seinen Augen liegen … Die Farbe wirkte so surreal!
Trug er vielleicht Kontaktlinsen?
»Du blutest.«
Ich runzelte die Stirn und schaute ihn fragend an. Er machte eine Kinnbewegung in Richtung meiner Brust. Als ich an mir herunterschaute, bemerkte ich, dass er Recht hatte. Meine linke Hand war aufgeschürft, mein himmelblaues Shirt und mein Witch-Heft mit meinem Blut durchtränkt. Mist!
»Wofür gibt’s Waschmaschinen?«, sagte ich hastig und mit einem flüchtigen Lächeln, bevor ich mich schleunigst umdrehte.
»Das würd ich dem Heft eher nicht antun!«, erklang seine dunkle Stimme hinter mir. Ich schluckte. Natürlich hatte ich nur mein T-Shirt gemeint! Was für ein Besserwisser!
Ohne mich ein weiteres Mal nach ihm umzusehen, ging ich auf meine Mutter zu und bedeutete ihr, dass wir jetzt reingehen konnten.
»Der war aber lecker!«, sprach Mam in ihrer üblichen unverblümten Art.
»Nicht so laut!«, zischte ich und zog entschlossen an ihrem Arm.
Was für ein Einstieg! Gott sei Dank würde ich nur sechs Wochen hierbleiben. Es konnte mir also egal sein, ob ich mich blamiert hatte und bei wem, denn schon bald würde sich niemand mehr an mich erinnern. Perfekt, sagte ich mir im Stillen, während Mam und ich durch den Torbogen hindurchgingen, der die Schwelle zu den Treppen markierte, die zur Haustür von Gebäude Nummer drei führten.
Als Jana die Klingel drückte, fiel mir das Messingschild daneben ins Auge. October war darin in verschnörkelten Lettern eingraviert.
October, wiederholte ich in Gedanken und lächelte, als eine korpulente Frau mit langen, kastanienbraunen Haaren und einem herzlichen Lachen die Tür öffnete.
2
Die Frau stellte sich als Heidi vor. Ihr Lächeln war breit und warm und sie hatte volle Lippen und sehr gerade Zähne.
»Na, dann kommt mal rein«, empfahl sie, nachdem Mam uns vorgestellt hatte.
»Wie war denn die Fahrt? Haben Sie uns gut gefunden?«
»Doch, doch«, versicherte Jana und sah mit staunendem Ausdruck im Gesicht in Richtung Decke, die – zugegeben – ganz schön beeindruckend war. Man konnte bis nach oben unters Dach sehen. Die braunen Balken, die sich in der Mitte trafen, hatten etwas Gemütliches und zugleich Majestätisches. Links von uns führte eine Treppe in die oberen Stockwerke, die mit einem Holzgeländer gesäumt war. Im ersten Stock gingen vier Zimmer von dem offenen Flur in den hinteren Teil des Hauses ab, im zweiten drei. Im vierten Stockwerk befand sich nur eine einzige Tür.
Das muss das Turmzimmer sein, dachte ich.
»Wir haben ein Navi. Alles kein Problem«, fügte Mam an und lächelte. Heidi nickte zufrieden.
»Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Kuchen haben wir auch.«
Jana schob die Finger unter den Henkel ihrer geschulterten Handtasche.
»Danke, nein«, lehnte sie ab. »Ich habe nicht viel Zeit.« Nur ich wusste, dass meine Mutter den Kuchen selbst dann nicht anrühren würde, wenn sie ein Jahr hierbliebe. Jana Dittel hatte nämlich etwas gegen überflüssige Kalorien. Es war mein Glück, dass ich essen konnte, was ich wollte, ohne zuzunehmen. Ansonsten wäre mein Leben sicher um einiges anstrengender gewesen, weil meine Mam mich Kalorientabellen auswendig lernen lassen und jeden zweiten Tag mit der Trillerpfeife an meinem Bett stehen würde, um mit mir Sport zu treiben.
»Was ist mit dir?«, erkundigte sich Heidi mit so viel Herzlichkeit in der Stimme, dass ich sie gleich mochte. Im Gegensatz zu Jana sah sie aus, als ob sie gerne mal ein, zwei Stückchen Kuchen aß. Ich erklärte Heidi, dass ich keinen Hunger hätte, woraufhin sie abermals freundlich nickte.
»Später vielleicht«, sagte ich. »Falls das dann noch möglich ist.«
»Aber natürlich!«, antwortete sie beschwingt. »Warum denn nicht?«
»Na ja«, druckste ich und schloss die Hand ein bisschen fester um den Henkel meines Koffers, »gibt’s hier keine festen Essenszeiten?«
Heidi schmunzelte und strich sich den langen Zopf von der Schulter.
»Gibt es«, gab sie strahlend zurück. »Aber so genau nehmen wir’s damit nicht.«
Es fühlte sich schön an, als sie mir zuzwinkerte. Ich lächelte. So übel würde es hier vielleicht gar nicht werden!
»Also dann«, Heidi deutete zur Treppe, »immer der Nase nach!«
Sie zeigte uns den Büroraum für die Betreuungskräfte, von dem noch ein weiteres Zimmer abging, in dem der Diensthabende übernachtete. »Und das ist die Bücherei«, erklärte sie und öffnete die Tür neben dem Büro, kurz vor der Treppe.
»Sie mag nur Comics«, kommentierte meine Mutter, was mir furchtbar unangenehm war.
»Gar nicht wahr«, entgegnete ich ohne nachzudenken, dabei hatte Jana mit ihrer Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen. Allerdings wollte ich nicht, dass Heidi (oder sonst wer) dachte, ich sei nicht gebildet, deshalb behielt ich meine Buchaversion in der Regel lieber für mich.
Die Bücherei war klein und einladend. In der Mitte des mit Teppich ausgelegten Raumes stand ein weinroter Ohrensessel mit einem Schemel davor. Die zwei Fenster hatten breite Bretter auf denen man sitzen und in den Wald schauen konnte. Wären mir Bücher näher, würde ich es ganz sicher lieben, mich hier mit einem dicken Wälzer niederzulassen und so zu tun, als wäre diese Welt in Worten ganz real und ich ganz dort. Vielleicht könnte ich mich ja von Zeit zu Zeit mit einem Comic hier verkriechen?
»Kommst du, Nicky?«, fragte Jana und ich bemerkte erst jetzt, dass sie und Heidi schon wieder im Flur standen und auf mich warteten.
»Klar«, antwortete ich und ließ noch einen letzten Blick über die deckenhohen Regale schweifen. Kaum hatte ich die Tür hinter mir zugezogen, begrüßte mich ein Kerl, der etwa in meinem Alter war.
»Hi!«
»Das ist Stevie!«, erklärte Heidi, eine Hand bereits am Treppengeländer.
»Ich kann mich auch selbst vorstellen«, warf Stevie ein und reichte mir seine Hand. Sein Gesicht war mit Sommersprossen übersät. Als nächstes fielen mir seine Haare auf, da sie neben einem knalligen Orange auch eine Afrostruktur aufwiesen. Sein Lächeln wirkte einladend und offen.
»Nicky«, erwiderte ich, während ich ihm die Hand schüttelte. Stevie machte den Mund auf, weil er offenbar etwas entgegnen wollte, da unterbrach ein Zetern den Moment. Als ich mich umdrehte, entdeckte ich einen Jungen, der neun oder zehn Jahre alt sein mochte. Er war gerade zur Tür hereingekommen, unter dem Arm trug er ein ramponiertes Skateboard.
»Was ist passiert?«, wollte Heidi wissen und beugte sich zu dem heulenden Kleinen hinunter.
»Er hat es kaputt gemacht!«, plärrte der Junge. Sofort kam mir das Bild von dem unfreundlichen Typen von vorhin in den Kopf. Heidi legte tröstend eine Hand auf seine Schulter.
»Wer?«
Der Junge schluchzte noch einmal besonders theatralisch, bevor er »Christian« ausstieß. Christian, das ist also sein Name.
»Warum müsst ihr zwei euch auch immer an die Köpfe kriegen?«, erwiderte Heidi, während sie dem Jungen einmal durchs Haar wuschelte.
Ich schmunzelte, als sich der Dreikäsehoch mit dem obligatorischen »Er hat angefangen!« rechtfertigte.
»Hey«, sagte ich vorsichtig und lächelte ein bisschen. Der Kleine schien mich erst jetzt, als ich mich ebenfalls zu ihm herunterbeugte, so richtig zu bemerken. »Ich weiß vielleicht, wie du das wieder hinbekommst«, erklärte ich und erntete dafür weit aufgerissene Augen. »Ein Gewindeschneider wäre gut.«
Ein kurzer Blick auf sein Brett ließ erahnen, dass das Gewinde an den Achsenmuttern hinüber war.
»Woher weißt du das?«, platzte es aus ihm heraus.
Ich deutete ein Grinsen an, bevor ich antwortete: »Wieso – weil ich ein Mädchen bin?«
»Ja!«, entgegnete er geradeheraus.
Ich seufzte, während ich mich wieder aufrichtete.
»Stell dir vor, es gibt Mädchen, die Skateboard fahren«, sprach ich, noch immer mit dem Anflug eines Lächelns auf den Lippen.
Mein sehr viel jüngeres Gegenüber zog die dunklen Brauen nach oben und musterte mich skeptisch.
»Du?«, fragte er langgezogen.
»Möglich«, erwiderte ich betont beiläufig.
»Patrick, jetzt lass das Mädel doch erst mal ankommen«, mischte sich Heidi ein. »Wir klären das nachher, okay?«
Patrick kickte die Turnschuhe von den Füßen und antwortete mit einem muffeligen »Meinetwegen».
»So, dann kennst du ja schon die halbe Belegschaft!«
Heidi machte eine Kopfbewegung in Richtung Treppe, ehe sie die erste Stufe nahm. Mam und ich gingen dicht hinter ihr.
Ich fragte sie, ob es insgesamt nur vier Kinder hier gab, daraufhin lachte sie. Wir kamen im ersten Stock an, als sie erklärte: »Ein paar mehr sind es schon.«
Meine Mutter übernahm das Fragen nach der tatsächlichen Anzahl für mich, derweil erreichten wir die nächste Treppe, die in den zweiten Stock führte. Es gefiel mir, so weit oben zu wohnen.
»Soll ich deinen Koffer nehmen?«, ertönte Stevies Stimme hinter mir. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er uns gefolgt war. Als ich mich umschaute, bemerkte ich, dass der kleine Patrick ebenfalls am anderen Ende des Flures stand und gespannt zu uns herüberlugte.
»Ich komm klar«, sagte ich und dann noch schnell »Trotzdem danke«. Hoffentlich würden die mir hier nicht die ganze Zeit so auf die Pelle rücken!
»Sie sind zu sechst – mit dir sieben«, beantwortete Heidi die Frage nach der Belegung. »Deine Zimmernachbarin heißt übrigens Natascha.«
Heidis Rücken und den meiner Mam vor mir, verzog ich das Gesicht bei dem Gedanken daran, dass ich kein Einzelzimmer haben würde. Was, wenn ich meine Mitbewohnerin nicht mochte? Oder wenn sie mich nicht mochte! Am liebsten hätte ich auf der Stelle kehrtgemacht und wäre abgehauen.
»Jede Etage hat ihr eigenes Badezimmer und ein Gäste-WC«, erklärte Heidi munter weiter und nahm die letzte Stufe zum zweiten Stock. »Hier wären wir!«
Schwungvoll öffnete sie die Tür ganz am Ende des Ganges und gewährte uns Einlass.
Der Raum war geräumig und lichtdurchflutet. Eine Schräge trennte rechts und links zwei Fenster voneinander; es gab zwei Betten und Schränke, die jeweils an einer Seite der Wand standen, ein bequem aussehendes Sofa, neben dem eine altmodische Schirmlampe stand und ein Traumfänger baumelte von der Decke.
»Das wäre deins!«, sagte Heidi und zeigte auf das Bett, ohne zehntausend Kissen mit Boybandaufdruck.
Auf einmal wurde mir bewusst – so richtig bewusst –, dass ich die nächsten Wochen hier drin schlafen würde. Bisher hatte ich gemeint, mich längst mit der Sache abgefunden zu haben, ohne dass sie mich groß störte. Aber jetzt gerade wurde mir dann doch etwas mulmig zumute. Was, wenn es hier ganz furchtbar werden würde, wenn all das bisher Gesehene einen völlig falschen Eindruck vermittelt hatte? Immerhin war ich in einem Heim und nicht in einem Ferienlager gelandet! Ruhig bleiben, sprach ich mir zu, du hast ein Ziel, eine Mission! Darauf konzentrierst du dich!
Ich nickte, wie um das Versprechen zu besiegeln, und ließ meinen Koffer auf den Boden sinken. Heidi erklärte unterdessen, dass ich mich wie zu Hause fühlen sollte; der Schrank, das Bett, das halbe Sofa gehöre jetzt mir. Ich lief ein paar Schritte weiter in den Raum hinein und warf einen vorsichtigen Blick aus dem Fenster.
»Die beiden Gebäude, November und December, stehen seit Neunundneunzig leer«, erläuterte Heidi genau in dem Moment, als ich meinen Hals reckte, um einen Teil der Rückseite der anderen Gebäude ins Visier zu nehmen.
»November und December?«, wiederholte ich ungläubig und dann fiel mir wieder ein, dass dieses Haus »October« hieß. Heidi lachte.
»Der Gründer dieser Einrichtung hatte wohl eine Vorliebe für Jahreszeiten«, erklärte sie schmunzelnd. »Ein Engländer.«
»Ah.«
Ich nickte wissend. Als ich mich wieder umdrehte, zeigte Mam mahnend auf ihre Armbanduhr.
»Und wie kommt es, dass October sich halten konnte?«, erkundigte ich mich.
Jana entfuhr ein genervtes Stöhnen, das Heidi ignorierte.
»Liebe, Hingabe und ein guter Draht zum Bürgermeister«, antwortete sie gelassen.
Gerade als Jana zu einem Augenrollen ansetzen wollte, leitete Heidi die Verabschiedung ein. »Dann lasse ich euch mal allein. Komm runter, wenn du deine Sachen ausgepackt hast, dann zeige ich dir den Rest des Hauses!«
»Ist gut«, antwortete ich. Kurz bevor Heidi die Zimmertür hinter sich schloss, merkte sie an: »Eine Sache noch.« Ich spitzte die Ohren. »Wir sind ein Waldheim, das heißt, auch wenn wir an den Wochenenden Filmeabende machen, ist uns der bewusste Umgang mit Technik sehr wichtig. Deshalb werden bei uns die Handys abgegeben.« Mein Atem stockte, als ich ihre letzten Worte vernahm.
»Aber … «, setzte ich zum Protest an. Ich war siebzehn und somit beinahe volljährig. Außerdem gehörte ich hier nicht einmal her! Zumindest nicht richtig …
»Nach dem Abendessen gibt’s drei Stunden Handyzeit«, unterbrach mich Heidi mit einem wissenden Blick und einem Lächeln. Ein Teil von mir atmete auf, während ein anderer noch immer auf die Barrikaden gehen wollte. Wie sollte ich mit Lena in Kontakt bleiben? Sie war abends meistens unterwegs und hatte dann sicher keine Zeit, um mir zu schreiben oder mit mir zu telefonieren. Und was war mit Ben? Ich musste mein Handy dabeihaben, wenn wir uns träfen, damit ich jemanden anrufen konnte, falls ich mich verlief oder … oder falls irgendetwas passieren würde, denn immerhin war das unser allererstes Treffen und es gab da noch diese einprozentige Chance, dass Ben in Wahrheit kein sechzehnjähriger Typ war, der auf Computerspiele und Comics stand, sondern ein vierzigjähriger Perverser.
Andererseits hätte er in dem Falle einen ausgesprochen langen Atem, denn wir schrieben schon seit mehr als drei Jahren miteinander …
»Zählt das wirklich auch für mich?«, versuchte ich zu verhandeln. »Ich bin ja nur sechs Wochen hier.«
Ich zog die Brauen in der Mitte zusammen und schaute Heidi flehend an. Sie stand an der Tür, eine Hand auf der Klinke liegend und lächelte.
»Du kannst es mir nach unten bringen, wenn deine Mutter sich verabschiedet hat.«
Die Betreuerin sagte das im selben freundlichem Ton wie vorher. Gleichzeitig spürte ich jedoch, dass sie keine weiteren Widerworte zulassen würde.
Ich gab ein langgezogenes »Okay« von mir und ein kleines Lächeln, weil ich Heidi trotz dieser blöden Vorschrift immer noch nett fand.
Bevor sie die Tür schloss, sprangen mir Stevies und Patricks Augen entgegen. Die beiden standen im Flur, an der Schwelle zu meinem Zimmer und hatten die ganze Zeit über neugierig an Heidi vorbei zu mir hereingeschaut.
»So«, stieß Jana erleichtert aus, »dann ist es jetzt also so weit.« Sie bedachte mich mit einem liebevollen Blick und strich mir übers Haar, ehe sie fragte: »Hast du alles?«
Bis auf mein Handy, ja, hätte ich gern gegrummelt, aber da ich wusste, dass meine Mam Abschiede hasste, schluckte ich das lieber runter.
»Sieht wohl so aus«, antwortete ich stattdessen und dann ließ ich mir einen Kuss von ihr auf die Wange drücken.
»Das wird gut werden«, sagte sie, so als müsste sie sich selbst noch einmal davon überzeugen, dass mein Aufenthalt hier die richtige Entscheidung war. »Du hast großes Glück gehabt, dass es bei den paar Sozialstunden geblieben ist.«
»Ich weiß«, entgegnete ich mit einem leicht genervten Unterton, weil sie mir das jetzt bestimmt das sechste oder siebte Mal unter die Nase rieb. Ja, ich war noch einmal glimpflich davongekommen, das war mir sehr wohl bewusst. Darüber hinaus war es ein Segen, Eltern zu haben, die kreativ genug waren, sich zusätzlich zu der staatlichen Peitsche noch eine weitere Bestrafungsmaßnahme epischen Ausmaßes auszudenken. Noch nie hatte ich gehört, dass jemand für ein paar Wochen ins Heim abgeschoben wurde, weil er geklaut hatte! Andererseits war das sicherlich noch allemal besser, als ein Aufenthalt im Knast.
»Ich rufe dich einmal die Woche an«, erklärte Jana, »dann bekommst du die neuesten Umzugsupdates.«
»Denk an die Handyzeit«, erwiderte ich schmunzelnd, woraufhin meine Mutter mit dem Kopf schüttelte.
»Die haben hier sicher ein Festnetztelefon«, bemerkte sie trocken.
»Bestimmt«, gab ich ihr recht und seufzte kaum hörbar, als ich meinen Blick noch einmal aus dem Fenster schweifen ließ. Es war wirklich schön hier, keine Frage. Der dichte, gemischte Wald lockte mit seinem kräftigen Grün und die hohen, mit Blumen bewachsenen Wiesen davor wirkten, als hätte sie jemand aus einer Naturzeitschrift ausgeschnitten und dort ausgelegt. Trotzdem war das hier immer noch die reinste Pampa! Mein einziger Lichtblick, während der nächsten sechs Wochen nicht vor Langeweile zu sterben, war Ben und unser geplantes Treffen. Oder die Treffen, besser gesagt, denn wir würden unser Vorhaben ziemlich sicher nicht gleich beim ersten Mal in die Tat umsetzen. Wenn wir uns im echten Leben ebenso gut verstünden, wie beim Chatten, würde ich mich bestimmt jeden Abend mit ihm in der Stadt verabreden und wir hätten jede Menge Zeit, noch einmal alles genau durchzugehen.
»Grüß Papa«, sagte ich, nachdem Jana meine Hand ein letztes Mal gedrückt hatte.
»Willst du nicht noch mit runterkommen?«
»Ach«, stammelte ich und schluckte, »ich pack lieber schon mal aus!«
»Verstehe«, entgegnete Jana mit nach oben huschendem Mundwinkel und kurzem Blick auf meine Hosentasche, in der sie mein Handy vermutete.
Was sie nicht wusste war, dass ich Abschiede genauso wenig leiden konnte wie sie. Das hatte ich ihr bloß noch nie gesagt und auch nicht gezeigt, weil es das nur schlimmer machen würde. Kurz und zumindest halbwegs schmerzlos zog ich da allemal vor.
Jana nickte verständnisvoll, woraufhin ich einen tiefen Atemzug einsog. Als sie mir ihr wunderschönes Miss-Germany-Lächeln zuwarf, kam mir der Gedanke, dass sie wirklich meine Mutter war, wieder so abwegig vor. Gar nicht einmal wegen ihres guten Aussehens, sondern eher, weil sie so eine unheimliche Präsenz hatte und so stark war. Alles, was meine Mutter betraf, wirkte immer so geordnet und perfekt geplant – und Schwangerschaften und Kinder waren das reinste Chaos. Nach meinem Empfinden passte das so gar nicht zusammen.
»Alles Gute zum Geburtstag, Liebes«, sagte sie noch und warf mir eine Kusshand zu, bevor sie ging.
***
Kaum hatte ich mich aufs Bett plumpsen lassen, klopfte es an meiner Tür.
»Ja bitte?«, rief ich und stand schnell wieder vom Bett auf, fast so, als wäre es verboten, sich darauf zu setzen.
War das vielleicht meine neue Zimmernachbarin? Vermutlich nicht, denn weshalb sollte sie vor dem Eintreten anklopfen – immerhin war das ja ihr Zimmer.
Zuallererst fiel mir der rote Lockenkopf ins Auge, als Stevie, dicht gefolgt von Patrick, hereinkam.
»Hey«, sagte er vorsichtig und schob die Hände in die Hosentaschen.
»Hey«, sagte ich zurück.
»Wir haben uns gefragt, ob du …«, er stockte und räusperte sich. Seine Gesichtsfarbe hatte inzwischen ebenfalls einen leichten Rotton angenommen.
»Sollen wir dir alles zeigen?«, mischte sich Patrick ein; seine dunklen Kulleraugen blickten mich dabei erwartungsvoll an.
»Ich glaube, das wollte Heidi nachher machen«, antwortete ich und lächelte verhalten.
»Die musste noch mal weg, um Clara abzuholen«, erklärte Stevie, der jetzt offenbar wieder seine Stimme gefunden hatte.
»Dann ist jetzt gerade niemand hier? Außer wir, meine ich?«, fragte ich skeptisch.
»Brigitte ist da«, erklärte Patrick und als sich ein großes Fragezeichen auf meinem Gesicht abzeichnete, fügte Stevie hinzu: »Unsere Haushälterin.«
»Aha«, entgegnete ich. Unterdessen ging der kleine Patrick einen Schritt auf mich zu.
»Willst du?«
Seine Augen waren sowas von teddybärmäßig, dass ich mich automatisch fragte, wer so ein süßes Kind nicht bei sich haben wollte. Erst einige Sekunden später fielen mir ein paar mehr Gründe ein, weshalb der Junge hier sein mochte. Ich schluckte und hoffte, dass die erste Möglichkeit die richtige war, denn gewalttätige, drogenabhängige oder gar tote Eltern kamen mir wie eine ganz schön schlimme Sache vor, für die man sicherlich Unmengen an Psychologenbesuchen brauchte, um darüber hinwegzukommen. Falls er seine Eltern gar nicht kannte, war das vielleicht leichter zu verdauen.
»Meinetwegen«, gab ich mich geschlagen. »Aber ich will erst noch auspacken.«
»Dann in zehn Minuten unten!«, kommandierte Patrick und Stevie lächelte breit.
»Abgemacht«, sagte ich, wohl wissend, dass ich mich sputen musste.
Als die beiden verschwunden waren, zog ich hastig mein Handy aus der Hosentasche.
Fünf neue Nachrichten wurden auf dem Display angezeigt.
Lena:
Hey Süße!Vermisse dich jetzt schon! Hör zu! Du wirst es nicht glauben, mit wem ich heute Abend ein Date habe! Torben Ammenhäuser! Krass oder? Er hat mir vorhin ne Nachricht geschrieben! Ich flipp total aus! Werde dir alles berichten! 1Mio Kussis
Lena:
Ich glaub’s immer noch nicht! TORBEN AMMENHÄUSER! Der ist bestimmt der Hammer im Bett! Ich meine – Hallooo! –seine Bauchmuskeln allein bringen alles in mir zum Schmelzen! OMG! Miss uuuu!
Lena:
Drück mir die Daaahaumen!!! Was soll ich anziehen?
Lena:
Bist du eigentlich schon angekommen?Noch mal: Was soll ich anziehen? Die Uhr tickt!!!Kussis
Ben:
Hey Nicky, bist du schon da? Ich bin nervös. Habe mir heute schon dreimal die Haare nachgegelt und zwei Tassen Kaffee getrunken, der viel zu stark war, weshalb ich jetzt noch mehr Herzflattern habe als eh schon.Freue mich echt, dich zu sehen.Bleibt es bei zwanzig Uhr?Ben
Ich ließ mein Handy für einen Augenblick sinken und starrte auf die gegenüberliegende Seite des Raumes. Sah so aus, als stand meine Zimmernachbarin Natascha nicht nur auf Boybands aus den Neunzigern, sondern auch auf japanische Mangazeichnungen. Die vielen Bilderrahmen damit auf ihrem Nachtschrank waren mir bis eben gar nicht aufgefallen. Als ich von unten einen Kinderschrei, kurz gefolgt von lautem Lachen hörte, besann ich mich wieder. Lena. Lena und Ben.
Hey Süße,vermisse dich auch! Ist ja cool mit Torben! Wuhuuu! Zieh auf jeden Fall das rote Kleid an. Das steht dir super! Ich drück dir alle Daumen, die ich habe!Weißt du schon, ob du mich besuchen kannst?Ich hoffe, es klappt noch mal, bevor … du weißt schon.
Ich hielt einen Moment inne und schluckte. Du weißt schon – so nannten Lena und ich meinen bevorstehenden Umzug nach England, weil wir die Wahrheit lieber nicht laut aussprechen wollten. Es war nicht leicht, sich mit dem Gedanken abzufinden, seine allerbeste Freundin bis zum Abschluss nur noch in den Schulferien zu sehen. Jetzt war der Abschied zum Greifen nah und ich wollte noch immer nicht daran denken. Nicht so richtig zumindest.
Jedenfalls, viel Glück heute Abend! Bin vorhin angekommen. Wirkt erst mal ganz okay alles. Vermisse dich! Immer einen Kuss mehr als du zurück!
Nachdem ich Lenas Nachricht abgeschickt hatte, war Ben dran.
Hey Ben,schön von dir zu lesen! Ich bin auch etwas nervös. Aber das wird schon!Ist ja nicht so, als würden wir uns erst seit gestern kennen.Kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich es lieber tun würde!
Stopp!
Letzter Satz: löschen!
Kann mir keinen besseren Zeitpunkt oder Partner dafür vorstellen!Zwanzig Uhr sollte klappen. Kann die Adresse schon auswendig.Bis nachher!Nicky
Hätte ich noch einmal schreiben sollen, dass wir es langsam angehen? Nein – ich schüttelte entschlossen den Kopf. Ben kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich nichts überstürzen wollte.
»Nicky!«
Patricks Rufen drang von den unteren Stockwerken zu mir nach oben.
»Komme gleich!«, rief ich zurück. Offensichtlich war hier alles ganz schön hellhörig.
In Windeseile packte ich meine restlichen Sachen aus und verstaute sie – grob sortiert – im Schrank. Mein Handy steckte ich mir wieder in die Hosentasche. Solange Heidi noch nicht wieder zurück war, konnte ich es ja noch bei mir haben.
Drei Stunden täglich … das würde eine ganz schöne Umstellung werden.
***
Als ich die Treppenstufen nach unten ging, warteten Stevie und Patrick im Flur und sahen zu mir auf. Vor der Tür, hinter der ich die Küche vermutete, stand eine ähnlich korpulente Frau wie Heidi. Allerdings hatte sie stachelige rotbraune Haare und wirkte mit ihrer übergroßen Brille, der Steppweste, die sie über einem ockerfarbenen Shirt mit V-Ausschnitt trug und den etwas zu kurz geratenen Hosenbeinen weniger modeinteressiert.
»Du musst Nicky sein!«, begrüßte sie mich und streckte mir ihre Hand entgegen.
»Brigitte mein Name. Köchin, Putzfrau und Mädchen für alles.« Sie lächelte und drückte meine Hand etwas zu fest für meinen Geschmack, nachdem ich genickt und »Hallo« gesagt hatte. »Na, was habt ihr jetzt noch geplant?«, fragte sie nun an Stevie gewandt.
»Wir zeigen Nicky hier alles«, sagte Patrick, der es offenbar liebte, für andere zu antworten. Seine braunen Augen strahlten dabei dermaßen, dass man hätte meinen können, ich wäre der Weihnachtsmann und kurz davor gewesen, ihm sein erstes Geschenk auszuhändigen. Irgendwie fühlte ich mich ein bisschen geschmeichelt von so viel Aufmerksamkeit. Das war ich nicht gewohnt, denn normalerweise sorgte Lena stets dafür, dass alle Augen auf sie gerichtet waren. Ich war das Anhängsel, das niemand groß bemerkte und das war mir auch ganz recht so. Ich mochte es nicht, im Rampenlicht zu stehen, wo es jedem gleich auffiel, wenn man einen Fehler machte. Deshalb hatte ich Glück, eine Freundin wie Lena zu haben, die mich davor bewahrte und die gleichzeitig noch dafür sorgte, dass mich niemand dumm anmachte.
Vermutlich lag es daran, dass mir Patrick und Stevie ziemlich harmlos vorkamen, dass es mir hier nichts ausmachte, mal im Mittelpunkt zu stehen.
»Dann viel Spaß«, entgegnete Brigitte und zog plötzlich eine Schürze hinter dem Rücken hervor. »Um zwölf ist Mittag.«
»Aye, Aye, Sir!«, erwiderte Stevie und salutierte vor ihr – was ihm einen sanften Schlag von der Haushälterin auf dem Hinterkopf bescherte. »Willst du mich schon wieder veralbern?«, fragte sie in gespielt strengem Ton, woraufhin Stevie bloß mit dem Kopf schüttelte und mit »Ich doch nicht«, gefolgt von einer Art Grunzen antwortete. Ich unterdrückte ein Kichern, als ich Patrick aus der großen Haustür heraus folgte.
»Wie sind denn hier so die Ausgangszeiten?«, erkundigte ich mich.
Beide Jungs an meiner Seite, passierten wir noch einmal den Pflastersteinweg von eben. Anders als vorhin gingen wir jedoch nicht zurück zu den Parkplätzen, sondern bogen querfeldein in die Wiese. Genau in die Richtung, aus der dieser unfreundliche Typ vorhin gekommen war.
»Zweiundzwanzig Uhr ist Sense«, klärte Stevie mich auf.
Das klang doch ganz passabel!
»Und in die Stadt dürfen wir allein, ohne Aufsicht?«, hakte ich nach.
»Klar! Wieso nicht?« Stevies Stimme war mit einem Hauch Empörung untersetzt. »Wir Großen jedenfalls«, hängte er noch an und machte eine Kopfbewegung in Richtung Patrick. »Der da nicht.«
Patrick streckte ihm die Zunge raus und grummelte etwas, das sich wie »Mir doch egal« anhörte.
»Cool«, sagte ich enthusiastisch. Meinem Plan stand also nichts im Weg!
Stevie und Patrick führten mich einmal halb um das Gebäude, bis wir bei einer Grünfläche ankamen, die – anders als die Wiese um den Parkplatz herum – gemäht war.
»Das Wasser ist arschkalt«, bemerkte Patrick, als ich neugierig das von drei Eichen umgebene Tretbecken begutachte.
»Trotzdem schön«, entgegnete ich und war einen Augenblick lang versucht, meinen Schuh auszuziehen und einmal meinen Zeh hineinzuhalten.
»Da drüben grillen wir manchmal«, erklärte Stevie und zeigte zu einer Holzhütte, die am anderen Ende der Wiese nahe dem Wald stand. Zwei Tische und vier lange Bänke waren davor platziert.
Etwas weiter weg, auf der Blumenwiese, befand sich eine Schaukel.
Beim Blick in den Himmel fingen zwei vereinzelte weiße Wölkchen meine Aufmerksamkeit ein, die über den strahlend blauen Himmel zogen. Ein Schwarm Vögel flog weit entfernt über unseren Köpfen Richtung Kassel. Ich inhalierte die nach gemähtem Gras und Wald duftende Luft.
»Ist alles ganz schön groß hier«, sagte ich, als ich wieder zu Stevie und Patrick schaute. Die beiden hatten ihre Augen auf mich gerichtet, was mir das Blut in die Wangen schießen ließ, als ich ihre Blicke bemerkte.
Nachdem wir noch ein bisschen umhergelaufen waren und mir der Teich auf der anderen Seite der Wiese und der Schuppen gezeigt wurde, gingen wir zurück. Beim Haus saßen zwei Jugendliche und ein kleines blondes Mädchen auf der Terrasse.
Die Kleine hatte sich auf der Hollywoodschaukel niedergelassen. Eine Hand an der Außenstange, stieß sie sich etwas unbeholfen vom Boden ab, wobei ihre Füße kaum die dunklen Holzbretter berührten. Ein Kerl mit kurzen braunen Haaren, den ich ebenfalls etwa auf mein Alter schätzte, saß gegenüber von einem etwas jüngeren Mädel. Sie hatte dunkellila gefärbte Haare, die ihr bis zum Hintern reichten. Zusammen mit ihrem hellen Teint hatte das Lila etwas Elfenartiges.
»Darf ich vorstellen«, begann Stevie und zeigte zuerst auf den Kerl, »Christian.« Ich hob meine Hand zum Gruß, während Christian mir zunickte. Dann hieß der Typ von vorhin also doch anders. Vielleicht gehörte er nicht einmal hierher. Es war ja möglich, dass er bloß jemanden besucht hatte.
»Ich bin Natascha«, stellte sich die Elfe mit den lila Haaren vor und stand auf, um mir die Hand zu reichen. Sie hatte einen leicht russischen Akzent und eine schön geschwungene Nase, die ihr puppenartiges Gesicht komplettierte. »Wir wohnen jetzt zusammen, richtig?«, fragte sie mich mit einem Lächeln.
»Sieht so aus«, antwortete ich. »Dann wusstet ihr alle, dass ich komme?«
»Jipp«, bestätigte Natascha. »Haben schon sehnsüchtig auf dich gewartet. Hier passiert ja sonst nichts.«
Ich lächelte ein bisschen, denn das klang irgendwie nett.
»Und wer bist du?«
Den Blick zur Hollywoodschaukel gerichtet versuchte ich, die Augen des kleinen Mädchens einzufangen.
»Das brauchst du gar nicht erst versuchen«, klinkte sich Christian ein, »die ist sich zu fein, um mit uns zu reden.«
»Bis auf Silke, mit der spricht sie manchmal«, fügte Patrick hinzu. »Und schreien tut sie, wenn ihr was nicht passt.«
Den anderen entfuhr beinahe gleichzeitig ein genervtes Stöhnen, woraufhin das Mädchen energisch mit dem Kopf schüttelte, was ihre goldenen Korkenzieherlocken zum Tanzen brachte.
»Ich bin Nicky«, sagte ich zu ihr, als sie mich doch einmal kurz ansah – versehentlich, wie ich annahm, denn sie schaute ganz schnell wieder weg.
»Sie heißt Clara-Corinna«, erklärte Patrick.
Stevie wollte von den anderen wissen, was sie bis jetzt gemacht hatten, woraufhin Christian erklärte, dass sie in der Stadt gewesen waren, weil Natascha noch neue Farben gebraucht hatte.
»Und was geht jetzt, Leute?«, fragte Stevie in die Runde.
Ruckartig stand Natascha wieder auf und dabei brachte ein warmer Windzug ihre Haare in Wallung. Es sah schön aus, wie die lila Strähnen um sie herumwehten, wie an einem Standventilator befestigte Schleifenbänder.
»Mittagessen«, sagte sie bestimmt und nickte mir zu. »Komm, wir gehen zusammen rein.«
Natascha plapperte munter neben mir und die anderen hinter mir. Es erstaunte mich, wie leicht es hier war, Freunde zu finden: temporäre Freunde.
»Bloß sechs Wochen also?«, fragte Natascha, nachdem sie mir erzählt hatte, dass sie schon über ein Jahr hier war. Ich bejahte und setzte mich neben sie an die lange Tafel im Esszimmer. Teller, Besteck, Gläser und eine Schüssel mit dampfenden Kartoffeln standen schon auf dem Tisch. Nachdem Stevie, Patrick, Christian und die kleine Clara-Corinna sich ebenfalls gesetzt hatten, stießen Brigitte und Heidi mit zwei großen Auflaufformen und drei Saftkaraffen dazu.
»Lasst es euch schmecken«, meinte Heidi, nachdem Brigitte sich in die Mittagspause verabschiedet hatte. Nur ein Besucher, dachte ich, während ich eine Gabel von dem Gemüseauflauf nahm. Das war gut, denn ich konnte mir diesen mürrischen Typ von vorhin beim besten Willen nicht inmitten dieser netten Runde vorstellen. Trotzdem hätte ich gern gewusst, wem er hier einen Besuch abgestattet hatte.
Vielleicht Natascha? War er ihr Freund?
Oder ein Kumpel von Christian? Er machte von allen hier den am wenigsten zugänglichen Eindruck, obwohl er ebenso nett zu sein schien. Ich rümpfte die Nase bei dem Gedanken, wie Christian und dieser Kerl sich gegenseitig zur Begrüßung auf die Schulter klopften.
»Gibst du mir mal den Saft?«, fragte Natascha an Stevie gewandt. Genau in diesem Moment flog die Tür auf und er kam herein: Schwarzer Kapuzenpulli, bis zum Ellenbogen hochgekrempelte Ärmel und dazu schwarze Jeans. Die dunkelblonden Haare fielen ihm leicht ins Gesicht. Seine Lippen passten mit ihrer Weichheit gar nicht so recht zu seinem markanten, harten Kinn, aber es war sein Gang, der mit jedem neuen Schritt sagte: »Sprich mich bloß nicht an!«