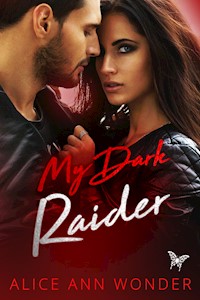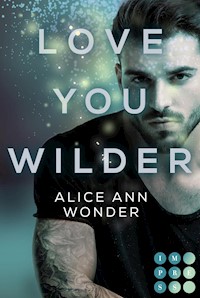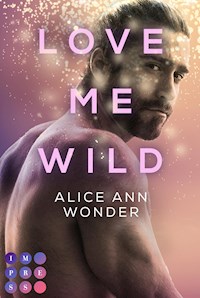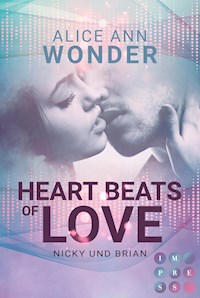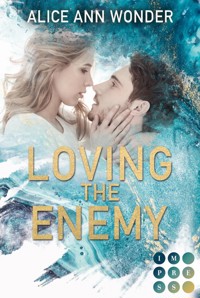Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein durchtriebenes Spiel zwischen einem jungen Akademiker und seiner Schülerin. Eine gefährliche Spannung zwischen zwei Studentinnen, irgendwo dazwischen ein verhängnisvolles Geheimnis. Und ein sündhaft gutaussehender Literaturprofessor, der hinter seinem Charme etwas verbirgt... Lerne die atemberaubende Sinners & Saints Sammelreihe 1-3 kennen und lasse dein Herz von Intrigen, Freundschaft und Liebe aufwühlen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Just for Today
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenJust for Today
Just for Today
Sinners and Saints
Sammelband 1
Alice Ann Wonder
Copyright © 2019 Alice Ann Wonder
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet. Sämtliche Personen im vorliegenden Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Teil 1
Vicious Bet
Über das Buch
Sie bricht Herzen, bis sie bluten.
Er versieht all ihre Klausuren mit Rot.
Sie lehrt ihre Mitschüler das Fürchten.
Er unterrichtet Literatur.
Sie ist die Böse, er der Gute.
Dachte sie zumindest.
Denn der junge Professor ist alles andere als harmlos – das wird sie noch herausfinden.
… und sich wünschen, er wäre niemals auf ihr durchtriebenes kleines Spiel eingegangen.
… oder vielleicht doch?
Mach Bekanntschaft mit den Privileged-Fiends – den privilegierten Teufeln – des Thorn Elite Colleges.
Inhaltsverzeichnis
Die kleine Meerjungfrau
Wer steht nicht auf Literatur?
Fegefeuer
Ich sehe dich
Pakt mit dem Teufel
Nur ein Kuchen
Dunkler Schatten
Geliebter Feind
Weil du mir gehörst
Pretty Privileged
Stadt der Engel
Theme Song
Wolf & Moon – Before
Die kleine Meerjungfrau
Damals ...
"Gehen wir später noch Eis essen?", fragte James, während er mit einem knochigen Ast ein Loch in den Sand unter unseren Füßen bohrte.
Ich vergrub meine Zehen in den feinen Körnern, bis sie nicht mehr zu sehen waren.
Die meisten Leute fanden, dass Vancouver im Sommer am schönsten war.
Mir war der Herbstanfang am liebsten.
An Tagen wie heute, wenn es noch warm genug zum Schwimmen war, aber man trotzdem bereits die Aufbruchsstimmung der Natur wahrnehmen konnte, fühlte ich mich am wohlsten.
Die Blätter der Bäume waren noch grün, doch wenn man genau hinsah, spürte man, dass sie bereits aufs Verfärben warteten. Bunt klopfte an die Tür.
Die Kraft der Natur, die in gleichbleibenden, verlässlichen Rhythmen, Veränderung mit sich brachte, hatte mich schon immer fasziniert.
Bei ihr wirkte es stets so leicht. Sie tat, was sie sollte, wann sie es sollte und wie sie es sollte.
"Mhmmm", brummte ich und sprang mit einem Mal auf. Dann lief ich laut johlend ein paar Meter. "Fang mich!", schrie ich und rannte den Wellen entgegen.
Ich musste in weniger als einer halben Stunde zu Hause sein. Aber daran wollte ich jetzt nicht denken.
"Geh nicht zu nah ans Wasser, Blaire!", rief James mir hinterher.
Doch ich hörte nicht. Ich jagte in die kalten Wellen hinein, bis ich knietief von immer neuen weißen Kämmen umgeben war, die mich umspülten.
Meine Hose war beinahe bis zum Bund klatschnass. Ich hatte sie zwar vorhin hochgekrempelt, aber so wie die Wellen spritzten, nutzte das nicht viel.
Das würde meiner Mutter nicht gefallen.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah hinauf zum Himmel.
Er war blau und klar. Ein paar Möwen zogen ihre Kreise und trugen mit ihren kreischenden Lauten zur perfekten Idylle der Umgebung bei.
Selig vor Glück schloss ich die Augen und atmete die salzige Luft des Meeres ein.
"Blaire!"
Als ich mich umdrehte, hatte James mich fast erreicht.
Er hasste das Wasser, ganz besonders um diese Jahreszeit, wenn es wieder kälter als im Juli oder August war.
"Du wirst krank", bemerkte er und streckte mir seine Hand entgegen.
"Werd ich nicht!", entgegnete ich trotzig und verdrehte die Augen.
"Komm, lass uns gehen!", beharrte James. "Sonst kriegst du noch Ärger."
Ich wusste, dass er recht hatte. Aber zu Hause war der letzte Ort, an dem ich im Moment sein wollte.
"Na los!"
James wackelte auffordernd mit den Fingern. Ich grinste und spritzte ihn nass.
"Hey! Blöde Kuh!", keifte er und spritzte nun ebenfalls eiskaltes Wasser in meine Richtung.
Dabei verfehlte er mich um ein Haar.
Ich wusste, dass er mich absichtlich nicht traf. Genau wie bei allen anderen Spielen, mit denen wir uns vergnügten, nahm er stets Rücksicht auf mich. An manchen Tagen gefiel mir das. Aber wenn Mom und Dad wieder gestritten hatten, machte es mich aus irgendeinem Grund wütend, dass James sich nie mit mir anlegen wollte.
An solchen Tagen hätte ich mich gerne mit ihm gerauft, so wie er das mit den Jungs in seinem Alter tat. Doch das ließ er nicht zu, was dann dazu führte, dass ich beleidigt war.
Allerdings schaffte ich es selten, besonders lange sauer auf ihn zu sein.
Dazu hatte ich ihn viel zu gern, auch wenn er mich manchmal nervte.
James Wyatt Cole war seit dem Kindergarten mein allerbester Freund.
Es gab niemanden auf der Welt, mit dem ich mehr Spaß hatte oder der bessere Verstecke bauen und Geheimnisse für sich behalten konnte.
"Selber!", gab ich gespielt schmollend zurück und patschte mit einer Hand noch einmal auf die Wasseroberfläche.
James schüttelte den Kopf und wandte sich um.
"Warte!", rief ich, als er bereits einige Schritte zurück in Richtung Strand gegangen war.
"Tschuldigung."
Ich sah ihn mit einem verschmitzten Grinsen an, während wir nebeneinander der Küste entgegen wateten.
"Ich geb dir nachher ein Eis aus", schlug ich als Wiedergutmachung vor.
Das hätte ich allerdings sowieso getan, weil James Familie noch weniger Geld als meine hatte.
Manchmal konnte er sich nicht einmal neue Schulhefte leisten. Wir hatten uns dann immer etwas einfallen lassen, wie zum Beispiel im Sommer selbstgemachte Limonade verkaufen und im Winter Plätzchen.
James war gut in Mathe, deshalb gaben wir stets nur so viel für die Zutaten aus, dass wir nach dem Verkauf noch eine gute Marge hatten.
Manchmal mähten wir auch den Rasen in der Nachbarschaft oder boten an, Autos zu waschen.
Da wir schon immer in derselben Straße wohnten, kannten und vertrauten uns die Leute. So kamen wir gut zurecht und in mageren Monaten, wie James Dad sie nannte, sorgten wir für das nötige Kleingeld.
Sein Vater arbeitete nämlich auf Kommission in einer Reederei und es gab nicht immer gleichbleibend viele Aufträge.
James Mutter war vor vier Jahren gestorben, einen Tag vor seinem sechsten Geburtstag. Das war ziemlich hart. Sie hatte Lungenkrebs, obwohl sie nie geraucht hatte. Ich habe jeden Abend gebetet, dass sie wieder gesund wird, aber es hat nicht geholfen. Vielleicht hätte ich James davon erzählen sollen.
Man sagte ja, dass zwei Menschen mehr bewirken können als einer.
Aber damals dachte ich, ihn würde das bestimmt nur noch trauriger machen, denn ich wusste von Anfang an nicht, ob es klappen würde.
Außerdem sagte Dad immer, das Nobelste, was man für einen anderen Menschen tun könne, sei eine gute Sache, von der er gar nichts weiß. Man sagt es ihm nicht, weil man dafür keinerlei Dank oder Anerkennung erwartet. Denn man macht es ja, weil man etwas für die andere Person tun will und dabei geht es nicht um einen selbst.
Jedenfalls war James an dem Tag, als es passiert war, zu mir gerannt.
Und dann waren wir runter zum Meer an unsere Stelle gegangen und hatten Steine ins Wasser geworfen.
Er hatte nicht reden wollen, also hatten wir einfach nur geschwiegen.
Irgendwann hatte er dann ganz schrecklich angefangen zu weinen und ich hatte ihn in den Arm genommen und sicherlich zwanzig Minuten oder länger einfach nur gehalten.
Dann hatten wir aus Treibholzstämmen eine Höhle gebaut und uns darin verkrochen.
"Hier bist du sicher", hatte ich ihm gesagt und anschließend ein Herz in den Sand gemalt. "Deine Mom passt jetzt von oben auf dich auf. Auch wenn sie nicht mehr hier ist."
Noch so eine Sache, die mir Dad erklärt hatte, als wir darüber sprachen, dass James’ Mom vielleicht bald sterben würde.
James hatte nur die Lippen zusammengekniffen und nichts weiter dazu gesagt, was ich wirklich verstehen konnte, denn wenn meine Mom gestorben wäre, hätte ich auch nichts sagen wollen.
Letztendlich wollte ich ihn auch bloß wissen lassen, dass seine Mutter nicht verschwunden ist, auch wenn es im Moment so aussah. Ich hätte das wichtig gefunden, wäre ich er gewesen.
Denn man braucht seine Mom ja – egal wie alt man ist.
Nach diesem Tag hatte ich James nie wieder weinen sehen.
Außerdem weigerte er sich seither strikt, seinen Geburtstag zu feiern.
Ich konnte das verstehen, backte ihm aber trotzdem jedes Jahr einen Nougatkuchen mit Karamell- und Krokantstreuseln obendrauf, denn James stand total auf Nougat!
Wenn er die Kerze auspustete, dachten wir beide an seine Mom und sendeten ihr einen lieben Gruß in den Himmel.
Das war unser kleines Ritual.
Trotzdem wünschte ich mir, dass James seinen Geburtstag irgendwann doch wieder feiern würde.
Jeder hatte an einem Tag des Jahres eine Feier verdient, fand ich.
Mindestens.
Wir liefen die Beach Ave entlang und bogen dann in die Jervis Street ein.
Jetzt waren es nur noch wenige Straßen bis zu unserer.
Wir wohnten direkt am Krankenhaus, was praktisch war, wenn sich einer von uns mal verletzte, sagte Dad stets.
Manchmal war es ein bisschen laut wegen den Krankentransporten mit ihren Sirenen.
Aber man gewöhnte sich schnell daran und das Tatütata war nur ein kleiner Preis dafür, dass wir in unmittelbarer Strandnähe lebten.
Alles Gute hat einen Preis, erklärte mir einmal mein Vater. Man musste etwas dafür tun oder ein Opfer bringen.
Unser Opfer war, dass wir die Lautstärke der Sirenen ertrugen.
Dann bin ich für viel Gutes bereit, hatte ich gedacht, als Dad mir von seiner Theorie erzählte.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass es noch viel größere Opfer gab, die es zu erbringen galt, wenn man etwas liebte.
Oder jemanden.
"Soll ich noch mitkommen?", fragte James, als wir vor meinem Haus angekommen waren.
Wir wohnten hier schon immer – also zumindest seit ich geboren wurde.
Die olivgrüne Farbe blätterte von den Wänden und es fehlten ein paar Dachziegel.
Die würde er reparieren, wenn das Geld wieder stimmte, hatte Dad gesagt.
Unser hölzerner Gartenzaun sah auch schon etwas ramponiert aus.
Aber mich störte das nicht. Dad musste viel arbeiten und Mom hatte kein Händchen für handwerkliche Dinge. Ich hatte mir vorgenommen, sobald ich alt genug war, um an Dads Werkzeugkiste zu dürfen, würde ich lernen, wie man einen Zaun wieder auf Vordermann brachte.
"Wir treffen uns um fünf", sagte ich zu James und lächelte.
Das war genug Zeit, um Lu bei ihren Hausaufgaben zu helfen, den Abwasch zu erledigen und noch ein wenig an meinem Vortrag über Seeanemonen zu feilen, den ich nach dem Wochenende in der Schule abgeben musste.
Unser Vater hatte uns beigebracht, dass Hausarbeiten wichtig sind.
Ich konnte nicht behaupten, dass ich sie gerne verrichtete, aber Erwachsenen konnte man sich ja schlecht widersetzen. Außerdem machte mir das Abwaschen mittlerweile sogar Spaß.
Wasser hatte ich schon immer geliebt und wenn ich nicht daran dachte, dass ich gerade eine Pflichtaufgabe erledigte, sondern mich nur auf das warme Nass und die kreisenden Bewegungen meiner Hände konzentrierte, dann war es gar nicht so übel.
Bügeln hingegen hasste ich wirklich!
Aber auch das musste eben manchmal sein.
Gott sei Dank nicht heute.
"Super, ich hole dich dann ab!", antwortete James freudestrahlend.
"O – ähm", stammelte ich und zupfte an meinem lila Ariel-Die-Meerjungfrau-T-Shirt. "Lass uns doch lieber unten am Fels treffen."
Ich biss mir auf die Lippe und knibbelte an meinem Nagelhäutchen.
James zog die Brauen zusammen und runzelte die Stirn.
Seine grünen Augen blickten mich skeptisch an.
"Bis dann", sagte ich schnell, um ihm keine Gelegenheit zu geben, noch weiter nachzuhaken.
Ich winkte, dann rannte ich an unserer Haustür vorbei zum Hintereingang.
Das war sicherer.
Ich wollte nicht, dass James hörte, wie meine Eltern stritten, wenn ich die Haustür aufmachte. Denn das taten sie in letzter Zeit ziemlich oft und so langsam bekam ich Angst, dass es sich nie mehr ändern würde.
Sie schienen auch jedes Mal ein anderes Thema zu haben, was sie aufrieb. Deswegen kam ich mit den Lösungsvorschlägen, die ich mir für ihre Meinungsverschiedenheiten ausgedacht hatte, auch nicht mehr hinterher.
In der Schule bei der Streitschlichtung hatte ich gelernt, dass beide Parteien einen Kompromiss machen sollten – und, dass es wichtig ist, sich zu entschuldigen, wenn man im Unrecht war.
Im Unterricht klang das alles so einfach, aber bei Mom und Dad war es wirklich schwer zu sagen, wer sich als Erstes entschuldigen sollte.
Ich liebte Mom natürlich, aber Dad vergötterte ich, das war seit jeher so gewesen.
Mom war oft launisch und irgendwie anstrengend.
Manchmal konnte ich verstehen, dass Dad sich über sie aufregte.
Andererseits arbeitete mein Vater sehr viel, genau wie der von James.
Vielleicht würde ich mich an Moms Stelle auch hin und wieder allein fühlen und wäre deswegen sauer auf ihn.
Ich klopfte den Sand von meinen Converse und stellte sie an den Rand des Fußabtreters, der vor der Terrassentür lag.
Dann drückte ich die Tür auf – sie war nur nachts verschlossen.
Drinnen war es mucksmäuschenstill. Sehr merkwürdig.
Ich schlich auf Zehenspitzen die Treppen hinauf. Oben angekommen, klopfte ich zweimal sacht an Lus Tür.
Als ich eintrat, saß meine kleine Schwester im Schneidersitz unter ihrem Fenster und schnitt Pferdefiguren aus.
Lucinda liebte Pferde in allen Formen und Farben.
Ich hingegen hatte zu viel Respekt vor diesen großen, laut wiehernden Tieren, als dass ich ihnen jemals freiwillig hätte näherkommen, geschweige denn auf ihnen reiten wollen.
Dafür hatte Lu nichts für Meerjungfrauen, den Ozean oder das Schwimmen übrig – was ich wiederum überhaupt nicht verstehen konnte.
"Wie ist die Lage?", fragte ich meine kleine Schwester, nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte.
Ich brauchte nicht zu erklären, was ich damit meinte.
Lu sah zu mir auf. Sie hatte genau wie ich große braune Augen und Locken im selben Farbton.
Mom sorgte immer dafür, dass wir hübsch aussahen und da sie noch zu klein war, um sich gegen ihre Stylingattacken zu wehren, trug sie auch heute wieder rosa Schleifen in den Zöpfen, die ihr links und rechts über die Schultern fielen.
"So schlimm wie vorhin war's noch nie", erklärte Lu und senkte ihren Blick, um mit dem Ausschneiden fortzufahren.
"Aber sie haben sich wieder vertragen", stellte ich fest und setzte mich neben sie.
Ich strich über den kuscheligen türkisen Teppich, der früher einmal in meinem Zimmer gelegen hatte.
Ich hätte ihn gern behalten, aber da wir knapp bei Kasse waren und Lu einen Spielteppich gut gebrauchen konnte, hatte ich ihn ihr überlassen.
Lu zuckte mit den Schultern.
"Sieht wohl so aus", sagte sie mit ihrer engelsgleichen Stimme und schnitt ihrem Pony eine Fransenfrisur.
Für ihre fünfeinhalb Jahre war sie erstaunlich geschickt.
Im Gegensatz zu mir, war sie schon immer toll im Balancieren, Tanzen oder wenn es darum ging, etwas zu basteln.
Ich hatte wenig Talent für solche Dinge.
Wahrscheinlich liebte ich es deshalb so sehr, mit James durch die Wälder zu streifen, am Strand herumzutollen und Burgen zu bauen, statt mit Puppen zu spielen.
Plötzlich hörten wir eine Tür zuknallen.
"Du wirst es ihnen sagen! Heute noch!", erklang Moms Stimme in gedämpften Ton.
Sie war wütend, das war schwer zu überhören.
Am Freitag kam Dad meistens früher von der Arbeit. Trotzdem beschwerte sich Mom auch an diesem Tag in der Regel zuallererst darüber, dass er zu viel arbeitete, wenn er das Haus betrat.
Das Kuriose daran war, dass sie sich auch darüber beklagte, wir hätten zu wenig Geld.
Ich verstand nicht, wie Dad hätte weniger arbeiten und dafür mehr Geld verdienen können. Aber das sagte ich ihr nicht. Sie hatte die Angewohnheit schnell böse zu werden und das nicht nur was unseren Vater anging.
"Du bist das Letzte", hörte ich Dad zischen und erschrak.
Normalerweise sagte er keine gemeinen Dinge zu Mom.
Egal wie sehr sie tobte, er blieb stets ruhig und besonnen.
Das bewunderte ich sehr an ihm. Eigentlich war er genau das Gegenteil von ihr.
Und es gab ja diesen Spruch, der besagte, Gegenteile würden sich anziehen. Deshalb dachte ich manchmal, dass die vielen Streitereien meiner Eltern gar nicht so schlimm sein konnten. Vielleicht musste das ja so sein, wenn man sich liebte.
Aber von Zeit zu Zeit beschlich mich trotzdem das Gefühl, dass bei uns zu Hause irgendetwas nicht richtig lief.
James hatte mir gesagt, dass seine Eltern sich nur ganz selten gestritten hatten.
Nicht einmal, als seine Mutter noch gesund war.
Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber da ich wusste, dass James nie log, glaubte ich ihm.
In diesem Moment ging die Tür zu Lus Kinderzimmer auf.
Unser Dad, ein hochgewachsener, schlanker Mann mit vollem braunen Haar und einer kleinen runden Brille auf der Nase, strahlte uns an.
"Habt ihr Lust auf ein Abenteuer?", fragte er mit dem Tonfall eines Gameshowmoderators.
"Jaaa!", rief Lu und sprang im Nu auf.
Sie rannte mit ausgestreckten Armen auf ihn zu, er packte ihre Hüften und wirbelte sie in dem winzigen Kinderzimmer herum.
Als er sie wieder hinunter auf den Boden ließ, sah mein Vater an ihr vorbei zu mir.
"Und was ist mit der kleinen Nixe dahinten?", fragte er und zog eine Braue hoch.
Ich liebte es, wenn er mich so nannte.
Niemand sonst tat das.
Na gut — James manchmal, um mich aufzuziehen, weil er es einmal mitbekommen hatte, dass Dad mich so rief.
Außerdem wusste er, wie sehr ich auf Meerjungfrauen abfuhr.
Ich hatte es ihm daraufhin verboten, weil diese Sache nur mir und meinem Dad gehörte.
Aber ich war nicht sauer, wenn er mich ab und zu damit neckte.
Denn neben meinem Dad und meiner Schwester war James mein liebster Mensch auf der Welt.
Mom kam direkt danach.
"Was machen wir?", fragte ich, obwohl ich Dad gut genug kannte, um zu wissen, dass er sein für uns geplantes Abenteuer nicht vorschnell preisgeben würde.
Dafür mochte er es viel zu sehr, uns zu überraschen.
"Wenn ich das nur wüsste", entgegnete er und nahm die wild auf und ab hüpfende Lu an die Hand. "Mitgehen auf eigene Gefahr."
"Das ist unfair!", beschwerte ich mich, während ich aufstand.
Dad gefiel es, wenn er Neugier in uns wecken konnte.
Bei mir wurde das natürlich mit jedem neuen Lebensjahr schwieriger.
Aber weil ich wollte, dass mein Vater sich freute, spielte ich ihm das Neugierigsein öfter mal vor.
Für gewöhnlich gingen wir in den Queen Elizabeth Park, denn der war nicht so weit von unserem Zuhause entfernt.
"Denk daran, was wir besprochen haben!", sagte Mom in warnendem Ton, als Dad mit Lu und mir den Flur entlang ging.
Sie stand im Türrahmen des Schlafzimmers. Ihr Augen-Make-up war ganz verschmiert und deutete darauf hin, dass sie geweint haben musste.
Mom trug ihr Make-up stets sehr dick auf, weil es ihr wichtig war, in jeder Situation gut auszusehen. Sie sagte, dass man nie wisse, wen man bezirzen müsse, um aus der Klemme zu kommen.
Das fand ich komisch, denn wie bitte kamen Menschen, die sich nicht schminkten, aus brenzligen Situationen heraus?
Auf jene Frage hatte sie lediglich erwidert, sie hätte es allein ihrem Aussehen zu verdanken, dass wir nicht jede Woche eine Strafgebühr für zu schnelles Fahren oder Falschparken bekamen.
Die Männer auf dem Revier hätten nämlich eine Schwäche für schöne Frauen, meinte sie. Und Dad könne froh sein, dass sie die Familie immer wieder aus dem Schlamassel zöge.
Mein Vater bedachte Mom mit einem kurzen Nicken und öffnete die Haustür.
"Los, raus mit euch beiden!", sagte er freundlich.
Lu schlüpfte unter seinem Arm hindurch und rannte in unseren Vorgarten.
Ich zögerte einen Moment und sah besorgt erst zu Mom und dann zu Dad.
"Na los, Blaire!", wies Mom mich mit ihrer gewohnt gebieterischen Art an.
Ich wollte protestieren, aber wusste nicht womit.
Das Gefühl, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht richtig lief, drückte schwer auf meine Brust.
Aber da ich nicht wusste, was ich hätte sagen oder machen können, um die eisige Kälte zwischen meinen Eltern zu durchbrechen, gehorchte ich widerwillig und ging hinaus zu meiner Schwester.
Dad folgte uns nicht sofort, sondern schloss noch einmal von innen die Tür, bevor er fünf Minuten später mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck das Haus endgültig verließ.
Irgendetwas tief in mir drin fühlte sich seltsam an. Ich hatte kein Geschrei gehört und war mir trotzdem sicher, dass etwas Ungutes vor sich ging.
Ich wollte nicht, dass sie sich stritten, aber das vertraute Gezeter von Mom wäre mir in diesem Augenblick tausendmal lieber gewesen als diese angespannte Stille.
***
"Gehen wir gar nicht in den Queen Elizabeth Park?"
Ich runzelte die Stirn, als Dad den Wagen aufschloss.
Normalerweise liefen wir zu Fuß, um Sprit zu sparen.
"Heute machen wir etwas ganz Besonderes", antwortete er, während er sicherstellte, dass Lu richtig angeschnallt war.
"Was denn? Was denn?", kreischte sie von der Rückbank aus.
"Überraschung!", erinnerte unser Vater und stupste mit dem Finger auf ihre von Sommersprossen gezeichnete Nase.
Lu schob schmollend die Unterlippe vor.
Ich fürchtete, das hatte sie von mir gelernt.
Ich saß vorne, denn ich war schon fast zehn und somit groß genug für den Beifahrersitz.
"Das wird dir gefallen", sagte Dad und drückte sanft mein Knie.
Ich hatte noch immer meine nasse, hochgekrempelte Hose an.
Bis zu diesem Moment hatte ich gar nicht mehr daran gedacht, sie zu wechseln.
"Wo hast du dich rumgetrieben?", wollte Dad mit Blick auf meine Jeans wissen.
Ich erzählte ihm, dass ich mit James am Sunset Beach unterwegs gewesen war.
"Ist ein guter Junge", bemerkte er und startete den Motor.
Ich war froh, dass er mich nicht zwang, noch einmal ins Haus zu gehen, um mich umzuziehen, so wie Mom das getan hätte.
"Ist ganz okay", antwortete ich schulterzuckend.
Obwohl ich James natürlich mehr als ganz okay fand, immerhin war er mein bester Freund. Aber irgendwie war es komisch, mit meinem Vater über ihn zu sprechen.
Dad musste das gespürt haben, denn er fragte nicht weiter nach.
Als wir auf dem Parkplatz des Aquariums zum Stehen kamen, konnte ich es nicht fassen!
Wir waren bisher erst ein einziges Mal hier gewesen, nämlich zu meinem siebten Geburtstag. Das war eine große Ausnahme, denn die Eintrittskarten waren nicht billig.
Ich hätte nie gedacht, Mom und Dad so bald wieder zu einem Besuch überreden zu können. Und nun hatte ich nicht einmal gefragt!
Ich freute mich riesig! Gleichzeitig machte sich ein dumpfes Gefühl der Angst in meiner Magengrube breit. Es musste etwas zu bedeuten haben, dass Dad mit Lu und mir hergefahren war.
Was hatte Mom damit gemeint, er solle es uns heute sagen?
Schon während der gesamten Fahrt hatte ich mir darüber den Kopf zermartert.
Auf dem Weg zum Aquarium kamen wir an Roteichen und Hemlocktannen vorbei. Letztere waren meine Lieblingsbäume, auch wenn es sie auf dem Festland zuhauf gab. Sie verströmten für mich die Atmosphäre von Weihnachten und das liebte ich. In der Weihnachtszeit gab es nämlich weniger Streitereien bei uns zu Hause.
Ich wusste zwar, dass der Frieden nicht von Dauer — dass er nicht echt war —, aber er war besser als nichts.
Für die paar Tage zwischen Weihnachten und Silvester waren wir eine glückliche Familie.
Mein Herz machte einen Satz, als wir die blau-türkise Unterwasserwelt betraten.
Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, bei der Vielzahl von bunten Fischen und Seeanemonen.
Die Welt unter Wasser hielt so viele Wunder bereit und obwohl ich mittlerweile wusste, dass es vermutlich keine echten Meerjungfrauen gab, hoffte ich trotzdem insgeheim, doch noch einer zu begegnen.
Nur weil noch nie jemand eine bestimmte Sache gesehen hatte, hieß das schließlich nicht zwangsläufig, dass sie nicht existierte.
Nachdem wir zweieinhalb Stunden staunend umhergewandert waren – selbst meine pferdefanatische kleine Schwester war begeistert – blieben wir an einer der vielen Holzbänke stehen und setzten uns.
Dads Gesichtsausdruck war die ganze Zeit über ernst gewesen.
Er hatte zwar seine üblichen Scherze mit uns gemacht, Lu Huckepack getragen und viel zu den verschiedenen Fischarten erklärt, aber irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Das fühlte ich.
"Was hat Mom vorhin gemeint?", fragte ich zögerlich, nachdem ich mein Gewicht von der linken auf die rechte und wieder auf die linke Pobacke verlagert hatte.
Ich war ganz schön nervös, denn was auch immer es war, was er uns sagen sollte – es konnte nichts Gutes sein.
"Was meinst du?"
Dad sah mich an, als wüsste er nicht, worum es geht.
Ich griff in meine Hosentasche und kramte das Kleingeld hervor, mit dem ich James und mir später ein Eis kaufen wollte.
"Willst du einen Schokoriegel?", fragte ich Lu.
Sie saß neben mir und hatte bis gerade eben noch wie gebannt eine Ansammlung von besonders schönen Seesternen in dem Aquarium vor uns beobachtet.
Nun sah sie mit großen Augen zu mir auf und nickte eifrig.
Ich drückte ihr das Geld in die Hand und zeigte auf den Imbissstand, der nur wenige Meter entfernt und in Sichtweite war.
Ich hatte Lu beigebracht, wie man Dinge im Supermarkt bezahlte und wusste, dass sie das hinbekam. Außerdem würde ich sie nicht aus den Augen lassen.
Ich brauchte nur ein paar Minuten mit Dad allein, denn vielleicht war das, was er zu sagen hatte, nichts, was sie hören sollte.
Unser Vater war wunderbar darin, mit uns zu spielen oder uns zuzuhören, Ratschläge zu geben und solche Sachen. Aber manchmal schien er zu vergessen, dass wir für bestimmte Dinge noch nicht alt genug waren.
"Ist es was Schlimmes?", fragte ich, als Lu zum Imbiss losgestiefelt war.
Dad wich meinem Blick aus und starrte stattdessen in das wabernde Blau.
"Mach dir keine Sorgen, kleine Nixe! Alles wird gut."
Er streichelte über meinen Kopf, dann legte er seinen Arm um meine Schultern und zog mich näher an sich.
Was ist denn nicht gut?, hatte ich fragen wollen. Doch er unterbrach meine Gedanken, als er sagte: "Ihr passt immer schön auf euch auf, du und deine Schwester, ja?"
Ich löste mich aus seiner Umarmung und sah hoch zu ihm; sein Blick war immer noch stur geradeaus gerichtet.
"Ja, aber – wieso sagst du das?"
Meine Stimme klang verzweifelt. Er und Mom waren doch auch noch da.
"Nur damit du es nicht vergisst. Manchmal verändern sich die Umstände, wenn man älter wird", bemerkte er seufzend.
Dann sah er mich endlich an.
Eine tiefe Falte lag zwischen seinen Augenbrauen.
"Ihr seid Schwestern. Daran musst du immer denken. Ihr müsst füreinander da sein."
Ich nickte.
"Klar."
"Und jetzt lass uns mal schauen, um was unsere Kleine mit ihrem Welpenblick den Kioskbesitzer noch alles erleichtert! Eure Mutter bringt mich um, wenn ihr vor dem Mittagessen zu viel Süßes esst."
Mit diesen Worten stand er auf und ging zu dem Imbissstand, an dessen Theke sich Lu mit ihren kleinen Händen festhielt und den Besitzer zu bezirzen versuchte.
Ich rollte mit den Augen und hoffte, sie würde wie ich irgendwann verstehen, dass sie Moms Ratschläge stets noch einmal überdenken musste.
Das flaue Gefühl in meinem Magen verschwand auch nicht, als wir wieder im Auto saßen und zurück nach Hause fuhren.
Dad hatte nichts weiter zu dem Thema gesagt und ein Teil von mir wollte glauben, dass ich mich vielleicht getäuscht hatte; es tatsächlich nicht um etwas Wichtiges gegangen war, und er diesen Ausflug einfach so mit uns gemacht hatte.
Doch an diesem Tag sollte ich lernen, dass das Leben auf jeden Fall kein Märchen ist; sondern manchmal einfach nur scheiße.
Und dass einen die liebsten Menschen auf der ganzen Welt so bitter enttäuschen können, dass man nie, nie, nie wieder irgendjemanden in sein Herz lassen will.
Als wir zu Hause ankamen, sagte Dad, wir sollten schon mal reingehen. Er hätte noch etwas zu erledigen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Mom das gutheißen würde. Immerhin hatten wir noch kein Mittag gegessen und sie wartete sicher schon auf uns.
"Es ist wichtig. Ich bin gleich zurück", versicherte mein Vater, nachdem ich ihm meine Bedenken mitgeteilt hatte.
Genau wie vorhin im Aquarium sah er mir dabei nicht in die Augen.
Lu hatte sich bereits abgeschnallt und war ins Haus gerannt, weil sie dringend pinkeln musste.
"Du kommst aber wieder, oder?"
Ich wusste nicht, weshalb ich das fragte. Er war doch mein Vater und würde nicht einfach so abhauen.
Aber … er war während der letzten paar Stunden so seltsam gewesen.
Ich musste es aus seinem Mund hören.
"Ich bin immer da, Blaire", antwortete er mit rauer Stimme.
Dann schaute er mich an und strich mir eine Locke von der Schulter auf den Rücken.
Seine braunen Augen sahen glasig aus.
"Und jetzt geh rein zu deiner Schwester."
"Aber, Dad –", begann ich. Doch er schnitt mir das Wort ab.
"Geh rein, Blaire!"
Noch nie hatte er in einem solchen Ton mit mir gesprochen – so wie Mom.
Ich schluckte und schnallte mich ab.
"Bis gleich", sagte ich, bevor ich die Autotür zumachte.
Aber er antwortete nicht.
Ich schaute ihm nach, bis unser gelber VW nicht mehr zu sehen war.
Als ich ins Haus kam, saß Mom weinend am Tisch.
Es roch weder nach Essen, noch hatte sie Besteck oder Teller hergerichtet.
Sie saß einfach nur da, die Ellenbogen auf der Holzkante abgestützt, das Gesicht in den Händen vergraben.
Lu stand neben ihr und streichelte behutsam über ihren Rücken.
"Nicht weinen, Momi", sagte sie wieder und wieder.
Doch das Schluchzen unserer Mutter war so laut, dass es Lus zarte Stimme übertönte.
***
Zehn Minuten, nachdem ich unser Haus betreten hatte, fragte ich Mom, was los sei.
Doch sie antwortete nicht.
Irgendwann – gefühlt war sicher mehr als eine Stunde vergangen – stand sie einfach auf und ging hoch in ihr Schlafzimmer. Dort schloss sie sich ein und weinte weiter.
Lu und ich blieben am Küchentisch zurück.
Da Mom nichts gekocht und Lu sicher Hunger hatte, versuchte ich mich an Kartoffelbrei aus der Tüte und Rührei. Ich hatte Mom schon öfter dabei zugesehen.
Ich gab mir reichlich Mühe, aber der Kartoffelbrei wurde klumpig und das Rührei brannte an.
"Das schmeckt eklig", quengelte Lu und verzog das Gesicht.
"Tut mir leid", sagte ich leise und schob meinen Teller beiseite.
"Wann kommt Dad nach Hause?"
Sie sah mich mit hoffnungsvollen Augen an.
"Ich weiß es nicht", antwortete ich und unterdrückte ein Seufzen.
Wir saßen zwei Stunden am Tisch und warteten.
Doch er kam nicht.
Als es fünf vor fünf war, sagte ich Lu, dass ich noch mal weg müsse.
"Du kannst mit. Möchtest du?", schlug ich vor, obwohl das eher eine Feststellung als eine Frage war.
Wer wusste schon, wann Mom wieder aus dem Schlafzimmer kommen würde.
Erst wollte Lu nicht, aber als ich ihr von meiner Verabredung mit James erzählte, war sie dabei.
Sie mochte James, denn genau wie Dad schaffte er es immer, sie zum Lachen zu bringen.
Ich schnappte mir mein pink lackiertes Fahrrad, half Lu auf den Gepäckträger und wartete, bis sie ihre Arme fest um meinen Bauch geschlungen hatte.
Dann radelte ich los.
Als wir bei dem großen Felsen am Sunset Beach ankamen, war James bereits da.
Er lehnte an dem bestimmt zwei Meter hohen anthrazitfarbenen Gestein, die Hände in den Hosentaschen vergraben und den Blick zum Meer gerichtet.
Ich half Lu beim Absteigen und legte das Rad nahe dem Felsen in den Sand.
"Hey", begrüßte ich ihn.
Sonnenstrahlen fielen auf James gebräunte Haut und ließen seine dichten dunkelbraunen Wimpern noch voller aussehen.
Obwohl er erst zehn war, bekam er schon jede Menge Liebesbriefe von Mädchen aus der Schule. Er sagte aber immer, dass er keine Lust auf eine Freundin habe.
Er fand Mädchen genauso blöd wie ich Jungs. Nur beim jeweils anderen machten wir eine Ausnahme, was sicher daran lag, dass wir uns schon so lange kannten.
James sah erst zu mir, dann zu Lu und wieder zu mir.
"Hi", sagte er, nachdem einige Sekunden verstrichen waren. "Alles klar?"
Ich presste die Lippen aufeinander und schluckte.
"Mom weint und Dad ist weg", platzte Lu heraus.
James schaute mich fragend an.
Er trug ein blau-weiß geringeltes T-Shirt, das seine Sommerbräune gut zur Geltung brachte. Seine Haare waren ein bisschen wellig und verwuschelt.
"Weiß nicht", gab ich zu.
Auf einmal fing Lu an zu schluchzen.
"Hey, hey!", begann James und stupste sie sacht in den Bauch.
Dann kniete er sich hin und platzierte seine Hände parallel zu seinen Beinen im Sand.
"Na", neckte er Lu, "willst du aufsteigen?"
Bei dem merkwürdigen Wiehergeräusch, das er von sich gab, musste sogar ich lachen.
Lus sorgenvolles Gesicht machte einem breiten Grinsen Platz.
Sie nickte eifrig und kletterte in Windeseile auf seinen Rücken.
Ich beobachtete ihn, wie er mit ihr den Wellen entgegenjagte und wieder zurück – im Schneckentempo versteht sich, denn es ist ganz schön schwer auf allen Vieren schnell zu sein.
Lu kicherte immer wieder und rief: "Hüa! Hüa, Pferdchen!"
In dem Moment war ich richtig froh, dass wir hergekommen waren.
Und dass James da war.
Nach ungefähr zehn Minuten kamen sie zurück.
James klopfte sich den Sand von der Jeans und als Lus Bauch knurrte, lud er uns zu sich nach Hause ein.
Sein Vater war noch nicht da, denn anders als unserer arbeitete er am Freitag wie an allen anderen Wochentagen immer bis spät in die Nacht hinein, wenn es viel zu tun gab.
James war ganz schön oft allein, denn er durfte um diese Uhrzeit auch nicht mehr zu uns kommen, was ich sehr schade fand.
Sicher hätten Mom und Dad etwas dagegen, wenn sie wüssten, dass wir ihn einfach besuchten, ohne dass ein Erwachsener darüber Bescheid wusste.
Mom auf jeden Fall!
Aber so wie ich das sah, war sie im Moment nicht da und Lu hatte Hunger, also … entschied ich, dass es in Ordnung war, mit zu ihm zu gehen.
James machte uns Nudeln mit Tomatensoße und ich war wirklich erstaunt, wie gut das schmeckte. Lu schien auch zufrieden, denn sie verschlang die gesamte Portion, die James ihr aufgefüllt hatte.
"Wollt ihr mal was Cooles sehen?", fragte James, nachdem wir die Teller abgewaschen und abgetrocknet hatten.
"Ja!", rief Lu begeistert und ohne lange nachzudenken.
Ich nickte.
"Dann kommt mal mit!", wies James uns an und wir folgten ihm in sein Kinderzimmer.
Es dämmerte draußen bereits, aber er ließ trotzdem seine Jalousie hinunter.
Vorher sagte er, dass wir uns in der Mitte seines Zimmers auf den Teppich legen sollten.
Ich fand das komisch, sagte aber nichts.
Lu war sofort Feuer und Flamme. Sie hüpfte auf einem Bein in James Zimmer hinein und ließ sich dann auf ihren Po plumpsen.
Es sah schmerzhaft aus und nicht so, als habe sie diesen abrupten Fall beabsichtigt. Aber sie machte keinen Mucks.
Zögerlich folgte ich ihrem Beispiel und setzte mich neben sie auf den Boden.
"Hinlegen", kommandierte James gespielt autoritär.
Wir gehorchten.
Als es stockdunkel im Zimmer war, knipste James eine Lichterkette an, die an der Decke im Karree gespannt war. Jetzt leuchteten unzählige große und kleine Sterne.
"Whoaaaaw!", staunte Lu.
"Hab ich selbst gemacht", erklärte James stolz.
"Sieht echt schön aus", sagte ich und meinte es so.
Ich fand es ziemlich beeindruckend, dass James immer so geschickt war, wenn es darum ging, seine Hände zu gebrauchen.
"Kannst du uns was vorlesen?", fragte Lu in einem Quengelton, der kein Nein duldete.
James überlegte kurz, dann rollte er sich auf die Seite und zog unter seinem Bett eine Kiste hervor.
Er nahm den Deckel ab und zum Vorschein kamen zig Kinderbücher.
Er warf mir einen verschwörerischen Blick zu und gerade, als ich mich fragte, für welches er sich wohl entscheiden würde, begann er, noch ehe er das Buch aufgeschlagen hatte, mit den Worten: "Es war einmal ein Meerkönig …"
Ein warmes Gefühl breitete sich in meiner Brust aus.
Er hatte die Geschichte der kleinen Meerjungfrau gewählt. Dabei mochte er sie nicht einmal besonders.
Ich schloss die Augen und legte eine Hand auf meinen Bauch, die andere verschränkte ich mit Lus.
"... die Meerjungfrau rettete den Prinzen, denn sie wusste, dass Menschen nicht unter Wasser atmen können", las er vor. "... sie verliebte sich in ihn, doch als er wieder an Land war, dachte er, eine andere hätte ihn gerettet, denn er wusste nichts von der Meerjungfrau. Also ging die kleine Meerjungfrau zur Meerhexe und besorgte sich einen Trank, durch den ihr Hände und Füße wuchsen, sodass sie an Land gehen und den Prinzen suchen konnte."
Ich blinzelte und drehte meinen Kopf, um James anzusehen.
Er saß mit angezogenen Beinen vor seinem Bett. Das Buch hatte er auf seinen Knien abgelegt. Als er meinen Blick bemerkte, lächelte er.
Und für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich das Gefühl, die Welt wäre noch in Ordnung.
Was auch immer das hieße.
Es fühlte sich an, als wäre nichts von dem bereits Geschehenen wahr; so als wären wir drei in einer Blase und die Zeit stünde still.
Hier in James Zimmer waren wir sicher.
"... es gab jedoch eine Einschränkung", las James weiter. "Die kleine Meerjungfrau würde bei jedem Schritt Schmerzen haben. Außerdem würde sie sich zu Schaum auflösen, wenn der Prinz die andere Frau heiraten würde, die er für seine Retterin hielt. Der kleinen Meerjungfrau war das egal, denn sie liebte den Prinzen.
Als Bezahlung für den Trank verlangte die Meerhexe ihre Stimme. So konnte sie dem Prinzen nicht einmal sagen, dass sie es war, die ihn gerettet hatte."
Erst als die Geschichte zu Ende war, merkte ich, dass Lu bereits schlief.
Also hoben James und ich sie vorsichtig hoch und legten sie in sein Bett.
"Ich muss jetzt erst mal nach Hause", sagte ich.
Mittlerweile war es schon halb sieben. Falls Mom wieder aus dem Schlafzimmer gekommen war und bemerkt hatte, dass wir nicht da waren, würde sie sich bestimmt Sorgen machen.
Außerdem war Dad jetzt vielleicht endlich zurückgekehrt.
Ich würde ihn fragen, was das alles zu bedeuten hatte und dann war es gut, wenn Lu nicht da war.
Deshalb ließ ich sie vorerst bei James schlafen.
"Danke", sagte ich leise, als wir unten an der Haustür standen.
"Keine Ursache", entgegnete er und deutete ein zaghaftes Lächeln an, das ich erwiderte.
Ich erklärte ihm, dass ich gleich wiederkommen würde und er versprach mir, so lange auf Lu aufzupassen.
Auf ihn war stets Verlass.
Als ich zu Hause ankam, war der Platz vor der Garage noch immer leer.
Mom war auch noch nicht wieder aus dem Schlafzimmer gekommen.
Dafür fehlte die Flasche Wein, die Onkel Matthew und Tante Elizabeth ihr und Dad zum letzten Hochzeitstag geschenkt hatten.
Sie hatte immer in der Vitrine über dem Fernseher gestanden und da wir nicht gerade viele Dekogegenstände besaßen, fiel mir gleich auf, dass sie nicht mehr da war.
Offenbar weinte Mom auch nicht mehr, denn im Haus war es ganz still.
Genauso still wie heute Mittag, als ich vom Strand zurückgekehrt war.
Ich wusste, dass es nicht in Ordnung war, aber ich wollte nicht an diesem Ort bleiben.
Also radelte ich zurück und erzählte James, dass uns Mom erlaubt hatte, bei ihm zu übernachten.
Hätte mein bester Freund die Wahrheit gewusst, hätte er sicher versucht, mich davon zu überzeugen, dass es besser wäre, nach Hause zu gehen, und das wollte ich nicht.
Er holte ganz viele Decken aus dem Wohnzimmer und breitete sie auf dem Boden in seinem Zimmer aus.
Da Lu inzwischen so ausgestreckt dalag, dass sie das gesamte Bett für sich beanspruchte, legten James und ich uns auf die Decken.
Irgendwann streckte er seinen Arm aus und ich legte meinen Kopf darauf.
Es sah ja keiner, deshalb war das vermutlich ausnahmsweise okay.
Unsere Nachtruhe dauerte nicht sehr lange, denn als James Vater gegen elf Uhr nach Hause kam und noch einmal nach ihm sah, entdeckte er uns.
Er schimpfte und bestand darauf, unsere Eltern anzurufen.
Als keiner ans Telefon ging, mussten wir in seinen Wagen steigen und mit ihm zu unserem Haus fahren.
Mom machte nach dem vierten Klingeln auf.
Als sie hörte, dass wir ohne ihre Erlaubnis bei James übernachten wollten, wurde sie sehr wütend.
Wir bekamen beide Hausarrest und ich durfte noch nicht einmal mein Fahrrad am nächsten Tag holen – James brachte es am Vormittag vorbei.
Ich hatte ihn vom Fenster aus gesehen und gewunken, denn ich durfte nicht nach unten gehen. Mom konnte ziemlich streng sein, wenn sie wollte.
Er winkte zurück und malte ein großes Fragezeichen in die Luft, woraufhin ich nur mit den Schultern zuckte.
Dann hatte ich einen Geistesblitz und schrieb in Großbuchstaben "Hausarrest" auf einen Zettel, den ich dann aus dem Fenster segeln ließ.
Rufen wäre nämlich zu laut gewesen, da hätte Mom mich garantiert gehört.
James nickte und machte ein verständnisvolles Gesicht.
Dann führte er einen seltsamen Tanz auf, der wohl komisch sein sollte.
Er sah einfach nur verdammt albern aus – so albern, dass ich zum Schluss laut lachen musste und mir schnell die Hand vor den Mund hielt.
James winkte noch einmal und ich winkte zurück und sah ihm nach, so wie ich Dad nachgesehen hatte, als er gestern am Horizont verschwunden war.
***
Dad kam auch am nächsten und am übernächsten Tag nicht zurück.
Im Badezimmer fehlten seine Kosmetikartikel und als Mom einmal unten in der Küche war, hatte ich die Gelegenheit genutzt und war in das Elternschlafzimmer geschlichen.
Dads Schrankseite war komplett ausgeräumt.
Da wusste ich, dass er so schnell nicht wiederkommen würde und konnte es einfach nicht fassen.
Ich hatte nie infrage gestellt, dass Dad Lu und mich liebte.
Er war immer ein fantastischer Vater gewesen.
Der beste, den man sich vorstellen konnte.
Wenn ich Mom nach Dad fragte, sagte sie nur, sie wisse nicht, wo er sei und dass er seine Familie im Stich gelassen habe.
Lu weinte ganz oft, was mich noch trauriger machte.
Aber ich riss mich zusammen, damit ich sie trösten konnte.
Mit einem Mal verstand ich, warum James so lange nicht mehr geweint hatte.
Ich hatte nämlich plötzlich das Gefühl, selbst nie wieder weinen zu können, weil ich die Tränen so oft unterdrückt hatte, dass sie mittlerweile irgendwo in meinem Körper stecken zu bleiben schienen.
Wenn ich es abends allein in meinem Zimmer versuchte, weil ich dieses drückende Gefühl in meiner Brust endlich loswerden wollte, kam einfach nichts.
Keine zwei Wochen später stellte Mom uns ihren neuen Freund vor.
Es wunderte mich, wie sie so schnell einen neuen Mann gefunden hatte, wo sie doch so gut wie nie ausging.
Außerdem wollte ich nicht, dass sie Dad ersetzte, denn ich rechnete immer noch damit, dass er jeden Augenblick zurückkommen würde.
Vielleicht brauchte er ja nur mal eine Pause.
Der Gedanke, dass Dad Urlaub von uns, seiner Familie, machte, schmerzte zwar, aber er war sehr viel erträglicher als die Tatsache zu akzeptieren, dass er uns für immer verlassen hatte und nie wieder zurückkehren würde.
Einen Monat später zogen wir in die Villa von Moms neuem Freund Bill.
Bill war ziemlich reich. Er hatte drei Autos, die glänzten und teuer aussahen und seine Villa hatte einen nierenförmigen XXL-Pool und zwei Bedienstete.
Mom sagte, sie hätte Bill beim Einkaufen kennengelernt, was mir schwerfiel zu glauben, denn Bill kaufte nie selbst ein.
Noch zwei Monate später heirateten sie.
Lu hatte sich schneller an ihn gewöhnt als ich.
Es hatte zumindest den Anschein und ich nahm an, dass Bill eine große Ranch mit sechs Rennpferden besaß, machte die Sache erheblich leichter für sie.
Da wir jetzt am anderen Ende von Vancouver wohnten, sahen James und ich uns fast nur noch in der Schule.
Mom hatte sich einmal breitschlagen lassen, ihn abzuholen und ein weiteres Mal war er mit dem Rad zu uns gekommen. Beides stellte sich auf lange Sicht als höchst unpraktikabel heraus.
Erstens, weil Mom mir unmissverständlich zu verstehen gab, dass sie diese Ausnahme nicht noch einmal machen würde.
Und zweitens, weil der Hin- und Rückweg von James’ Haus zu unserer neuen Villa insgesamt vier Stunden mit dem Fahrrad dauerte.
Es fuhr auch kein Bus und obwohl Bill im Geld schwamm, wollte er mir keins für eine Taxifahrt geben.
Anfangs war ich sauer deswegen und traurig, aber dann nicht mehr so.
Irgendwann begann ich mich an die neue Situation zu gewöhnen.
Äußerlich war mein Leben sehr viel angenehmer geworden – wir hatten immer Obst und Gemüse auf dem Tisch, bekamen ständig neue Klamotten und Mom sorgte sich nicht mehr, dass uns der Strom abgestellt werden könnte.
Innerlich jedoch fühlte sich zunehmend alles so an, als wäre ich ein Fisch, der in einem Aquarium hinter einer dicken Scheibe lebte.
Zwar tat meine Brust nicht mehr so weh, aber dafür spürte ich auch andere Dinge nicht mehr so stark.
Ich lachte selten und wenn dann nicht richtig.
So wie ich das mit James immer getan hatte. Oder mit Dad.
Das war vermutlich die einzig gute Sache daran, dass ich James nicht mehr so oft sah: ich dachte weniger an meinen Vater. Und das war gut.
Irgendwann in dieser Zeit, im ersten Jahr nach der Hochzeit von Mom und der absoluten Gewissheit, dass Dad nicht wiederkehren würde, hatte mein Herz einen irreversiblen Schaden genommen.
Doch das merkte ich erst sehr viel später.
Wer steht nicht auf Literatur?
Einige Jahre später ...
"T-H-O-R-N!!!", skandierten wir im Gleichklang und formten die einzelnen Buchstaben mit unseren Körpern nach, als wären wir Cheerleader.
Alle außer Madox.
Er gehörte zu uns, zu den P-Fiends – den privilegierten Teufeln des Thorn Elite Colleges –, und das war der einzige Grund, weshalb er sich die Ruderwettkämpfe zu Gemüte führte.
Aber er machte keinen Hehl daraus, dass er das Gekreische und das Anfeuern missbilligte.
Er stand auch nicht klatschend auf, als unsere Jungs wie jedes Semester die Goldmedaille holten.
Madox' Familie gehörte zu den wohlhabendsten in Kanada, genau wie die unseren.
In Vancouver hielten die Reichsten der Reichen zusammen.
Unsere Eltern waren allesamt Mitglieder im Vice Country Club, dessen monatliche Beiträge so obszön hoch waren, dass sich andere Familien damit für ein Jahr hätten ernähren und ihre Miete bezahlen können.
Das Thorn nahm regelmäßig zum Start des neuen Semesters an einem Ruderwettkampf teil, bei dem die besten sechzehn Colleges des Landes gegeneinander antraten.
Ich mochte die Wettkämpfe. Beim gemeinsamen Jubeln und Mitfiebern spürte ich stets eine Verbundenheit mit anderen, die mir im Alltag fehlte. Außerdem gehörten Benji und Rash seit dem ersten Jahr, an dem wir alle fünf am Thorn aufgenommen wurden, zum Schulteam der Ruderer.
Zusammen mit Madox, der mit seiner rebellischen Art großartig mit der ebenfalls eigensinnigen Sky harmonierte, waren sie die Könige des Colleges.
Alle Studenten hatten Respekt und Achtung vor ihnen — sie fürchteten sie regelrecht.
Und ich war ihre Königin.
Ach ja – und Sky natürlich auch!
Allerdings hielt sie sich für moralisch überlegen, weshalb sie sich selbst nie so nennen würde.
Doch das änderte nichts daran, dass es stimmte. Auch ihre Familie war milliardenschwer, darüber konnten auch ihre Hippie-Klamotten, die sie – weiß der Teufel warum – in Secondhand-Läden kaufte, nicht hinwegtäuschen.
Dass sie trotz ihres Bemühens, nicht versnobt zu wirken, Porsche fuhr, war einfach nur lächerlich. Aber das behielt ich für mich.
Wir saßen in der obersten – stets für uns reservierten – Reihe, als die Trommeln ertönten und unsere Mannschaft auf die Tribüne gerufen wurde, um vor dem Start des Wettkampfes noch einige Worte an die Zuschauer zu richten.
Die Ehre des Sprechens gebührte stets dem Team, das im vorherigen Semester den Sieg davon getragen hatte.
Seit Benji und Rash mit von der Partie waren, hatte das Thorn zwei Mal in Folge gewonnen.
Mich wunderte das nicht, denn beide waren von klein auf Leistungssportler und trainierten hart, um sich und ihren Körper durch immer neue Herausforderungen an ihre Grenzen zu bringen.
Rashs Eltern waren nach Kanada immigriert, als er drei oder vier Jahre alt gewesen war.
Sie waren Besitzer eines Ölimperiums und unzähliger Hotels in Dubai, ihrer Heimat.
Rash, der eigentlich Rashid Noel Stone hieß, wurde von seinen Erzeugern praktisch gezwungen, sich über den Sport zu integrieren.
Schwer zu sagen, ob das eine gute oder schlechte Erziehungsmethode war. Jedenfalls war Rash ein erstklassiger Tennisspieler, Ruderer und Boxer.
Letzteres zum Leidwesen seiner Eltern, denn Boxkämpfe gehörten in unseren Kreisen nicht gerade zum guten Ton.
Mit der Änderung ihres Nachnamens – zusammen mit den Milliarden, die sie auf ihren Konten hatten – hatte Rashs Familie die idealen Voraussetzungen zur Aufnahme im Vice Country Club geschaffen.
Im Gegensatz zu Rash, der wirkte, als hätte er tatsächlich Freude an der exzessiven körperlichen Ertüchtigung, konnte niemand von uns übrigen P-Fiends sagen, warum Benji sich das antat.
Und antat war in seinem Falle genau das richtige Wort!
Er konnte alles: angefangen von Golf über Tennis, verschiedene Kampfsportarten und Rudern.
Benjamin King war der Beste — bei allem, was er machte.
Zuweilen hatte es allerdings den Anschein, dass er sich allein deshalb regelmäßig auspowerte, weil er sich für irgendetwas bestrafte.
Oder aber, weil er auf Schmerz stand, so lautete zumindest Skys Theorie.
Er war höllisch attraktiv, aber so lange ich ihn kannte, hatte es kein Mädchen gegeben, das jemals gut genug für ihn gewesen war.
Ein beeindruckendes Erscheinungsbild und wohldefinierte Muskeln, um der Damenwelt zu imponieren, konnten also nicht der Motor hinter seinem übertriebenen Hang zu sportlichen Aktivitäten sein.
Außerdem strahlte sein Gesicht, wie auch der Rest seiner Körperhaltung, stets tiefe Frustration und Wut aus.
Manchmal machte er sogar mir Angst – und das, obwohl wir enge Freunde waren.
Wie schon im Jahr zuvor, war es Benji, der vor das Mikrofon trat.
Ihm und Rash stand die blau-goldene Uniform – die Wappenfarben des Thorns – besonders gut.
Beide hatten dunkle Haare, wobei Rashs mehr ins Schwarze und Benjis eher ins Braune gingen.
"Das Thorn College begrüßt alle Teilnehmer und Zuschauer zum Semesterbeginn", sagte er mit tiefer Stimme.
Seine Augen waren dabei ausdruckslos und kalt.
Nachdem er die einstudierte Begrüßungsrede, die dem Originalton von Direktor Campbell entsprach, zum Besten gegeben hatte, schloss er mit den Worten: "Mögen die Wettkämpfe beginnen!"
Die Studenten auf der Tribüne sprangen von ihren Bänken auf und klatschten laut. Allen voran die weiblichen Zuschauer, die Benji anhimmelten, als wäre er der dunkelhaarige Thor (und das war gar nicht so weit hergeholt, nur dass er keinen Hammer in der Hand und kürzere Haare hatte).
Dass seine Eltern Vancouver quasi besaßen und daher auch regierten, spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Ich warf einen Blick zu Madox. Er war gerade dabei, sich einen Joint zwischen die Zähne zu klemmen.
"Spinnst du?", zischte Sky und schlug ihm das Teil aus der Hand.
Madox, dem die Haare leicht ins Gesicht fielen, funkelte sie aus seinen braunen Augen böse an. Blitzartig packte er Sky am Handgelenk und zog sie zu sich.
"Was fällt dir ein?", knurrte er, während er sie mit seinem Blick erdolchte.
"Mach nicht schon am ersten Tag im neuen Semester Ärger! Was soll das?!", fuhr Sky ihn an, als hätte sie ein Recht dazu.
Ich wusste, dass sie ab und an mit ihm ins Bett ging, aber es war nicht mehr als eine flüchtige Affäre und Madox Hanson war niemand, dem man Vorschriften machen konnte.
"Erstens: das interessiert doch keinen!", entgegnete er mit aufeinandergepressten Zähnen. "Zweitens: bist du jetzt meine Mutter? Denn dann haben wir heute Abend ein gewaltiges Problem." Er drückte seine Zunge gegen das Innere seiner Wange – was wohl eine charmante Anspielung aufs Blasen sein sollte.
"O Gott", flüsterte ich und rollte mit den Augen.
Madox konnte ein richtiger Arsch sein.
Allerdings waren wir übrigen P-Fiends auch nicht gerade Sonnenscheine.
Bis auf Sky, selbstverständlich.
Aber auch sie hatte eine dunkle Seite – das war uns allen klar –, auch wenn sie sich noch so sehr bemühte, sie zu verstecken.
Warum sie allerdings ausgerechnet Madox vögelte, wollte mir – vom Offensichtlichen mal abgesehen – nicht einleuchten.
Sie hatten beide etwas Pseudo-Anarchistisches an sich und sahen unverschämt gut aus … aber war da sonst noch etwas, das sie verband?
"Wer ist das denn?", hörte ich meine Erzfeindin Chloe Clarice Bell eine Bank unter uns fragen.
Sie zeigte auf den neuen Trainer unserer Rudermannschaft.
Es hieß, dass Walter Lam vor drei Wochen seine Frau verlassen und mit einer Stripperin durchgebrannt war.
Die Gerüchteküche in Vancouver köchelte ununterbrochen vor sich hin – besonders die im Vice Country Club.
Allerdings hielt ich jene Neuigkeit, die ich während der Ferien von Abigale Clark erfahren hatte, für höchst unwahrscheinlich.
Walter war ein angesehenes Mitglied des Clubs gewesen.
Er war zwar nicht annähernd so reich wie einer von uns P-Fiends, aber schlecht ging es ihm nicht.
Seine Frau und er genossen ein gewisses Ansehen; sie hatten mehrere Villen und ihnen gehörte das Strokes – die einzige vernünftige Bar im Ort.
In Anbetracht der Tatsache, dass seine Frau die mit der Kohle war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass Walter alles aufgegeben und ein Leben in Armut vorgezogen hatte.
Sicher hatte seine Frau, wie alle klugen Reichen, einen Ehevertrag mit ihm geschlossen.
"Er heißt Logan Edwards", erklärte Melissa Trembley, Chloes bessere Hälfte.
Ich konnte beide nicht ausstehen, aber insbesondere Chloe war mir ein Dorn im Auge.
Sie war in meinem Jahrgang und hatte seit Beginn unserer Studentenkarriere die einzige Praktikantenstelle in der Abteilung Umwelt bei Xantec in Beschlag genommen.
Xantec Industries war ein kanadisches, börsennotiertes Generalunternehmen, das sich um die Planung und Konstruktion von Infrastrukturprojekten und -einrichtungen kümmerte.
Ich träumte schon seit Jahren davon, dort zu arbeiten.
Hauptsächlich, weil ich – anders als der Rest der P-Fiends – nach dem Studium unbedingt in Vancouver bleiben wollte.
Madox, Sky, Rash und Benji hingegen konnten es kaum erwarten, so weit wie möglich von hier zu verschwinden.
Das konnte ich, besonders was Benji anging, überhaupt nicht nachvollziehen.
Für mich gab es keinen besseren Ort auf der Welt!
(Was vermutlich auch damit zusammenhing, dass ich mich schwer mit neuen Situationen tat.)
Jedenfalls hatte ich große Pläne für Vancouver, die hauptsächlich den Ausbau von Aquarienlandschaften und den Schutz der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten betrafen.
Xantec war das einzige ernstzunehmende Unternehmen im Umkreis, das die finanziellen Ressourcen hatte, um wirklich etwas zu bewegen.
Ich hatte Chloe Clarice Bell im letzten Jahr höflich darum gebeten, die Stelle freizugeben. Soweit ich wusste, interessierte sie sich nicht einmal sonderlich für die Umwelt. Sie verwendete ständig Einwegprodukte und bei der alljährlichen Strandreinigungsaktion hatte ich sie auch noch nie gesehen.
Der einzige Grund, weshalb sie die Stelle blockierte, war der, dass sie mit Jackson Roy, dem Chef der Xantec Umweltabteilung vögelte.
Er sah gut aus, das war nicht zu leugnen. Aber das rechtfertigte nicht, dass sie mir die Zukunft ruinierte.
Dieses Semester hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, Chloe von ihrem hohen Ross zu stoßen.
Ich würde diese Praktikantenstelle erhalten, komme was wolle!
Xantec war dafür bekannt, Studenten nach ihrem Abschluss nur einzustellen, wenn sie vorher für mindestens ein Jahr ein erfolgreiches Praktikum absolviert hatten.
Ich hätte mich natürlich für eine der vier anderen Bereiche bewerben können – doch die konnten mich nicht begeistern.
Ich hatte keine Lust, mehrere Jahre meines Lebens mit einer Sache zu verschwenden, die mir keinen Spaß machte, nur um dann irgendwann mit viel Glück doch noch in die Abteilung zu gelangen, für die mein Herz brannte.
Ich wollte in den Bereich Umwelt – und zwar von Anfang an!
Nachdem ich Chloe erfolglos darum gebeten hatte, Platz zu machen, würde ich jetzt andere Geschütze auffahren!
Die kleine Miss Perfect würde sich warm anziehen müssen, so viel stand fest.
Der Plan, den ich hatte, um mir zu holen, was ich begehrte, war finster.
Aber so wie ich das sah, blieb mir nichts anderes übrig als ihn durchzuziehen.
Sie hatte es nicht anders gewollt.
Ich hatte Chloe und ihre geschwätzige Busenfreundin Melissa noch immer im Visier.
Sie hingegen fixierten den durchtrainierten, dunkelblonden Kerl, den Melissa eben als Logan identifiziert hatte.
Ich spitzte meine Ohren, als ich sie hinzufügen hörte: "Er unterrichtet außerdem Literatur."
Sie kicherte und fegte sich die kupferfarbenen Haare mit einem Kopfschütteln von der Schulter. "Die Vorlesungen werden heiß!"
Chloe stimmte in das Gekicher ihrer Freundin mit ein, woraufhin ich mit den Augen rollte.
"Hoffentlich ist er nicht so streng wie Turner", murmelte Chloe und sog an ihrem Strohhalm.
Sie hielt eine Orangen-Zimt-Limonade in der Hand, deren Marke im letzten Jahr von zwei Absolventen des Thorns angemeldet wurde.
Seitdem gab es sie an jedem Automaten auf dem Campusgelände.
Darüber hinaus wurde das zuckerhaltige Biogetränk bereits in sechs weitere Länder importiert.
Thorns Studenten waren eben ambitioniert.
Während die Mitglieder der Ruderteams zu ihren Booten liefen, fiel mein Blick plötzlich auf ihn.
James Wyatt Cole.
Er kam – genau wie so ziemlich bei jeder Ruderveranstaltung – zu spät.
Dabei war er der Letzte, der sich das erlauben konnte.
Er hatte ein Stipendium und konnte sich im Gegensatz zu den meisten anderen Studenten nicht einfach mit einer großzügigen Spende bei Rektor Campbell einschleimen, wenn er zu weit aus der Reihe getanzt war.
Würden wir noch miteinander reden, hätte ich ihm auf jeden Fall bereits den Kopf gewaschen. Mehrfach, wenn nötig. Denn Harper Campbell waren jene Veranstaltungen äußerst wichtig.
James trug eine abgewetzte Lederjacke, seine Haare waren verstrubbelt – aber nicht so wie die von Madox, bei dem ich mir sicher war, dass er sie absichtlich so stylte.
Nein, James Wyatt Cole interessierte sich nicht dafür, ob er als cool galt. Er war es einfach.
Seine Hose war dunkel und seine Sneaker grau oder beige, das konnte ich von meinem Platz hier oben nicht so genau erkennen.
Cole hatte was von dem jungen James Dean, nur mit braunen Haaren – und er rauchte nicht, weil er vernünftig war.
Im Gegensatz zu mir hatte er sich charakterlich kaum verändert.
James war immer noch der anständige, nette Junge von nebenan.
Nur mit mehr Muskeln, markanteren Gesichtszügen und größer – sehr viel größer.
"Na, stalkst du schon wieder deine Jugendliebe?", neckte mich Madox in zynischem Ton.
"Er ist nicht –", begann ich, doch dann winkte ich ab. "Ach vergiss es!"
Ich musste mich nicht rechtfertigen – schon gar nicht vor Madox Hanson!
Ich hatte nur mal rüber geschaut, das war ja wohl kein Verbrechen!
"Wer ist das da, neben James?", wollte Sky wissen.
Sie deutete auf ein schlankes Mädchen, das auffällige Cowboyboots zu einer ausgewaschenen, eng sitzenden Jeans und Creolenohrringe trug.
Sie hatte blonde, verdammt kurze Haare und große blaue Augen. Ein bisschen erinnerte sie mich an Taylor Swift.
Gedankenversunken schüttelte ich den Kopf.
Diese ständigen Vergleiche hatte ich mir schon seit geraumer Zeit abgewöhnen wollen. Aber irgendwie schlichen sie doch stets wieder in meinen Kopf.
Mom nervte mich immer damit, dass ich meine Fantasie für etwas Vernünftiges einsetzen sollte – zum Beispiel dafür, einen guten Job und den passenden – auf jeden Fall stinkreichen – Mann zu finden, statt für meine Gedankenspielereien.
So sehr sie mir die meiste Zeit über auf den Geist ging – was diese Sache betraf, hatte sie vermutlich recht.
"Keine Ahnung", antwortete ich und musterte den Swift-Verschnitt noch einmal von oben bis unten.
Sie war ziemlich hübsch und lachte gerade über etwas, das James gesagt hatte.
Augenblicklich fühlte ich einen Stich in meinem Herzen.
Es ging nicht um James, er war mir mittlerweile vollkommen egal.
Na gut – nicht völlig gleichgültig, aber er interessierte mich nicht mehr.
Ach, was redete ich – er hatte mich nie interessiert!
Wir waren früher einmal Freunde gewesen, hatten uns auseinander gelebt und waren unserer Wege gegangen. So war das eben manchmal im Leben.
"Erstsemester", bemerkte Madox.
"Ach ja?", fragte ich betont beiläufig, während ich sie und James dabei beobachtete, wie sie sich einen Platz in der untersten Reihe der Tribüne suchten.
Dort saßen für gewöhnlich die wenigen Loser des Thorns, aber James wusste das vermutlich nicht einmal.
Oder er wusste es und es interessierte ihn nicht.
So oder so – es war gesellschaftlicher Selbstmord auf einem dieser Plätze zu sitzen.
Aber das brauchte mich nicht zu kümmern. Ich saß richtig und nur das zählte.
"Wisst ihr schon, was das Motto von Joshs Party wird?", fragte ich in die Runde, um ein anderes Thema anzuschneiden.
"Bittersweet Disaster", erklärte Sky und warf Madox einen weiteren bösen Blick zu, weil er sich nach ihrer vorherigen Attacke einfach einen neuen Joint aus der Jackentasche gezogen und angezündet hatte.
Josh Hamilton gehörte zwar nicht zu uns – seine Familie war nicht reich genug, nicht einmal ansatzweise –, doch das änderte nichts daran, dass er jedes Jahr zum Semesterbeginn eine legendäre Party schmiss.
"Das lässt ja nicht gerade viel Spielraum für die Fantasie", scherzte Madox und nahm einen tiefen Zug von seinem Glimmstängel.
Als er Sky anschließend den Rauch ins Gesicht blies, verpasste sie ihm eine Ohrfeige.
… nur um sich wenige Sekunden danach von Madox die Zunge in den Hals stecken zu lassen.
Die beiden waren 'ne Nummer für sich ...
Beim Wettkampf traten immer vier Mannschaften gleichzeitig gegeneinander an.
Die Boote richteten sich gerade aus, als mir jemand von hinten die Augen zuhielt.