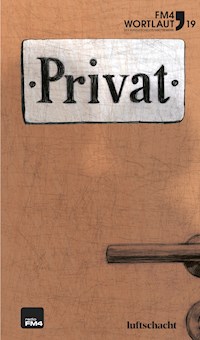16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufgewachsen ist Lina, ein Kind der 1990er, in einer Welt, die aus der Zeit gefallen scheint: in einer donauschwäbischen Gemeinschaft, die sich nach Vertreibung und Flucht in Salzburg angesiedelt und ihr traditionelles Leben nach 1945 dort fortgesetzt hat. Als Lina eines Abends von der SS-Mitgliedschaft ihres Großvaters erfährt, beginnt sie, nach Antworten jenseits der großen Opfererzählung zu suchen. Zerrissen zwischen der Liebe zu ihren verstorbenen Großeltern und ihrer eigenen Politisierung, will sie erstmals das Schweigen brechen. Getragen von ihren engen Freund*innen stellt sich Lina ihrer Familiengeschichte und bricht zu einer Recherche auf, die sie bis nach Belgrad führen wird. Als sie endlich auch die Konfrontation mit ihrer Mutter sucht, wird das zur Zerreißprobe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Katherina Braschel
Heim holen
Katherina Braschel
Heim holen
Roman
Residenz Verlag
Wir danken für die Unterstützung
© 2026 Residenz Verlag GmbH
Mühlstraße 7, 5023 Salzburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Buchgestaltung, Satz: Kevin Mitrega, Schriftloesung
Lektorat: Jessica Beer
Gesamtherstellung: EuroPB, Tschechische Republik
Printausgabe:
ISBN 978-3-7017-1815-3
ePub:
ISBN 978-3-7017-4767-2
INHALT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
II
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Dank
für alle, die fragenund alle, die pflegen
und für meine Mutter
I
1
„… Donauschwaben oder so, glaub ich.“
Ich sitze mit Alvin und Franzi in der Straßenbahn, wir unterhalten uns über Rückenbeschwerden und Alvin erzählt gerade von seinem neuen Orthopäden, als mich dieser Satzfetzen, der von irgendwo hinter mir kommt, aus dem Gespräch reißt. Die Beiläufigkeit, mit der ich mich umdrehe, gelingt mir normalerweise besser, ich tue, als wollte ich mich umsehen, wo am Ring wir gerade sind, als könnte ich diese Stationen nicht verlässlicher auswendig als die Geburtstage meiner Großeltern. Die Straßenbahn ist voll und ich kann nicht ausmachen, wer gerade über Donauschwaben geredet, wer meine ganze Kindheit in einem Wort aufgerufen hat.
Etwas in mir erwartet ein Aufmerken, einen Blickkontakt, eine Art von Erkennen. Jemand, der weiß, was „Donauschwaben“ bedeutet, der dieses Wort kennt, muss mir doch meine Familiengeschichte ansehen, sagt dieses eigenwillige Gefühl, muss doch wissen, dass ich damit irgendwie mitgemeint bin. Ich schaue mich um, aber niemand fängt meinen Blick auf, niemand quetscht sich zu mir durch und fragt, als was ich auf meinem ersten Bingili-Ball verkleidet war.
„Donauschwaben“ ist ein Wort, das ich außerhalb meiner Familie selten höre, ein Wort, das sonst nur ich sage, gleich dahinter ein „Das ist ein bisschen kompliziert“ und eine Erklärung, die mehr ein kurzes Umreißen ist, ein paar Grundinformationen für fragende Gesichter. Dann spule ich die Sätze herunter, die ich von meiner Mutter übernommen habe:
„Donauschwaben sind unter den Habsburgern entlang der Donau angesiedelt worden, Ausdehnung des Deutschen Reiches und so, und waren dann die deutsche Minderheit dort, auch in Rumänien, Ungarn und so weiter. Meine Großeltern waren in Franztal, also Zemun, das ist ein Stadtteil von Belgrad, und 1944 sind die Donauschwaben, die noch dort waren, dann nach Österreich geflüchtet, die meisten Männer waren schon im Krieg, mein Opa auch. Nach 1945 waren sie dann eine Zeit lang staatenlos, viele sind auch in die USA oder nach Kanada gegangen, aber meine Großeltern sind eben in Salzburg gelandet.“
Manchmal bekomme ich danach ein paar Fragen gestellt, die ich beantworten kann:
„Und wieso genau Salzburg?“
„Warum Schwaben, waren die alle von dort vorher?“
„Kannst du dann Serbisch?“
Und manchmal ein paar, die ich nicht beantworten kann:
„Wo war dein Opa dann im Krieg?“
„Waren das dann alle Nazis?“
„Wie viele Donauschwaben gab es überhaupt?“
Mein Wissen über die Donauschwaben besteht aus meinem Aufwachsen, den Geschichten meiner Großeltern, den Festen, bei denen ich als Kind Gedichte aufgesagt und schwere Trachten getragen habe, und dem Dialekt, den sonst niemand spricht. Es besteht aus dem in meinen Fingern gespeicherten Gefühl, über den gestärkten und in Falten gelegten Stoff der Trachtenröcke zu streichen, zum letzten Mal vor bestimmt 15 Jahren. Es besteht aus den losen Stückchen Kontext, die ich in den letzten Jahren vereinzelt eingesammelt habe. Mein Wissen über die Donauschwaben besteht vor allem aus Fragezeichen, Widersprüchen und Dingen, die sich mir entziehen.
„Lina?“, fragt Franzi neben mir. „Warst du nicht irgendwo in der Nähe der Praterstraße bei der Physio? Waren die okay?“
„Äh… Was? Sorry“, sage ich und schiebe das Bild meines Großvaters im weißen Unterhemd beim Kukuruz-Säen beiseite. In meinen Winterschuhen ziehe ich kurz die Zehen zwei Mal zusammen. Auch sie haben das Gefühl von Erde und den rauen Holzbrettern, über die ich als Kind beim Aussäen der Kukuruzkörner balanciert bin, gespeichert.
„Du warst doch im Zweiten bei der Physio, oder?“, wiederholt Alvin Franzis Frage und deutet ungefähr in die Richtung des Bezirks.
„Ja, das war für Kassen-Physio ganz okay“, finde ich mich wieder in unser Gespräch ein und erzähle noch kurz von meiner Strom- und Wärmebehandlung und den Übungen der Therapeutin für meinen kaputten Rücken, bevor wir uns bei der nächsten Station aus der Straßenbahn schieben.
2
Ich kann, wenn ich will, jederzeit in meinem Kopf mit dem Zeigefinger von der Grundstücksgrenze an der Straße bis ins Wohnzimmer meiner Großeltern fahren.
Ich kann mich vornüberbeugen, ohne dass es zieht in meinem Rücken, nichts knackt, es gibt dann keine Bandscheiben, die erleichtert aufatmen. Ich setze den Zeigefinger auf die Schwelle, wo die Straße aufhört und der Weg zum Haus beginnt, zwischen vereinzelte Kieselsteine, und so, dass ich den grünen Lack des Gartentors an meinem Fingerknöchel spüren kann. Vielleicht splittert etwas bei meiner Berührung ab, vielleicht nur fast.
Dann gehe ich, gehe rückwärts, seitwärts, lasse meine Fingerkuppe über die Waschbetonplatten, die in den 1960ern einmal wasserwaageneben waren, schleifen wie früher ein Stück Straßenmalkreide. Die Furchen zwischen den Platten sind unterschiedlich tief, in vielen gibt es kleine und etwas größere Steinchen, ein paar breitblättrige Gräser. Mein Finger schreddert und springt den Weg neben dem Haus entlang, fast bis ans Ende der Mauer, dort fängt der Vorbau an. Direkt vor der kleinen Stufe zum Vorbau ist ein Eisengitter in den Boden eingelassen, es hat harte Kanten, und ich wusste lange nicht, dass man es herausnehmen kann. Einfach so.
Als Kind habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wohin der Dreck fällt, wenn er an den harten Kanten abgestreift wird und darunter kein Loch ist. Vielleicht habe ich auch immer gedacht, dass Dreck ohnehin etwas ist, was zerfällt, wie die getrockneten Erdbröckchen an meinen Gummistiefelsohlen, die ich mit zwei Fingern zu Staub zerdrücken konnte.
Hier fängt es an, das gelbe Haus, hier, wo ein schmaler Eisenbeschlag die Stufenkante säumt und immer schon zwei Fliesen locker waren. Sie machen „klick klick“, wenn man auf sie tritt. Die Fliesen im Vorhaus sind gelb und weiß gesprenkelt, sehen aus wie Eierspeise von einem blassen Huhn. Ganz leicht bewegt sich mein Finger über sie, über die seltsame Textur, sie sind nicht flach, sondern eine Miniatur-Hügellandschaft, bis zur dicken Haustür reichen sie. Irgendwann in den letzten zwanzig Jahren hat sich das leise Knarren des Türöffnens zu einem Knallen verzogen, man muss jetzt von innen gegen die Tür drücken, um sie zu schließen. Es ist nicht die einzige Tür in diesem Haus, die mittlerweile knallt, statt zu knarren.
Mein Finger gleitet über die Tür, über ihr Muster, über die einzelnen Holzteile zum immerkalten Fenster, durch das man nur Schemen sehen kann, ich weiß bis heute nicht, wie man diese Art von Glas nennt. Der Türgriff ist ein umgedrehtes Eichenblatt, genauso kalt wie das Fenster in der Mitte, gegen das ich als Kind so oft von außen meine Nase gedrückt habe, um zu erraten, wer mir aufmacht. Das Poltern auf der Treppe, das man bis vor die Tür hört, hätte als Indiz schon ausgereicht, aber ich mochte das Gefühl des kalten Glases an Nase und Stirn und die Vorstellung, von innen ganz seltsam auszusehen.
Die Treppen, die dahinter beginnen, haben einen grünen Linoleumboden mit weißen Schlieren, auf dem ersten Absatz ist die dunkelbraune Tür zur Wohnung meiner Großeltern. Auf dem goldenen Türgriff kann man Rutsche spielen mit den Fingern, er ist nach unten gebogen, ein kleiner Sprung und man landet auf dem flachen Oval am Ende des Griffs, das ein wenig dunkler ist von den vielen Händen auf ihm.
Die Tür schwingt leicht auf, sie ist nie versperrt. Innen hängt ein Schlüssel mit gehäkeltem Band, ich habe ihn kein einziges Mal in Verwendung gesehen. Vielleicht ist er zur Zierde da, oder weil sich das einfach so gehört, weil eine Tür einen Schlüssel braucht.
Ich kenne keinen Boden, der so glatt und weich ist wie das rote Linoleum im zwei Quadratmeter kleinen Vorzimmer meiner Großeltern. Mein Finger kann darauf eislaufen und Pirouetten drehen, mein Nagel kann sich hineindrücken, kurz bleibt eine Spur davon zurück und verschwindet dann wieder, kein Schmutz und auch sonst nichts kann diesem Boden etwas anhaben.
Ich ziehe mit meinem Finger weiter ins Wohnzimmer, ich quere die weißen Schlieren im Rot, bei denen ich immer an Tomatensuppe mit Schlagobers denken muss. Der Wohnzimmerboden ist ein grauer Teppich, und weil in meiner Kindheit nur ich so klein bin, weil nur ich auf dem Boden sitze und liege, freiwillig, weiß auch nur ich, dass dieser Teppich nicht wie andere Teppiche steil aufragende Haare hat, sondern viele kleine Schlaufen. Immer mehrere der grauen Teppichhaare, in die manchmal ein wenig Lila gewebt ist, sind zu einer Schlaufe zusammengefasst. In sie kann man den Fuß einer Playmobil-Figur zwängen, dann bleibt sie von allein stehen.
Wenn man mit nackten Knien über diesen Teppichboden rutscht, wird es warm an der Haut. Das ist das Gute daran, dass dieser Raum so klein ist: Man kann nicht rennen, hinfallen und sich aufbrennen.
Das ist das Wohnzimmer meiner Großeltern: zwei Sessel mit abnehmbaren, goldgelben Pölstern, hölzernen Armlehnen und dazwischen ein Couchtisch. In der Ecke der Fernseher, Familienfotos dahinter, Familienfotos im Regal, das Kassettenradio, das nie an ist, außer ich wünsche es mir. Hinter den Sesseln die Vollholzwand, in der die Fotoalben und Ordner stehen. Zwischen den Regaltürmen eine Schlafbank, auf der mein Großvater jeden Abend einschläft und eines Tages nicht mehr aufwacht.
Es gibt dieses Wohnzimmer nicht mehr.
Ich habe die Vollholzwand nach dem Tod meiner Großmutter eigenhändig herausgerissen, den Schimmelfleck dahinter entdeckt, die Tapete abgetragen, die braunen Türen geschliffen und weiß angemalt, den Teppichboden herausgezwungen und die Holzdielen darunter freigelegt. Wo die meisten Möbel hingekommen sind, weiß ich nicht.
Ich kann diese Reise mit meinem Zeigefinger nur in das alte Wohnzimmer meiner Großeltern machen oder in das Wohnzimmer, das es jetzt dort gibt, in dem niemand wirklich wohnt.
Das Zimmer, das es dazwischen war, das Wohn- und Schlafzimmer meiner Großmutter, ihr Pflege- und schließlich ihr Sterbezimmer, es entzieht sich mir.
Ich kann mich nicht hinunterbeugen, mein Finger weiß nicht, wie sich die Rollen des Pflegebettes angefühlt haben, ich bin mir nicht einmal mehr sicher, ob es am Fenster oder zwischen den Vollholztürmen stand, vielleicht beides zu verschiedenen Zeiten.
Auch die Dinge, die meine Mutter jetzt hineingestellt hat, kennt mein Finger nur ungefähr. Ab und zu ziehe ich ein Buch aus den Regalen, wenn ich dort bin, oder mache ein Foto von mir mit meinem eingerahmten Kindergartenbild. Dieses Foto war einmal in einem anderen Rahmen, es hat den Raum nicht verlassen, stand an einer ähnlichen Stelle bei meiner Großmutter im Regal. Ich weiß nicht, warum meine Mutter es in diesen gesteckt hat, vielleicht war es auch die Pflegerin oder eine meiner drei Tanten.
In diesem Zimmer habe ich einen Zahn verloren, ein neongrünes Plastiklineal als Erbstück versprochen bekommen, länger ferngesehen, als ich eigentlich durfte, und zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen. In diesem Zimmer hat meine Großmutter an einem Ostersonntag meine Mutter geboren und ich habe 53 Jahre später meine erste Pille danach dort geschluckt. Warum genau dort, weiß ich nicht mehr.
3
„Ja, das ist ja wie bei den Spatzen, wegen dem Brüten, das weißt du ja, da suchen sie sich genau solche Plätze, das wundert mich jetzt nicht, dass du da Amseln im Innenhof hast, wenn es wirklich welche sind“, sagt meine Mutter und die Selbstverständlichkeit der Art, wie sie über Vögel spricht, reißt mich zurück in meinen Körper.
Das Augenrollen, das Einatmen, das ich gleich wieder auffange, in meiner Brust festhalte und langsam und tonlos auslasse, damit kein Schnauben am anderen Ende der Leitung ankommt, sie lackieren über das Gefühl, mit dem ich meiner Mutter gerade noch von den brütenden Amseln erzählt habe. Davon, dass sie das Nest der Krähen übernommen haben, die ich den Winter über bei der Aufzucht ihrer Kinder beobachtet habe. Sie lackieren über das, was sich kurz offen angefühlt hat, was aus mir herauserzählt gekommen ist, ohne dass ich es zuvor abgewogen hätte. Mit der sicheren Pinselbewegung eines Menschen, der sein ganzes Leben lang Dinge lackiert hat, streichen die öligen Borsten über den Einbruch dieser anderen Person in mich, dieser Person, die sofort weiß, wie welcher Vogel heißt, die gelöst am Telefon plaudert, über alles, was ihr gerade in den Sinn kommt. Und der glatte Pinselstrich meiner Entnervtheit, er versiegelt mich wieder.
Meine Mutter spricht über Niststrategien und sagt dann etwas über die Fischreiher am See in der Nähe des gelben Hauses, unseres Hauses. In jedem ihrer Sätze sitzt ein „ja“.
„In der Kastanie wäre ja, da so in der Mitte, ein guter Platz für sie.“
„Die kommen ja jetzt dann wieder.“
Jedes „ja“ ist ein Anlehnen an ein gemeinsames Verständnis, an ein Interesse, ein geteiltes Wissen über Amseln, Spatzen, Stieglitze und Fischreiher, und vor allem ist da diese Selbstverständlichkeit. Als wäre es ganz klar, dass ich, dass jeder Mensch weiß, was ein Stieglitz ist und wann und wo ein Fischreiher wie viele Eier legt. Als ob es nicht nur alle wüssten, sondern wissen müssten.
„Das weiß man doch“, heißt jedes dieser „ja“.
Die Amsel im Innenhof ist weggeflogen, während ich geatmet habe. Ich beuge mich über das trocknende Geschirr auf der breiten Fensterbank meiner Küche, schaue in die Äste des Baumes, aber sehe keine Vögel mehr.
„Lina?“, sagt meine Mutter. „Bist du noch da?“
„Ja“, antworte ich, „ich bin noch da, ich hab nur etwas geschaut.“
„Ach so, ja, weil es so gekracht hat in der Leitung, da war ich mir nicht sicher.“
„Ich habe nur etwas geschaut“, sage ich noch einmal und spüre, wie mir meine Entnervtheit zwischen die Wörter gleitet.
„Ja? Was hast du denn geschaut? Sind noch mehr Amseln gekommen?“
„Nichts“, sage ich und klinge kalt.
In der kurzen Stille, die nun folgt, presse ich meine Augenlider fest aufeinander, balle die Hand zur Faust und verziehe lautlos das Gesicht. Es ist ein stummes Wettrennen, wer zuerst so tut, als wäre nichts gewesen, wer zuerst eine Smalltalk-Frage stellt.
Ich atme ein, halte die Luft kurz an, öffne dann die Augen wieder und sage: „Und? Im Garten bei dir passt sonst alles?“
Vor der Pensionierung meiner Mutter war „der Garten“ eines der Themen gewesen, die ich nur mit Vorsicht angesprochen habe, mit dem Einbetten in andere Fragen habe ich die Beete verkleinert und mit meinem Tonfall das Unkraut vorsorglich ausgerissen, immer bereit, schnell über die Müllabfuhr-Zeiten oder die Wettervorhersage weiterzusprechen. Ich wusste, wie gern sie sich mehr um ihre Pflanzen gekümmert hätte, dass ihr aber neben ihrer Vollzeitstelle die Zeit selbst dann noch gefehlt hat, als die Pflege meiner Großmutter weggefallen war. In den letzten drei Jahren ist der Garten zu ihrem Lieblingsthema geworden und damit auch zu meinem, ein sicheres Terrain.
„In der Personalagentur hab ich die Menschen eingeteilt, jetzt teil ich die Blumen ein, aber die machen weniger Probleme, und Chef habe ich auch keinen mehr“, ist einer der Sätze geworden, die meine Mutter oft wiederholt und die ich manchmal lautlos mitspreche.
„Ja“, antwortet sie jetzt ein wenig schnell, „ja, du, so weit alles gut. Weißt ja eh, wie das um die Jahreszeit ist, jetzt muss ich halt schauen, wie ich das heuer mit dem Vorziehen mache, wo ich die Töpfe hinstelle, dass es ihnen nicht zu kalt wird, vielleicht mach ich unten den Tisch frei, vielleicht geht es sich auf der einen Sitzbank aus. Ich weiß das ja noch nicht, das sollte ich mir eh überlegen.“
Während meine Mutter weiter über Paprikapflanzen und Mini-Gewächshäuser für Stecklinge redet, entspanne ich die Schultern, lasse mich auf mein Sofa fallen und sage immer wieder „mhm“, in einem interessierten Ton, einem Ton, der sagt: „Rede nur weiter, ich höre dir zu.“ Ich ziehe die Beine hoch auf die Sitzfläche und nehme mein Handy vom Ohr, um den Lautsprecher-Modus einzuschalten.
Bei längeren Telefonaten mit meiner Mutter schalte ich oft auf Lautsprecher und spiele nebenbei Solitär auf meinem Handy. Ich schiebe Karten von links nach rechts, während ich „mhm“ sage, meine Durchschnittszeit für ein Spiel liegt bei zwei Minuten und 37 Sekunden.
Ich kann mich auf mein Kurzzeitgedächtnis verlassen, es spielt mir in fünffacher Geschwindigkeit alle Sätze ab, die meine Mutter gerade gesagt hat, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Limit an „Mhm“s, um noch interessiert zu wirken, erreicht ist. Während mein Gedächtnis dann ihre Sätze wiederkäut, damit ich etwas herausfischen kann, um mich darauf zu beziehen, räuspere ich mich und hole kurz Luft, das ist alles an Zeit, was ich dafür brauche. Ich bin geübt darin. Es sind „Mhm“s mit mehr Wörtern, Sätze wie „Ja, das ist ja dann schon lustig, wenn man so durch die Au geht und überall hämmern die Spechte“ oder „Na ja, vielleicht hast du dann nächstes Jahr auch so ein Blaufinken-Paar bei dir im Baum, Mama, das wäre ja nett.“
Jedes dieser Gespräche dauert zu lange und nach den wenigsten fühle ich etwas.
Erst leicht versetzt kommt nach dem Auflegen eine Welle der Scham, ein schlechtes Gewissen, keine bessere, interessiertere Tochter zu sein, die Vorstellung, wie sehr es meine Mutter verletzen würde, wenn sie mich und die Solitär-App auf meinem Handy sehen könnte. Manchmal schicke ich ihr dann eine Nachricht: „schön, dass wir uns wieder einmal gehört haben“, und füge ein glückliches Emoji und ein Herz an.
„Und kommst du wieder einmal nach Salzburg in nächster Zeit?“, fragt meine Mutter.
Sofort unterbreche ich mein Spiel und merke, wie mir warm wird, wie meine Wangen rot werden, ich bin nicht mit Terminen und Argumenten ausgestattet, warum ich so bald nicht nach Salzburg kommen werde, warum es sich leider nicht ausgehen wird. Ich höre, wie meine Mutter versucht, diese Frage nebenbei zu stellen, ohne Druck, aber die Muskeln in meinem Rücken sind angespannt, ich lauere auf einen Vorwurf, der nicht ausgesprochen wird, auf eine Enttäuschung, die sich durch die Telefonleitung schweigt.
„Puh, also, in nächster Zeit wird’s schwierig bei mir, in der Arbeit kommen jetzt wieder einige größere Projekte, wo noch viel zu tun ist, außerdem geht eine Kollegin von mir in drei Wochen in Karenz, und es ist immer noch nicht ganz klar, was mit ihren Stunden passiert“, hole ich aus, „und Alvins Geburtstagsfeier ist auch am übernächsten Wochenende und dann fängt dieses Filmfestival an, wo ich für einige Filme schon Karten hab und –“
„Nein, nein, ich wollte nur fragen, nur so, es hätte ja sein können, dass du etwas in Salzburg zu tun hast oder so“, unterbricht mich meine Mutter und ich beeile mich zu sagen, dass es mir wirklich leidtut und ich aber Ende des nächsten Monats schauen werde, ob sich nicht einmal ein Besuch ausgeht, dass ich mich gleich melden werde, wenn ich mehr darüber weiß, wie diese Wochen dann aussehen.
„Du, ja. Schaust einfach, wie es bei dir ist, und gibst mir Bescheid“, sagt meine Mutter und ich füge noch dazu, dass ich mich auch freuen würde, meine Tanten wiederzusehen.
Noch während ich spreche, hoffe ich, dass meine Mutter keine Verschiebung in meiner Stimme bemerkt, dass sie nicht hört, dass ich mich darüber tatsächlich freuen würde.
4
„In 24-Stunden-Einheiten sind wir okay miteinander“, sage ich, wenn mich jemand fragt, wie mein Verhältnis zu meiner Mutter ist.
Ich sitze mit Franzi in der Bar, in die wir schon seit über zehn Jahren gehen und für die wir langsam zu alt werden.
Unser erstes gemeinsames Bier haben wir hier getrunken, als wir bei demselben Filmfestival gearbeitet und uns überraschenderweise angefreundet haben. Dass es uns beide überrascht hat, weil Franzi meine Schüchternheit für Desinteresse und ich deys Überforderung für Überheblichkeit hielt, haben wir einander erst später erzählt. Sich mit Franzi anzufreunden, war wie der Beginn einer großen, vereinnahmenden Verliebtheit, wovon wir beide in den darauffolgenden Jahren einige hatten, mit dem Unterschied, dass unsere Beziehung nie romantisch war und immer bestehen blieb. Durch Auslandsaufenthalte, Eifersüchte auf neue Freund*innen und Phasen mit mehr oder weniger engem Kontakt hindurch hielten dey und ich aneinander fest, und immer noch ist Franzi die Person ohne Überraschung in den Augen, wenn ich in größeren Runden Neuigkeiten erzähle, weil dey immer schon davor alles von mir weiß.
Franzi erzählt von deys Vater, von seinen endlos ausufernden Erzählungen und seiner Unfähigkeit, Fragen zu stellen. Dann fragt Franzi nach meiner Mutter und wie es mir mit ihr gerade geht.
„In 24 Stunden können meine Mama und ich alle Themen durchgehen, die sicher sind: meine Tanten und Cousinen, wer befördert wurde und wessen Kinder etwas Neues können. Wir können die Nachbar*innen in Salzburg, den Garten und das Fernseh- und Netflix-Programm besprechen, was bei mir in der Arbeit los ist, und dann vielleicht noch die Tagesnachrichten streifen, wobei das eh schon schwierig werden kann. Wir kochen ein bisschen, essen ein bisschen, und wenn wir dann ein, zwei Bier getrunken haben, sind wir beide entspannter und ich erzähle mehr, über die Wohnung oder meine Kolleg*innen vielleicht, oder ob ich mir wieder mal was second hand gekauft habe“, antworte ich und Franzi nickt.
In 24 Stunden halten sich die unangenehmen Pausen in Grenzen, in denen sich mein Körper verkrampft und die ich dann mit Belanglosigkeiten fülle, die mir den Magen umdrehen. Wenn kein Handybildschirm mit Solitärkarten zwischen uns ist, fühle ich diese Belanglosigkeiten stärker, sie kriechen mir unter die Haut und ihre Sinnentleertheit schnürt mir den Brustkorb ein.
„Es ist wie eine arge Allergie“, sage ich zu Franzi, „die unangenehmen Pausen sind die Momente, wenn die Wundpflaster Luftblasen bekommen und sich an den Ecken aufbiegen, wenn die Allergietabletten ihre Wirkung verlieren und die Nase wieder beginnt zu jucken. Ich werfe eine Tablette Belanglosigkeit nach der anderen nach, in dem Wissen, dass es meinem Magen nicht guttut, deshalb die 24-Stunden-Zeiträume, nicht länger. Aber es wirkt einfach trotzdem immer wie die bessere Wahl, diese Belanglosigkeiten. Magenkrämpfe statt explodierendem Alles.“
„Du redest schon wieder in zu vielen Metaphern“, sagt Franzi, und ich will dey für die direkte Art wieder einmal umarmen, „außerdem merkt man, dass du keine Allergien hast, von wegen Pflaster, pff.“
Ich muss lachen und dey recht geben. Schließlich ist Franzi die Person von uns beiden, die jedes Jahr monatelang nicht richtig Luft bekommt.
„Okay, mit nur ein bisschen Allergie-Metapher, weil ich jetzt nicht mehr ohne kann“, versuche ich es noch einmal und bestelle noch zwei Bier, „ich bin einfach auf alles allergisch, was meine Mutter sagt. Oder auf so gut wie alles. Sie macht einen Kommentar über einen Lokalpolitiker oder irgendwas anderes, was von diesen sicheren Themen abweicht, und ich merke, wie sich in mir alles aufstellt, wie ich nicht normal darauf reagieren kann. Und dann denke ich mir, ich bin 30, nicht 13, warum kann ich nicht einfach ein Gespräch wie mit jeder anderen Person führen, warum bin ich sofort auf 180 und vermute hinter jedem Buchstaben von ihr etwas, das mich wahnsinnig macht. Ich bin echt einfach hypoallergisch auf sie und danach bin ich frustriert und das macht alles noch schlimmer.“
Ich schüttle den Kopf, in einer Verzweiflung, die nur zur Hälfte übertrieben ist, und stütze die Stirn auf meinen Händen ab. An der Außenkante meiner Hand klebt ein Stück Untersetzer, das mir Franzi laut lachend abzupft.
„Wow, du solltest definitiv das mit den Allergie-Metaphern lassen, Lina, das ist ja wild“, sagt dey und schiebt meine Ellbogen sanft vom Tisch, damit der Kellner Platz für unsere neuen Biere findet.
Wir stoßen an und ich frage Franzi, was an meiner Allergie-Metapher nicht stimmt.
„Na, hast du das Gefühl, dass du besonders unproblematisch und verträglich bist, wenn du in Salzburg bist?“, fragt dey. Ich lache schnaubend in mein Bier hinein und ziehe eine Augenbraue hoch.
„Eben“, meint Franzi und nickt, „wohl generell in Salzburg nicht und mit deiner Mutter noch weniger.“
Dann erklärt dey mir, dass „hypo“ nicht „hyper“ bedeutet, sondern „‚darunter‘, etwas mit nur so wenigen allergieauslösenden Inhaltsstoffen, dass die unter der Grenze der Auslösung bleiben“.
„Oh“, sage ich und lache. Dass Franzi mich nun länger liebevoll damit aufziehen wird, das weiß ich schon jetzt. Dey wird mich fragen, ob ich „normal oder hypoviel Milch“ in meinen Kaffee möchte und ob „das Wasser hypokalt ist“, wenn wir gemeinsam zum Baden an die Donau fahren.
Ein paar Stunden und Getränke später verabschieden wir uns an der U-Bahn-Station. Wir umarmen uns fest und gehen zu unseren U-Bahn-Linien. Auf meinem Gleis gibt es eine freie Bank, und weil ich um diese Uhrzeit ohnehin nie Musik höre, lasse ich meine Kopfhörer im Rucksack und starre die nächsten sieben Minuten die Werbung auf der anderen Seite des Bahnsteigs an, die die Vorteile des Plasmaspendens auflistet.
Als ich schließlich an meiner Station aussteige und die Treppen hinaufgehe, muss ich noch einmal an Franzis Worte denken, und während ich den Rest meines Heimwegs zu Fuß gehe, nehme ich dey eine Sprachnachricht auf.
„Halloooo, okay, hey, sorry, nochmal zu dem hypoallergen. Ich glaube, so zwischen meiner Mutter und mir stimmt das, also ich bin auf sie hyperallergisch, aber jetzt hab ich mir gerade gedacht, dass wir im Kontext von anderen Leuten schon wieder genau so funktionieren, so hypoallergen. Wir sind immer superverträglich und machen keine Umstände, alles ist unkompliziert und das ist auch bestimmt zur Hälfte ehrlich, weil wir wohl beide recht flexibel sein können, aber die andere Hälfte ist dieses Donauschwäbische, jedenfalls glaub ich das. Immer klein und brav sein, schön hörig und auf keinen Fall schwierig sein. ‚Horch amol‘, hat mein Opa immer gesagt, wenn er was angeschafft hat, und natürlich haben dann alle gehorcht auf ihn und ja. Anyway, jedenfalls hab ich mir gedacht, dass insofern hypoallergen nicht ganz falsch war, aber du darfst trotzdem weiter ein hypoalkoholisches Bier für mich bestellen oder was auch immer.“
Ich überlege kurz, ob für Franzi irgendetwas davon Sinn machen wird, aber schicke die Sprachnachricht trotzdem ab. Kurz darauf werden die Häkchen darunter weiß und es erscheint ein kleines rotes Herz.
„du hypobetrunki“, schreibt Franzi und nach kurzer Zeit kommt noch eine zweite Nachricht: „das mit den donauschwaben musst du mir nochmal erklären, das check ich jetzt nicht. bin schon zähne putzen, war schön mit dir heute! hypobussi“
Ich lächle und schicke Franzi noch ein „Mach ich mal, längere Geschichte“ mit einem weiteren Herz und schließe meine Haustür auf.
5
„Gibst du mir den Karfiol, dann schneid ich den auch noch“, sage ich über die Schulter nach hinten zu Alvin und schiebe mit dem Handrücken die Schalen und abgeschnittenen Enden der Karotten vom Tisch in den Mülleimer. Weil von Alvin keine Antwort kommt, drehe ich mich zu ihm um. Er steht vor dem geöffneten Kühlschrank und sieht mich mit gerunzelter Stirn an.
„Hä, ist keiner mehr da? Aber ich hab doch gestern einen gekauft“, sage ich und lege mein Messer weg, um selbst nachzusehen.
„Nein, aber äh, warte kurz, Karfiol …?“
Ich will Alvin schon dafür aufziehen, dass er immer noch nicht weiß, wie man in Österreich zu „Blumenkohl“ sagt, obwohl wir jahrelang in einer WG zusammengewohnt haben, aber plötzlich bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich gerade wirklich ein österreichisches und nicht vielmehr ein donauschwäbisches Wort gesagt habe. Manchmal blitzt der Dialekt meiner Mutter und meiner Großeltern unvermittelt durch meine Sätze und Gedanken, dann ist da eine „Beckmess“, wenn ich über die Marmelade reden will, die Alvin und ich letztes Jahr gemeinsam eingekocht haben, oder „Grumbirra“ dort, wo sonst Erdäpfel oder Kartoffeln wachsen.
„Ach so, Blumenkohl, oder? ‚Karfiol‘, was für ein alberner Name“, unterbricht Alvin meine Unsicherheit, zieht die „o“s von „Karfiol“ in die Länge und fragt, ob ich den ganzen aufschneiden möchte.
„Ja, ich denk schon. Franzi und Maria kommen ja auch und dann ist noch was für morgen da.“ Alvin nickt. „Aber lass mich mal schauen, wie groß der ist“, ich nehme ihm den Karfiol ab und wiege ihn in meiner Hand, schüttle den Kopf und gebe Alvin das Gemüse zurück, der mich überrascht ansieht. „Doch nicht den ganzen? Der ist doch gar nicht mal so groß?“
„Was? Ach so, nein, schon den ganzen. Sorry, ich hab an meine Oma gedacht gerade“, antworte ich und setze mich wieder an den Tisch zu meinem Schneidbrett.
„An deine Oma? Wieso das?“
Alvin setzt sich zu mir. Er schneidet den gewaschenen Karfiol mittig durch und legt mir eine Hälfte auf mein Brett. Während unsere Messer durch die weißen Röschen und den Strunk gleiten, erzähle ich:
„Na ja, meine Großeltern haben diesen eigenen Dialekt geredet, dieses Donauschwäbisch. Und meine Mama auch, mit ihren Schwestern. Ich versteh das alles, weil ich eben damit aufgewachsen bin, und manchmal hab ich dann Wörter im Kopf, bei denen ich mir plötzlich nicht mehr sicher bin, ob man das wirklich so sagen kann. Also, ohne Donauschwaben. Dann hängt es mich kurz ein bisschen aus im Hirn. Das ist gerade wegen Karfiol und Blumenkohl passiert, da musste ich kurz überlegen.“
„Aber das ist jetzt schon ein österreichisches Wort, oder?“, versichert sich Alvin.
„Ja. Oder beides, keine Ahnung. Die haben ja schon deutsch geredet, aber eben ganz eigen, und es gibt auch Worte, die komplett anders sind. Vielleicht haben sie Karfiol auch nicht so genannt, aber da müsste ich meine Mama fragen, das weiß ich nicht.“
Alvin nickt und kippt sein Schneidbrett mit den Karfiolstücken in die große Schüssel zwischen uns.
„Und wie sagst du dann zu … Apfel? Oder Banane? Oder Granatapfel?“, fragt Alvin und grinst.
„Ich?“, frage ich lachend zurück. „Ich sag da gar nicht anders dazu, außer vielleicht, du sagst Rosenkohl oder so. Außerdem glaube ich nicht, dass meine Großeltern jemals etwas mit Bananen gemacht hätten, das gab’s ja gar nicht, in Belgrad am Feld.“
„Mhm“, sagt Alvin und nickt, „schon interessant, irgendwie. Mir sagt das alles überhaupt nichts. Du könntest mal was erzählen über deine Großeltern, machst du ja nie.“
„Was erzählt sie nie?“, steigt Franzi ins Gespräch ein. Dey ist gerade in die Küche gekommen, stellt die Tragetasche einer Konditorei auf den Tisch und hängt den Fahrradhelm über eine Stuhllehne. Im Gegensatz zu Alvin benutzt Franzi den Schlüssel zu meiner Wohnung, den ich beiden gleich nach meinem Einzug machen habe lassen, jedes Mal, wenn dey zu mir kommt.
„Ach, nichts, nicht so wichtig. Hallo!“, sage ich, während Franzi erst mich und dann Alvin umarmt.
„Doch, schon wichtig!“, lässt Alvin nicht nach. „Das ist doch deine Familiengeschichte. Du hast nur mal so ein paar Basics von den Donauschwaben erzählt, dass die im Kaiserreich irgendwo hingezogen sind, als Deutsche, und dass deine Großeltern in Belgrad waren und dann im Zweiten Weltkrieg nach Österreich geflüchtet sind, und dass da dann recht viele in Salzburg gelandet sind.“
Ich zucke die Schultern und merke, wie ich unruhig werde, nicht weiß, wo ich anfangen soll, ohne zu weit auszuholen, und dabei versuche, die historischen Abläufe in meinem Kopf zu ordnen, soweit ich sie kenne, so viel ich davon weiß.
„Ich bin eben damit aufgewachsen“, sage ich schließlich, „wir waren da so fest eingebunden, meine Großeltern sowieso, aber auch meine Mama und ich. Da gab es den Verein der Salzburger Donauschwaben und den anderen Verein, in dem wirklich nur die Franztaler waren, also aus dem Viertel, wo die alle her waren in Belgrad, das hieß Franztal. Oder eigentlich am Stadtrand von Belgrad muss das gewesen sein, Zemun heißt das heute, der Stadtteil. Oder warte, so hieß das früher auch schon, und Franztal war nur das Viertel in Zemun. Mein Opa hat sein Leben lang Ahnenforschung gemacht, der hatte tausend Ordner mit Listen und Querverweisen, das ganze Wohnzimmer voll. Welche angeheiratete Schwester von irgendwem neunzehnhundertirgendwas nach Kanada ausgewandert ist und wie die dann geheißen hat und so. Es gab diese ganzen Feiern, bei denen wir immer waren: Weihnachten und Pfingsten und Bingili-Ball, also Fasching, und Spanferkelessen und Herbstfest und alles Mögliche. Trachtentanz mit eigenen Trachten und so. Für mich war das als Kind immer toll, weil mein Opa so viel in den Vereinen gemacht hat, und ich hab mich immer total wichtig gefühlt, weil alle wussten, dass ich seine Enkelin bin, schon als kleines Kind. Es war ja auch jede zweite Familie in dieser Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, über irgendwelche Ecken mit uns verwandt, mehr oder weniger. Oder jedenfalls waren es Donauschwaben. Die haben dort alle gemeinsam Häuser gebaut nach der Flucht.“
„Und wann war das, diese Flucht?“, fragt Franzi, während dey Salatblätter wäscht und in kleinere Stücke reißt.
„1944“, antworte ich automatisiert und erzähle dann lachend weiter: „Boah, wie viele Dezemberabende ich mit den Vorbereitungen für diese Weihnachtsfeiern verbracht hab. Immer ein paar Mütter mit Gitarren und Liedzetteln und ein Haufen Kinder im Kellerraum vom Haus der Donauschwaben. Da hab ich jedes Mal mein Gewicht in Mandarinen und Erdnüssen gegessen. Alle mussten irgendwas singen oder spielen oder aufsagen bei der Weihnachtsfeier. Und am Ende stehen alle auf und singen ‚Stille Nacht‘, ganz andächtig, mit dem Programmheft in der Hand, das eh jedes Jahr gleich ausgeschaut hat. Und dann gibt’s Essen und Kuchenbuffet und Tombola. Wobei, nein, Tombola gab’s zu Bingili, nicht Weihnachten.“
„Wie bei uns im Dorf“, sagt Alvin und lacht auch, „nur irgendwie harmonischer klingt das.“
Ich schaue ihm zu, wie er den Tisch von den Resten des Gemüseschneidens reinigt, und denke nach. „Hm, ja, vielleicht“, antworte ich und frage mich, vielleicht zum ersten Mal, ob ich jemals Streitigkeiten in den Vereinen oder bei den Feiern mitbekommen habe. Ich kann mich an keine erinnern. In meinem Kindheitsgedächtnis ist tatsächlich alles immer harmonisch und verschworen, wie Alvin sagt. Eine Gemeinschaft, die immer gleich ist.
„Aber sind die alle gemeinsam geflohen?“, unterbricht Alvin mein Nachdenken.
„Die vom Heimatverband?“
Alvin nickt.
„Es waren sicher auch Donauschwaben aus anderen Städten bei den Feiern, so genau weiß ich das nicht. Manchmal waren auch Tanzgruppen von anderen donauschwäbischen Vereinen da, oder Siebenbürger oder Sudetendeutsche. Also, die aus Franztal sind sicher gemeinsam geflüchtet, aus Zemun generell, denke ich. Das war ein Zug an Pferdewägen und manche sind auch zu Fuß gegangen. Meine Oma war Anfang zwanzig und ist mit ihrer Mutter gefahren, die hatten ja einen Wagen, weil sie Bäuerinnen waren. ‚Über Nacht‘ mussten sie zusammenpacken und weggehen, hat sie immer gesagt, ‚über Nacht‘.“
Ich mache eine kurze Pause und schalte den Reis auf dem Herd etwas höher. „Außer natürlich die Männer, die waren schon im Krieg, wie mein Opa. Bis auf die ganz alten, sein Vater zum Beispiel, mein Uropa also, der ist auch auf einem Wagen mitgeflohen.“
„Ach krass“, sagt Alvin, „die waren alle im Krieg?“
„Ja, schon, also die Männer …“
„Aber warte mal, waren die dann für Serbien? Nein, gab’s das da überhaupt? Für wen haben die gekämpft im Krieg?“, fragt Alvin weiter und runzelt die Stirn.
„Ich, äh, na ja, also für Deutschland, die sind alle –“, setze ich zu einer unsicheren Antwort an, aber plötzlich springt Franzi auf und schreit „Fuck!“, während am Herd der Reis überkocht und dey ihn schnell von der Platte zieht.
„Shit“, rufe ich und helfe Franzi beim Wegwischen des heißen Wassers. Im selben Moment klingelt es, Alvin zwängt sich zwischen Wand und Tisch aus der Sitzbank heraus und geht zu meiner Wohnungstür, um Maria zu öffnen. Während ich Küchenrolle auf das stärkegetränkte Reiswasser halte, das schaumig den Herd überschwemmt, spüre ich, wie erleichtert ich bin, dass Marias Klingeln unser Gespräch beendet hat. Mein Körper fühlt sich an, als hätte ich tief Luft geholt für die Erzählung der Weihnachtsfeiern, das Muster der Tischdecken dort genauso lebhaft vor mir wie das rote Papier der Nikolaus-Säckchen, das so leicht reißen konnte, das vielleicht deshalb irgendwann durch Plastiksäckchen mit Nikolaus-Aufdruck ersetzt wurde, die wir Kinder am Schluss immer bekommen haben. Als hätte ich bei Alvins Fragen nach den historischen Abläufen nicht mehr gewusst, wohin mit all der Luft in meinen Lungen.
Ich hätte sie nicht mit Erzählungen füllen können, denke ich, mir fehlen die Antworten, das Wissen abseits der „Basics“, wie Alvin sie nennt. Sogar, was er damit gemeint hat, ob es Serbien zu dieser Zeit überhaupt gab, verstehe ich nicht und schäme mich dafür.
„Hast du eigentlich Fotos von diesen Feiern?“, fragt Franzi, nimmt mir die nasse Küchenrolle aus der Hand und wirft sie in den Mülleimer. „Klatsch“ macht der angesogene Papierball auf unseren Gemüseresten.
„In Wien nicht, aber ich kann mal in Salzburg schauen, wenn ich dort bin. Da gibt’s bestimmt welche“, antworte ich und füge augenrollend hinzu, dass ich ohnehin nächste Woche hinfahren muss.
„Süüüüüß, Baby-Lina!“, ruft Franzi.
Ich schneide eine Grimasse und umarme dann Maria, gratuliere ihr zu ihrer PhD-Stelle, dem eigentlichen Grund für unser Abendessen. Im Gegensatz zu mir ist Maria in ihrem Studium voll aufgegangen, während ich meinen Master nach einigen zähen Semestern schließlich glücklich abgebrochen habe. Ich verstehe bis heute nicht, wie Maria ihre aktivistische Arbeit in mehreren politischen Gruppen, über die wir uns kennengelernt haben, mit ihrem aufwendigen Psychologie-Studium vereinbaren konnte, aber nachdem wir einmal gemeinsam ein Seminar, das auch für Soziologie-Studierende wie mich offen war, besucht haben, war für mich klar, dass sie an der Universität Karriere machen würde.
Auch oder gerade weil wir uns in dieser Runde so viel weniger sehen als früher, als Maria und Franzi meist mehrmals in der Woche bei Alvin und mir in der WG waren, manchmal auch bei uns übernachtet haben, und wir regelmäßig Dinge zu viert unternommen haben, freut es mich, dass Maria sich dieses Abendessen als Feier gewünscht hat.
„Wer will Sekt?“, fragt Franzi von hinter meiner Kühlschranktür. „Gibt aber auch Kindersekt.“
„Den mit Pfirsich“, wirft Alvin mit Blick auf Maria ein, die grinst, und ich quetsche mich an ihr vorbei, um Gläser aus dem Schrank zu holen und nach dem Gemüsecurry zu sehen.
6
„Das hab ich noch von Daheim“, sage ich zu Gabi, meiner Tante, als sie mir ein Kompliment für mein Hemd macht. Wir sitzen zu siebt im ehemaligen Wohnzimmer meiner Großeltern, auf der Sitzgarnitur, die meine Mutter in den renovierten Raum gestellt hat. Es ist ein „Schwesternkaffee plus“, wie meine Mutter sagt, sie sind nicht zu viert wie sonst, heute bin ich da. Ich und zwei der Ehemänner meiner Tanten.