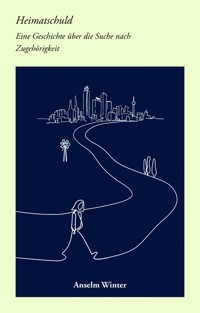
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Heimatschuld" ist ein eindringlicher Roman, der die Reise eines Protagonisten durch die Komplexität von Identität, Heimat und Zugehörigkeit verfolgt. Der Roman beginnt mit den inneren Reflexionen des Protagonisten über das Konzept der Heimat, dem Thema, das sich durch das gesamte Buch zieht. Er kämpft mit seinem Selbstbild und findet Trost in der Literatur, die ihm hilft, seine eigenen Kämpfe um Identität und Zugehörigkeit zu verstehen. Eine zentrale Figur im Leben des Protagonisten ist sein Freund Rafi, ein talentierter Filmemacher, der aus einem Kriegsort stammt. Ihre Freundschaft bietet einen tiefen Einblick in die Bedeutung von menschlichen Verbindungen und die Auswirkungen von Rafis Vergangenheit auf seine Gegenwart. Die Rückkehr des Protagonisten nach Berlin markiert einen Wendepunkt. Er wird von gemischten Gefühlen und Erinnerungen überwältigt, reflektiert über seine Vergangenheit und die Bedeutung von Verbindungen zu anderen Menschen. Die Stadt selbst wird zu einem Symbol für Veränderung und Selbstfindung. Im Verlauf des Romans durchlebt der Protagonist Phasen von Trauer und Depression, lernt jedoch, mit seinem Schmerz umzugehen. Die Akzeptanz seiner Situation und die Erkenntnis, dass Heimat mehr als ein physischer Ort ist, führen zu einer neuen Perspektive auf das Leben. Der Roman endet mit einer Begegnung mit Rafi und symbolisiert den Beginn einer neuen Reise. "Heimatschuld" ist eine eindringliche Erzählung, die die Schwierigkeiten des Lebens und die Bedeutung von Beziehungen in Zeiten der Unsicherheit beleuchtet. Das Buch ist ein Porträt der menschlichen Psyche, das zeigt, wie Vergangenheit und Gegenwart miteinander verflochten sind und wie man mit den Dämonen der Vergangenheit umgehen kann, während man versucht, im Hier und Jetzt zu leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heimatschuld
Eine Geschichte über die Suche nach Zugehörigkeit
ANSELM WINTER
IMPRESSUM
© 2023 Lukas Sydlo
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2024
Autor: Anselm Winter
E-Mail: [email protected]
Satz und Druck:
(nur bei gedrucktem Buch zutreffend)
Bildnachweis/Illustrationen:
Buchcover: Dascha Behr
Herstellung und Verlag:
Independently published
ISBN
978-3-758478-40-6
Das Werk, inklusive seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung im Ganzen oder auch teilweise bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Autors. Dasselbe gilt insbesondere für eine ganze oder teilweise elektronische Vervielfältigung, Übersetzung, Publikation oder öffentliche Zugänglichmachung.
INHALTSVERZEICHNIS
DER NIEMAND
ERINNERUNGEN
RAUCHSCHWADEN
ERINNERUNGEN II
HEIMKEHR
VERWOBENE SCHICKSALE
LEUGNUNG
WUT
VERHANDLUNG
DEPRESSION
AKZEPTANZ
IN DIE NACHT GETAUCHT
ERINNERUNGEN III
REIßENDER TRIBUT
METANOIA
DER NIEMAND
Aleksander Hemon beschreibt in seinem Buch Lazarus Project die Bedeutung von Heimat als den Ort, an dem jemand merkt, dass du nicht mehr da bist.
Der Nachhall dieser Worte in meinem Bewusstsein schien meinen Entscheidungsprozess in Frage zu stellen. Die Gewichtung meines Weggangs, seine Auswirkungen auf meine Mitmenschen, konnten mein gesamtes Vorhaben ins Wanken bringen. Alle schienen ihren Frieden mit dem Konzept der Heimat gemacht zu haben, doch ich fühlte mich zurückgelassen, noch auf der Suche nach meinem Ort in der Welt.
Während ich diese Gedanken in meinem Kopf hin und her wälzte, fixierte ich mein Spiegelbild, die betont langen Haare, die meinen Blick kreuzten. Sie waren ein ständiges Dilemma, das meine Tage beherrschte. Jeden Morgen traf ich auf mein Spiegelbild, und das brennende Zögern war da. Sollte ich sie kürzen oder zulassen, dass sie weiterhin wild und frei wuchsen? Das Abschneiden würde mir beim Duschen ordentlich Zeit sparen, und doch waren es gerade diese langen Haare, die mich ausmachten, die meine Stirn verbargen, deren auffällige Breite seit meiner Jugend für Komplexe sorgte. Es schien, als hätten sie einen Punkt erreicht, an dem sie den Wachstumsprozess aufgaben und sich stattdessen in Strähnen ablösten, die nach dem Kämmen im Waschbecken lagen und mich hilflos zurückließen.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sich meine Haare, entmutigt und erschöpft, massenhaft von meiner Kopfhaut verabschiedeten, als ob sie meinen inneren Zustand spiegelten. Auf der linken Seite meines Halses prangten zwei prominente Muttermale. Ich nahm diese Eigenheit oft mit humorvoller Selbstironie und stellte mir vor, dass ich von einem Vampir gebissen worden sei. Dies könnte auch meine blasse Haut und meinen schlanken Körperbau erklären – eine humorvolle Sichtweise, um mit meinem ungewöhnlichen Aussehen klarzukommen.
Mit einem kurzen, geübten Wisch sammelte ich die abgestorbenen Haare und ihre Follikel aus dem kühlen Keramikwaschbecken. Es war ein unangenehmes Ritual, oft gepaart mit dem Schmerz, wenn ich meine Hand an der scharfen Kante des Beckens schnitt.
Mit einem Seufzer drehte ich mich vom Spiegel weg, schluckte eine Tablette und verließ das Badezimmer. Wie im Lazarus Project von Hemon kämpfte auch ich mit meinem Platz in der Welt, mit meiner Identität und der Entscheidung, wer ich sein wollte. Man hätte mich den Modern-Day-Lazarus nennen können. Meine Suche nach Heimat und Identität war oft schmerzhaft und verwirrend, jedoch unvermeidlich. In der Auseinandersetzung mit meinem Spiegelbild fand ich Trost in der Literatur, in den Worten Hemons und in der Erkenntnis, nicht allein zu sein in meinem Ringen um Identität und Heimat. Der Raum um mich herum schien still zu sein, als spiegele er meine innere Unruhe. Die Wohnung, die einst so voller Leben und Erinnerungen gewesen war, wirkte nun verlassen und kalt. Der Geruch von verblasstem Parfüm und vergessener Zufriedenheit hing in der Luft. Ich fühlte mich wie ein Fremder in meinen eigenen vier Wänden, ein Wanderer ohne Ziel.
Mein Blick fiel auf das alte Sofa im Wohnzimmer, dessen Polster bereits durchgesessen und abgenutzt waren. Es erinnerte mich daran, dass ich hier schon viel zu lange verweilt hatte, festgefahren in einer endlosen Routine. Die Vorhänge waren zugezogen und ließen nur gedämpftes Licht herein. Ich spürte die Dringlichkeit, etwas zu verändern, aus diesem erstickenden Gefühl der Heimatlosigkeit auszubrechen.
Jeder Morgen begann gleich, in meiner Heimatstadt. Sobald mein Wecker um 08:00 Uhr, 08:15 Uhr und 08:30 Uhr klingelte und mich wie ein Feueralarm aus meiner Traumwelt riss, begab ich mich entlang meiner gewohnten Badezimmer-Route zur Kaffeemaschine. Doch auch an diesem Morgen war die Kaffeemühle mal wieder leer. Ich nahm die frischen Kaffeebohnen und legte sie in die elektrische Mühle, die ich meist in irgendeinem Küchenschrank verstaut hatte. Das metallische Zertrümmern der Kaffeebohnen um diese unchristliche Zeit war einfach nicht auszuhalten.
Während die Mühle leise in meinem Küchenschrank ratterte, drehte ich mir eine Zigarette und ging auf meinen Balkon hinaus. Durch die geschlossene Balkontür drang das leichte Trommeln der Mühle, begleitet von den morgendlichen Geräuschen des Hinterhofs. Ich horchte in den Klang der Vögel, die ihr munteres Lied im Schall des Hinterhofs sangen. Mein Blick fiel auf einen einzelnen Vogel, der sich auf die Mauer zwischen den Hinterhöfen setzte. Das Anwesen erinnerte an das ehemalige Gelände einer längst verlassenen Fabrik, gezeichnet von einem grauen, gepflasterten Untergrund und imposanten Fassaden, die sich jeglicher Farbvielfalt entzogen. Die einzige Farbnote in dieser tristen Szenerie boten Kleidungsstücke, die an Wäscheleinen im Wind tanzten, gleichsam Proklamationen: Dies ist mein Territorium, mein Stück Heimat! Doch hinter den verschlossenen Türen verbarg sich oft nur das Erbe der Eltern, aufgelistet in Lebensläufen, um Vermieter von der Bonität zu überzeugen. In diesem Stadtteil wurde Individualität zu einer Seltenheit - in einer Welt, in der selbst Durchschnittsbürger mit gewöhnlichem Stammbaum um Wohnraum rangen. Hier zeigte sich eine Uniformität des Strebens: Alle begehrten dieselbe Anerkennung, dasselbe Streben nach Status. Auch wenn ich meine Garderobe mit Sorgfalt kuratierte, schien es oft, als ob ich meine Kleidung nach keinem bestimmten Muster auswählte, nur in der Hoffnung, unauffällig zu wirken.
Der einzige wirkliche Blickfang war ein kleiner Vogel, der stolz auf der Mauer thronte. Sein tiefschwarzes Gefieder kontrastierte mit einem scharlachroten Schnabel. Seine vielseitigen Gesänge verrieten seine Art: zweifellos eine Amsel. Mein Wissen um die Vogelwelt war begrenzt; tatsächlich kannte ich nur drei Arten. Ich spielte mit dem Gedanken, dem Vogel mit meiner unbeholfenen Melodie eine Art Balzruf beizubringen, doch mein amateurhaftes Pfeifen erntete keine Resonanz. Nach einem letzten melodischen Zwitschern erhob sich die Amsel und verschwand hinter einem der umliegenden Gebäude.
Das rhythmische Mahlen der Kaffeemühle hatte aufgehört. Ich löschte meine Zigarette in einem eleganten Aschenbecher aus Glas und kehrte durch die Glastür in die Küche zurück. Das akribisch abgewogene Kaffeepulver füllte meinen Siebträger, und bald umhüllte mich das Aroma des frisch aufgebrühten Kaffees – ein Duft, der Erinnerungen an neue Anfänge und die Sehnsucht nach Veränderung wachrief. Als ich den ersten Schluck Kaffee nahm, wurde mir klar, dass der heutige Tag besonders war. Nach dem Koffeinschub realisierte ich den Grund für das besondere Gefühl: Gestern hatte mich Rafi, ein enger Freund, nach langer Abstinenz angerufen und zu einem Besuch eingeladen. Die Vorfreude vermengte sich in mir mit einer angenehmen Nervosität. Es war erstaunlich, wie eine schlichte Einladung so viel Bedeutung erlangen konnte. Die Aussicht, Rafi wiederzusehen, rief Erinnerungen an die Tage des Lockdowns hervor, in denen wir gemeinsam in einem kleinen Apartment festgesessen und einander Halt geboten hatten. Stunden des Teetrinkens und tiefsinniger Gespräche hatten diese Zeit geprägt. In diesen Augenblicken schien es, als würden wir uns gegenseitig besser verstehen als jeder andere. Rafi schien meine Gedankengänge zu kennen, und ich konnte seine Stimmungen erfassen, ohne dass Worte nötig waren. Aber nicht einmal Rafi konnte meinen Weg bestimmen oder meine Entscheidungen beeinflussen.
Es waren noch einige Stunden Zeit, bis ich mich zu Rafi aufmachen würde. Diese Verabredung konnte einen Wendepunkt darstellen, eine Gelegenheit, mich aus meiner täglichen Routine zu lösen und etwas Neues zu erleben. Ich dachte zurück an den Tag, als Rafi und ich uns zum ersten Mal in einer Vorlesung an der Universität getroffen hatten.
Der Saal war groß, und ich fühlte mich einsam und verunsichert zwischen den vielen unbekannten Gesichtern. Dann sah ich Rafi, alleine in einer Reihe sitzend. Etwas zog mich an, also ging ich zu ihm und fragte ihn, ob der Platz neben ihm noch frei sei. Als er mir mit einem Lächeln zustimmte, fühlte ich mich gleich wohler. Mir fiel auf, wie er Notizen in zwei Sprachen machte: eine war Deutsch, die andere erkannte ich als Arabisch. Das weckte meine Neugier, und bald darauf wurden wir Freunde, zogen zusammen und verbrachten viele Stunden außerhalb des Studiums miteinander. Rafi öffnete mir die Augen für seine Vergangenheit und für seine Fluchtgründe.
Seine Erzählungen waren oft humorvoll, doch ich spürte die Schwere dahinter. Seine Geschichten berührten mich stets tief, und ich wurde mir seiner inneren Kämpfe bewusst.
Mein Herz klopfte vor Vorfreude und Dankbarkeit für unsere Freundschaft. Nachdem ich meinen Kaffee in der Küche ausgetrunken hatte, legte ich mich nochmal ein paar Stunden ins Bett, weil ich sonst nichts mit mir anzufangen wusste.
Inzwischen zeigte die Radiouhr neben meinem Bett 12:00 Uhr. Es wurde langsam Zeit, mich aus dem Bett zu schälen, mich anzuziehen und mich auf den Weg zu Rafis Wohnung zu machen. Er wollte mir mehr von seiner Heimat erzählen. Schon der Gedanke, ihn wiederzusehen, brachte Wärme in mein Herz. Doch der Morgen fing träge an. Warum stellte ich den Wecker überhaupt auf 08:00 Uhr, wenn ich mich sowieso wieder ins Bett legte, nachdem ich eine geraucht und Kaffee getrunken hatte? Wahrscheinlich, um mir ein Gefühl der Kontrolle zu geben. Nach weiteren 30 Minuten des An-die-Decke-Starrens quälte ich mich schließlich aus meinem Bett. Die richtige Kleidung zu finden schien heute eine Herausforderung zu sein. Dieser Gedanke der Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit versetzte mich ins Grübeln. Es fühlte sich an, als müsse ich eine Herzoperation mit chirurgischer Genauigkeit durchführen oder einen Bilderrahmen akkurat an einer schiefen Wand ausrichten. Die Entscheidung, was ich anziehen sollte, erschien mir wie ein unlösbares Rätsel. Schlussendlich griff ich nach dem Outfit vom Vortag, das noch auf dem Sofa lag: schwarze Hose und ein graues Hemd über dem weißen T-Shirt. Ich schlüpfte in meine Stiefel und machte den letzten prüfenden Rundgang in meiner Wohnung. Bevor ich die Wohnung verlassen konnte, überprüfte ich natürlich noch einmal, ob der unbenutzte Herd ausgeschaltet, die Zigarette im Aschenbecher wirklich erloschen war und ich alle Wasserhähne geschlossen hatte. Mit drei leichten Schlägen auf meine Hosentaschen stellte ich sicher, dass sowohl Geldbeutel, Handy als auch Schlüssel nicht vergessen wurden. Beim Abschließen der Tür hatte ich meine kleine Routine, um zu prüfen, dass die Tür abgeschlossen ist. Nachdem ich die Türschwelle überschritten hatte, schloss ich die Tür hinter mir und bereitete mich auf die qualvolle Tortur des Abschließens vor. Mit flüsternder Stimme sprach ich: „Der Schlüssel ist im Schloss, der Riegel ist ausgefahren und der Schlüssel ist ganz rechts.“ Sobald ich den stumpfen Schmerz auf der Innenseite meines rechten Daumens spürte, wusste ich, dass die Tür wirklich abgeschlossen war. Jetzt musste ich nur noch den Schlüssel nicht zu weit nach links drehen und denken, das Schloss sei wieder zurückgeschnappt. Nach weiteren fünf Versuchen, den Schlüssel zu drehen und zu ziehen, war ich mir einigermaßen sicher, dass die Tür tatsächlich abgeschlossen war und sich niemand aufgrund meiner Nachlässigkeit Zugang zu meiner Wohnung verschaffen könnte. Während ich das machte, hoffte ich immer, dass die Nachbarn nicht dachten, ich versuche, bei jemandem einzubrechen. Es ist komisch, welche skurrilen Gedanken einem manchmal durch den Kopf gehen. Während ich an der Tür rüttelte, hatte ich immer Angst, dass meine Nachbarn es sehen und denken würden, jemand wolle in die Wohnung einbrechen, obwohl mich eigentlich jeder im Haus kannte.
Das helle Sonnenlicht zwang mich dazu, meine Augenlider zusammenzukneifen. Nachdem ich mich an das Tageslicht gewöhnt hatte und meine Augen nicht mehr schmerzten, setzte ich dennoch meine Sonnenbrille auf. Die Straßen waren mit Menschen gefüllt. „Es ist Dienstag. Haben die alle nichts zu tun?“, fragte ich mich selbst leicht gereizt. Ich drehte mir noch eine Zigarette, zündete sie an und machte mich auf den Weg zu Rafis Wohnung. Nachdem es mit der Musik nicht geklappt hatte, machte es tatsächlich wieder Spaß, Menschen musizieren zu hören. Es freute mich, dass Musik nun wieder ein kleiner Teil meines Alltags als Nicht-Musiker war, und ich rechtfertigte das Scheitern meiner Musikkarriere mit den Worten: „Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.“ Wahrscheinlich war das einfach nur eine schöne Lüge, um nicht eingestehen zu müssen, dass ich nicht gut genug war.
Zu Beginn meiner Reise durch die Heimatstadt wählte ich das „Genre Shoegaze“ als meine musikalische Begleitung. Ich dachte, ich brauche etwas Entspanntes, um meine Ohren und meinen Körper aufzuwärmen, da ich wie erwartet zu dünn angezogen war. Beim Durchqueren der Seitenstraßen der Altstadt glitzerte das Sonnenlicht in dem aufsteigenden Dunst der Straße. Nachdem ich an einem Café vorbeigegangen war, das sich seltsamerweise bei Sonnenuntergang in eine Bar verwandelte, sah ich die gleichen leeren Gesichter, die die gleichen leeren Gespräche führten. Eigentlich war ich froh, ein Versager zu sein. Hauptsache, ich werde nicht zu einem dieser vorhersehbaren Schatten meiner selbst. Das Wetter besserte sich langsam, und ich erreichte den Punkt, an dem meine Kleidung mich zu warmhielt. Ich öffnete die Knöpfe meines Hemdes und trug es nun offen. Der kühle Luftzug an meinem Oberkörper kühlte mich ein wenig ab, obwohl ich mich bereits völlig verschwitzt fühlte. Langsam näherte ich mich der meiner Meinung nach unsichersten Kreuzung in meiner Heimatstadt. Von links wurden Autos von sechs Spuren auf zwei geleitet. Eine Spur führte von der Straße, an der ich gerade entlanglief, ab, vier weitere führten Fahrzeuge aus den Vorstädten in die Innenstadt, und die letzte Fahrspur verlief über die anderen vier und führte mit der linken der beiden zusammenführenden Straßen zusammen. Doch das war noch nicht alles. Von der rechten Seite kamen drei Straßenbahnlinien, von denen sich zwei kreuzten. Zwei Schienen führten von weiteren Vororten in die Innenstadt, eine Schiene verlief von der Innenstadt in die entgegengesetzte Richtung der Vorstädte, in Richtung der grauen Viertel.
Das graue Viertel meiner Heimatstadt, in dem ich auch aufgewachsen war, erstreckte sich hauptsächlich über 20-stöckige Betongiganten, kleine bungalowartige Einfamilienhäuser und ein Zentrum, das größtenteils leerstand und meistens als Zenni bezeichnet wurde – ein Treffpunkt für die Bewohner. Die riesigen Wohnblöcke präsentierten sich im typischen Stil des Brutalismus, wie man es in Architekturlehrbüchern finden würde. Abgesehen von ein paar Discounter-Supermärkten, einer Bar namens Haus 14 und einem Fanshop für irgendeinen Mannschaftssport diente das Zenni den Bewohnern als Treffpunkt, Rückzugsort oder wurde komplett gemieden.
Zurück an der gefährlichsten Kreuzung der ganzen Stadt machte ich mich langsam bereit, die beiden Zulaufspuren zu überqueren. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf einer Straßeninsel wagte ich mit großen Schritten den Sprung über die finale Autospur. Sobald die Autos links von mir vor der Ampel standen, wusste ich, dass die Straße sicher war, um sie zu überqueren. Als ich den lehmigen Boden der Bahnschienen erreichte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel die herannahende Bahnlinie 1 auf meiner rechten Seite. An einem normalen Tag wäre ich problemlos über die drei Bahnschienen gegangen, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch heute war kein normaler Tag, und ich musste in der Mitte der überkreuzenden Schienen anhalten und warten, bis die Bahn vorbeigefahren war. Der Bahnfahrer schaute mich mit einem Blick von Ekel und Enttäuschung an; vermutlich fragte er sich, warum ich nicht, wie normale Menschen, den Gehweg benutzte. Ich hatte schon den Impuls, laut zu rufen, dass ich keine Lust hätte, den ganzen Platz zu umgehen, aber ich beschränkte mich auf einen lauten Seufzer. Von der Bahnhaltestelle aus, an der mich der Bahnfahrer gerade verurteilt hatte, konnte man bereits den großen Bogen sehen, der das untere Viertel ankündigte. Entgegen der Annahme, dass das untere Viertel „unter allem“ lag, war es tatsächlich das diverseste Viertel der Stadt. Es ähnelte dem Quartier Latin, dem Pariser Studentenviertel. Mit seinen engen Straßen und hohen barocken Fassaden bot das Viertel einen charmanten Ort, um das Leben zu genießen. Inzwischen hatte ich mich ein wenig aufgewärmt, und gerade lief eine österreichische Punkband im Shuffle-Modus auf meinem Handy. Durch das deutsche Geschrei und die verzerrten Gitarrenklänge bewegte ich mich automatisch schneller. Ich ging entlang der mit großen Eichen bestandenen Allee und bog links in eine Seitenstraße ein. An der Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes prangte der Straßenname „Schläferstraße“.
Die Schläferstraße war eher eine Gasse als eine tatsächliche Straße. Der Kopfsteinpflasterbelag war stark abgenutzt, und man musste darauf achten, nicht in einen der größeren Risse zu stolpern. Zu dieser Tageszeit, am späten Nachmittag, sah man vor den Häusern meistens Männer in Anzügen oder Hemden stehen. Offenbar dachten sie, dass die Schläferstraße ein guter Ort für ihre Mittagspause sei. Ich konnte den Reiz solcher Milieus nie ganz verstehen. Die Frauen, die hier arbeiteten, mussten sicherlich hart arbeiten, und die Männer, die hier vorbeikamen, hatten wahrscheinlich auch ihre Gründe. Man konnte verstehen, dass sie hier einen Ort suchten, um etwas Druck abzulassen, dennoch war mir immer unbehaglich bei dem Gedanken an solche Austausche. In der Straße standen nie Autos; die Besucher parkten anscheinend immer außerhalb. Wahrscheinlich wohnten die Dienstleisterinnen hier oder in den umliegenden Blöcken. Eine Gruppe von drei Männern in blauen Anzügen und roten Krawatten ging an mir vorbei. Einer von ihnen lachte und sagte zu den anderen: „Jetzt aber schnell, ich habe um 16:30 Uhr ein Meeting und will nicht zu spät nach Hause zu meiner Frau kommen. Heute ist Serienabend.“ Dann sah ich, wie sie in eines der vielen Lokale mit bunten Schildern über dem Eingang verschwanden. Als ich mich dem Ende der Straße näherte, tauchten ein paar Damen an den Ecken auf, kurz bevor die nächste Querstraße begann. Eine der Frauen kam auf mich zu und fragte mit einem verspielten Schmunzeln, ob sie mir helfen könne. Ich antwortete: „Nene, alles gut. Ich bin verabredet und spät dran.“ Sie schien etwas überrascht, aber dennoch optimistisch zu sein und sagte: „Habe ja nicht gesagt, dass ich dir den ganzen Tag helfen will. Es kann auch schnell gehen.“ Sie spielte mit ihrem vollen roten Haar und wickelte es um ihren Zeigefinger. Ich dachte nur darüber nach, dass sie viel zu leicht bekleidet war und fragte mich, wie ihr bei diesem stürmischen Wetter nicht kalt sein konnte. „Nein, nein, schon gut“, erwiderte ich mit einem genervten Unterton. „Tja, wer nicht will, der hat schon. Hast du vielleicht eine Zigarette für mich? Meine sind gerade alle.“ Ich zögerte und überlegte, denn da ich oft hier entlangging, um zu Rafi zu gelangen, bestand die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich beim nächsten Mal wieder nach einer Zigarette fragen würde oder es ihren Kolleginnen erzählen würde, und dann würden alle versuchen, mir Zigaretten abzuschwatzen. Ich griff in die Innentasche meines Mantels, um meine Utensilien zum Drehen herauszuholen, aber als sie den halbleeren, abgenutzten Tabakbeutel sah, sagte sie einfach: „Weißt du was? Schon gut.“ Sie wandte sich von mir ab und ging in Richtung ihrer Straßenecke. Nach dieser Interaktion verließ ich die Schläferstraße mit einem mulmigen Gefühl im Magen. Was, wenn sie es ihren Freunden erzählt, dass ich ihr keine Zigarette gegeben habe? Würden sie dann beim nächsten Mal auf mich warten und mich belästigen, wenn ich wieder durch die Straße gehe? Um auf die andere Straßenseite der Hauptstraße zu gelangen, die parallel zur Schläferstraße verlief, begab ich mich in Richtung der Unterführung. Das Neonlicht der mit Spinnennetzen übersäten fluoreszierenden Lampen warf ein angenehmes Licht auf die mit Graffiti besprühten Wände. Der Lärm der Autos war hier unten gedämpft und kaum wahrnehmbar. Das Licht war jedoch nur angenehm, solange die dichten Spinnennetze mit Staub oder Beute bedeckt waren. Nachdem ich die Unterführung verlassen hatte, wurde das Rumpeln der Autos wieder lauter. Vor mir sah ich bereits die Abzweigung zu Rafis Wohnung. Es war, als ob diese Unterführung ein Wurmloch wäre, das mich in eine andere Galaxie transportierte. Hier sah alles komplett anders aus, als hätte ich 500 Kilometer zurückgelegt und wäre in einem anderen Land angekommen. Arabische, türkische, asiatische und polnische Restaurants reihten sich nebeneinander auf. Die Luft roch nach einer Mischung aus Zimt, Koriander, Butter und Schwarztee. Eine seltsame Kombination, aber angesichts der bitteren Stadtbrise irgendwie angenehm. Eine Kreuzung weiter, und ich erreichte Rafis Straße. Direkt neben dem Zementcafé befand sich seine Eingangstür. Während ich an dem süßen Kaffeegeruch des Lokals vorbeiging, steuerte ich direkt auf seine Haustür zu. Rafi wohnt im vierten Stock, und da ich wusste, dass ich bei ihm nicht rauchen darf, drehte ich mir noch schnell eine Zigarette, steckte sie mir in den Mund und zündete sie an. Ich dachte mir: „Als ob ich jedes Mal vier Stockwerke runter- und wieder hochgehe, wenn ich eine rauchen will.“ Direkt vor Rafis Haus befand sich eine riesige Baustelle. Ich erinnerte mich, dass er mir gesagt hatte, dass dort ein neuer Park entstehen sollte. Bisher war jedoch nichts davon zu sehen. Das abgegrenzte Gelände mit Stahlzaun war etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld und völlig kahl und farblos. Es standen nur ein paar gelbe Bagger und hellblaue Dixi-Klos auf diesem Ödland. Trotz der trostlosen Umgebung wimmelte es hier von Menschen. Ich hatte das Gefühl, als würden sie mich alle anstarren, obwohl das wahrscheinlich nicht der Fall war. Um kein schlechtes Gewissen zu bekommen, ging ich zum Mülleimer am Straßenende und warf meine Zigarette in den dafür vorgesehenen Schlitz. Wieder vor Rafis Haus drückte ich auf seine Klingel. Ich wusste, dass es seine Klingel war, weil sie die einzige ohne Namensschild war. Ohne nachzufragen, wer da klingelt, hörte ich das Summen des Türschnappers und die Tür öffnete sich. Der Weg in den vierten Stock war wie immer eine Qual. Das Komische an so vielen Stockwerken war, dass man dachte, man hätte das richtige Stockwerk erreicht, aber dann gab es noch ein Stockwerk. Und noch eins. Und noch eins. Am Ende war man total außer Atem und bereute es. Als ich endlich den vierten Stock erreicht hatte, stand Rafi bereits in der offenen Tür seiner Wohnung und wartete auf mich. „Hey, alter Freund! Bist du endlich hier? Komm rein!“ Er umarmte mich und ich gab ihm einen Klaps auf den Rücken.
„Ja, ja, ich bin da. Was gibt‘s bei dir Neues?“, fragte ich und betrat seine Wohnung.





























