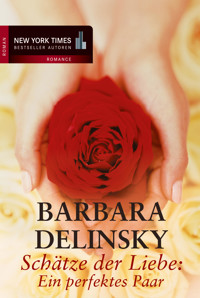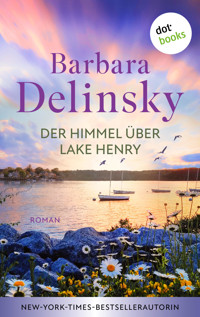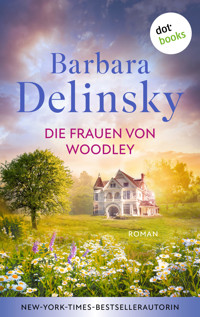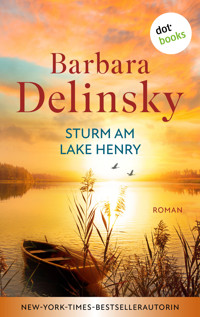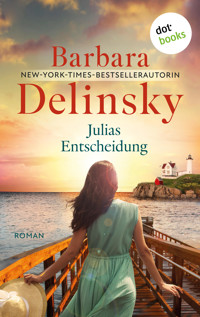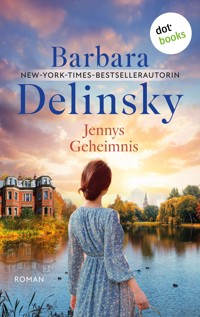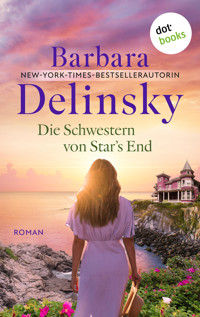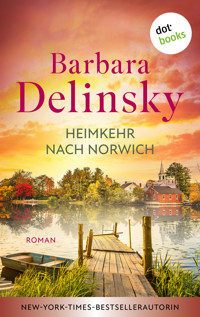
5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach den eigenen Wurzeln: Der aufwühlende Roman »Heimkehr nach Norwich« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Wird sie jemals fühlen dürfen, was es heißt, ein Zuhause zu haben? Bei der Beerdigung ihrer Adoptivmutter erfährt Chelsea Kane zum ersten Mal den Namen ihres Geburtsortes – und bekommt einen rätselhaften alten Schlüssel überreicht. Ein Vermächtnis ihrer wahren Eltern? Fest entschlossen, Antworten zu finden, reist Chelsea in die Kleinstadt Norwich … doch noch während sie versucht, ihre Vergangenheit zu ergründen, muss sie sich plötzlich fragen, was die Zukunft bringen kann: Chelsea entdeckt, dass sie schwanger ist – ausgerechnet jetzt, wo sie für den wortkargen Judd, der in Norwich tief verwurzelt ist, zarte Gefühle entwickelt. Wird Chelsea, wie ihre Mutter damals, vor eine Entscheidung gestellt werden, die ihr Leben für immer verändert? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Schicksalsroman »Heimkehr nach Norwich« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird Fans von Nora Roberts begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wird sie jemals fühlen dürfen, was es heißt, ein Zuhause zu haben? Bei der Beerdigung ihrer Adoptivmutter erfährt Chelsea Kane zum ersten Mal den Namen ihres Geburtsortes – und bekommt einen rätselhaften alten Schlüssel überreicht. Ein Vermächtnis ihrer wahren Eltern? Fest entschlossen, Antworten zu finden, reist Chelsea in die Kleinstadt Norwich … doch noch während sie versucht, ihre Vergangenheit zu ergründen, muss sie sich plötzlich fragen, was die Zukunft bringen kann: Chelsea entdeckt, dass sie schwanger ist – ausgerechnet jetzt, wo sie für den wortkargen Judd, der in Norwich tief verwurzelt ist, zarte Gefühle entwickelt. Wird Chelsea, wie ihre Mutter damals, vor eine Entscheidung gestellt werden, die ihr Leben für immer verändert?
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New–York–Times–Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake–Schwestern 2
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook–Neuausgabe Januar 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »The Passions of Chelsea Kane« bei HarperCollins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Schatten vergangener Tage« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Barbara Delinksy.
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook–Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-016-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks–Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung–per–Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Heimkehr nach Norwich« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Heimkehr nach Norwich
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Prolog
Sie kämpfte gegen den schier übermächtigen Drang zu pressen an. Sie wollte nicht, daß das Baby schon geboren würde. Sie war noch nicht bereit, sich davon zu trennen, wollte es noch länger behalten, doch ihr Körper spielte nicht mit. Er hatte die Regie übernommen und strebte unaufhaltsam seinem Ziel entgegen. Vom Beginn der Wehen am vorangegangenen Abend an waren die Kontraktionen stark gewesen, eine weitere Art der Strafe zu all den anderen, die sie bereits erfahren hatte. Aber jetzt setzten sie ihr noch grausamer zu, schienen ihren Leib zusammenzuschnüren und raubten ihr den Atem, zwangen das Kind in ihrem Bauch erbarmungslos nach unten, bis sie nicht mehr anders konnte, als ihre Schenkel zu öffnen, und nicht mehr die Kraft hatte, das Mädchen wegzustoßen, das mit der Hand dazwischengriff.
Es war fast dunkel im Zimmer, das einzige Licht spendeten der Holzofen und der zarte Schimmer der heraufsteigenden Morgendämmerung. In halluzinatorischen Augenblicken zwischen den Schmerzschüben bildete sie sich ein, daß er bestimmt hatte, daß das Baby jetzt geboren würde, zu einem Zeitpunkt, da niemand wach wäre, um es mitbekommen zu können, daß der Fleck auf der weißen Weste von Norwich Notch, den das Baby bedeutete, im Schutz der Dunkelheit ausgewaschen würde, das Kind fortgeschafft. Bei Sonnenaufgang würde die Stadt wieder im reinen Glanz erstrahlen.
Eine weitere Wehe baute sich auf, diesmal so heftig, daß sie unwillkürlich aufschrie. Der Schrei gellte durch die Stille, gefolgt von einem zweiten und dann, als die Eisenklammer um ihren Leib sich lockerte, von dem krampfhaften Ringen nach Luft.
Auch diese Laute ließen die Stille erzittern, und als sie wieder klar denken konnte, wurde ihr die Ironie dieser Stille bewußt. Eigentlich hätte zur Geburt des Kindes, das einen solchen Aufruhr verursacht hatte, ein Schneesturm um die Hütte toben müssen – oder wenn schon kein Schneesturm, dachte sie mit einem Anflug von Hysterie, dann zumindest einer der sintflutartigen Regenfälle, die New Hampshire Ende März häufig heimsuchten. Dann hätte Schlamm die Straßen unpassierbar gemacht, niemand hätte zu ihr gelangen und sie ihr Baby vielleicht ein wenig länger behalten können. Aber es heulte kein Wind, keine Schneeflocken wirbelten durch die Luft, kein Regen trommelte auf das Dach, kein Schlamm wälzte sich über die Straßen. Lautlos zog die Dämmerung herauf, verhöhnte sie mit ihrer schrecklichen Ruhe.
Ihr Leib verkrampfte sich, wurde steinhart, unglaubliche Schmerzen wanden sich wie Seile um ihre Mitte, die bei jedem Mal fester angezogen wurden. Sie sehnte sich danach, daß jemand ihre Hand hielte, ihr das tröstliche Gefühl vermittelte, ihr beizustehen, doch es war keine Hand da, niemand, der ihr beistand. Also krallte sie ihre Finger in das zerknitterte Laken und biß die Zähne zusammen, um den in ihrer Kehle aufsteigenden Schrei zurückzuhalten.
»Pressen Sie«, sagte die leise Stimme zwischen ihren Beinen. Sie gehörte der sechzehnjährigen Tochter der Hebamme, die mit der Aufgabe betraut worden war, das unerwünschteste Kind des Ortes ans Licht der Welt zu holen. Die Stimme des auf diesem Gebiet unerfahrenen Mädchens war sanft und verriet gleichzeitig, mit welcher Aufregung sie das für sie neue Erlebnis erfüllte, als sie drängte: »Pressen Sie ... Da! Ich sehe den Kopf!«
Sie versuchte dagegen anzukämpfen. Das Baby auszustoßen hieß, das einzige Leben auszustoßen, das sie jemals erschaffen hatte, und sobald es ihren Körper verlassen hätte, wäre das Baby für sie verloren. Sie fragte sich, ob es das wohl wußte. Und sie fragte sich, ob es das wohl wollte – es schien so entschlossen, geboren zu werden. Verübeln konnte sie es ihm nicht, sie hätte ihm nichts zu geben außer ihrer Liebe, und damit könnte sie es weder kleiden noch ernähren. Und so würde sie das Kind um des Kindes willen fortgeben. Sie hatte dieser Entscheidung zugestimmt, doch es bekümmerte sie zutiefst. Zutiefst.
Die nächste Wehe war so schmerzhaft, daß sie alle Gedanken aus ihrem Kopf verdrängte außer dem, daß sie diese Geburt mit Sicherheit nicht überleben würde. Ihre Finger umklammerten das fadenscheinige Laken so fest, daß die Knöchel weiß wurden, und ihr ganzer Körper war ein einziger Schmerz. Als dieser abebbte, bedauerte sie es einen Moment lang, noch am Leben zu sein, und als sie schweißgebadet und zitternd die nächste Attacke kommen fühlte, war die Enttäuschung immer noch stark. Instinktiv preßte sie.
»So ist’s gut«, lobte das Mädchen mit bebender Stimme. »Noch ein bißchen ... Oooo ja! Da ist es!«
Das Baby verließ ihren erschöpften Körper, doch der Schmerz blieb. Er stieg nach oben, umschloß ihr Herz und überschwemmte ihren Verstand und wurde nicht von dem dünnen Schrei gemildert, der über ihren stoßweisen Atem hinweg schrill von einem neuen Leben kündete. Sie versuchte das Kind zu sehen, doch selbst wenn es heller gewesen wäre, hätte ihr noch immer aufgetriebener Bauch es vereitelt. Als sie versuchte sich aufzurichten, knickten ihre zitternden Arme ein.
»Ist es ein Mädchen?« rief sie im Zurückfallen. »Ich wollte ein Mädchen.«
»Pressen Sie noch mal.«
Sie spürte ein Ziehen, eine weitere Kontraktion, einen weiteren, heftigen Krampf, und dann, mit seinem Verebben, ein qualvolles Gefühl des Verlusts. »Mein Baby«, flüsterte sie verzweifelt. »Ich will mein Baby.« Als antworte er ihr, begann der Säugling am Fußende des Bettes zu weinen.
Der Klang seines Stimmchens drang bis in die tiefsten Tiefen ihrer Seele. Wäre es eine Totgeburt gewesen, hätte sie getrauert und es irgendwann überwunden, aber ein gesundes Kind zu gebären und dann weggeben zu müssen, war doppelt herzzerreißend. »Ich will mein Baby sehen.«
Sie bekam keine Antwort. Aus den Geräuschen am Ende des Bettes konnte sie schließen, daß das Baby gewaschen wurde.
»Bitte!«
»Ich darf nicht.«
»Es ist mein Baby!«
»Sie haben zugestimmt.«
»Wenn ich es jetzt nicht sehe, werde ich es nie sehen.«
Die Arbeit am Ende des Bettes wurde nicht unterbrochen.
»Bitte!«
»Er hat es mir verboten.«
»Er erfährt es doch nicht. Nur für eine Minute!«
Wieder versuchte sie sich aufzurichten, aber das Baby lag bereits in einem Körbchen am warmen Ofen, und ihre Kräfte verließen sie, ehe sie mehr tun konnte, als sich auf die Ellbogen zu stützen. Als sie diesmal auf die dünne Matratze zurückfiel, geschah es mit einem Gefühl der Niederlage. Sie war völlig erschöpft, jede Faser ihres Körpers schmerzte, und eine bleierne Müdigkeit ergriff Besitz von ihr. Sie hatte die ganzen neun Monate gekämpft, die schließlich in den letzten Kampf – die Wehen – mündeten. Sie sei zu alt, um ein Kind zu bekommen, hatten sie gesagt, und zum ersten Mal glaubte sie ihnen. Sie konnte nicht mehr kämpfen.
Sie schloß die Augen und ließ sich waschen – zuerst den Geburtsbereich und dann ihren übrigen, schweißbedeckten Körper. Selbst die Tränen, die über ihre Wangen rannen, liefen vor Erschöpfung langsam, doch ihre Gedanken eilten voraus. Sie kannte den Plan. Es war alles arrangiert. Der Rechtsanwalt würde bald kommen.
Das Mädchen zog ihr ein sauberes Nachthemd über den Kopf und deckte sie dann warm zu, doch der Versuch der behutsamen Hände, sie auf diese Weise ein wenig zu trösten, steigerte ihr Gefühl der Verzweiflung noch. Ihre Zukunft lag wie ein unfruchtbares Land vor ihr – so unfruchtbar, wie sie sich all die Jahre gewähnt hatte. Sie war nicht sicher, daß sie sie bewältigen könnte.
Plötzlich spürte sie eine neue Bewegung auf dem Bett und dann das Gewicht eines kleinen Bündels, das ihr mit einem geflüsterten: »Aber nicht verraten!« in den Arm gedrückt wurde.
Sie öffnete die Augen, zog eine Ecke der Windel beiseite, in die das Baby gewickelt war – und es verschlug ihr den Atem. Der Anblick, der sich ihr im fahlen Morgenlicht bot, ließ keine Wünsche offen. Große, weit auseinanderliegende Augen, eine winzige Knopfnase und ein Rosenknospenmündchen – ein Mädchen, das von beiden Elternteilen das Beste geerbt hatte, das lieb und stark wirkte, und in diesem Augenblick wußte ihre Mutter, daß sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Es würde keine baufälligen Hütten für ihre Tochter geben, keine schäbigen Kleider oder kärgliche Mahlzeiten, keine Verachtung seitens der Bewohner dieser Stadt, keine Demütigungen, keine Mißhandlungen, sondern ein Leben in gesellschaftlicher Anerkennung, Achtung und Liebe.
Sie drehte sich auf die Seite und drückte das Kind an ihre Brust, küßte die warme Stirn, atmete den unverfälschten Babyduft ein, strich mit den Händen über die winzige Gestalt und drückte sie fester an sich, als die Tränen erneut zu fließen begannen. Diesmal liefen sie schneller und wurden von so heftigen Schluchzern begleitet, daß sie das Klopfen an der Tür kaum hörte.
Das Mädchen neben ihr griff hastig nach dem Kind. »Er ist da.«
»Nein! O nein!« Sie preßte das Baby an sich, verbarg sein Köpfchen unter ihrem Kopf, jedoch weniger, um das Kind zu schützen, als vielmehr um ihrer selbst willen. Ohne dieses kleine Wesen war sie nichts.
Ein ängstlich geflüstertes »Bitte!«, und dann zogen Hände an ihrem Arm. »Wir müssen weg.«
Wir. Schon gehörte ihr Kind jemand anderem – in diesem Moment der Tochter der Hebamme, dann dem Rechtsanwalt der Adoptiveltern und schließlich den Adoptiveltern selbst. Das Schicksal nahm seinen Lauf, und es gab keine Möglichkeit, es aufzuhalten, ohne seinen Zorn zu wecken, und niemand kannte die Folgen seines Zorns besser als sie. Es war ein stiller Zorn und gefährlich bei einem Mann, der ebenso starrsinnig war wie mächtig. Aber er war ein Mann, der zu seinem Wort stand. Ebenso, wie er sie gewarnt hatte, daß sie leiden werde, wenn sie darauf bestünde, das Kind auszutragen, was sich bewahrheitet hatte, hatte er versprochen, daß das Kind unbeschadet übergeben werde, und er würde sich daran halten.
Sie hob das Kind an ihre Wange. »Mach was aus dir, Baby.«
»Geben Sie sie mir.«
»Tu’s für mich, Baby – tu’s für mich.«
»Bitte!« flehte das Mädchen. »Jetzt!«
»Ich liebe dich.« Mit einem gequälten Stöhnen drückte sie das Baby ein letztes Mal an sich. »Ich liebe dich«, schluchzte sie leise. Das zweite, energischere Klopfen ließ sie zusammenzucken. Sie stieß einen Protestlaut aus, doch es war ein zweckloser Ausdruck des Kummers, der ihr das Herz zerriß. Ihr Schicksal war besiegelt. In der Hoffnung, daß es mit ihrer Tochter freundlicher umgehen würde, legte sie sie in die wartenden Hände. Unfähig, mit anzusehen, wie das leise jammernde Kind aus ihrem Leben entführt wurde, kehrte sie der Wärme des Raumes den Rücken und schloß die Augen.
Die Tür öffnete sich, leises Gemurmel folgte, Kleidung raschelte, der Weidenkorb knarzte, die Tür fiel ins Schloß – und dann folgte Stille, öde und marternde Stille. Sie war wieder allein, wie sie es den größten Teil ihres elenden Lebens gewesen war – nur gab es jetzt keine Hoffnung mehr. Der letzte Schimmer davon war ihr mit ihrer wunderschönen kleinen Tochter genommen worden. Sie stieß einen knurrenden Laut aus, der an ein verzweifeltes Tier erinnerte, und krallte dann ihre Finger in den Schmerz, der ihren Leib wie ein Messer durchschnitt. Ihre Verwirrung hatte noch kaum nachgelassen, als die zweite Attacke kam. Als sie die dritte kommen spürte, hatte sie bereits zu begreifen begonnen, und bei der vierten war sie bereit.
Kapitel 1
Von dem plüschig-bequemen, samtbezogenen Zweiersofa aus, das für diesen Anlaß in die Bibliothek gebracht worden war, studierte Chelsea die blonden, blauäugigen, hakennasigen Mitglieder der Familie ihrer Mutter und kam zu dem Schluß, daß sie, von wem immer sie auch abstammen mochte, mit besseren Voraussetzungen gesegnet war. Sie verabscheute die Arroganz und die Habgier, der sie sich hier gegenübersah. Abby war noch nicht einmal richtig kalt, und diese Hyänen hatten bereits begonnen, sich um das Erbe zu raufen.
Was Chelsea anging so wünschte sie sich nur Abby zurück – aber Abby war für immer fort.
Mit gesenktem Kopf lauschte sie dem Flüstern des Januarwindes, der gezischten Unterhaltung der Mahlers, dem Schnappen des Klappdeckels der Taschenuhr ihres Vaters und dem Rascheln der Papiere auf dem Schreibtisch. Nach einer Weile richtete sie den Blick auf den Teppich, einen Aubusson in elegant gedeckten Blau- und Brauntönen. »Dieser Teppich ist wie dein Vater«, hatte Abby mit ihrem unvergleichlichen britischen Humor erklärt, und Kevin war tatsächlich vornehm zurückhaltend. Ob er den Teppich ebenso liebte, wie Abby es getan hatte, blieb dahingestellt. Solche Dinge waren bei ihm schwer zu beurteilen. Er neigte nicht zu Gefühlsäußerungen. Selbst jetzt, als Chelsea aufschaute und in seinem Gesicht nach Trost suchte, fand sie keinen. Sein Ausdruck war ebenso herzzerreißend düster wie der dunkle Anzug, den er trug. Obwohl er sich das Zweiersofa mit ihr teilte und entsprechend nah neben ihr saß, war er in seinem Gram unerreichbar – und so war das schon seit Abbys Tod vor fünf Tagen.
Chelsea wäre gerne noch näher an ihn herangerückt und hätte seine Hand genommen, aber sie wagte es nicht. Sie würde damit das Land seiner Trauer unbefugt betreten und wußte nicht, ob er sie willkommenheißen würde oder nicht. So leer, wie sie sich fühlte, wollte sie keine Zurückweisung riskieren.
Endlich bereit, nahm Graham Fritts, Abbys Anwalt und Testamentsvollstrecker, das erste der vor ihm liegenden Papiere zur Hand. »Ich beginne mit der Verlesung des letzten Willens von Abigail Mahler Kane ...«
Chelsea ließ die Worte an sich vorbeirauschen. Sie erinnerten sie zu schmerzlich an den noch frischen Kummer, kamen zu schnell nach dem edlen, geschnitzten Sarg, dem wohlmeinenden Nachruf des Geistlichen und den Dutzenden gelber Rosen, die eigentlich strahlend schön wirken sollten, jedoch ein glanzloses Bild der Trostlosigkeit boten. Chelsea hatte nicht gewollt, daß das Testament so schnell eröffnet wurde, doch Graham hatte sich dem Drängen der Mahlers gebeugt, die zur Beerdigung von weither nach Baltimore angereist waren und nicht noch einmal gezwungen sein wollten, sich dieser Strapaze auszusetzen. Kevin hatte nicht widersprochen – er ließ sich kaum je auf Auseinandersetzungen mit dem Clan ein. Nicht, daß er ein Schwächling gewesen wäre, er war ein ungeheuer tüchtiger Mann, aber er verbrauchte seinen Kampfgeist in seinem Beruf bei den schwierigen Fällen, derer er sich annahm, und darum war er im Privatleben ein ausgesprochen friedfertiger Mensch.
Abby hatte das verstanden. Sie war ein äußerst mitfühlender Mensch gewesen, wurde Chelsea bewußt, als sie jetzt ihre Gedanken treiben ließ. Sie erinnerte sich, wie Abby sie in Epsom-Salz-Lauge badete, als sie die Windpocken hatte, und kiloweise Chelseas Lieblingseis – Schwarzkirsche – aus dem Supermarkt kommen ließ, als ihr eine Zahnspange verpaßt wurde, voller Begeisterung Farbkopien an all ihre Freunde schickte, als eine Zeichnung von Chelsea den ersten Preis bei einer örtlichen Kunstausstellung bekam, und sie tadelte, als sie sich die Ohren zweifach durchstechen ließ.
In der letzten Zeit, als Abbys körperlicher Zustand sich zusehends verschlechterte, wie es für langjährige Polio-Opfer typisch war, hatte das Blatt sich gewendet: Nun übernahm Chelsea das Baden, Verwöhnen, Loben und Tadeln, und sie war dankbar gewesen, dafür die Gelegenheit zu bekommen. Abby hatte ihr so viel gegeben – ihr etwas davon zurückgeben zu können war ein Geschenk, und das um so mehr, als sie beide immer deutlicher erkannten, daß Abby nicht mehr viel Zeit bliebe.
»... vererbe ich dieses Haus und das in Newport meinem Mann, Kevin Kane, desgleichen ...«
Häuser, Autos, Aktien und andere Wertpapiere – Kevin brauchte das alles nicht. Er war ein erfolgreicher Neurochirurg, der das Spitzengehalt, das er vom Krankenhaus bezog, noch durch eine gutgehende Privatpraxis aufstockte. Er war es auch gewesen, der für Chelseas alltägliche Bedürfnisse aufkam, und er hatte auf dieser Regelung bestanden. Abby hatte die Sonderausgaben finanziert.
Chelsea hatte sich im Laufe der Jahre oft gewünscht, sie hätte das nicht getan, denn es schürte nur die ablehnende Haltung seitens des Clans gegenüber dem »Kuckucksei«. Abbys Brüder und Schwestern hatten nicht gebilligt, daß ein Treuhandfonds für Chelsea eingerichtet werden sollte, in deren Adern kein Tropfen Mahler-Blut floß, aber Abby hatte darauf bestanden, daß Chelsea als ihrer Tochter die gleichen Voraussetzungen geschaffen würden wie jedem anderen Mahler-Enkel. Und so war sie ihnen gleichgestellt worden. Zumindest finanziell. Es bestand ein Treuhandfonds auf ihren Namen, der es ihr ermöglichte, von den Zinsen sorgenfrei leben zu können, selbst wenn sie sich entschließen sollte, niemals zu arbeiten.
»... meiner Tochter, Chelsea Kane, hinterlasse ich ...«
Chelsea war Architektin, mit inzwischen siebenunddreißig Jahren, eine von drei Partnern in einer Firma, die entlang der Ostküste lukrative Aufträge ausführten. Darüber hinaus hatte sie in einige dieser Projekte nach sorgfältiger Prüfung privat investiert, was bedeutete, daß ihr Einkommen sich sehen lassen konnte, und allein dieses ermöglichte ihr bereits ein sorgenfreies Leben.
Vielleicht war sie aus diesem Grund nie sonderlich auf die Anhäufung von Vermögenswerten aus gewesen, und darum hörte sie kaum zu, was Graham vorlas. Sie wollte nichts von ihrer Mutter erben, denn das hieße, ihren Tod anzuerkennen. Ihre Tanten und Onkel hatten damit offenbar kein Problem. In dem Bemühen, gleichgültig zu wirken, saßen sie mit künstlich-lässig im Schoß gefalteten Händen da, doch die verkrampften Muskeln um die spitzen Nasen und der gierige Ausdruck ihrer Augen verrieten sie.
»... meinem Bruder, Malcolm Mahler, vermache ich ...«
Malcolm bekam die Jacht, Michael den Packard, Elizabeth die beiden englischen Vollblüter, Anne die Eigentumswohnung in Aspen – aber sie fixierten Graham noch immer, als er weiterlas.
»Was die Rubine betrifft ...«
Die Rubine. Erst jetzt wurde Chelsea klar, daß sie es waren, worauf ihre Onkel und Tanten gelauert hatten. Nicht, daß es einem von ihnen an Schmuck gemangelt hätte oder an Jachten oder Autos oder Pferden, doch die Rubine waren etwas Besonderes. Sogar Chelsea, die niemals auch nur im Traum erwogen hätte, so auffällige Stück zu tragen, konnte ihren Wert einschätzen. Sie befanden sich seit sechs Generationen im Familienbesitz der Mahlers und gingen traditionsgemäß von der ältesten Tochter auf deren älteste Tochter über.
Abby war die älteste Tochter gewesen und Chelsea ihr einziges Kind. Aber Chelsea war adoptiert.
»Ich habe diesem Punkt meines Testaments ausführlichere Überlegungen gewidmet als dem Rest meines Nachlasses und beschlossen«, las Graham vor, »die Rubine wie folgt aufzuteilen: Meine Schwester Elizabeth soll die Ohrringe bekommen, meine Schwester Anne das Armband und meine Tochter Chelsea den Ring.«
Elizabeth sprang auf. »Nein das kommt nicht in Frage! Wenn die älteste Tochter keine Tochter hat, dann erbt die Zweitälteste das ganze Set, und die bin ich!«
Anne, die bis dahin mit übereinandergeschlagenen Beinen dagesessen hatte, stellte abrupt beide Füße auf den Boden und beugte sich gleichermaßen empört vor. »Die Stücke dürfen nicht auseinandergerissen werden, sie sollten immer komplett bleiben. Was hat Abby sich nur dabei gedacht?«
»Sie muß verwirrt gewesen sein«, lautete Malcolms höfliche Umschreibung für Unzurechnungsfähigkeit.
»Oder von jemandem beeinflußt«, lautete Michaels vage, aber doch eindeutig zielgerichtete Anschuldigung.
»Eine Mahler würde das Set nie aufteilen«, insistierte Elizabeth.
»Es steht mir zu – im Ganzen.«
Jetzt rührte Kevin sich auf seinem Platz – kaum merklich, aber angesichts seiner bisherigen Bewegungslosigkeit genügte es, um die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen. Mit vor Kummer heiserer, aber erstaunlich fester Stimme erklärte er: »Eigentlich hätte das ganze Set in den Besitz von Chelsea übergehen müssen, sie ist die älteste Tochter der ältesten Tochter.«
»Sie ist nicht Abbys Tochter«, protestierte Elizabeth.
»Nicht wirklich, zumindest. Sie hat nicht unsere Gene, kann sie also auch nicht weitergeben. Außerdem – sieh sie dir doch an: Sie ist eine Karrierefrau, sie wird kein Kind bekommen. Selbst wenn sie unser Fleisch und Blut wäre ...«
Chelsea stand still auf und stahl sich aus dem Zimmer. Elizabeths Worte gingen über ihre Kräfte. Sie litt mehr als alle da drin darunter, daß kein Mahler-Blut in ihren Adern floß. Jahrelang hatte sie versucht herauszufinden, wessen Blut es war, aber Kevin hatte sich beharrlich geweigert, sich dazu zu äußern, und Abby war gesundheitlich zu angeschlagen gewesen, als daß Chelsea es über sich gebracht hätte, sie damit zu belästigen, und so war diese Frage unbeantwortet geblieben. Abby war in jeder Hinsicht ihre Mutter gewesen, und ihr Tod hatte nicht nur ein schmerzliches Verlustgefühl in Chelsea ausgelöst, sondern auch Unsicherheit und die Empfindung, den Halt verloren zu haben. Abby hatte sie geliebt. Ungeachtet ihrer körperlichen Einschränkungen hatte sie sie bis zum Ersticken vergöttert. Chelsea hätte ihr oft gerne gesagt, sie solle sie in Ruhe lassen, doch Abby war viel zu lieb für eine solche Zurückweisung, und Chelsea hätte ihr um nichts in der Welt weh getan. Sie hatte das große Los gezogen, als sie adoptiert wurde. Das Haus der Kanes war ein Hafen, und die Liebe machte es zu einem sicheren, glücklichen Heim.
Nichtsdestoweniger war sie neugierig gewesen, hatte wissen wollen, warum sie adoptiert worden war, warum Abby selbst keine Kinder bekommen konnte, warum sie gerade sie ausgesucht hatten. Sie wollte wissen, wo sie geboren worden war, wer ihre leiblichen Eltern waren und warum sie sie weggegeben hatten.
Abby hatte ihr erklärt – mit so sanfter Behutsamkeit, daß Chelsea sich selbst nach so vielen Jahren noch genau daran erinnerte –, daß sie wegen ihrer Lähmung keine Kinder bekommen konnte, sie und Kevin sich genau dann dazu entschlossen hatten, eines zu sich zu nehmen, als ein kleines Mädchen dringend ein Zuhause suchte. Die Adoption sei inoffiziell vonstatten gegangen. Abby behauptete, nichts zu wissen, und Kevin schloß sich dem an. »Du bist eine Kane«, erklärte er beharrlich, selbst dann, wenn Chelsea sich gänzlich Kane-untypisch präsentierte. »Es spielt keine Rolle, woher zu stammst, solange du weißt, wer du jetzt bist.«
Chelsea trat vor den goldgerahmten Spiegel, der in der Halle über der Konsole hing. Sie war ebenso hochgewachsen und schlank wie die Mahlers und ebenso elegant gekleidet, aber da endeten die Ähnlichkeiten. Sie hatte im Gegensatz zu blauen Augen grüne, und ihre langen Haare waren kastanienbraun mit einer Naturwelle, um die die Mahler-Frauen sie dann beneideten, wenn Wellen in Mode waren. Aufgrund eines Motorradunfalls, den sie mit siebzehn gehabt und der eine gebrochene Nase und eine anschließende Operation zur Folge hatte, war Chelseas ehemalige Stupsnase jetzt schmal und gerade. Und dank einer Zahnspange, die sie vor dem Eintritt ins Teenageralter getragen hatte, war ihr vorher leicht fliehendes Kinn in perfekten Einklang mit ihren übrigen Zügen gebracht worden. Sie war eine attraktive Frau. Es zu leugnen hätte falsche Bescheidenheit bedeutet, und dazu war Chelsea zu ehrlich. Sie hatte einen langen Weg zurückgelegt seit der Teenagerphase der taillenlangen, verwegenen Mähne, kajalumrandeten Augen und Blumenkindaufmachung. Abby war stolz auf die Frau gewesen, zu der sie sich entwickelt hatte.
Jetzt war Abby nicht mehr da, und ihre Familie stritt sich in der Bibliothek erbittert um ein Schmuckset. Chelsea war regelrecht übel vor Abscheu. Wäre Kevin nicht gewesen, hätte sie auf der Stelle das Haus verlassen, aber sie wollte ihn nicht allein lassen. Er war todunglücklich. Nachdem sich Abbys Tod so viele Jahre angekündigt hatte, fiel es ihm unendlich schwer, ihn jetzt als gegeben hinzunehmen. Chelsea konnte ihm seine starrsinnige Schweigsamkeit bezüglich ihrer Adoption verübeln, aber nicht seine hingebungsvolle, allumfassende Liebe zu Abby.
Die Bibliothekstür öffnete sich, und Elizabeth und Anne erschienen. »Wir werden Einspruch einlegen, daß du es nur weißt«, kündigte Elizabeth Chelsea im Vorbeigehen an.
Anne zerrte ihre Pelzmäntel aus dem Garderobenschrank. »Der Ring muß im Familienbesitz bleiben.«
Ohne ein weiteres Wort, ohne jede Geste des Trostes oder der Ermutigung verließen die beiden Schwestern hocherhobenen Hauptes das Haus.
Die Eingangstür war kaum hinter ihnen ins Schloß gefallen, als Malcolm und Michael aus der Bibliothek traten.
Chelsea reichte ihnen ihre Mäntel.
Sie zogen sie schweigend an, und Malcolm rückte gerade seinen Hut auf dem Kopf zurecht, als er sagte: »Du hast ziemlich gut abgeschnitten, Chelsea.«
Sie trat mit hängenden Armen einen Schritt zurück. »Ich habe nicht auf die Details geachtet.« Und sie interessierten sie jetzt ebensowenig wie zuvor bei der Verlesung.
»Das hättest du aber tun sollen. Abigail hat dich zu einer wohlhabenden Frau gemacht.«
»Ich war schon vor ihrem Tod eine wohlhabende Frau.«
»Dank der Mahlers!« Das kam von Michael, der mit geschürzten Lippen auf seine Handschuhe hinunterschaute, während er sie sorgfältig über seine Finger streifte. »Elizabeth und Anne sind außer sich, und ich kann es ihnen offengestanden nicht verdenken. Ihr Argument ist stichhaltig. Der Ring ist viel Geld wert. Du brauchst das Geld nicht, und du brauchst den Ring nicht. Er kann nicht einmal annähernd den emotionalen Wert für dich haben, den er für uns hat.« Er hob seinen blauen Mahler-Blick und bohrte ihn in ihre grünen Augen. »Wenn du auch nur halb so anständig bist, wie Abby es immer von dir behauptet hat, dann wirst du uns den Ring geben. Du hast kein Recht darauf.«
Chelseas Gedanken wanderten zu den Partys ihrer Mutter zurück, zu denen die Mahlers erschienen waren. Chelseas Freunde waren beeindruckt gewesen. Sie hielten die Mahlers für Jetsetter, die in den glitzernden Hauptstädten der Welt mit Prinzen und Fürsten Umgang pflegten und Oxford-Englisch sprachen, als hätten sie es mit der Muttermilch eingesogen. Aber Chelsea hatte schon damals keine Bewunderung dafür aufbringen können, wenn in gewählten Worten häßliche Dinge ausgedrückt wurden.
Sie hätte gerne Abneigung oder Trotz empfunden, doch sie hatte nicht die Kraft dazu. Ebenso wie ihr Erbe ging es ihr auch gegen den Strich, so kurz nach Abbys Tod ein Streitgespräch zu führen. »Ich kann mich im Moment nicht mit dieser Angelegenheit befassen«, sagte sie. »Wirklich, ich kann es nicht.«
»Falls es dir darum gehen sollte, den Ring schätzen zu lassen«, vermutete Malcolm, »dann kann ich dir mitteilen, daß das bereits geschehen ist. Graham hat die Bescheinigung bei seinen Unterlagen.«
»Es geht darum, daß ich trauere. Ich brauche Zeit.«
»Aber nimm dir nicht zu viel. Die Mädchen werden bestimmt vor Gericht gehen, wenn du den Ring nicht freiwillig herausgibst.«
Chelsea hob abwehrend die Hand. »Nicht jetzt!« murmelte sie und floh in die Küche, wo sie unter einer Krone aus Kupferpfannen an den Arbeitsblock in der Mitte des Raumes gelehnt stand, als Graham hereinstürmte.
»Ahhh, Chelsea!« rief er erleichtert. »Ich hatte schon gefürchtet, Sie seien weggegangen.«
Chelsea mochte Graham. Er war im Alter ihrer Eltern, als Abbys Anwalt nachgerückt, als sein Vater starb, und seitdem eine stille Konstante in ihrem Leben.
Sie steckte die Hände unter ihre Achseln und warf ihm einen flehenden Blick zu. »Jetzt bedrängen Sie mich bitte nicht auch noch, Graham! Es war schlimm genug, daß das Testament verlesen wurde, ehe Mutter richtig kalt ist, aber das Schachern darum ist widerlich. Die Familie hat darauf bestanden, daß es so schnell eröffnet wurde, aber ich habe nicht die Absicht, es mir anzusehen, darüber nachzudenken oder darauf zu reagieren, bevor ich genug Zeit gehabt habe, um sie zu trauern.« Sie deutete vage in Richtung der Haustür. »Sie fliegen nach Hause und gehen zur Tagesordnung über, als habe sich nichts verändert, und vielleicht trifft das für sie ja zu, aber für mich hat sich viel verändert, und das hat nichts mit dem zu tun, was immer ich geerbt habe, oder mit der daraus folgenden ›Wertsteigerung‹ meiner Person. Ich weigere mich, das Leben meiner Mutter in Dollars und Cents auszudrücken, und wenn Sie gekommen sind, um das zu tun, dann vergessen Sie’s.«
»Nein, darum bin ich nicht hier.« Graham zog einen Umschlag aus der Innentasche seines Sakkos. »Das ist für Sie.«
Mißtrauisch musterte sie das Kuvert. Es war alt und abgegriffen.
»Wenn das irgendeine Aktie ist, dann will ich sie nicht«, sagte sie, obwohl der Umschlag keinen geschäftlichen Eindruck machte. Er war klein und unscheinbar, und Chelsea konnte sogar von weitem erkennen, daß er keinen Absender trug.
Graham legte ihn auf den Arbeitsblock. »Nehmen Sie ihn«, drängte er sie sanft. »Abby wollte, daß ich ihn Ihnen gebe.«
»Ist er im Testament aufgeführt?«
»Nein. Es war eine Privatangelegenheit zwischen ihr und mir, und jetzt werden Sie einbezogen.«
Neugierig nahm Chelsea das Kuvert. Das Gewicht überraschte sie. Was war da drin? Sie wog den Umschlag in der Hand und richtete ihre Aufmerksamkeit dann auf die Adresse. Die Schrift war ungelenk, die Tinte verschmiert, doch sie konnte den Namen ihrer Mutter erkennen. Den Namen darunter zu entziffern, bereitete ihr größere Schwierigkeiten.
Graham sprang ihr bei. »Das Kuvert wurde zu Händen meines Vaters geschickt – an seine Büroadresse. Er war der Anwalt, der Ihre Eltern bei der Adoption vertrat.«
Das war Chelsea nicht neu, doch es Graham so unvermutet erwähnen zu hören, erschreckte sie. Ihr Herz setzte einmal aus und machte das Versäumnis dann mit übertriebener Geschwindigkeit wett. Ihr Blick flog zu der Briefmarke. Auch sie war altersbedingt blasser geworden, aber der Stempel war noch leserlicher als das Gekrakel darunter: Er wies den Absendetag als den achten November neunzehnhundertneunundfünfzig aus und den Absendeort als Norwich Notch, New Hampshire. Chelsea las den Ortsnamen laut vor und schaute Graham fragend an.
»Sie sind dort geboren«, erklärte er.
Sie starrte ihn entgeistert an. Die Frage nach ihrem Geburtsort hatte all die Jahre ebenso zu ihrem Leben gehört wie ihre Geburtstagsfeier in jedem März. Daß sie plötzlich eine Antwort darauf bekommen hatte, war überwältigend. Norwich Notch. Sie hielt den Umschlag so vorsichtig in der Hand, als sei er zerbrechlich, wagte nicht, ihn zu öffnen.
»Was ist das, Graham?« ertönte Kevins düstere Stimme von der Tür her.
Grahams Blick löste sich von Chelseas Gesicht und richtete sich auffordernd auf den Umschlag. Sie schluckte, drehte ihn um, hob die Klappe an und zog ein Papiertaschentuch heraus, das ebenso abgegriffen war wie das Kuvert. Es sah aus, als sei es viele Male auseinander und wieder zusammengefaltet worden. Sie legte es behutsam auf den Arbeitsblock und faltete es ein weiteres Mal auseinander. Darin lag, mit einem ehemals roten Band versehen, das schon vor langer Zeit seine Leuchtkraft verloren hatte, ein schwarz angelaufener, silberner Schlüssel. Zumindest hielt sie es für einen Schlüssel. Der Kopf war ein Miniaturwaldhorn, das man mit Verzierungen leichter greifbar gemacht hatte, doch der Bart war glatt, nur eine dünne Röhre, halb so lang wie ihr Daumen.
Das Bild des Metronoms, das im Wohnzimmer ihrer Eltern auf dem Konzertflügel stand, erschien vor ihrem geistigen Auge. Dieses Metronom war in Jahren mühevollen Klavierunterrichts eine Heimsuchung für sie gewesen – und es wurde mit einem Schlüssel aufgezogen, dessen Bart ebenso glatt war wie dieser hier.
Verwirrt schaute sie zu Graham auf. »Wer hat ihn geschickt?«
Er zuckte die Schultern und schüttelte den Kopf.
»Es ist doch ein Schlüssel, oder?«
»Abby glaubte es, doch sie war sich nicht ganz sicher. Er kam, als Sie fünf Jahre alt waren.« In entschuldigendem Ton setzte er für Kevin hinzu: »Da er an Abby adressiert war, hatte mein Vater keine andere Möglichkeit, als ihn ihr auszuhändigen.«
Auch Chelsea wandte sich ihrem Vater zu. »Es gab ja auch keinen Grund, es nicht zu tun«, sagte sie zu ihm. Seine stattliche Gestalt füllte den Türrahmen aus, und er hielt sich trotz der schweren Last, die auf seinen Schultern ruhte, sehr gerade.
»O doch, den gab es«, widersprach er. Seine Einstellung zu diesem Thema hatte sich über die Jahre hinweg nicht geändert, nicht, als Chelsea volljährig wurde, und auch jetzt, nach Abbys Tod nicht. »Du warst von deiner achten Lebensstunde an unser Kind. Wir haben dich aufgezogen und geliebt. Deine Mutter wollte gar nicht wissen, woher du kamst. Sie brauchte es nicht zu wissen. Diese Information war bedeutungslos – und sie ist es noch. Wir haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist.«
Chelsea war sehr bewußt, daß das nicht stimmte. Sie hatte weder die edlen Züge der Mahlers noch Kevins Grübchenkinn, schmale Lippen und rosigen Teint, und während die Mahlers und die Kanes musikalisch begabt waren, mangelte es ihr völlig an Musikgehör.
Aber sie hatte nicht vor, sich darüber mit Kevin zu streiten. Er wurde selbst in seinen besten Zeiten von dem Gedanken gepeinigt, daß sie sich irgendwann auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern machen würde, und im Augenblick war er himmelweit von seinen besten Zeiten entfernt. Er war in Trauer. Sie war es ebenfalls, und seine zurückhaltende Art machte es ihr nicht leichter. Sie würde auf keinen Fall riskieren, den Abstand zwischen ihnen noch zu vergrößern.
Aber sie konnte den Schlüssel nicht einfach ignorieren. Sie legte ihn auf ihre Handfläche und strich mit dem Daumen über die Vorder- und Rückseite. »Wer hat ihn geschickt?« fragte sie noch einmal.
»Abby hatte keine Ahnung – sie bekam ihn so, wie ich ihn Ihnen übergeben habe. Ohne Begleittext.«
Chelsea legte den Schlüssel auf den Arbeitsblock, strich das Papiertaschentuch glatt und betrachtete zuerst die eine und dann die andere Seite, verfuhr danach in gleicher Weise mit dem Kuvert. Es stand nichts darauf außer der Adresse, nirgends war eine Nachricht zu entdecken. »Es muß doch etwas dabeigewesen sein.«
»Sie sagte, nein.«
»Sie sagte auch, sie wisse nicht, wo ich geboren wurde«, platzte Chelsea heraus, denn die Erkenntnis, daß Abby sie angelogen hatte, schmerzte. Noch schlimmer war der Gedanke, daß Kevin Kenntnisse besaß, die darüber hinausgingen. Ihr Blick suchte den seinen. »Wußtest du, daß sie den Schlüssel bekommen hatte?«
Er schüttelte langsam den Kopf, und die gemäßigte Bewegung drückte seinen Zorn aus. »Ich hätte es verhindert, wenn ich gekonnt hätte. Sie hatte weiß Gott schon genügend Sorgen, ohne sich den Kopf über einen Schlüssel zu zermartern.«
Eine überwältigende Traurigkeit ergriff von Chelsea Besitz. »Sie hätte sich nicht damit herumquälen müssen, wenn sie ihn mir einfach gegeben hätte.«
»Wenn sie das getan hätte, hättest du uns verlassen.«
»Wegen eines Schlüssels? Ich habe nicht einmal eine Ahnung, wozu er gehört.«
»Du hättest es herausgefunden«, erwiderte er barsch. »Das ist deine Art: Wenn du auf irgend etwas neugierig bist, dann läßt du nicht locker.« Sein Ton wurde sanfter. »Das war eine der Eigenschaften, die deine Mutter besonders an dir bewunderte: Du hattest den Mut, der ihr fehlte.«
Chelsea schaute ihn verblüfft an. »Sie hatte mehr Mut als wir alle.«
Die Erinnerung ließ Kevin sanft bleiben. »Sie sah es nicht so. Sie war durch ihre Familie fast ebenso in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt wie durch ihre Beinschienen, und du schwammst dich frei. Du tatest die Dinge, die sie vielleicht gerne getan hätte. Du suchtest nach Herausforderungen und bewältigtest sie. Sie liebte das Blumenkind, das du warst, ebensosehr wie den Champion des Schwimmvereins.« Sein Mund wurde noch schmaler, sein Ton wieder hart. »Jedenfalls hat sie sich darum zweifellos mit dem Schlüssel herumgequält. Sie wußte, daß du mit diesem Anhaltspunkt und der dir eigenen Neugier sofort losgestürzt wärest, um Eltern zu finden, die dich von vornherein nicht haben wollten.«
»Das ist nicht fair«, flüsterte Chelsea mühsam, denn ein dicker Kloß blockierte ihre Kehle. Sie bedauerte Kevin, der fürchtete, daß zwei andere Menschen seinen und Abbys Platz in ihrem Herzen erobern würden. Aber sie bedauerte auch sich selbst, denn das letzte, was sie glauben wollte, war die Version, daß sie nur am Leben war, weil zur Zeit ihrer Zeugung Abtreibungen illegal waren.
Sie drehte den Schlüssel in der Hand und sagte leise: »Ich wäre überhaupt nicht ›losgestürzt‹. Ich hätte dich und Mom ganz sicher nicht gekränkt. Ihr seid meine Eltern, und daran wird sich nie etwas ändern.« Sie wünschte verzweifelt, sich ihm verständlich machen zu können. »Ich habe nur immer wissen wollen, wer die anderen sind.« Das war ihr ein ungeheuer wichtiges Anliegen. Sie bezweifelte, daß jemand, der nicht adoptiert war, das Gefühl der Zurückweisung begreifen konnte, das die Tatsache, gleich nach der Geburt weggegeben worden zu sein, in einem Menschen weckte, die Empfindung, ausgeschlossen zu sein, die sie bei Familienzusammenkünften quälte, die nagende Gewißheit, daß etwas fehlte.
Aber jetzt war nicht der geeignete Zeitpunkt, ein emotionsgeladenes Thema nach dem anderen zu besprechen. Behutsam legte sie den Schlüssel in die Mitte des Papiertuchs und faltete es zusammen, wie Abby es offenbar so viele Male getan hatte. Dann schob sie das kleine Päckchen in den Umschlag zurück und steckte ihn in die Tasche ihres Seidenkleides.
Den Kopf hebend, sagte sie zu Kevin: »Du hast recht – es ist im Moment nicht wichtig.« Als wolle sie ihm zeigen, daß Abby in ihr weiterlebe, wandte sie sich mit der gleichen Souveränität Graham zu, die ihre Mutter in ähnlich kritischen Augenblicken an den Tag legte, und sagte: »Die Köchin macht ein unglaubliches Schmorhähnchen. Sie bleiben doch zum Dinner, nicht wahr?«
Kevin kannte Chelsea gut. Sie war wirklich eine Macherin. Als ihr der nötige Notendurchschnitt fürs College fehlte, hatte sie ihre Zulassung in Princeton erreicht, indem sie sich mit einer eindrucksvollen Arbeitsmappe buchstäblich in den Räumen der Architekturfakultät einnistete. Als sie beschloß, daß ihre erste Wohnung loftähnlich sein sollte, und das in einer Art und Weise, wie es Baltimore bis dahin noch nicht gesehen hatte, präsentierte sie einem der größten Bauunternehmer der Stadt eine Skizze und das Versprechen, unentgeltlich Bauzeichnungen zu liefern, wenn er das Gebäude kaufe, das sie im Sinn hatte, und sich des Projekts annähme. Als sie mit zwei Partnern ein Architekturbüro eröffnete, entwarf sie ein ins Auge fallendes Logo und schickte jedem potentiellen Kunden, den sie in ihrem privaten Adreßbuch finden konnte, einen handgeschriebenen Brief. Angesichts dessen, daß sie mit dem privaten Bekanntenkreis ihrer Mutter und dem beruflichen ihres Vaters aufgewachsen war, enthielt dieses Adreßbuch eine Unmenge von Namen. Jetzt bildete der Schlüssel eine Herausforderung für sie. Zuerst versuchte sie das schwarz angelaufene Silberding zu ignorieren – es trieb einen Keil zwischen Kevin und sie, und das zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt –, doch es ließ sich nicht ignorieren, machte seine Existenz von jeder Stelle aus, die sie als Versteck wählte, still, aber aufdringlich deutlich.
Gleichzeitig begann der Name Norwich Notch einen vertrauten Klang zu gewinnen. Sie fragte sich, ob irgendeine geheimnisvolle Macht in ihr Verbindung mit ihrem Geburtsort aufnahm oder ob sie den Namen einfach so oft vor sich hingesagt hatte, daß er ihr bekannt vorkam. Ein Atlas in der Bücherei verriet ihr, daß das Städtchen in der südwestlichen Ecke von New Hampshire lag und elfhundert Einwohner hatte – aber so viele Bücher sie auch wälzte, es fand in keinem davon Erwähnung. Schließlich wurde sie im Telefonbuch für den Keene-Peterborough-Distrikt fündig. Unter anderem war der Norwich Notch Town Clerk verzeichnet, die Norwich Notch Congregational Church und das Norwich Notch Community Hospital. Jede dieser Stellen käme als Informationsquelle in Frage. Das wußte sie, denn sie hatte in den letzten Jahren alle Artikel zum Thema Adoption gelesen, deren sie habhaft wurde, und kannte den Verlauf der Nachforschungen, die in den aufgeklärten Neunzigern an der Tagesordnung waren. Der Trend der Behörden ging eindeutig in Richtung eines Informationsaustauschs zwischen leiblichen Eltern und Adoptierten. Offene Adoptionen waren in Mode.
Sie hätte den Hörer abnehmen und ein Telefonat führen können. Sie hätte nach Boston fliegen und von dort nach Norden fahren oder nach Manchester fliegen und von dort nach Westen fahren können. Sie hätte auch den ganzen Weg nach Baltimore fahren können – aber sie tat nichts von alledem. Sie war noch nicht bereit dazu. Nicht so kurz nach Abbys Tod. Nicht, so lange Kevin so übersensibel war. Nicht so bald, nachdem sie zum ersten Mal etwas von Norwich Notch gehört hatte. Sie brauchte Zeit, um sich auf seine Existenz einzustellen.
Doch der Schlüssel wurde ihr schnell ein alter Freund. Nachdem sie ihn eine Woche lang Abend für Abend in der Hand gehalten und gedreht und studiert hatte, holte sie Silberputzmittel aus dem Schrank unter dem Spülbecken und behandelte, sorgsam darauf bedacht, das ausgefranste Band nicht vollzuschmieren, den Schlüssel bis in jede winzige Ecke mit der Creme, wonach sie ihn ebenso sorgsam abspülte und -trocknete.
Von der Patina befreit, war der Schlüssel ein reizvolles Ding, dessen bis ins Detail ausgearbeitete Schnörkel Chelsea für originalgetreu hielt. Der dünne, glatte Bart, der aus dem Mundstück ragte, war zwar hier und da eingedellt, doch das Horn selbst war in tadellosem Zustand. Als sie mit der Daumenkuppe über die Konturen fuhr, malte sie sich aus, daß begleitet von einer Rauchwolke, ein Geist erschiene, der ihr alles erzählte, was sie wissen wollte. Doch die Nacht war still, und sie blieb allein.
Sie hatte so viele Fragen, so viele Fragen, und die drängendste war, wer den Schlüssel geschickt hatte und warum. Zweiunddreißig Jahre waren eine lange Zeit, in der Menschen starben und Situationen sich änderten. Dann wieder fragte sie sich, ob der Poststempel nicht viel wichtiger für ihre Suche wäre. Norwich Notch. So vertraut. Es klang ländlich und voller Charme – aber natürlich konnte es auch ein deprimierendes Elendskaff sein. Sie war nicht sicher, ob sie herausfinden wollte, welches von beidem zutraf. Sie war nicht sicher, ob sie widerstehen könnte, es herauszufinden.
Inzwischen wuchs der Reiz des Schlüssels. Je öfter sie ihn betrachtete, um so mehr faszinierte sie nicht die Perfektion der Ausarbeitung, sondern die Kerben am Bart. Sie zeugten davon, daß er benutzt worden war – von Menschen, die in einer Beziehung zu ihr standen.
Sie malte sich viele verschiedene Szenarien aus, allesamt Variationen derer, die sie sich als Kind zusammengeträumt hatte. Ihre biologischen Eltern waren darin immer arm, aber voller Liebe zueinander. In einer Version waren sie Teenager, zu jung und zu unsicher, um sie zu behalten. In einer anderen war ihr Vater verheiratet, aber bis zum Wahnsinn in ihre Mutter verliebt. In einer dritten waren ihre Eltern zwar miteinander verheiratet, hatten jedoch bereits sieben Kinder und konnten sich kein achtes leisten.
Bei dieser letzten Möglichkeit verharrte Chelsea am längsten, denn der Gedanke, Geschwister zu haben, erfüllte sie mit freudiger Erregung. Sie hatte sich immer einen Bruder oder eine Schwester gewünscht, Abby regelrecht darum gebettelt. Irgendwann hatte sie eingesehen, daß eine Frau mit zwei unbrauchbaren Beinen und einer zarten Gesundheit nicht mehr als ein Kind bewältigen könnte, aber der Wunsch nach einem Geschwister war geblieben. Ihrer Meinung nach waren Geschwister in einer Weise miteinander verbunden, wie Freunde es nie sein konnten. Sie war mit Scharen von Freunden aufgewachsen, doch sie hatte immer diese andere, besondere Beziehung vermißt. Es gab Zeiten, da fühlte sie sich schrecklich einsam.
In diesen Zeiten suchte sie meistens Trost bei Carl.
Kapitel 2
»Ich möchte eine große Peperoni-Pizza mit doppeltem Käse, grünem Paprika, Pilzen und Zwiebeln«, sagte Carl ins Telefon und bedachte Chelsea dabei mit seinem Laß-den-guten-alten-Carl-nur-machen-Grinsen, die als Antwort darauf die Augen verdrehte.
Sie war erschöpft. Sie waren nach einer abendlichen Präsentation für ein Ärztehaus, mit dessen Entwurf sie betraut worden war, ins Büro zurückgekommen. Normalerweise hätte sie es allein gemacht, doch so kurz nach Abbys Tod konnte sie sich noch nicht wieder richtig konzentrieren, und so hatte Carl sie begleitet, um notfalls einzuspringen. Sie hatte zwar keine Schwierigkeiten, war jedoch froh, ihn dabei zu haben.
Er war Chelseas ältester und liebster Freund. Sein Vater und Kevin hatten in den Fünfzigern gemeinsam als Assistenzärzte angefangen, und seitdem waren die Familien eng verbunden. Solange Chelsea sich erinnern konnte, hatten die Harpers den Sommer in Newport in einem Haus verbracht, das nur zwei Blocks von den Kanes entfernt lag. Als zwei Einzelkinder hatten Chelsea und Carl sich zusammengeschlossen, und sie ergänzten sich wunderbar. Sie war impulsiv, er bedächtig. Sie war waghalsig, er vernünftig. Er brachte sie zum Nachdenken, sie ihn zum Fühlen.
Chelsea erinnerte sich, daß sie im Alter zwischen fünf und zehn Jahren ganz selbstverständlich davon ausgegangen war, Carl eines Tages zu heiraten. Als Teenager war das Thema Heirat dann zugunsten solcher Dinge wie Pubertät, Beatles-Musik und vegetarische Ernährung in den Hintergrund gerückt. Letzteres hatte sie von ihrem dreizehnten Lebensjahr an praktiziert, bis sie mit fünfzehn einen schweren Big-Mac-Anfall erlitt. Carl hatte all ihre Marotten mit Nachsicht ertragen, ja, sie sogar als eine Bereicherung seines Lebens gesehen und sich dafür erkenntlich gezeigt, indem er immer für sie da war, wenn sie einen Freund brauchte.
Partner in der eigenen Firma zu sein war eine logische Weiterentwicklung der Tage, in denen sie gemeinsam Sandburgen gebaut hatten. Carl war der Techniker, der Geschäftsmann. In puncto Risikobereitschaft stand er ihr in nichts nach, wenn es um Investitionen oder architektonische Herausforderungen ging. Innerhalb der Firma war er es, der die Aufträge an Land zog, bei Ausschreibungen für öffentliche Gebäude Entwürfe einreichte, dafür sorgte, daß sie im »Architectual Record« oder in der »Progressive Architecture« Erwähnung fanden. Chelsea war diejenige mit der zündenden Kreativität. Sie war die Künstlerin.
Im Augenblick war sie allerdings weder von zündender Kreativität noch voller Elan. Sie war den ganzen Tag von Termin zu Termin gehetzt, um die Woche aufzuholen, die sie sich als Trauerzeit zugestanden hatte. Sie fühlte sich ausgelaugt. Die Rückkehr zur Arbeit war ihr sehr schwergefallen.
»Es dauert zwanzig Minuten«, sagte Carl, als er den Hörer auflegte. »Hältst du so lange durch?«
»Natürlich. Kannst du mir noch einen zweiten Gefallen tun?«
Als er fragend die Brauen hochzog, erläuterte sie ihren Wunsch.
»Ruf Dad an. Erkundige dich, ob es ihm gutgeht. Heute bin ich den ersten Abend seit Abbys Tod nicht bei ihm.«
Carl rief an, und das Gespräch, das er mit ihm führte, war kurz und unverkrampft, getragen von der Selbstverständlichkeit, die aus einer alten Freundschaft erwuchs. Nachdem er es beendet hatte, berichtete er Chelsea: »Er fährt zu meinen Eltern rüber, sagte, im Krankenhaus sei alles gut gelaufen. Er freut sich, daß du mit mir zusammen bist.«
Sie lächelte. »Ich glaube, er hatte meine Gesellschaft satt. Aber es war eine schöne Zeit – in gewisser Weise. Nach einer Weile fing er an zu reden, in Erinnerungen zu kramen, erzählte mir Geschichten aus seiner Zeit mit Mom, ehe sie krank geworden war. Es überraschte mich, denn er ist normalerweise so zurückhaltend.«
Carl ging zu ihr hinüber. »Das bist du in letzter Zeit ebenfalls.« Er trat hinter ihren Stuhl und begann ihre verspannten Schultern zu massieren. »Es ist schwer für dich, nicht wahr?«
»Ja. Ich vermisse sie.«
»Es wird besser werden.«
»Ich weiß. Für Dad es ist noch schlimmer als für mich. Ich zermartere mir ständig den Kopf nach einer Möglichkeit, ihn ein bißchen aufzuheitern.«
»Du bist bei ihm gewesen, das hat ihm gutgetan.«
»Meinst du?« fragte sie nachdenklich, was sie neuerdings häufig war. Kevins Beziehung zu ihr war stets von sanftem Lächeln und anlaßbedingten Geschenken charakterisiert gewesen. Er war ein vielbeschäftigter Mann, und wenn er nach seinen langen Arbeitstagen aus dem Krankenhaus kam, galt sein Interesse vor allem anderen Abby. Das war der Grund dafür, daß Chelsea es trotz der tragischen Umstände genossen hatte, zu erleben, daß er Zeit mit ihr verbrachte und sich ihr ein wenig öffnete.
»Wir haben in der letzten Woche wahrscheinlich mehr Stunden miteinander verbracht als im ganzen letzten Jahr. Aber ich kann sie ihm nicht ersetzen.«
Sie schloß die Augen und ließ den Kopf langsam kreisen, um die Lockerungsarbeit von Carls Händen zu unterstützen. »Hm – du weißt genau, wo du hingreifen mußt.« Sie atmete ein, befahl ihren Muskeln, sich zu entspannen, atmete aus. »Carl?«
»Hm?«
»Glaubst du, das Hunt-Omni wird in Eigentumswohnungen umgewandelt?« Es gab Gerüchte, daß das Hotel verkauft würde. Nach New Yorker Maßstäben war es nicht besonders groß, aber wenn es zu Apartments umgestaltet werden sollte, böte das eine echte architektonische Herausforderung.
»Sieht so aus. Ich habe mit John Baker darüber gesprochen – er steht mit der Käufergruppe in Kontakt, und jetzt weiß er, daß wir interessiert sind.«
Chelsea hatte noch nie zuvor ein Hotel umgebaut. Es wäre eine schöne Aufgabe, genau das richtige, um sie von ihrem Kummer über Abbys Tod abzulenken und ihn unmerklich schwächer werden zu lassen.
Und da war auch noch die andere Sache, die sie fast ebenso intensiv beschäftigte wie der schmerzliche Verlust. Sie umfaßte Carls Hände und drückte sie kurz, stand auf, ging zu ihrem Aktenkoffer und nahm das kleine Taschentuchpäckchen heraus. Er war ihr gefolgt. »Was hast du da?« fragte er neugierig.
Sie faltete das Tuch auseinander und legte den Schlüssel auf ihre Handfläche.
»Wow!« Er nahm ihn und drehte ihn hin und her. »Wofür ist der?«
»Man kann irgendwas damit aufziehen. Mein Juwelier« – den sie heute zwischen zwei Terminen aufgesucht hatte – »sagt, daß er zu einer Spieldose gehöre.«
Carl betrachtete ihn immer noch aufmerksam von allen Seiten.
»Wo hast du ihn her?«
»Mutter hat ihn Graham gegeben, damit er ihn mir nach ihrem Tod gäbe. Er wurde aus einem kleinen Ort in New Hampshire geschickt. Norwich Notch. Ich bin dort geboren worden.«
Sein Blick hob sich jäh zu ihrem Gesicht. »Wie hast du denn das erfahren?« Er wußte von der Adoption und um die Frustration, mit der es Chelsea erfüllte, nichts über ihre Herkunft zu wissen, und wenn sie auch manchmal das Gefühl hatte, daß er Kevin darin zustimmte, daß diese Information unerheblich wäre, hörte er ihr geduldig zu, wenn sie darüber sprach.
»Durch den Poststempel – und Graham hat es bestätigt. Sein Vater hat die Adoption damals abgewickelt.«
»Wow. Norwich Notch?«
Sie nickte.
»Warum klingt das vertraut?«
Ihre Augen leuchteten auf. »Für dich auch? Ich habe den Namen inzwischen schon so oft vor mich hingesagt, daß ich meine Objektivität verloren habe.«
»Norwich Notch.« Sein Blick wurde konzentriert. Chelsea konnte beinahe sehen, wie er die Erinnerungen in seinem Kopf durchblätterte. Nach einer Weile schüttelte er stirnrunzelnd den Kopf. »Es fällt mit nicht ein. Wo in New Hampshire liegt es denn?«
»In der südwestlichen Ecke.«
»Ahhh – das erklärt es. Wir sind auf dem Weg zum Skilaufen entweder durch- oder vorbeigefahren. Wahrscheinlich haben wir den Namen auf Wegweisern gelesen.«
Sie erinnerte sich zwar nicht daran, hatte aber das Gefühl, daß seine Vermutung richtig war. Er besaß ein gutes Gedächtnis, und außerdem leuchtete ihr die Erklärung ein: Der Ortsname hatte sich ihnen zweifellos unbewußt eingeprägt.
»Und wer hat den Schlüssel geschickt?« fragte Carl.
Sie zuckte die Schultern.
»Kein Absender? Kein Begleitbrief?«
»Nichts. Nur ein Poststempel auf einem Kuvert, das Mom so oft auf und zu gemacht hat, daß es schon fast auseinanderfällt.« Die Vorstellung davon verfolgte Chelsea. »Ich frage mich, was sie die ganze Zeit über gedacht hat.« Sicherlich nicht, daß sie Chelsea verlieren würde – sie war sich ihrer Liebe sicher gewesen. Nein, Chelsea vermutete, daß sie sich mit der Frage herumgequält hatte, wie Kevin wohl darauf reagieren würde.
Carl legte den Schüssel wieder in ihre Hand. »Was willst du damit machen?«
»Weiß ich noch nicht, aber irgend etwas ganz bestimmt. Er ist mein einziger Hinweis auf meine Herkunft – ich kann ihn nicht einfach ignorieren.«
»Was sagt denn Kevin dazu?«
Chelsea drehte den Daumen nach unten und sah Carl nachdenklich werden. Er ging zum Fenster, unter dem, sechs Stockwerke tiefer, die Lichter des Inner Harbor funkelten.
»Nun, das kann man verstehen. Versetz dich doch mal in seine Lage. Er hat gerade erst Abby verloren, und jetzt fürchtet er, dich auch noch zu verlieren.«
Sie machte eine ungeduldige Handbewegung. »Das ist genau so albern wie der Spruch, daß ein Vater seine Tochter verliere, wenn sie heirate. Nein, schüttel nicht den Kopf, Carl, es ist das gleiche. Er ist mein Vater, und das wird er bleiben, was auch immer ich herausfinde. Tatsache ist, daß sie mich weggegeben haben und er mich aufgenommen hat. Dafür werde ich ihn ewig lieben.« Sie meinte es ernst, aber das bedeutete nicht zwangsläufig blinden Gehorsam. Sie war nie in ihrem Leben blind gehorsam gewesen.
»Was ist verwerflich daran, daß ich die Bedingungen, unter denen ich geboren wurde, erkunden will? Das ist bei allen Kindern ein beliebtes Thema. Du weißt doch auch Bescheid.«
»Ja. Ich war ein Versehen.«
»Kein Versehen, eine ›wundervolle Überraschung‹, wie deine Eltern es formulieren, und sie betonen immer wieder, wie glücklich sie sind, dich bekommen zu haben, auch wenn sie damals in Panik gerieten. Es ist eine schöne Geschichte, und du kennst sie. Ich möchte meine auch kennen.« An dem Platz, den dieses Wissen hätte einnehmen sollen, gähnte eine große Leere, eine Leere, die sie sich einsam fühlen ließ.
»Vielleicht würde sie dir nicht gefallen«, warnte er.
Diese Möglichkeit hatte sie auch schon in Betracht gezogen – sie hatte sich nicht nur schöne Variationen zu diesem Thema zusammengeträumt. In einer Alptraumversion waren ihr Vater ein Mörder, ihre Mutter eine Hure und ihre Geschwister geistig behindert. In einer anderen – noch schlimmeren – wollten sie nichts von ihr wissen, was ihr Gefühl bestätigen würde, sofort nach der Geburt abgelehnt worden zu sein.
»Du hast recht«, nickte sie. »Vielleicht würde sie das nicht – aber ich wüßte wenigstens, woran ich bin. Es ist die Ungewißheit, die mich manchmal so quält. Ich kann die Wahrheit akzeptieren, ich kann sie begreifen und verarbeiten, aber wie die Dinge jetzt liegen, fühle ich mich wie in einem Zwischenstadium, als sei ich gar nicht wirklich die nächste Generation, so lange ich nicht weiß, wer die davor war.«
»Du sprichst von Heirat und Kindern«, sagte Carl nach einer kaum merklichen Pause.
Sie hielt seinem Blick stand, lächelte und seufzte dann. Er traf den Nagel wieder einmal auf den Kopf. »Vielleicht.«
»Nein, eindeutig. Es ist doch ganz klar. Du warst nie verheiratet und hast keine Kinder, obwohl du beides genießen würdest, das weißt du.«
»Ich hatte keine Zeit dafür.«
»Das ist richtig«, gestand er ihr zu, »aber jetzt hättest du sie. Die Firma ist etabliert, die Geschäfte gehen von Jahr zu Jahr besser, unsere Investitionen zahlen sich aus, es läuft alles fast von selbst. Du könntest ein wenig kürzertreten, dir Zeit für einen Ehemann nehmen oder zu Hause arbeiten, während das Baby schläft. Du bist siebenunddreißig – und du wirst nicht jünger.«
»Du auch nicht, aber ich sehe dich nicht mit Volldampf in den Ehehafen steuern. Was tut sich denn mit Hailey?«
Hailey Smart war Anwältin in einer Kanzlei zwei Stockwerke tiefer, ein koboldhaftes, unternehmungslustiges Geschöpf und ein As in ihrem Beruf. Chelsea mochte sie.
Er rümpfte die Nase. »Hailey ist mir zu verrückt.«
»Ist sie nicht, sie ist super.«
»Ich bin ständig außer Atem, wenn ich mit ihr zusammen bin.«
Chelsea grinste. »Das kommt von der Leidenschaft, mein Freund.«
»Nein, das kommt vom Alter. Und außerdem ist Hailey nicht du.«
Der Türsummer kündigte die Ankunft der Pizza an. Da außer ihnen niemand mehr im Büro war, öffnete sie selbst. Unterwegs legte Carl den Arm um ihre Taille.
»Ich habe mich in dich verliebt, als ich zwei Jahre alt war, und es hat sich nichts daran geändert«, sagte er. »Du bist mein bester Freund, wie könnte ich Hailey heiraten, so lange es dich in meinem Leben gibt?«
»Habt ihr über Heirat gesprochen, du und Hailey?« fragte sie überrascht. Sie hatte nicht geglaubt, daß seine Gefühle für sie so weit gingen.
»Sie hat darüber gesprochen«, präzisierte Carl.
Das überraschte Chelsea noch mehr. Sie hatte Hailey als eine Frau eingeschätzt, die das Heiraten bis zur letzten Minute aufschob – und mit ihren neunundzwanzig Jahren hatte sie ja noch reichlich Zeit. Ihre Karriere war kaum den Kinderschuhen entwachsen.
»Hailey meint, daß sie alles schaffen kann, was sie sich in den Kopf setzt«, erklärte er mit einem Anflug von Spott in der Stimme. »Das bedeutet, gleichzeitig Anwältin, Ehefrau und Mutter zu sein. Wenn das Mädchen seinen Willen bekommt, wird sie eines Tages ihr Baby im Richterzimmer stillen.«
Chelsea lachte. »Das hat sie mir erzählt. Sie hat alles geplant. Sie wird elegante Kleider tragen und ihre Rolle als erfolgreiche Anwältin mit Bravour spielen, aber das Gericht wissen lassen, daß sie Stillpausen benötigt. Sie sagt, die Gegensätzlichkeit dieser beiden Bilder werde unwiderstehlich sein, die Geschworenen würden ihr aus der Hand fressen.«
Sie kamen in den Empfangsbereich, der mittels schicker Elemente von dem größeren Zeichensaal getrennt war. Das Ganze, nach Chelseas Entwürfen gebaut, war hoch und offen, mit vielen Fenstern und Oberlichtern, die einen Ausgleich für das dunkle Rostbraun der unverputzten Ziegelwände bildeten. Bei der Einrichtung lag der Schwerpunkt auf Glas und Chrom, und obwohl praktisch, war sie von moderner Eleganz. Gedimmte Punktstrahlerleisten verströmten sanftes Licht.
Carl bezahlte die Pizza, und dann gingen sie ihren Weg zurück, vorbei an den Arbeitsplätzen der drei Zeichner und des Projektleiters, dem sie unterstanden, in den Bereich, in dem die Chefbüros lagen, und ließen sich in Chelseas Büro nieder, wo sie die Unterhaltung sofort wieder dort aufnahmen, wo sie sie unterbrochen hatten, da ihr seine Worte noch immer in den Ohren klangen. Sie war ernsthaft beunruhigt. Carl hatte, wenn auch in aller Unschuld, bisher ausschließlich ihr gehört. »Liebst du Hailey?«
Er räumte ein paar Entwürfe vom Zeichentisch und stellte die Pizza darauf. »Ich liebe dich.«
»Ich meine es ernst, Carl.«
»Ich auch.« Er verschwand in sein Büro und kam Sekunden später mit einer Handvoll Servietten zurück. »Ich bin an dich gewöhnt, Chels. Wenn ich mit anderen Frauen zusammen bin, habe ich immer das Gefühl, dich zu betrügen.«
»Das solltest du aber nicht, wir sind doch nicht in dieser Weise aneinander gebunden.«
»Vielleicht sollten wir das sein«, überraschte er sie ein drittes Mal – diesmal durch seine Ernsthaftigkeit. Dann biß er von einem Pizzastück ab und machte damit die Wirkung zunichte. Die Hälfte des Belages rutschte herunter und klatschte in die Schachtel zurück. Er schob ihn vorsichtig wieder darauf, klappte das Pizzastück zusammen und versuchte es noch einmal.
Chelsea hatte diese Schwierigkeiten nicht. Während sie kaute, überlegte sie, worauf er wohl hinauswollte, als er sagte: »Ich habe seit Abbys Tod viel darüber nachgedacht. Ich denke, das ist ganz natürlich. Wenn man einen Menschen verliert, der einem nahesteht, wird man sich der Sterblichkeit bewußt, und man denkt an all die Dinge, die man sich wünscht, aber vielleicht versäumt, wenn man nichts unternimmt, um sie zu bekommen. Wir sind beide siebenunddreißig, und wir haben beide nie geheiratet – hauptsächlich, weil wir einander hatten. Warum machen wir nicht Nägel mit Köpfen?«