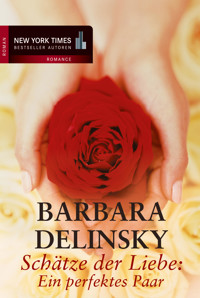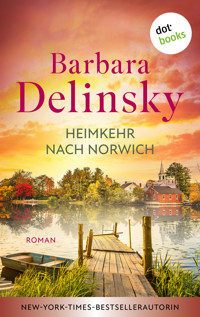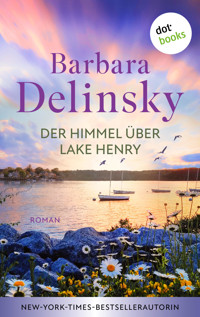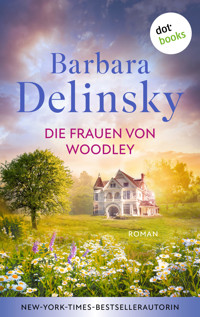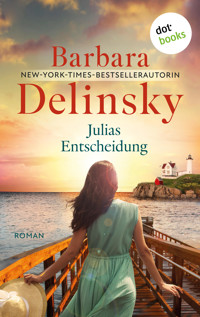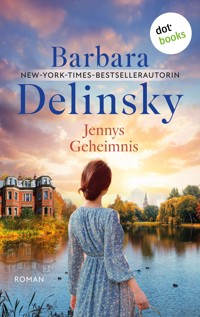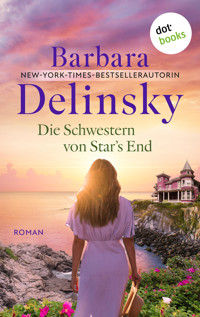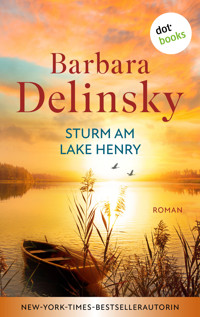
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Blake-Schwestern
- Sprache: Deutsch
Ein Geheimnis aus der Vergangenheit: Der berührende Roman »Sturm am Lake Henry« von Bestsellerautorin Barbara Delinsky jetzt als eBook bei dotbooks. Golden dämmert der Morgen über Lake Henry herauf, in den Straßen breitet sich der fröhliche Trubel der jährlichen Ahornernte aus – doch für Poppy Blake bricht an diesem Tag eine Welt zusammen: Ihre beste Freundin wird von der Polizei abgeführt. Ausgerechnet Heather, die gute Seele der kleinen Gemeinde, soll vor fünfzehn Jahren einen Mann überfahren haben. Warum nur schweigt sie zu diesen schrecklichen Vorwürfen? Poppy ist fest entschlossen, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen – doch seitdem sie selbst durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt, ist jeder Tag aufs Neue voller Herausforderungen. Als der charismatische Journalist Griffin ihr seine Hilfe anbietet, schöpft Poppy leise Hoffnung … aber welches Ziel verfolgt er wirklich? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Kleinstadtroman »Sturm am Lake Henry« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky ist der erste Roman ihrer mitreißenden »Blake Schwestern«-Reihe, die Fans von Susan Wiggs und Nora Roberts begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Golden dämmert der Morgen über Lake Henry herauf, in den Straßen breitet sich der fröhliche Trubel der jährlichen Ahornernte aus – doch für Poppy Blake bricht an diesem Tag eine Welt zusammen: Ihre beste Freundin wird von der Polizei abgeführt. Ausgerechnet Heather, die gute Seele der kleinen Gemeinde, soll vor fünfzehn Jahren einen Mann überfahren haben. Warum nur schweigt sie zu diesen schrecklichen Vorwürfen? Poppy ist fest entschlossen, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen – doch seitdem sie selbst durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt, ist jeder Tag aufs Neue voller Herausforderungen. Als der charismatische Journalist Griffin ihr seine Hilfe anbietet, schöpft Poppy leise Hoffnung … aber welches Ziel verfolgt er wirklich?
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Das Haus auf Beacon Hill«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Originaltitel »An Accidental Woman« bei Simon & Schuster, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-770-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sturm am Lake Henry« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Sturm am Lake Henry
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Kapitel 1
Ein Geräusch riss ihn aus dem Schlaf, und der Schauder, der Micah Smith belief, hatte nichts mit der kalten Luft zu tun, die durch das leicht geöffnete Fenster auf seiner Bettseite ins Zimmer drang. Es war noch sehr früh, das sagte ihm der rote Lichtschein, dieser Vorbote der Morgendämmerung, wenn Februarschnee den Waldboden bedeckte. Heute war es ein anderes Rot, ein tiefes, aber das war es nicht, was ihn beunruhigte. Es war auch kein Geräusch, das aus dem Zimmer der Mädchen kam, das ihn den Atem anhalten ließ. Sie würden noch eine Stunde schlafen oder sich zumindest ruhig verhalten, bis sie Heather oder ihn auf dem Flur hörten. Was ihn still daliegen ließ, den Blick auf das Fenster gerichtet, war ein Geräusch von draußen, selbst im Winter war es im Wald nicht gänzlich still, aber das, was er nun hörte, war weder ein Hirsch noch eine Eule noch ein Schneeschuhhase. Es war ein Auto, das langsam, sehr langsam, die schneeverharschte Zufahrt zu dem kleinen Haus, das Micah für seine Familie gebaut hatte, herauffuhr.
Steh auf!, rief eine Stimme in seinem Kopf, doch er rührte sich nicht, lauschte nur, flach atmend. Nicht ein Auto. Zwei. Sie kamen näher, hielten an. Ihre Motoren kamen zum Stillstand.
Tu was!, schrie die Stimme in seinem Kopf jetzt drängender, und das hoch über der Eingangstür, außerhalb der Reichweite der Mädchen deponierte Gewehr fiel ihm ein. Doch er war wie gelähmt. Das Einzige, was er bewegen konnte, war sein Kopf – den er in Heathers Richtung drehte. Sie schlief tief und fest, nicht ahnend, was er hörte, nicht ahnend, welche Gedanken ihn neben ihrem warmen Körper ans Bett fesselten.
Während er ihr langes, dunkles, silberüberhauchtes Haar betrachtete, klickte draußen eine Autotür und dann noch eine. Er sah im Geiste vor sich, wie auch die übrigen Türen geöffnet wurden, bedächtig und lautlos, von Männern, die dafür ausgebildet waren, unbemerkt zu agieren.
Heathers helle Schulter schaute zwischen ihren schlafzerzausten Haaren hervor. Er hätte sie gerne gestreichelt, doch dann wäre sie vielleicht aufgewacht, und das wollte er nicht. Wenn sie aufwachte, wenn sie hörte, was er hörte, würde sich ihrer aller Leben von Grund auf ändern, daran hatte er keinen Zweifel. Als er die Autos hatte kommen hören, war ihm bewusst geworden, dass er seit vier Jahren gefürchtet hatte, Heather zu verlieren, und es steckte eine sehr reale Furcht dahinter, nicht etwa der Aberglaube, dass diese Frau ihn, weil die erste ihn verlassen hatte, ebenfalls verlassen würde. Heather war nicht mit ihr zu vergleichen – und auch mit niemand anderem. Heather war einzigartig.
Das Leben in den Wäldern von New Hampshire hatte Micahs Ohr geschult, sodass es ihm ein Leichtes war, die Schritte draußen richtig zu deuten: Das Haus wurde umstellt. Mit seinem Gewehr würde er bei fünf oder sechs Leuten, so viele würden es wohl sein, nichts ausrichten können. Außerdem wäre Waffengewalt nicht angebracht. Die da draußen hatten nicht die Absicht, Gewalt anzuwenden. Und was geschah, war unabwendbar.
Es klopfte an der Haustür – so leise, dass es ihm, hätte er noch geschlafen, vielleicht entgangen wäre. Zeit, den Stier bei den Hörnern zu packen. Mit einer für seine Größe und kräftige Gestalt erstaunlichen Schnelligkeit und Anmut glitt er unter der dicken Daunendecke hervor, fuhr in seine Jeans, zog leise die Schlafzimmertür hinter sich zu, schlich den Flur hinunter und durchquerte, ohne Zeit damit zu verschwenden, Licht zu machen, das Wohnzimmer, um rechtzeitig vor dem zweiten Anklopfen die Tür zu öffnen. Pete Duffy, dem er sich gegenübersah, hatte bereits die Hand gehoben.
Pete war der Stellvertreter von William Jacobs, Lake Henrys Polizeichef, und ein Freund von Micah. Bestimmt hatte man deshalb ihn ausgewählt. Offenbar wollte man die Sache so ruhig und unauffällig wie möglich abwickeln und war der Meinung, indem man Pete schickte, einen Mann, dem Micah vertraute, sein Ziel zu erreichen. Allerdings war der bedauernde Ausdruck auf dem Gesicht seines Freundes nicht dazu angetan, Micahs Gefühl drohenden Unheils zu mindern, das ihn beschlich, als sein Blick auf den zweiten Mann, der direkt hinter Pete auf der Veranda stand, fiel. Micah kannte weder diesen noch die beiden Frauen in seiner Begleitung. Alle drei trugen Jeans und identische, blaue Jacken, auf deren Rückseite, dessen war Micah sich sicher, drei Buchstaben prangten.
»Wir sind wegen Heather hier«, sagte Pete leise, und sein Ton verriet, wie entsetzlich unangenehm ihm das war. »Sie«, fuhr er mit einer angedeuteten Kopfbewegung in die Richtung des Trios fort, »haben einen Haftbefehl gegen sie.«
Micah schluckte trocken. Ein Haftbefehl war eine ernste Sache. »Warum soll sie verhaftet werden?«
Der Mann trat neben Pete und streckte beide Hände aus. In der einen hielt er Papiere, in der anderen seinen Dienstausweis.
»Jim Mooney, FBI«, stellte er sich vor. »Ich bin beauftragt, Heather Malone zu verhaften. Ihr wird vorgeworfen, sich durch Flucht der Strafverfolgung entzogen zu haben.« Micah dachte über die Worte des Mannes nach. Es gab schwere Vergehen und minderschwere Vergehen. Heather hatte ihre Vergangenheit stets für sich behalten. Wenn er sich im Laufe ihrer gemeinsamen Jahre gefragt hatte, warum sie ein solches Geheimnis daraus machte, war ein Konflikt mit dem Gesetz stets das schlimmste der Szenarien, die er entworfen hatte. Jetzt konnte er nur beten, dass ihr ein minderschweres Vergehen zur Last gelegt wurde. Allerdings hätte sich in dem Fall wohl kaum das FBI bei Tagesanbruch zu ihnen in den Wald bemüht.
»Strafverfolgung weswegen?«, wollte er wissen.
»Mord.«
Seltsamerweise schockte ihn diese Antwort nicht – nein, er war so erleichtert, dass er dem Beamten fast ins Gesicht gelacht hätte. Wenn die Anklage auf Mord lautete, konnte es sich nur um einen Irrtum handeln. »Heather wäre niemals zu einem Mord fähig.«
»Als Heather Malone vielleicht nicht – aber wir haben Beweise dafür, dass ihr richtiger Name Lisa Matlock lautet, und dass sie vor fünfzehn Jahren in Kalifornien einen Mann getötet hat.«
»Heather war nie in Kalifornien.«
»Lisa schon«, informierte ihn der Beamte. »Sie ist dort aufgewachsen, und sie hat dort gelebt, bis sie vor fünfzehn Jahren absichtlich einen Mann mit ihrem Auto überfuhr. Unmittelbar danach verschwand sie. Vor vierzehn Jahren kam sie als Heather nach Lake Henry und arbeitete als Küchenhilfe, wie sie es als Lisa in Kalifornien in den zwei Jahren vor ihrem Verschwinden getan hatte. Heathers Gesicht stimmte mit dem von Lisa überein, bis hin zu den grauen Augen und der Narbe im Mundwinkel.«
»Es gibt Millionen von Frauen mit grauen Augen.« Micah spürte plötzlich die kalte Winterluft auf seinem nackten Oberkörper.
»Und die Narbe stammt von einem Autounfall.« Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, als ihm klar wurde, was er gesagt hatte, doch der Beamte sprach ihn von Verrat frei.
»Nicht von diesem. Dabei kam sie unverletzt davon. Aber der Mann, den sie überfahren hatte, starb – ein Mann, den sie Minuten, ehe sie ihn überfuhr, zu erpressen versucht hatte.«
»Erpressen!«, schnaubte Micah. Jetzt war er noch sicherer, dass es sich um einen Irrtum handelte. »Auch dazu wäre Heather nicht fähig. Mir ist egal, wie sie sich nennt – sie ist sanft, sie ist freundlich, sie ist gutherzig. Sie würde eher sterben als jemanden töten.«
Der Beamte ließ sich davon nicht beeindrucken. »Wenn das stimmt, wird es sich in der Gerichtsverhandlung herausstellen, aber jetzt muss ich sie erst einmal mitnehmen. Entweder holen Sie sie, oder wir holen sie.«
Micah richtete sich zu seiner vollen Größe von einem Meter neunzig auf. »Das dürfen Sie nicht. Dies ist mein Haus.« »Wir haben es umstellt. Sollte sie versuchen, durch die Hintertür zu entkommen, wird sie dort in Empfang genommen.«
Pete wandte sich dem Beamten mit finsterer Miene zu. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es keine Probleme geben wird, Mooney.«
Mit einem flehenden Blick beschwor er Micah: »Sie haben das Gesetz auf ihrer Seite – uns bleibt keine Wahl.«
Doch Micah gab sich noch nicht geschlagen. »Graue Augen und eine Narbe! Was sind denn das für Beweise?« »Wir haben noch mehr«, erklärte der Beamte.
Micah sah den Mann nachdenklich an. »Fingerabdrücke?«
»Ihre Handschrift.«
Micah hatte genügend gelesen, um ein wenig über die Materie zu wissen. »Das ist kein schlüssiger Beweis.« »Ich würde sagen, Sie sind voreingenommen.« »Sie ja wohl auch, verdammt!«
Pete trat zwischen die beiden Männer. Langsam und deutlich erklärte er Micah: »Sie haben einen Haftbefehl. Er gibt ihnen das Recht, sie mitzunehmen. Streit dich nicht mit ihnen, Micah.«
Plötzlich ging hinter Micah ein Licht an, die Lampe am Durchgang zum Flur. Dort stand Heather. Sie trug ihren Morgenrock und hielt mit einer Hand die Revers über der Brust zusammen, während sie sich mit der anderen an der Wand abstützte. Als sie die Leute auf der Veranda sah, weiteten sich ihre Augen. Sie waren nicht einfach nur grau – sie glitzerten wie geschmolzenes Silber. Diese Augen hatten Micahs Herz schon bei ihrer ersten Begegnung zum Klingen gebracht, und das taten sie auch jetzt, als er sich ihr zuwandte und sie seine Augen mit einer stummen Bitte festhielten.
Er reagierte darauf, indem er die Hand hob, um die beiden Beamtinnen aufzuhalten, die sich bei Heathers Anblick in Bewegung gesetzt hatten, und ging selbst zu ihr. Mit beiden Händen griff er in ihre Haare, umfasste ihr Gesicht und forschte in ihren Augen nach Schuldbewusstsein. Alles, was er sah, war Furcht.
»Sie behaupten, du seist jemand anderer«, flüsterte er. »Das kann ja nur ein Irrtum sein – aber sie müssen dich mitnehmen.«
»Wohin?«, fragte sie kaum hörbar.
Das wäre nicht die erste Frage gewesen, die Micah an ihrer Stelle eingefallen wäre. Er hätte wissen wollen, für wen sie ihn hielten und warum er mit ihnen gehen müsse. Wenn Heather nicht gewusst hätte, warum die Leute gekommen waren, hätte auch sie das wissen wollen.
Andererseits war sie ein vernünftig denkender Mensch – weit mehr als er.
»Ich weiß es nicht«, murmelte er. »Vielleicht in Willie Jakes Büro.« Er schaute über seine Schulter zu Pete. »Sie wollen sie nur verhören?«
Bevor Pete antworten konnte, traten die beiden Beamtinnen auf sie zu. »Wir müssen sie festnehmen«, erklärte ihm die eine und sagte dann zu Heather: »Wenn Sie sich anziehen wollen, begleiten wir Sie.«
Heathers Blick flog von der einen Frau zu der anderen und dann zu Micah. Sie legte die Hand auf seine Brust und krallte sich in die gekräuselten Haare. In Momenten der Leidenschaft tat sie es, weil sie Halt suchte, um sich nicht gänzlich zu verlieren – jetzt tat sie es, weil sie in ihrer Angst Halt suchte.
»Ich begleite sie«, sagte er, doch eine der Beamtinnen packte sie am Arm und leierte ihr ihre Rechte herunter, wie Micah es schon Dutzende von Malen in Fernsehkrimis gehört hatte. Doch dies war kein Fernsehkrimi – dies war die Realität, und die Verzweiflung in Heathers Augen zerriss ihm fast das Herz. So sehr er sich auch wünschte, ihr helfen, etwas für sie tun zu können – er war vernünftig genug, um zu wissen, dass ihm die Hände gebunden waren, und so sah er sich nur wieder zu Pete um und sagte: »Jemand wird sich dafür verantworten müssen. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht. Heather hat nichts getan. Es ist alles ein schrecklicher Irrtum.«
Pete trat zu ihm, als die beiden Beamtinnen mit Heather den Flur hinuntergingen. »Das habe ich ihnen auch gesagt. Und Willie Jake genauso. Er hat sich fast die ganze Nacht mit dem Versuch um die Ohren geschlagen, sie zur Vernunft zu bringen – aber sie haben den Haftbefehl, Micah. Da können wir nichts machen.«
Micah drehte sich wieder um, aber Heather war bereits im Schlafzimmer verschwunden. Als er ihr folgen wollte, hielt Pete ihn am Arm fest. »Du musst hierbleiben. Sie steht unter Arrest.«
»Daddy?«, kam ein Stimmchen aus dem hinteren Teil des Flurs.
»O Gott!«, stöhnte Micah leise. Es war Melissa, seine siebenjährige Tochter. So ungezwungen, wie es ihm angesichts seiner aufsteigenden Panik möglich war, sagte er: »Geh wieder ins Bett, Missy. Es ist noch zu früh zum Aufstehen.« Aber Missy, weit neugieriger und mutiger als ihre jüngere Schwester, tapste in ihrem langen, rosa Nachthemd barfuß auf ihn zu. Ihre Haare waren so dunkel wie seine und so lang und dick wie Heathers, aber wild gelockt. »Warum ist Pete hier?«, wollte sie wissen und schob ihre kleine Hand in seine, schaute dabei jedoch Mooney an. »Wer ist das?«
In Micahs Kopf überschlugen sich die Gedanken. »Er ... er arbeitet manchmal mit Pete zusammen«, war alles, was ihm in der Eile einfiel. »Sie müssen Heather ein paar Fragen stellen.«
»Was für Fragen?«
»Na ja – dies und das.«
»Jetzt gleich?«
»Ein bisschen später.«
Sie schaute zu ihm hoch. »Wenn die Sonne aufgeht?« Das würde ihr einleuchten, denn auf diesen Zeitpunkt hatte Heather die Mädchen immer vertröstet, als sie noch klein waren, wenn sie ihn und Heather zu nachtschlafender Zeit wecken kamen.
»Ja.«
Ein schelmisches Blitzen ließ ihre Augen funkeln. »Ich wette, sie schläft noch. Darf ich sie kitzeln gehen?«
»Nein.« Seine Finger schlossen sich fester um ihre Hand. »Sie ist schon wach. Sie ist sogar schon beim Anziehen. Ich möchte, dass du wieder ins Bett gehst. Und weck deine Schwester nicht.«
»Die ist auch schon wach. Sie hat sich bloß nicht rausgetraut.«
Micah wusste, dass das nicht die einzige Erklärung war. Er hatte bereits vor langer Zeit erkannt, dass seine jüngere Tochter ein seltsam erwachsenes Einfühlungsvermögen besaß. Sie würde wissen, dass etwas Schlimmes vorging. Ihre Angst wäre begründet. »Dann spiel mit ihr, damit sie sich nicht mehr fürchtet.« Er gab ihre Hand frei.
Missy ging rückwärts ein paar Schritte in den Flur. Als sie glaubte, er könne sie nicht mehr sehen, drückte sie sich an die Wand.
»Missy!«, sagte Micah in warnendem Ton und bedeutete ihr mit einer Handbewegung weiterzugehen. Bevor sie gehorchen konnte, kam Heather mit den beiden Beamtinnen aus dem Schlafzimmer. Sie trug Jeans und einen dicken Pullover, dessen Unförmigkeit sie verloren wirken ließ. Ihr Ausdruck spiegelte diesen Eindruck wieder. Als sie Missy entdeckte, blieb sie wie angewurzelt stehen. Hilfesuchend warf sie einen Blick zu Micah, ehe sie ihn wieder auf das Kind richtete.
Missy schaute die Beamtinnen an. »Wer sind die?«
»Sie arbeiten auch mit Pete zusammen«, sagte Micah. »Geh zu Star, Missy. Sei lieb – du musst mir jetzt helfen.« Missy blieb, wo sie war.
Heather kniete sich vor sie hin. »Hör auf Daddy, Schätzchen«, bat sie in sanftem Ton. »Geh zu deiner Schwester. Sie braucht dich.«
Mit plötzlich sorgenvoller Miene legte Missy die Hände auf Heathers Schultern. »Wo fährst du hin?«
»In die Stadt.«
»Wann kommst du wieder?«
»Bald.«
»Bestimmt?«
»Ja.«
»Versprichst du’s?«
Micah, der ebenso bang auf die Antwort wartete wie seine Tochter, sah Heather schlucken – doch gleich darauf antwortete sie in demselben sanften Ton: »Ich werde mein Bestes tun, um hier zu sein, wenn du aus der Schule kommst.« »Versprichst du’s?«, fragte Missy noch einmal.
»Ja«, flüsterte Heather, stand auf und küsste das Kind auf den Scheitel. Micah bildete sich ein, dass sie den Kuss ein wenig länger ausdehnte als gewöhnlich. Als sie auf ihn zukam, standen Tränen in ihren Augen. Bei ihm angelangt, sagte sie leise: »Ruf Cassie an.«
Cassie Byrnes war eine von Heathers engsten Freundinnen – und Rechtsanwältin.
Micah nahm ihre Hände in die seinen und stellte bei dieser Gelegenheit fest, dass die weiten Ärmel des übergroßen Pullovers Handschellen verbargen. Sie waren fast so kalt wie ihre Haut. Aufgebracht drehte er sich zu Pete um, der warnend die Brauen hob und mit einer Kopfbewegung auf Missy deutete.
»Ruf Cassie an«, wiederholte Heather. Ihre Bitte war angebracht, sie entsprach ihrem vernünftigen Denken, doch sie war nicht die Reaktion, die Micah sich gewünscht hätte. Er hätte Heather gerne verwirrt gesehen, sie gerne protestieren gehört, ihre Unschuld beteuern, vielleicht sogar weinen und empört erklären, dass sie noch nie etwas von einer Lisa Matlock gehört habe. Dass sie all das nicht tat, musste allerdings nicht bedeuten, dass sie in Wahrheit tatsächlich so hieß und zu Recht beschuldigt wurde. Sie war ein praktisch denkender Mensch, und angesichts des Haftbefehls war es das einzig Vernünftige zu kooperieren.
Die Handschellen jedoch hielt er für eine Zumutung. Eine so zierliche Person wie Heather hätte nicht einmal ohne sie den Hauch einer Chance gehabt, sich gegen das Polizeiaufgebot im Haus – und das zusätzliche draußen – durchsetzen. Abgesehen davon würde es seiner Heather nicht im Traum einfallen, tätlich zu werden. In den vier Jahren, die sie zusammen waren, hatte er kein einziges Mal erlebt, dass sie auch nur zornig geworden wäre.
Als die beiden Beamtinnen mit ihr zur Tür gingen, folgte er dichtauf. »Wohin bringen Sie sie?«
Mooney stellte sich ihm in den Weg, als die Beamtinnen Heather hinausführten. »Nach Concord. Sie wird heute Vormittag einem Richter vorgeführt. Besorgen Sie ihr einen Anwalt.«
Einem Richter vorgeführt! Micahs Blick flog zu Pete, der seine stumme Frage beantwortete: »Sie müssen den Haftbefehl vorlegen.«
»Wird sie wegen Mordes angeklagt?«
»Nein. Vorläufig wird sie überhaupt nicht angeklagt. Sie legen den Haftbefehl vor und beantragen die Auslieferung nach Kalifornien. Heather hat die Wahl, sie kann auf ein Überstellungsverfahren verzichten und mit ihnen nach Kalifornien fliegen, oder sie kann es durchfechten. Sie können sie nicht einfach mitnehmen oder sie des Mordes oder wegen einer anderen Straftat anklagen, bis sie nachweisen, dass die Anklagepunkte okay sind.«
Micah hätte gerne noch Genaueres über all das gehört, was Pete ihm da erzählte, doch er hatte noch dringendere Fragen, und Mooney verließ gerade das Haus. Er folgte dem Mann über die Veranda und die Treppe hinunter, ohne das Eis auf den Planken, den Schnee auf der Zufahrt unter seinen nackten Füßen und die Winterkälte auf seinem nackten Oberkörper zu spüren. »Ich komme mit«, erklärte er. Diese Idee war absolut unvernünftig, denn er könnte die Mädchen weder mitnehmen noch allein zu Hause lassen, doch er dachte in diesem Moment nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen.
Mooney ging unbeirrt weiter, als habe er es nicht gehört. »Das ist Unsinn«, versuchte Pete, ihn zur Vernunft zu bringen.
Micah beobachtete, wie Heather auf den Rücksitz eines dunklen Kombis gedrückt wurde, in den, der am weitesten vom Haus entfernt stand, und sah gleichzeitig zwei Männer aus dem Wald auftauchen und ebenfalls in den Van steigen.
Micah rannte los. »Ich will bei ihr sein!«
Pete rannte neben ihm her. »Das werden sie dir nicht erlauben. Fahr lieber später mit Cassie hin. Halt sie jetzt nicht auf. Lass sie verschwinden, bevor’s hell wird, umso weniger Aufhebens gibt es.«
Daran hatte Micah überhaupt nicht gedacht. Als er jetzt zum Himmel hinaufschaute, stellte er fest, dass er bereits heller geworden war. Pete hatte Recht. Aber als der Deputy ihn am Arm packte und zum Haus zurückziehen wollte, riss Micah sich los und rannte weiter. Er hielt vor der Tür des Kombis an, hinter der Heather saß, und drückte die Hand auf das Fenster. Ihre Blicke trafen sich. Mooney ließ den Motor an, und Micah lief mit, bis der Wagen zu schnell für ihn wurde. Keuchend starrte er durch seine Atemwolken das Gesicht an, das sich ihm hinter der Heckscheibe zugewandt hatte, und hielt Heathers Blick fest, bis der Kombi um eine Kurve verschwand.
Sie war fort.
Plötzlich fror er – äußerlich und innerlich. Er machte kehrt und rannte zurück. Petes Streifenwagen stand noch da. »Ein schöner Freund bist du!«, stieß er hervor, als er an dem Deputy vorbeistürmte.
»Was hätte ich denn tun sollen, verdammt noch mal?«, wehrte er sich und rannte Micah nach, »Sie hatten einen Haftbefehl.«
»Du hättest ihnen sagen können, dass sie sich irrten. Du hättest ihnen sagen können, dass sie einen Fehler machten.«
»Das haben wir ja getan. Aber sie sind vom FBI, zum Teufel. Es war schon ein Fall für die Bundespolizei. Was hätten wir machen können?«
»Uns anrufen. Uns warnen.«
»Und was hätte das genützt? Wärt ihr geflüchtet, als hättet ihr was verbrochen? Nein, Micah – es ging nicht anders.« Micah nahm, von Zorn getrieben, zwei Verandastufen auf einmal.
»Sieh es doch mal so«, sagte Pete. »Sie müssen beweisen, dass sie diese Lisa Malone ist. Glaubst du, irgendjemand hier wird sagen, dass sie nicht Heather ist? Keine Chance. Also werden sie Leute auftreiben müssen, die ihre Behauptung bestätigen. Das wird einige Zeit dauern, meinst du nicht?«
Micah kümmerte in diesem Moment nur die Zeit, die er von Heather getrennt sein würde, und da war ihm jede Minute zu viel. Er wollte sie bei sich haben, und das nicht nur der Mädchen wegen. Er vermisste sie schon jetzt, ihre Sanftheit, ihre Zuverlässigkeit – und, ja, ihre Vernunft. Er war ein impulsiver Mensch und manchmal so auf kleine Details fixiert, dass er das Bild, zu dem sie gehörten, gar nicht wahrnahm. Heather tat das. Sie war ihm eine unschätzbare Hilfe im täglichen Leben und eine wertvolle Mitarbeiterin bei der Herstellung seines Ahornsirups – und die Saison stand vor der Tür.
Aber Heather war nicht da. Jetzt musste er das Bild allein erkennen. In diesem Fall bedeutete das zunächst einen Anruf bei Cassie. Er überquerte die Veranda, schlug Pete die Tür vor der Nase zu – und vergaß Cassie auf der Stelle. Missy stand mit herzzerreißend verzweifeltem Gesicht mitten im Wohnzimmer. Obwohl er Star nirgends entdeckte, hätte Micah schwören können, dass sie da war. Er schaute unter dem Sofa nach, unter den Lehnstühlen, unter dem quadratischen Couchtisch, den er nach Heathers Anweisungen geschreinert hatte – und dann sah er sie. Die Haustür war von Bücherregalen flankiert, und aus dem untersten Fach des linken schimmerte ihm neben einem leuchtend gelben National-Geographic-Stapel ihr blassgrünes Nachthemd entgegen. Sie hatte die Knie angezogen und die Ärmchen darum geschlungen. Ihre Haare, dunkel wie seine, aber lang, glatt und fein, lagen wie eine Stola um ihre Schultern, und in den Augen, die ihn ansahen, las er Traurigkeit und Wissen.
Sein Herz flog ihr entgegen. Es war nicht so, dass er Star mehr liebte als Missy – er sorgte sich nur mehr um sie. Sie war ein sehr viel ernsteres Kind als Melissa. Und verschlossen. Melissa sagte, was sie dachte. Star war stiller. Sie war noch ein Baby gewesen, als ihre Mutter fortging. In Wirklichkeit war sie nicht fortgegangen, sondern mit ihrem Pickup ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen, in eine Schlucht gestürzt und im Führerhaus verbrannt, doch er umschrieb das stets mit diesem Wort. Natürlich konnte Star sich nicht an Marcy erinnern, doch er war überzeugt, dass sie ihre Mutter vermisste. Heather ging sehr liebevoll mit Star um. Heather ging mit beiden Mädchen sehr liebevoll um. Und nun war Heather auch fortgegangen.
Er ging in die Hocke und holte seine kleine Tochter vorsichtig aus ihrem Versteck. Sie schlang die Arme und Beine um ihn, als er sich aufrichtete.
Da er nicht wusste, wie er anfangen sollte, sagte er einfach nur: »Es ist alles okay, mein Baby«, und trug sie den Flur hinunter. In dem Zimmer, das die Mädchen sich teilten, setzte er sie auf ihr Bett. Wie auf Missys herrschte auch hier ein wildes Durcheinander aus Laken, Kissen und Daunendecke. Nur die Farben waren unterschiedlich: Missys Bettzeug war rosa, Stars grün. Das hatte sich Heather ausgedacht. »Es ist alles okay«, wiederholte er, »aber du musst mir im Moment trotzdem helfen. Ich muss ein paar Telefonate führen. Zieh dich bitte inzwischen an.«
»Und was ist mit Missy?«
»Missy wird sich auch anziehen. Und wenn ihr fertig seid, frühstücken wir alle gemeinsam.«
»Wir warten nicht auf Momma«, sagte das Kind mit Überzeugung in seiner Kleinmädchenstimme.
»Nein. Sie wird in der Stadt frühstücken.«
»Was wird sie essen?«
Er dachte einen Moment nach. »Vielleicht Eier. Und Waffeln. Wenn wir das Gleiche essen, wird es sein, als wäre sie bei uns. Was meinst du?«
»Vielleicht.«
»Hafergrütze«, meldete sich Missy von der Tür her zu Wort. »Hafergrütze ist ihre Lieblingsspeise. Ganz bestimmt isst sie die. Aber ich bring sie nur mit viel Ahornsirup runter.«
»Nun – Ahornsirup ist jede Menge da, also hast du Glück. Hilfst du deiner Schwester beim Anziehen?« Micah lächelte und machte sich – wobei er das Gefühl von Dringlichkeit zurückkehren spürte, das ihn ergriffen hatte, als der FBI-Kombi mit Heather um die Kurve verschwunden war – auf den Weg zur Küche. Nach ein paar Schritten drehte er um und ging wieder zurück, diesmal jedoch in das dem der Mädchen gegenüberliegende Zimmer. Er hatte es kurz nach Heathers Einzug in der Hoffnung auf ein gemeinsames Kind angebaut, aber bisher waren die Mädchen und das Geschäft immer vorgegangen. Als es kürzlich ein paar Tage hintereinander geschneit hatte, waren die Mädchen auf die Idee gekommen, das Puppendorf aufzubauen, das er für sie geschreinert hatte, und er musste über das Rathaus und die Bibliothek steigen, um zu der Schrankkammer zu gelangen und dann die auf Bügeln hängende Reservekleidung beiseite schieben, um an das dahinter angebrachte Regal zu kommen.
Der Rucksack lag außerhalb der Reichweite der Mädchen ganz rechts auf einem Bord, gut versteckt hinter Kleidungsstücken und den Schachteln mit Weihnachtsschmuck, der vor gar nicht langer Zeit abgenommen worden war. Der braune Rucksack war klein und abgeschabt. Heather hatte ihn seinerzeit mitgebracht. Seines Wissens war er das einzige Überbleibsel aus ihrer Vergangenheit.
Er holte den Rucksack herunter und rückte die Schachteln zurecht, um die entstandene Lücke zu schließen, klemmte ihn sich unter den Arm und ging, ohne sich die Überlegung zu gestatten, was sich darin befinden mochte, durch die Küche in den hinteren Flur. Hier hingen an in verschiedenen Höhen angebrachten Wandhaken Jacken in unterschiedlichen Größen, Hüte, Laternen, Hacken und Schaufeln und ein reparaturbedürftiger, aufgerollter Kunststoffschlauch. Unten auf dem Boden stand aufgereiht ein Sortiment von Schuhwerk, beherrscht von den Schneeschuhen, die sie jeden Tag benutzt hatten, wenn sie den Hügel zum Zuckerahorn hinaufstiegen, um Winterabfall zu entfernen und die Hauptschlauchleitung im Hinblick auf die kommende Saison auf etwaige Beschädigungen hin zu untersuchen.
Jetzt jedoch war sein Ziel nicht der Zuckerahorn. Er stieg in die größten Stiefel der Reihe, zog eine Jacke an und versteckte den Rucksack darin. Für den Fall, dass ihn jemand vom Wald aus beobachtete, hängte er sich den aufgerollten Plastikschlauch über die Schulter. Dann ging er die Hintertreppe hinunter und den viel begangenen, mit festgebackenem Schnee bedeckten Weg zum Zuckerhaus hinauf. Es stand ein paar hundert Meter hügelaufwärts vom Farmhaus entfernt, ein lang gestreckter Steinbau mit einem großen über das Dach hinausragenden glockenförmigen Abzugsschacht für den beim Eindicken des Saftes entstehenden Dampf.
Jetzt stieg kein Dampf auf. Kein süßer Duft lag in der Luft, keine freudige Erwartung. Das Zuckerhaus lag ebenso still da wie der Wald. Still und kalt.
Auch Micah war kalt. Er öffnete die Tür, trat ein, schloss sie hinter sich und ging durch den Hauptraum, an hintereinander gereihtem rostfreien Stahl entlang, in den erst kürzlich fertig gewordenen Anbau, in dem es noch nach frischem Holz roch. Er war Küche – mit einem riesigen Herd, Reihen von Schränken und Regalen und Arbeitstischen für die Herstellung von Candy oder Karamellen – und Büro zugleich. Dort standen Heathers Schreibtisch mit ihrem Computer und mehrere Aktenschränke. Micah legte den Schlauch auf einen Stapel aufgerollter reparierter Schläuche.
In den Hauptraum zurückgekehrt, steuerte er auf das hoch und tief gestapelte Feuerholz am anderen Ende zu. Dies war nur ein Bruchteil dessen, was er im Laufe der Saison brauchen würde. Der Rest lag draußen, jenseits der großen Flügeltür, durch die auf einem eisernen Tiefladewagen, der in Schienen lief, der Nachschub kam. Diesseits der Tür, am hinteren Ende des Stoßes, zog er drei Hölzer auf einmal heraus. Als er dahinter ein stark gebogenes Stück entdeckte, stopfte er den Rucksack davor und legte die drei Scheite zurück. Dann wischte er sich die Hände an seiner Jacke ab und verließ das Zuckerhaus. Wieder im Farmhaus angekommen, rief er Cassie Byrnes an.
Cassie Byrnes war keine Langschläferin. Fünf Stunden genügten ihr, um ihre Batterien aufzuladen, und das war ein Segen, denn sonst hätte sie ihr tägliches Pensum nie und nimmer geschafft. Es war ebenfalls ein Segen, dass ihr Mann und die Kinder morgens erst in letzter Minute aus den Betten fanden, denn so konnte sie auch die frühen Stunden ungestört nutzen.
An diesem Morgen war sie mit städtischen Belangen beschäftigt. Man hatte die Anwältin gerade bei der alljährlichen Wahl zum fünften Mal hintereinander zur Vorsitzenden des Lake Henry Committees bestimmt, was angesichts der Tatsache, dass sie erstens eine Frau und zweitens mit knapp sechsunddreißig wesentlich jünger war als die Herren, die traditionsgemäß die Geschicke der Stadt geleitet hatten, durchaus nicht selbstverständlich war – aber Cassies Tüchtigkeit hatte ihr auch diesmal zum Sieg verholfen. Sie lebte von Geburt an in Lake Henry, war redegewandt und engagiert und verfocht mit Leidenschaft die Umweltthemen, die das Hauptanliegen des Komitees darstellten. Größtenteils ging es dabei um die Seetaucher, die in jedem April aus wärmeren Gefilden zurückkehrten, ihre Nester bauten und bis weit in den November hinein ihre Jungen aufzogen. Im Moment fischten sie selig im Osten im nicht zugefrorenen Küstengewässer, ohne zu wissen, dass Cassie sich auch in ihrer Abwesenheit zumindest indirekt mit ihnen beschäftigte. Viele Leute im Ort, die um die Sauberkeit des Sees besorgt waren, machten sich dafür stark, drei zusätzliche Polizeibeamte, einen Streifenwagen und Testgeräte zur regelmäßigen Überprüfung der Wasserqualität in den Dienst der Sache zu stellen. Unglücklicherweise würde all das Geld kosten. Cassie versuchte derzeit die genaue Summe zu errechnen, damit bei der Bürgerversammlung Ende März hieb- und stichfeste Gründe für eine Anhebung der Grundsteuer vorgelegt werden könnten.
Das Telefon klingelte. Mit einem Blick auf ihre Schreibtischuhr nahm sie den Hörer ab. Halb sieben. Ein Anruf um diese Zeit verhieß nichts Gutes.
»Cassie Byrnes«, meldete sie sich.
»Hier ist Micah.« Seine Stimme klang gepresst. »Heather ist verhaftet worden. Wir brauchen deine Hilfe.«
Cassie blinzelte verwirrt. Die Worte »Heather« und »verhaftet« passten nicht zusammen. »Was sagst du da? Wer hat sie verhaftet?«
»Das FBI. Sie behaupten, Heather sei jemand anderer und habe jemanden umgebracht, bevor sie hierher zog. Sie soll sich ›der Strafverfolgung durch Flucht entzogen haben, wie sie sagten, deshalb haben sie sie festgenommen. Es geht um Mord. Und Erpressung. Sie haben ihr Handschellen angelegt, Cassie! Handschellen! Und Pete war dabei und sagte, es sei alles legal!«
Cassie starrte wie vor den Kopf geschlagen ins Leere. Heather Malone war ihre Freundin. Sie hatten vor knapp zwölf Stunden noch zusammengesessen. Nicht im Traum wäre Cassie auf die Idee gekommen, dass Heather jemals mit dem Gesetz in Konflikt geraten könnte. Aber die Sache war ernst – dafür sprach erstens Micahs Verzweiflung und zweitens die Tatsache, dass die örtliche Polizei an der Aktion beteiligt gewesen war.
Entschlossen machte sie ihren Kopf frei von privaten Gedanken und der Arbeit, über der sie gesessen hatte, und griff nach ihrem Aktenkoffer. »Es mag legal sein, aber das heißt nicht, dass die Beschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Ich kenne Heather nicht erst seit gestern.« Sie stand auf und knipste die Schreibtischlampe aus. »Wo haben sie sie hingebracht?«
»Nach Concord, wenn ich das richtig verstanden habe. Dort soll heute Vormittag eine Verhandlung stattfinden.« »Nicht ohne mich«, erklärte Cassie entschieden. »Ich werde mich erkundigen, wo genau sie ist, und dann fahren wir beide zu ihr. Hol mich in fünfzehn Minuten ab.« »Bis gleich.«
*
Seit Micah und Heather zusammen waren, hatte es noch keinen einzigen Tag gegeben, an dem er jemand anderen für die Betreuung seiner Töchter hätte finden müssen. Doch nun musste er es – und er brauchte nicht lange zu überlegen. Von all den Menschen, die er und Heather als Freunde bezeichneten, brachte er diesem das größte Vertrauen entgegen.
Kapitel 2
Poppy Blake war schon eine ganze Weile wach. Sie lag auf der Seite, mit dem Gesicht zur Fensterwand. Hätte jemand ins Zimmer geschaut, hätte er angenommen, dass sie zusah, wie der Morgen über dem See heraufdämmerte, denn der Anblick war wirklich atemberaubend. Unberührter Schnee lag auf dem halbmeterdicken Eis. Hohe Hem- locktannen und Kiefern ragten auf den im See verstreuten Inselchen und am dahinterliegenden Ostufer schattenhaft in den Himmel. Als der Tag anbrach, die Sonne hinter ihnen aufstieg, schimmerte zartgelbes Licht durch die Bäume. Im Sommer, wenn Ahorn, Buchen und Birke Laub trugen, sah man die Sonne nicht aufgehen, doch im Winter, wenn man sie am sehnlichsten herbeiwünschte, war sie sofort da.
Poppy nahm nichts davon wahr. Sie befand sich in einer anderen Welt, wo man Fehler aus der Vergangenheit ungeschehen machen und von vorne anfangen konnte. In jener Welt lag sie nicht allein im Bett, sie wohnte nicht in einem ebenerdigen Haus, und das Kinderzimmer war nicht mit Trainingsgeräten ausgestattet, die sie brauchte, um ihren Oberkörper kräftig zu erhalten und ihre unteren Gliedmaßen vor Muskelschwund zu bewahren. Und in ihrer Traumwelt stand kein Rollstuhl neben ihrem Bett.
Poppy konnte die Beine nicht bewegen. Schon seit zwölf Jahren nicht. Seit dem Unfall mit dem Schneemobil. In diesen zwölf Jahren hatte sie alles gelernt, was man über das Leben als Querschnittsgelähmter wissen muss, wobei die wichtigste Lektion gewesen war, das Beste daraus zu machen, da die Uhr sich nun einmal nicht zurückdrehen ließ. Nur, indem sie ihre Behinderung akzeptierte, konnte sie ein befriedigendes Leben führen.
Trotzdem gestattete sie es sich, hin und wieder zu träumen. Heute rankten sich ihre Phantasien um einen Mann, den sie nur ein paarmal gesehen hatte. Er war einen Meter fünfundsiebzig groß, hatte rote Haare, blaue Augen und einen sexy Bariton, den sie eine Zeit lang sehr oft am Telefon gehört hatte. Bis vor einem Monat hatte der Mann sie regelmäßig angerufen, doch seitdem war Funkstille. Sie hatte ihn immer wieder zurückgewiesen, denn was hätte er schließlich mit einer Frau im Rollstuhl anfangen sollen? Offenbar war es ihm zu dumm geworden, gegen die Mauer anzurennen. Oder er hatte sich ihrer Meinung angeschlossen.
Das Telefon an ihrem Bett klingelte. Es war ihr Privatapparat, über eine andere Nummer zu erreichen als die große, komplizierte Anlage im Nebenzimmer, mit der Poppy ihren Lebensunterhalt verdiente. Sie betrieb einen Telefondienst für Lake Henry und die Nachbarorte und saß einen Großteil des Tages an ihrem Schaltpult, stellte Verbindungen her, nahm Mitteilungen für die Leute im Ort entgegen, unterhielt sich mit Anrufen und gab Informationen weiter. Ihre Familie und Freunde riefen sie häufig auf der Privatleitung an, aber niemals zu nachtschlafender Zeit. Ein Anruf zu dieser frühen Stunde konnte nichts Gutes bedeuten.
In den Sekunden, die sie dafür brauchte, die Kissen beiseite zu schieben, sich auf die andere Seite zu drehen und nach dem Hörer zu greifen, quälte sie die Angst, dass ihre Mutter krank geworden sei, aber dann erkannte sie an der Nummer auf dem Display, dass sie nicht aus Florida angerufen wurde, wo Maida die ersten drei Monate des Jahres verbrachte, sondern von hier aus dem Ort. Von Heather, um genau zu sein.
»Hey du«, meldete sie sich in fragendem Ton, denn es wunderte sie, dass ihre Freundin sie so früh sprechen wollte, schließlich hatten sie den gestrigen Abend miteinander verbracht.
Aber es war nicht Heather, die sie sprechen wollte.
»Hier ist Micah.« Er klang gehetzt. »Es gibt Probleme.« Danach überstürzten sich seine Worte, ergaben keinen Sinn für Poppy – bis er sagte: »Kannst du die Mädchen zur Schule fahren – und Star ein bisschen beruhigen? Ich mache mir Sorgen um sie.«
Poppy sah im Geist das kleine Mädchen mit den langen, seidigen Haaren vor sich, die das blasse Gesicht mit den tief liegenden, dunklen Augen umrahmten. Sie liebte Micahs beide Töchter, aber Star hatte etwas an sich, was ihr Herz in besonderer Weise rührte. »Natürlich kann ich das. Aber was ist denn überhaupt los«, fragte sie verwirrt. »Hast du tatsächlich gesagt, Heather soll jemand anderer sein?« »Ich sage das nicht – das FBI sagt das.«
»Und sie soll einen Mann getötet haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind befreundet, seit sie hier wohnt. Sie hat mir nach dem Unfall beigestanden, und ich hätte mir niemand aufopfernderen und verständnisvolleren wünschen können. Heather könnte nicht einmal töten, wenn ihr Leben davon abhinge.«
»Das habe ich ihnen auch gesagt – aber meine Stimme zählt nicht. Wir sind in fünf Minuten da, okay?«
»Ich erwarte euch vor der Tür.«
Und das tat sie. Poppy hielt nichts von Make-up und eleganter Kleidung. Auch vor dem Unfall hatte sie sich nur zu festlichen Anlässen dazu überwunden, sich »fein« zu machen, wie ihre Mutter das nannte. Als Kind hatte sie sich fügen müssen, doch später, als rebellischem Teenager, war es ihr ein großes Vergnügen gewesen, Maida in Form einer bewussten Unscheinbarkeit zu trotzen. Heutzutage steckte keine Rebellion mehr dahinter, dass sie sich nicht schminkte und modisch kleidete, sondern ihr Sinn fürs Praktische. An diesem Morgen gestattete sie sich in ihrem rollstuhlgerecht eingerichteten Bad lediglich eine Katzenwäsche. Sehr viel mehr Zeit verwendete sie darauf, ihre Beine hochzulegen und die schafwollgefütterten Stiefel anzuziehen, damit ihre Füße nicht kalt würden, denn spüren könnte sie das ja nicht.
Während sie kurz darauf mit einem dicken Parka um die Schultern die Scheinwerfer von Micahs Pick-up näherkommen sah, fuhr sie sich schnell noch mit den Fingern durch ihr streichholzkurzes Haar. Die Straße war schmal, aber asphaltiert. Letzteres eines der Zugeständnisse, zu denen Poppy sich bereitgefunden hatte, als ihre Eltern kurz nach dem Unfall einen Keil von ihrem Grundstück abgeteilt und ihrer Tochter ein Haus darauf gebaut hatten. Eine direkte Verbindung zu ihnen hatte sie abgelehnt, um sich wenigstens eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, und stattdessen die längere Zufahrt zur Hauptstraße gewählt. Das Angebot, sie asphaltieren zu lassen, hatte sie aus Sicherheitsgründen akzeptiert, denn bei schlechtem Wetter hätte sich der Weg sonst in eine tückische Schlammstrecke verwandelt. Trotzdem war er an manchen Wintertagen nicht ungefährlich. Der vor drei Tagen gefallene Schnee war zwar weggeräumt und anschließend war Sand gestreut worden, doch heute Morgen schimmerte Eis auf dem Asphalt.
Der Neigungswinkel der von der Veranda nach unten führenden Rampe war sehr flach, doch aus Sicherheitsgründen war sie beheizt – an der Unterseite liefen Heizschlangen entlang -, was im Winter sehr hilfreich war.
Als der Pick-up am Fuß der Rampe hielt, war auch Poppy dort angekommen.
Micah sprang aus dem Führerhaus, hochgewachsen, kräftig gebaut und, wie meistens, ohne Kopfbedeckung. Allerdings war sein Haar dick, und er trug es länger als hier auf dem Land üblich, und so nahm Poppy an, dass ihm damit ausreichend warm war. Gekleidet war er in ausgebleichte Jeans, Arbeitsstiefel und eine karierte Holzfäller Jacke, nicht zugeknöpft, die aufsprang, als er um die Kühlerhaube ging, und ein Thermohemd zum Vorschein brachte. Er öffnete die Beifahrertür und hob die Mädchen heraus. Beide trugen leuchtend bunte Parkas und Rucksäcke.
»In den Rucksäcken ist was zu essen«, sagte er zu Poppy. »Heather hat die Brote schon gestern Abend gemacht. Das tut sie immer am Abend zuvor ... immer ... für alle Fälle ...« Er brach ab und sah plötzlich bestürzt aus, als sei etwas, was er bisher als fürsorglich, sogar lobenswert, betrachtet hatte, es gar nicht.
Was er damit andeutete, war natürlich, dass Heather damit gerechnet hatte, eines Tages abgeholt zu werden, was Poppy jedoch nicht glauben konnte. Und so schickte sie ihn mit einer Kopfbewegung in Richtung Hauptstraße fort. »Fahr los und kläre diesen unsäglichen Irrtum auf.« Sie nahm Missy den Rucksack, den das Kind ihr hinstreckte, aus der Hand, als Missy sich an ihr vorbei hinter den Rollstuhl schob, um ihn ins Haus zurückzuschieben. Dann streckte sie die Arme nach Star aus, die sich mit herzzerreißend traurigem Gesicht an ihren Vater drückte. Poppy musste mehrmals mit den Händen auf ihren Schoß klopfen, bis das kleine Mädchen endlich zu ihr kam.
»Ich danke dir vielmals,« murmelte Micah und sah seine Töchter plötzlich so erschrocken an, dass Poppy klar wurde, dass er erst in diesem Moment darüber nachzudenken begann, welche Konsequenzen sich aus Heathers Verhaftung ergeben könnten.
»Mach dir keine Gedanken – sie sind gut aufgehoben,« versicherte Poppy ihm. Es dauerte noch ein paar Sekunden, bis er sich losreißen konnte und in seinen Pick-up stieg. Poppy hatte Star auf dem Schoß sitzen, und zu dritt schauten sie dem Wagen nach. »Na, diesen Staffelstab haben wir ja reibungslos übernommen,« sagte lächelnd Poppy, als er ihren Blicken entzogen wurde.
»Was ist ein Staffelstab?«, fragte Missy.
»So etwas wie ein runder kurzer Stock,« erklärte Poppy. »Man benutzt ihn beim Staffellauf, einem Wettkampf, bei dem mehrere Mannschaften gegeneinander laufen, wobei der Läufer einer Mannschaft, einer Staffel, nach Durchlaufen seiner Strecke dem nächsten, nachfolgenden Läufer seinen Staffelstab übergibt und so weiter und so weiter. Der letzte Staffelläufer trägt den Stab dann durchs Ziel. Schieb mich hoch, Missy.« Sie half mit einer Hand mit. Den anderen Arm hatte sie um Star gelegt. Sie beugte sich zu der Kleinen vor. »Habt ihr gefrühstückt?«
»Wir wollten, aber dann war keine Zeit mehr«, antwortete Missy von hinten.
»Daddy hat’s vergessen«, sagte Star.
»Daddy geht heute viel im Kopf herum«, sagte Poppy. »Aber ich habe nur euch im Kopf, und außerdem liebt ihr meine Küche doch.« Sie drückte Star fest an sich, während sie die Rampe hinauf, durch die Haustür und den Flur entlang zu der besagten Küche fuhr. Die Einrichtung war höhenmäßig auf ihre Behinderung zugeschnitten, also entsprechend niedriger gehalten als üblich, und überall gab es Drehteller. Für Poppy stellten sie eine Notwendigkeit dar, für die Mädchen Spielzeuge.
Poppy brannte darauf, mehr über die Ereignisse des Morgens zu erfahren, die ihr regelrecht bizarr erschienen, doch natürlich hütete sie sich, die Kinder darauf anzusprechen. Ungezwungenheit lautete das Gebot der Stunde, und so tat sie, als sei alles in bester Ordnung. Während sie Waffeln toastete und sie danach mit Butter und Ahornsirup aus Micahs letztjähriger Produktion bestrich, redete sie mit den Mädchen über die Schule, über den Schnee und die bevorstehenden Ice Days, doch das einzige Echo kam von Missy. Star blieb schweigsam und wich Poppy nicht von der Seite. »Alles okay?«, fragte Poppy sie von Zeit zu Zeit und bekam jedes Mal ein Nicken zur Antwort, doch die Miene der Kleinen ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich um Heather sorgte.
Poppy hätte ihr gerne gesagt, es geht ihr gut, sie ist bald wieder da. Es ist alles ein Irrtum. Daddy wird die Sache in Ordnung bringen. Doch sie sagte nichts davon – weil sie nichts wusste. Das wurmte sie. Bis heute hatte sie geglaubt, den Finger am Pulsschlag von Lake Henry zu haben – aber das hier hatte sie völlig überrascht. Sie fragte sich, ob irgendjemand in der Stadt es hatte kommen sehen.
Je länger sie darüber nachdachte, umso ärgerlicher wurde sie, denn ihre Gedanken gingen über die simple Tatsache einer Verhaftung hinaus. Sie war der festen Überzeugung, dass Heather nicht getan hatte, was man ihr zur Last legte – aber irgendjemand hatte mit dem Finger auf sie gezeigt. Wäre es um jemand anderen gegangen, hätte Poppy vielleicht Rache, Eifersucht oder einen sonstigen Groll als Motiv erwogen – doch es ging um Heather. Alle mochten Heather. Und sie mochten Micah, der, wenn auch etwas eigenbrötlerisch, so doch ein Einheimischer war, »einer von ihnen«. Allein die Tatsache, dass Heather zu seinem Leben gehörte, garantierte ihr die Loyalität der Einwohner von Lake Henry. Deshalb bezweifelte Poppy entschieden, dass der Verräter in ihren Reihen zu suchen war. Es musste jemand von außerhalb sein. Drei Monate zuvor war Lake Henry der Schauplatz eines Medienzirkusses gewesen – wegen eines Vorfalls, in den Poppys Schwester verwickelt war und Poppy hatte den starken Verdacht, dass jemand aus diesem Verein für diese Nacht-und-Nebel-Aktion verantwortlich war.
Doch auch darüber konnte sie mit den Mädchen natürlich nicht sprechen. Und so wusch sie ihnen scheinbar heiter den Sirup von ihren Händen und Mündern, half ihnen, ihre Parkas wieder anzuziehen und zog ihren eigenen an. Draußen ließ sie sie mit dem Lift in den brandneuen Blazer fahren, den Maida ihr zum Beginn des Winters buchstäblich aufgezwungen hatte. Er war klatschmohnrot und ihren Bedürfnissen angepasst. Die Mädchen saßen zum ersten Mal darin, und Missy ließ sich jeden Knopf, Schalter und Hebel erklären. Star schwieg auch jetzt, hörte jedoch aufmerksam zu. Nachdem Missys Wissensdurst gestillt war, sorgte Poppy dafür, dass die Kinder sich korrekt anschnallten, fuhr sie zur Schule und umarmte sie zum Abschied.
Kaum war die große schwere Tür hinter ihnen zugefallen, rief sie über Handy bei John Kipling an. Er war zwar in Lake Henry aufgewachsen, hatte jedoch den Großteil seines Lebens außerhalb verbracht. Da er die Stadt mit fünfzehn verlassen hatte und zehn Jahre älter war als Poppy, hatte sie ihn erst bei seiner Rückkehr vor drei Jahren richtig kennen gelernt, und inzwischen waren sie nicht nur gute Freunde, sondern seit knapp sechs Wochen sogar Verwandte, denn John hatte am Neujahrstag Poppys Schwester Lily geheiratet.
Aber Poppy rief ihn an diesem Morgen weder als Freund noch als Schwager an. Er war der Redakteur der Lokalzeitung, und Poppy wollte ihn vor ihren Karren spannen.
Da es erst halb acht war, versuchte sie es zunächst in dem Haus am See, das Lily von ihrer Großmutter Celia St. Marie geerbt hatte. Das Häuschen war etwas kleiner als das ein Stück uferabwärts gelegene von John, aber es hatte eine Geschichte, und so war er dort eingezogen. Die beiden planten einen großen Anbau, und sie hatten Micah gebeten, ihn nach dem Sirupmachen hochzuziehen. Aufgrund ihrer Bekanntschaft würde John sich also nicht nur als Journalist für das Drama um Heather interessieren.
Niemand nahm den Hörer ab, was bedeutete, dass John entweder in Charlie’s Café beim Frühstück oder bereits an seinem Schreibtisch saß.
Sie fuhr zuerst bei Charlie’s vorbei. Der General Store und das angrenzende Café boten mit den Schneemützen auf ihren roten Schindeldächern einen fröhlichen Anblick. Aus dem dicken Backsteinkamin stieg eine Rauchsäule auf, und eine Mischung aus Speck- und Birkenholzduft wehte durch das spaltbreit geöffnete Fahrerfenster in den Blazer.
Drei Männer standen vor dem Café beieinander. Sie unterhielten sich, die Schultern hochgezogenen und die Kragen ihrer dunklen Wolljacken zum Schutz gegen die Kälte aufgestellt, von weißen Atemwolken begleitet. Als Poppy langsam vorbeifuhr, schauten sie herüber und winkten ihr zu. Sie erwiderte den Gruß. Da Johns Tahoe nicht zu sehen war, ließ sie den Blazer weiterrollen. Gleich darauf entdeckte sie den Geländewagen vor dem gelb gestrichenen viktorianischen Gebäude, das hinter dem Postamt an dem verschneiten See lag. Dort schlug das Herz der Lokalzeitung.
Wäre Sommer gewesen – oder Frühling oder Herbst -, hätte Poppy angehalten und persönlich mit John gesprochen, aber jetzt war Winter, und das Ein- und Aussteigen auf vereisten Wegen oder nicht freigeschaufeltem Gelände riskant. Außerdem wollte sie möglichst schnell nach Hause an ihren Arbeitsplatz. Also telefonierte sie der Einfachheit halber, tippte die Nummer der Lake News ein und fuhr weiter.
»Kipling«, meldete sich John mit der geistesabwesenden Stimme, die er immer hatte, wenn er in die Lektüre des Wall Street Journal, der New York Times oder der Washington Post vertieft war.
»Hier ist Poppy«, sagte sie ins Mikro und kam sofort zur Sache. »Weißt du, was da läuft?«
»Hey, Süße.« Jetzt war sein Ton heiter. »Nein. Was soll laufen?«
»Du weißt es wirklich nicht?«
»Äh ... wir haben verschlafen«, gestand er eine Spur verlegen. »Ich bin erst seit ein paar Minuten hier.«
Poppy konnte sich vorstellen, warum die beiden verschlafen hatten, und der Gedanke, bei dem sie einen Anflug von Neid verspürte, war nicht dazu angetan, ihre Stimmung zu bessern. »Hat dich noch niemand angerufen?«, fragte sie.
»Das müsstest du doch wissen.«
»John!«
»Nein. Es hat mich noch niemand angerufen.« Jetzt klang er besorgt. »Was ist mir entgangen?«
»Eine bodenlose Schweinerei!«, schnauzte sie ihn an, als sei das Ganze seine Schuld. Dann nahm sie sich zurück und informierte ihn im Telegrammstil über die dramatischen Ereignisse des frühen Morgens. »Heather ist der letzte Mensch, dem ich zutrauen würde, unter einem falschen Namen zu leben oder einen Mord zu begehen!«, sagte sie aufgebracht. »Aber irgendjemand behauptet, dass sie genau das getan hat, und ich fahre hier am See entlang und überlege, wer es gewesen sein könnte. Aus Lake Henry war es bestimmt niemand, denn alle lieben sie, und selbst, wenn sie auch das nicht täten – sie lieben Micah. Und selbst, wenn sie auch das nicht täten, würde keiner einem aus der Gemeinde was am Zeug flicken, weil er viel zu viel Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen der Übrigen hätte. Darum glaube ich, dass es einer von den Medienfuzzis gewesen sein muss, die sich im letzten Herbst bei uns rumtrieben, als diese scheußliche Geschichte Lily ihren Gott sei Dank nur kurzen, unerwünschten Ruhm bescherte – und diese Typen sind deine Freunde ...«
»Das sind sie nicht!«, protestierte John. »Aber du hast mich jetzt so mit Fakten zugeschüttet, dass ich nur die Hälfte verstanden habe. Noch mal von vorne. Was ist mit Heather?« Poppy bremste, als ein Stück weiter vorne ein Reh über die Fahrbahn setzte, und schaute ihm nach, wie es mit wippender Blume graziös über die vom Schneepflug an den Straßenrand geschobene weiße Mauer sprang und mit federnden Sprüngen im Wald verschwand. »Sie wurde vom FBI festgenommen. Viel mehr weiß ich auch nicht. Micah brachte die Mädchen zu mir und fuhr dann Cassie abholen. Sie wollen den Feds hinterherfahren. Wohin, weiß ich nicht.«
»Nach Concord. Die Feds gehen zum Bundesgericht, und das nächste ist in Concord.«
Poppy gab wieder Gas und umklammerte mit beiden Händen das Lenkrad – allerdings nicht, weil sie fürchtete, ins Schleudern zu geraten, denn die Straße war tadellos geräumt. »Bundesgericht.« Das Wort schmeckte bitter. »Heather vor dem Bundesgericht. Das will mir nicht in den Kopf.«
»Weil du von ihrer Unschuld überzeugt bist.«
»Du vielleicht nicht? Denk nach! Hattest du bei irgendeiner Begegnung mit ihr das Gefühl, dass sie etwas zu verbergen hatte?«
»Nein. Aber ich bin auch nie auf die Idee gekommen, dass sie eine pathologische Lügnerin sein könnte. Wenn sie das wäre, könnte sie uns alle zum Narren gehalten haben. Pathologische Lügner sind erstaunlich überzeugend.« »Heather ist grundehrlich!«, fuhr Poppy auf. »Alle vertrauen ihr. Frag Charlie – er hat einen guten Blick für Menschen. Sonst hätte er sie wohl kaum so schnell von der Köchin zur Geschäftsführerin des Cafés befördert. Zum Teufel, Kip – er vertraut ihr das Lokal und alles, was damit zusammenhängt, an, wenn er mit Annette und den Kids wegfährt. Würde er das tun, wenn er sie für unehrlich hielte?« Poppy lenkte den Blazer nach rechts, als ihr ein alter Kombi entgegenkam. Am Steuer saß der Posthalter, Nathaniel Roy. Er war zwar schon fünfundsiebzig und trug eine Brille mit dicken Gläsern, aber er kannte Poppys Blazer und war auf seine alten Tage noch so spontan, dass er geblinkt hätte, wenn er sie zum Anhalten hätte bringen wollen. Dass er ihr nur zuwinkte und weiterfuhr, bedeutete, dass auch er noch nichts von Heathers Verhaftung wusste.
»Poppy – du rennst bei mir offene Türen ein«, sagte John. »Ich bin ja deiner Meinung – aber andererseits kennen wir Heather nicht ihr ganzes Leben lang.«
»Dich kennen wir auch nicht ein ganzes Leben lang«, erwiderte Poppy. »Und Lily ebenfalls nicht. Ihr wart beide jahrelang weg.«
»Aber wir wurden beide hier geboren.«
»Und du verurteilst Heather, weil sie nicht hier geboren wurde?«
»Poppy, Poppy«, seufzte John. »Ich verurteile sie nicht. Ich stelle nur Überlegungen an, die andere Leute auch anstellen werden.«
Poppy hätte gerne dagegen aufbegehrt, doch sie wusste, dass er Recht hatte. »Also gut – lassen wir das. Kannst du ein paar Telefonate führen? Rausfinden, wo sie ist? Versuchen, den Topf am Überkochen zu hindern? Ich möchte nicht, dass die Geschichte sich wiederholt. Wie bei Lily. Auch sie wurde zu Unrecht beschuldigt, und das Resultat kennst du. Zwei Jobs verloren, Wohnung in Boston aufgeben müssen und von den Medien in Stücke gerissen.« »Und das Resultat vom Ganzen, dass sie sich in mich verliebte«, merkte John an.
»Aber Heather liebt Micah bereits – und die Mädchen ebenfalls«, hielt Poppy ihm entgegen. »Sie braucht keine Krise, um zur Besinnung zu kommen. Warum tut ihr jemand das an? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch nur einen einzigen Feind in Lake Henry hat. Und ich möchte zu gerne wissen, wer glaubt, sie erkannt zu haben. Es müsste dich als Zeitungsmann doch reizen, herauszufinden, auf wessen Konto diese Verleumdung geht. Klemmst du dich dahinter?«
»Wenn du nicht willst, dass die Geschichte hohe Wellen schlägt, ist Zurückhaltung angesagt«, erwiderte er. »Sonst geht der Schuss nach hinten los. Zu viele Fragen machen hellhörig. Konzentrieren wir uns lieber erst mal auf das, was heute in Concord abläuft. Ich werde ein paar Leute anrufen. Wenn ich was erfahren habe, melde ich mich bei dir.« Ein paar Sekunden später kam Poppy an der Mauer vorbei, hinter der Blake Orchards lag, der ganze Stolz ihrer Mutter. Die Steine der Mauer sahen wie hüfthohe Schneeklumpen aus, und das Schild hatte eine weiße Flockenkrone auf. Wenn sie durch das Tor und die gekieste Straße entlanggefahren wäre, die zwischen stämmigen Apfelbäumen hindurchführte, die ohne ihr Laub noch kleiner wirkten, wäre sie nach einer halben Meile zum Haus ihrer Mutter gekommen, hinter dem die Mosterei lag. Beides war den Winter über geschlossen.
Und so blieb sie auf der Hauptstraße, die sich einen Hügel hinauf landeinwärts wand und dann wieder an den See zurückführte. Sie bog in ihre Zufahrt ein, hielt vor ihrem Haus, manövrierte mit geübten Bewegungen ihren Rollstuhl aus dem Blazer und machte, dass sie an ihr Schaltpult kam. John hatte bestimmt noch nicht zurückgerufen, aber vielleicht war eine Nachricht von Micah da.
*
Von seinem Platz an der Wand aus konnte Micah mit seinen Einsneunzig fast über alle Köpfe in der Eingangshalle des Gerichtsgebäudes hinwegschauen, und es war allerhand Betrieb. Die Anwälte hoben sich durch ihre Anzüge, von denen einige ihre besten Tage bereits hinter sich hatten, von ihrer Umgebung ab. Die Mandantschaft reichte vom schwangeren jungen Mädchen bis zum weißhaarigen Alten, die Kleidung von Highschool-Lässigkeit bis zum legeren Landlook, von konservativer Eleganz über Hinterwäldler-Sonntagsstaat bis zum Öko-Outfit. Aber gemeinsam war allen Mandanten ihr Ausdruck: Sie waren unglücklich.
Und das war Micah auch. Er hätte jetzt eigentlich oben beim Zuckerahorn sein und die Hauptschlauchleitung auf neue Schäden überprüfen sollen. Das tat er immer mit Heather gemeinsam. Natürlich konnte er es auch allein, aber er hatte sie eben gerne bei sich. Alles in ihm wehrte sich dagegen, stattdessen hier zu sein, aber es war nicht zu ändern. Cassie hatte ihm gesagt, er solle auf sie warten, und so wartete er, die Fäuste tief in den Taschen seiner Holzfällerjacke vergraben, jeden Muskel im Körper angespannt und die Zähne so fest zusammengebissen, dass seine Kieferknochen schmerzten. Er wollte Heather wiederhaben und mit ihr nach Hause fahren. Das war alles, was er sich wünschte. Heather wiederhaben und nach Hause fahren. Nachdem er, umspült vom gedämpften Stimmengewirr in der Halle, eine halbe Ewigkeit regungslos verharrt hatte, sah er Cassie aus einem Zimmer am anderen Ende kommen. Mit ihren langen Beinen und den blonden Ringellocken war sie in dem dunklen Hosenanzug und der weißen Seidenbluse ein echter Hingucker, doch dass Micahs Puls bei ihrem Anblick schneller schlug, hatte nichts mit ihrer Attraktivität zu tun. Er empfand Achtung für Cassie, aber das Einzige, was ihn an ihr interessierte, war ihr anwaltliches Können.
Als sie bei ihm ankam, sagte sie nichts, sondern bedeutete ihm nur, ihr zu folgen. Sie gingen einen Flur hinunter und bogen um eine Ecke. Cassie blieb vor einer Tür stehen, in deren obere Hälfte eine Milchglasscheibe eingelassen war, klopfte leise an und drehte an dem Knauf.
Micah hatte erwartet, Heather in dem Zimmer vorzufinden, doch außer einem alten, reichlich mitgenommenen, leeren Schreibtisch und zwei ebenso mitgenommenen Metallstühlen war es leer.
»Wo ist sie?«, fragte er.
»Offenbar noch unterwegs.« Cassie legte ihren Aktenkoffer auf den Schreibtisch. »Die Situation ist folgende: Es wird in Kürze eine Anhörung stattfinden. Es ist keine Anklage, nur eine Anhörung vor einem Richter, bei der die Feds ihren Haftbefehl vorlegen, den fraglichen Haftbefehl, in dem Heather zur Last gelegt wird, sich durch Flucht der Strafverfolgung entzogen zu haben. Heather braucht sich nicht zu äußern.«
Die Tür öffnete sich.
Micah zerriss es fast das Herz, als Heather von einem Wachmann hereingeschoben wurde. Sie war leichenblass und sah noch verängstigter aus als am Morgen zu Hause. Ihre silbergrauen Augen klammerten sich hilfesuchend an seine.
Er dachte daran, dass er nichts über ihre Vergangenheit wusste, und an den Rucksack, den er versteckt hatte, und an das, was der FBI-Agent gesagt hatte. Wir haben Beweise dafür, dass ihr richtiger Name Lisa Matlock lautet und dass sie vor fünfzehn Jahren in Kalifornien einen Mann getötet hat. Wenn das der Wahrheit entspräche, würde es die Angst in ihren Augen erklären.
Aber wenn sie zu Unrecht beschuldigt würde und sich machtlos der polizeilichen Gewalt ausgeliefert sähe, wäre auch das eine Erklärung.
Er entschloss sich, an Letzteres zu glauben. Mit zwei großen Schritten war er bei ihr, zog sie in seine Arme und drückte ihr Gesicht an seine Brust, um die angstvollen Augen nicht mehr sehen zu müssen. Aber er spürte, wie sie zitterte, und das war fast genauso schlimm. Seine Heather war immer die Ruhe selbst gewesen und so selbstbewusst, wie es eine Fremde in der eingeschworenen Gemeinde von Lake Henry sein konnte.