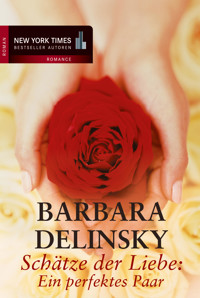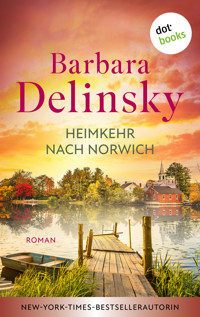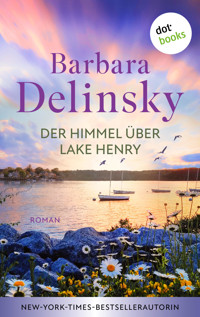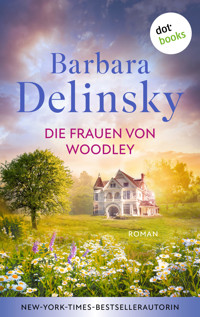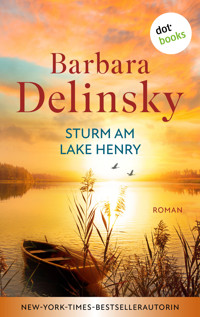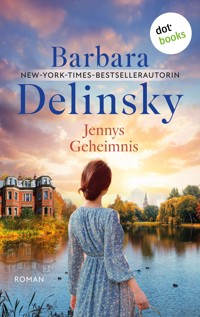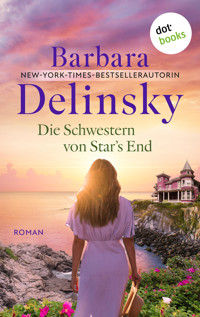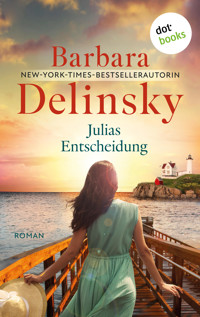
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Insel der neuen Hoffnung: Der bewegende Schicksalsroman »Julias Entscheidung« von Barbara Delinsky jetzt als eBook bei dotbooks. Eine Insel vor der Küste von Maine – ein einziger Moment, der das ganze Leben verändert. Wie kann es danach weitergehen? Diese Frage stellt sich Julia jeden Tag, seitdem sie einen furchtbaren Bootsunfall überlebte. Hinter ihr liegt ein perfektes Leben – aber nur deshalb perfekt, weil Julia stets alles dafür geopfert hat, andere glücklich zu machen: ihre kontrollsüchtigen Eltern und ihren Ehemann, der sich für Julia schon seit langem wie ein Fremder anfühlt. Muss sie nicht alles daransetzen, nie wieder einen Tag voller Leere und Belanglosigkeit verstreichen zu lassen? Von neuem Mut erfüllt, beschließt Julia, dem rätselhaften Band nachzuspüren, das sie nach dem Unfall mit den beiden anderen Überlebenden verbindet: dem verschlossenen Fischer Noah und der jungen Kim, die seitdem kein Wort mehr spricht … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Roman »Julias Entscheidung« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird alle Fans von Nicholas Sparks und Nora Roberts begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Insel vor der Küste von Maine – ein einziger Moment, der das ganze Leben verändert. Wie kann es danach weitergehen? Diese Frage stellt sich Julia jeden Tag, seitdem sie einen furchtbaren Bootsunfall überlebte. Hinter ihr liegt ein perfektes Leben – aber nur deshalb perfekt, weil Julia stets alles dafür geopfert hat, andere glücklich zu machen: ihre kontrollsüchtigen Eltern und ihren Ehemann, der sich für Julia schon seit langem wie ein Fremder anfühlt. Muss sie nicht alles daransetzen, nie wieder einen Tag voller Leere und Belanglosigkeit verstreichen zu lassen? Von neuem Mut erfüllt, beschließt Julia, dem rätselhaften Band nachzuspüren, das sie nach dem Unfall mit den beiden anderen Überlebenden verbindet: dem verschlossenen Fischer Noah und der jungen Kim, die seitdem kein Wort mehr spricht …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Sturm am Lake Henry«
»Im Schatten meiner Schwester«
Weitere Romane sind in Planung.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The Summer I Dared« bei Scribner, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2004 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-671-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Julias Entscheidung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Julias Entscheidung
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Prolog
Die Amelia Celeste war als Hummerboot geboren worden. Eine elegante Lady, stolze zwölf Meter Mahagoni und Eiche, vom anmutig geschwungenen Bug über das Vordeck zum Ruderhaus und in einer geraden Linie bis zum Heck. Gemäß dem Grundsatz, dass die Hummerfischer von Maine ihre Boote ebenso liebevoll behandeln wie ihre Ehefrauen, war die Amelia Celeste von Matthew Crane ebenso verhätschelt worden wie die Amelia Celeste aus Fleisch und Blut, mit der er vierzig Jahre verheiratet gewesen war und auf deren Grab er noch heute, zwölf Jahre nach ihrem Tod, jeden Freitag ein Dutzend langstielige Rosen legte.
Matthew war begütert. Sein Großvater hatte ein Vermögen mit Holzfällen gemacht, nicht nur in den riesigen Wäldern von Maines Norden, sondern auch auf den Inseln im Golf, auf denen es mehr Bäume gab als Granit. Auf einer dieser immergrünen Inseln mit Namen Big Sawyer hatte er ein Einfamilienhaus gebaut. Zwei Generationen später waren Crane-Nachkommen gleichermaßen unter den Fischern wie unter den Künstlern vertreten, aus denen der Kern der ansässigen Inselbewohner bestand.
Matthew war Fischer und trotz des Familienvermögens im Herzen ein einfacher Mann geblieben. Seit seinem sechzehnten Geburtstag liebte er es, im Morgengrauen hinauszufahren und Hummerfangkörbe aus den fruchtbaren Wassern der Penobscot Bay heraufzuholen. Purist, der er war, hielt er auch an den hölzernen Fallen fest, als schon alle anderen aus der örtlichen Flotte die aus Eisendrahtgeflecht gefertigten benutzten. Ebenso wäre er eher gestorben, als sein verlässliches Holzboot gegen ein Fiberglasboot einzutauschen, das leichter und schneller wäre. Geschwindigkeit war Matthew nicht wichtig. Er handelte nach der Überzeugung, dass es im Leben darum ging, etwas zu »tun«, und nicht darum, es »erledigt« zu haben. Und gegen das Argument, ein leichteres Boot verbrauche weniger Treibstoff, führte er ins Feld, dass in einem Metier, wo kein Tag dem anderen glich, das Meer innerhalb von Minuten sich verändern und urplötzlich zwei Männer, die gerade Hummerfallen über die Reling steuerbords heraufzogen, aus dem Gleichgewicht bringen konnte, die Stabilität der Amelia Celeste Gold wert sei. Und dann war da noch der Lärm. Holz war ein natürlicher Schallisolator. Auf der Amelia Celeste war es so still, wie es auf einem Fiberglasboot niemals sein könnte, und still bedeutete, dass man die Möwen hören konnte, die Kormorane, den Wind und die Wellen. Diese Dinge spendeten ihm Seelenfrieden.
Verlässlichkeit, Stabilität und Seelenfrieden - drei gute Gründe dafür, dass Matthew, als er gegen die fünfundsechzig ging und die Arthritis in seinen Händen sich derart verschlimmerte und er daher seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, sein Boot mit einem neuen Motor und Tanks ausstattete, das Ruderhaus mit seitlichem Windschutz versah, über dem mittleren Fenster einen Nebelscheinwerfer montierte, am Heck Sitzplätze für Passagiere einbaute, das Mahagoni frisch hochglanzlackierte und die Amelia Celeste als Fähre wieder zu Wasser ließ.
In den ersten Jahren ihrer neuen Bestimmung stand Matthew selbst am Ruder. Er fuhr dreimal täglich zum Festland hinüber - einmal morgens, einmal um die Mittagszeit und einmal am Ende des Tages. Autos beförderte er nicht - das tat die Fähre von Maine - und er gab auch keinen Fahrplan heraus, denn wenn ein Insulaner etwas besonders Dringendes zu erledigen hatte, dann stellte Matthew seinen Zeitplan darauf ein. Er verlangte einen nominellen Fahrpreis und nahm es mit dem Kassieren nicht genau. Der Fährdienst war kein Job - er war ein Hobby. Er wollte nur auf dem Boot sein, das er liebte, in der Bucht, die er liebte, und wenn er den Inselbewohnern damit das Leben leichter machte - vor allem während der Wintermonate, wenn die Abgeschiedenheit zur Nervenbelastung werden konnte -, umso besser.
An jenem Dienstagabend Anfang Juni jedoch, als die Idylle durch eine Tragödie zerstört wurde, stand Matthew zu seinem großen Bedauern nicht am Ruder der Amelia Celeste. Sie wurde von Greg Hornsby gesteuert, einem sehr viel jüngeren Vetter von ihm, der seine vierzig Lebensjahre auf dem Wasser zugebracht hatte und ein ebenso geschickter Seemann war wie Matthew. Nein, es fehlte nicht an Erfahrung oder Geschicklichkeit. Und auch nicht an Elektronik. Als Hummerboot war die Amelia Celeste mit Mehrbandfunk, Fischsuchern und Radar ausgerüstet. Als Passagierfähre besaß sie das neueste GPS zur exakten Navigation, doch an diesem Tag sollte das alles nicht helfen.
Tief im Wasser liegend wie alle Hummerboote verließ die Amelia Celeste Big Sawyer um sechs Uhr abends mit der Fotografin, dem Art Director, den Models und der Ausrüstung eines nachmittäglichen Fotoshootings im Inselhafen. Die Sonne war pünktlich zum Beginn der Aufnahmen herausgekommen, ebenso ein Grüppchen Schaulustiger, die See erwärmte sich aber nicht, der Atlantik blieb kalt wie im Juli üblich, und am Spätnachmittag näherte sich eine Warmfront und brachte Nebel mit.
Das war kein Problem. Nebel war in dieser Region ein häufiger Besucher. Ein Hummerfischer, der sich vom Nebel am Ausfahren hindern ließ, war ein Hummerfischer, der seine Rechnungen nicht bezahlen konnte.
Von Greg Hornsby, der die Strecke in- und auswendig kannte, und den Instrumenten gesteuert, umfuhr die Amelia Celeste die Hummerbojen in den Untiefen, die zu schmalen Buchten der Nachbarinseln Little Sawyer, West Rock und Hull Island führten. Nachdem sie in jedem Inselhafen einen Passagier an Bord genommen hatte, setzte sie sich mit gemütlichen zweiundzwanzig Knoten in die Fahrrinne Richtung des etwa sechs* Meilen entfernten Festlandes.
Fünfzehn Minuten später legte die Amelia Celeste in Rockland an, und die Fotografin mit ihren Leuten stieg aus. Acht Passagiere warteten darauf, an Bord gehen zu können, nicht fein angezogen wie diese Stadtmannschaft, sondern in Flanellhemden und Kapuzensweatshirts, Jeans und Arbeitsstiefeln, wie sich jeder vernünftige Inselbewohner bis zum tatsächlichen Sommerbeginn kleidete. Diese acht lebten allesamt auf Big Sawyer, was bedeutete, dass Greg ohne Zwischenstopps nach Hause kommen würde, was ihm sehr recht war. Dienstags gab es im Harbor Grill Steaks, und Greg liebte gegrillte Steaks. Wenn es Ribs im Grill gab, mussten seine Frau und die Kinder zu Hause ohne ihn auskommen. Seine Kumpel reservierten immer eine Nische, und er würde sich zu ihnen gesellen, sobald er die Amelia Celeste ins Bettchen gebrächt hätte.
Er nahm Jeannie Walsh zwei Taschen und einen großen Karton ab und verstaute alles unter einer Bank, während sie übers Schandeck trat. Ihr Mann Evan reichte Greg weitere Taschen hinüber und dann die einjährige Tochter, bevor er selbst an Bord ging. Jeannie und Evan waren Bildhauer. In den Taschen befanden sich Ton, Glasuren und Werkzeuge, und in dem Karton befand sich eine neue Töpferscheibe, alles an diesem Tag in Portland gekauft.
Grady Bartz und Dar Hutter, beide Ende zwanzig, kamen mit der Lässigkeit am Meer aufgewachsener Männer an Bord. Grady arbeitete im Hafen für Foss Fish and Lobster, dem Fischhändler auf der Insel, und kehrte, nur unwesentlich sauberer als sonst aussehend, von einem freien Tag zurück. Dar arbeitete bei Brady’s, im Laden für Fischereibedarf. Als er an Bord war, wuchtete er eine Kiste vom Pier herüber, deponierte sie neben dem Ruderhaus und ging zum Heck, um sich einen Platz zu suchen.
Als Nächster bestieg Todd Slokum die Fähre, dürr und blass, das krasse Gegenteil eines Seemanns. Noch heute, nach immerhin drei Jahren auf der Insel, wurde er grün im Gesicht, sobald er einen Fuß auf die Fähre setzte. Es war viel gemutmaßt worden, doch bis heute wusste niemand wirklich, warum er überhaupt nach Big Sawyer gekommen war. Aber dass Zoe Ballard ein Engel war, ihn eingestellt zu haben, darin waren sich alle einig.
Todd stolperte über das Schandeck, landete mit weichen Knien auf den Planken und taumelte auf die ihm am nächsten stehende Bank zu, wobei sein Blick verlegen über die bereits Anwesenden huschte.
Hutchinson Prine, ein Hummerfischer von Jugend an, war nur eine Spur sicherer auf den Beinen. Hinter seiner Wortkargheit verbarg sich ein wahrer Reichtum an Wissen. Obwohl schon nahe der siebzig, fuhr er noch immer jeden Tag hinaus, jetzt allerdings war sein Platz am Heck. Am Ruder stand sein Sohn. Hutch fühlte sich nicht gut. Er hatte sich in Portland durchchecken lassen, und seiner finsteren Miene nach zu urteilen, hatten die Ärzte ihm nichts Angenehmes mitgeteilt.
»Wie geht’s?«, fragte Greg und bekam keine Antwort. Er streckte die Hand aus, um Hutch an Bord zu helfen, aber der schlug sie weg und bestieg die Amelia Celeste ohne Hilfe. Dichtauf folgte sein Sohn Noah. Zwar größer und intelligenter und ein noch besser aussehender Mann als sein Vater, war er jedoch genauso schweigsam wie er. Er wirkte im Moment wie versteinert, langte aber hinüber, um die Leinen loszumachen.
Die Amelia Celeste war gerade im Begriff abzulegen, als ein Ruf vom Ufer herüberschallte. »Warten Sie! Bitte warten Sie!« Eine schlanke Frau kam die Landungsbrücke heruntergerannt und kämpfte ganz offensichtlich mit gewaltig schwerem Gepäck, das bei jedem Schritt gegen ihren Körper prallte. »Halt, halt, nicht wegfahren!«, flehte sie. »Ich muss mit! Bitte warten Sie!«
Sie war keine Einheimische. Ihre Jeans war sehr dunkel, ihre Bluse sehr weiß, ihr Blazer modisch gesteppt. Die Keilabsätze ihrer Sandalen waren höher, als jede vernünftige Insulanerin Absätze tragen würde, und als wäre das nicht schon eigenartig genug für diese Gegend, waren ihre Finger- und Zehennägel blassrosa lackiert. Die feinen, glatten Haare, die im Wind flatterten, schimmerten in einem Dutzend Blondtönen. Sie war kaum geschminkt, Aufsehen erregend attraktiv und, nach dem Ring an ihrer linken Hand zu urteilen, verheiratet. Ihre große Schultertasche und der prall gefüllte Rucksack waren aus einem wesentlich weicheren Leder als das von den einheimischen Handwerkern verarbeitete.
Es kamen oft Frauen wie sie nach Big Sawyer, aber nicht Anfang Juni und kaum jemals ohne Begleitung.
»Ich muss nach Big Sawyer«, erklärte sie Noah völlig außer Atem, bevor sie ihren Irrtum erkannte und sich an Greg wandte. »Ich hatte mir einen Platz auf der Fünf-Uhr-Fähre reservieren lassen, aber die habe ich verpasst. Man hat mir erlaubt, meinen Wagen für ein, zwei Tage am Ende des Piers stehen zu lassen. Kann ich mit Ihnen zur Insel rüberfahren?«
»Wenn Sie eine Unterkunft haben?«, meinte Greg, denn er wusste, dass sich diese Frage alle an Bord stellten. »Es gibt nämlich keine Hotels bei uns. Nicht einmal eine Frühstückspension. «
»Ich bin die Nichte von Zoe Ballard. Meine Tante erwartet mich.«
Die Worte wirkten wie ein Zauberspruch. Noah nahm ihr die Taschen ab und verstaute sie im Ruderhaus. Dann reichte sie ihm ihren Rucksack und ging an Bord, doch als Evan Walsh aufstand und ihr seinen Platz anbot, schüttelte sie den Kopf und hangelte sich an dem Geländer den engen Gang zum Bug entlang, das Matthew, als er die Amelia Celeste zur Fähre umfunktionierte, angebracht hatte.
Noah holte die Heckleine ein und stieß die Fähre vom Anleger ab. Er sagte etwas zu seinem Vater, doch falls er eine Antwort erhielt, so bekam Greg es nicht mit. Während er langsam den Gashebel nach oben schob, kam Noah am Ruderhaus vorbei, postierte sich auf der anderen Seite des Bugs, Zoe Ballards Nichte gegenüber, verschränkte die Arme und starrte in den Nebel.
Leise und anmutig für ein Boot mit einem so breiten Heck glitt die Amelia Celeste mit zunehmender Fahrt durch den Hafen. Obwohl es erst in zwei Stunden dunkel werden würde, war die Welt durch den Nebel aller Farben beraubt. Nur hier und da brachte die Silhouette eines vertäuten Bootes ein wenig Abwechslung in das fahle Grau, so wie das Klirren eines Eisenhakens in die Stille, doch beides wurde sehr schnell vom Nebel verschluckt. Als sie die granitenen Wellenbrecher hinter sich gelassen hatten, wurde der Seegang stärker und der Radar eingeschaltet. Kleine grüne Punkte auf dem Schirm zeigten, wo sich Boote, Felsen oder Fahrrinnen-Kennzeichnungen befanden. Farbige Bojen hüpften auf dem Wasser unter dem Nebel, signalisierten Hummerfallen auf dem Meeresboden. Die Amelia Celeste umfuhr sie im größtmöglichen Abstand und beschleunigte erst, als sie die sichere Fahrrinne erreicht hatte.
Der Seegang war leicht bis mittel, nicht übermäßig strapaziös für das Boot, auch wenn es tief im Wasser lag, und so war nichts zu hören außer dem leisen Brummen seiner Maschine, dem gleichmäßigen Geräusch der Bugwelle und den gelegentlich ausgetauschten Worten im Achterschiff, ohne Hall. Der Nebel schluckte jeden Schall mit weit offenem Schlund.
Und dann kam irgendwo in der Suppe von Steuerbord ein Brummen wie von einer Hummel, doch kaum wahrgenommen, steigerte es sich zu einem bösen Brummen, das der Nebel, wie vom Besitzer beabsichtigt, nicht zu schlucken vermochte. Besagter Besitzer war Artie Jones, und er hatte sein Boot The Beast getauft, ein in einer von Fischerbooten beherrschten Region berüchtigtes langes Rennboot der Alphamännchen-Sorte, dessen aerodynamischer, violetter Körper über die Wasseroberfläche schoss, angetrieben von Zwillingsmotoren, die es auf beeindruckende eintausendeinhundert PS brachten. Es schaffte mühelos fünfundsiebzig, und dem anschwellenden Brummen der beiden Mercs nach zu urteilen, näherte es sich dieser Geschwindigkeit.
Noah warf Greg einen Was-zum-Teufel-soll-das-Blick zu.
Greg zuckte ratlos mit den Schultern. Der Nebel ließ kein anderes Boot in der Region erkennen, doch auf dem Radarschirm beschrieb The Beast einen weiten Bogen, nachdem es sich von Steuerbord zu einem Punkt achteraus bewegt hatte, kreuzte die letzten Ausläufer des Kielwassers der Amelia Celeste und raste in Richtung Norden davon. Das Heulen der Motoren verlor sich zusehends im Nebel.
Eine Hand auf einer Messingspeiche des Steuerrades, die andere auf dem Gashebel, hielt Greg die Amelia Celeste auf Inselkurs. Die Aussicht auf gegrillte Ribs verdrängte Artie Jones aus seinen Gedanken, bis The Beast wieder zu hören war. Das tiefe Kettensägenbrummen achtern kam eindeutig von diesen Monstermaschinen. Das Rennboot kam zurück. Der Radarschirm bestätigte es.
Greg griff zum Hörer seines UKW-Funksprechgeräts, das auf die von den einheimischen Bootsbesitzern benutzte Frequenz eingestellt war. »Was zum Teufel treiben Sie, Artie?«, rief er verärgert, denn Macho oder nicht, kein Mann, der seine Sinne beieinander hatte, würde im Nebel mit einem anderen Boot Fangen spielen.
Artie antwortete nicht. Das Heulen der Motoren schwoll an.
Greg betätigte sein Nebelhorn, obwohl er wusste, dass es keine Chance gegen diesen Lärm hatte. Sein Blick schoss zwischen dem Radarschirm, auf dem das Rennboot erfasst war, und dem Schirm des GPS, auf dem die Amelia Celeste erfasst war, hin und her, und ihm wurde klar, dass die beiden Boote kollidieren würden, wenn er nichts unternähme. Allerdings hatte er keine Ahnung, was er tun sollte. Artie fuhr wie ein Verrückter. Auf dem Radarschirm sah man ihn durch die besten Fischgründe zischen und an Bojen vorbeipflügen, in einem Tempo, durch das mit Sicherheit zig Warpleinen zerrissen würden. Wenn er es auf die Amelia Celeste abgesehen hatte, irgendein perverses Spiel spielte, hatte sie keine Chance, ihm zu entkommen.
»Artie, verdammt noch mal - nehmen Sie das Tempo zurück und gehen Sie aus dem Weg!«, schrie er, ohne sich darum zu kümmern, dass er damit die Passagiere beunruhigte, denn so wie die mit aufgerissenen Augen in die Richtung des stetig anschwellenden Motorgeheuls in den Nebel starrten, waren sie bereits hochgradig beunruhigt.
Wieder und wieder betätigte er sein Nebelhorn. Ohne Erfolg.
Bis zur Insel war es noch knapp eine Meile, er hatte die Verantwortung für neun Passagiere, Artie Jones fuhr Amok mit seinem Powerboot - welche Chance hatte er, Greg, mit seiner langsameren Amelia Celeste der Schnecke, gegen The Beast, den Windhund?
Nachdem er das Rennboot noch ein paar Sekunden auf dem Radar verfolgt hatte, versuchte er, den weiteren Kurs von The Beast vorauszuberechnen. Dann traf er eine Entscheidung. Nachdem er dem Rennboot nicht davonfahren könnte, drosselte er die Geschwindigkeit, um es vorbeizulassen.
Es hätte funktioniert, wenn The Beast getan hätte, was Greg erwartete. Was er nicht wissen und demzufolge auch nicht einkalkulieren konnte, war, dass Artie am Steuer seines geliebten Bootes einen Herzinfarkt erlitten hatte und bewusstlos darüber zusammengesunken war, und, dass in dem Moment, als die Amelia Celeste den Rückzug antrat, sein lebloser Körper seitwärts wegzurutschen begann und das Steuerrad sich mitdrehte.
Matthew Crane wusste sofort, was passiert war, als er die Explosion hörte. Er saß auf seinem Stammplatz auf der Terrasse des Harbor Grill, genoss einen Whiskey, während er darauf wartete, dass die Amelia Celeste aus dem Nebel auftauchen und auf den Kai zugleiten würde. Sein Gehör war darauf trainiert, ihr Motorgeräusch auf eine Meile Entfernung zu hören, und The Beast konnte er nicht überhören. Und plötzlich hatte ihn die gleiche Ahnung, die gleiche Angst befallen wie damals, als seine Fleisch-und-Blut-Amelia-Celeste zum letzten Mal ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der schreckliche Knall war kaum verklungen, als er auch schon die Stufen hinunter- und über den schmalen Strand rannte. Er kletterte auf den Kai und lief gestikulierend und brüllend auf die Hand voll Männer zu, die gerade von der Überprüfung ihrer Fallen zurückgekehrt waren und selbst alarmiert in den Nebel starrten.
Innerhalb weniger Minuten waren sie unterwegs und erreichten den Schauplatz des Dramas gerade noch rechtzeitig, um die ersten zwei Überlebenden aus dem Wasser zu fischen, bevor ihnen Rauch, Feuer oder die Kälte des auch im Juni eisigen Atlantiks zum Verhängnis werden konnte. Der dritte Überlebende wurde von einem anderen Boot aufgenommen. Keiner der drei hatte mehr als ein paar Blutergüsse erlitten, was angesichts des Schicksals der Übrigen einem Wunder gleichkam.
Kapitel 1
Julia Bechtel hatte das Gefühl, als würde sie von einer riesigen Hand gepackt, hoch in die Luft gehoben und in einem weiten Bogen ins Meer geschleudert. Sie ging unter, wie betäubt, erlitt jedoch keine Orientierungsstörung, kämpfte, selbst im Sinken begriffen, gegen die See an, um an die Oberfläche zu kommen. Als sie sie durchstieß, rang sie nach Luft. Die Wellen gingen hoch, aber sie nahm es mit ihnen auf. Sie konzentrierte sich auf das Atmen, bewegte Arme und Beine im Rhythmus der See, um sich so über Wasser zu halten.
Ihr Atem ging flach und stoßweise, während ihr langsam bewusst wurde, was geschehen war. Schreie, ein Zusammenstoß und eine Explosion - echote es, die Erinnerung kam wieder. Sie wischte sich das Haar aus den Augen, versuchte, sich zu orientieren. Auf den Wellen um sie herum tanzten Bretter, aus dem Boot gerissen wie sie selbst, doch wo der Rest der Amelia Celeste sich befinden sollte, loderten Flammen, die das Mahagoni und weiß Gott noch alles fraßen, und zwischen schwarzem Rauch und weißem Nebel gab es keinen Unterschied.
Ihr Instinkt riet ihr, sich vom Feuer zu entfernen, und sie gehorchte ihm. Ihre Sandalen hatte sie verloren, ebenso ihr Taschenbuch im Blazer, doch als sie spürte, wie ihre vollgesogene Jacke sie in die Tiefe zu ziehen drohte, streifte sie sie ab. Sie zitterte am ganzen Leib, wusste aber nicht, ob vor Kälte oder vor Schreck. Angst empfand sie nicht.
»Hey!«, drang eine Stimme durch den Qualm, und dann wurde ein Kopf sichtbar. Er gehörte dem Mann, der wie sie am Bug gestanden hatte. »Sind Sie verletzt?«, brüllte er gegen das Tosen des Feuers an.
Sie glaubte, nein. Es schien alles zu funktionieren. »Nein!«, rief sie zurück.
»Halten Sie sich da dran fest.« Er schob ihr etwas hin. Es war ein langes, offenbar schwimmfähiges Sitzkissen. »Ich muss wieder rein.«
Julia packte das Kissen und wollte eben fragen, ob das überhaupt möglich sei, als eine zweite, alles erschütternde Explosion erfolgte. Sie hatte gerade noch Zeit, Luft zu holen, bevor der Mann sie unter Wasser zog, damit sie nicht von herabstürzenden Bruchstücken getroffen würden. Als sie auftauchten und sich spuckend und nach Luft schnappend und Wasser tretend umsahen, war der Trümmerhagel vorüber und an ein »Wieder-Rein« nicht mehr zu denken. Das Feuer war noch lauter geworden, der Rauch noch dicker. Einen Moment lang starrte der Mann mit einer Mischung aus Kummer und Entsetzen auf das Bild der Zerstörung, dann fiel ihm offensichtlich etwas ein. Er riss seinen Blick los und schaute sich suchend um, entdeckte das losgerissene Sitzkissen, schwamm es holen und zu ihr zurück. »Festhalten«, schrie er, und als sie gehorchte, zog er sie damit durch die Wellen weiter vom Wrack weg, während er unverwandt auf die Feuerhölle starrte.
Plötzlich vollführte er eine Drehung und brüllte in die entgegengesetzte Richtung, in der Julia das Ufer vermutete: »Hey! Hierher! Hey! Hier sind Leute, die Hilfe brauchen!« Julia wusste, dass er nicht sich oder sie meinte. Sie schienen okay zu sein, es ging um all die anderen, jenseits der Flammen, die vielleicht von Trümmern getroffen, durch die Explosion das Bewusstsein verloren oder Brandwunden erlitten hatten.
Und dann begann der Mann unfassbarerweise, auf die Feuerhölle zuzuschwimmen.
»Bleiben Sie hier!«, schrie sie verzweifelt, doch sie wusste nicht, ob aus Angst um ihn oder davor, allein zurückgelassen zu werden. Der Nebel war erstickend dicht, das Feuer nah, und sie hatte keine Ahnung, wie weit es bis zur Küste war, und in diesem Moment bekam sie Angst. Das Meer war riesig und sie ein unendlich winziger Punkt darin. Zwei Punkte waren besser als einer.
Er schwamm aber weiter, und plötzlich hielt er an, trat, den Blick auf die Flammen geheftet, Wasser und wandte sich dann nach links, aber dort stellten sich ihm die Wellen in den Weg, zogen ihn hinaus, statt ihn vorwärts zu tragen, und so ließ er sich zu Julia zurücktreiben und suchte ebenfalls Halt an dem Kissen.
»Haben Sie noch jemanden gesehen?«, fragte sie. Ihr Atem ging schwer, doch nicht annähernd so schwer wie seiner.
Er schüttelte den Kopf und schaute dann wieder in Richtung Ufer. Kurz darauf hörte Julia, was er gehört hatte, und wiederum kurz darauf durchstieß ein Boot den Nebel. Es war ein Hummerboot, kleiner als die Amelia Celeste und bedeutend weniger gepflegt, doch Julia hatte noch nie in ihrem Leben etwas Schöneres gesehen.
In null Komma nichts war sie an Bord geholt, in eine Decke gewickelt und in die kleine Kabine am Bug verfrachtet, doch dort, in der Sicherheit und Wärme, begann sie, noch stärker zu zittern, denn sie hörte nicht nur die Geräusche in ihrem Kopf - die Schreie, den Zusammenstoß, die Explosion -, sie sah auch alles wieder vor sich: Wie der violette Bug des Rennbootes den Nebel durchstieß, gerade hoch genug, um über die Seite der Fähre zu schießen und dann auf sie herunter zu krachen.
Unfähig, still zu sitzen, ging Julia an Deck und starrte, triefend und unter ihrer Decke zitternd, die Hand vor den Mund haltend in den Nebel. Der Rauch war so beißend, dass sie die Decke über die Nase zog.
Der Mann, der mit ihr im Wasser gewesen war, war ebenfalls an Bord, aber für ihn gab es keine Decke, keine Fürsorge. Er und zwei andere beugten sich über die Schiffsseite und versuchten angestrengt, im Nebel und Qualm etwas zu erkennen, während das Boot sich durch Trümmer von Holz und Fiberglas und einem Gemisch anderer, zum Teil brennender Dinge, die Julia nicht benennen konnte, schlängelte. Die geisterhafte Silhouette eines weiteren Suchbootes huschte im Nebel vorbei. Ein drittes erschien, ging längsseits, und der Mann, der mit ihr im Wasser gewesen war, wechselte hinüber.
Julia stellte keine Fragen, und er blickte nicht zurück. Die Männer beider Boote kannten ihn, er war also ein Einheimischer, und demnach kannten ihn auch die anderen auf der Amelia Celeste. Und er war voller Sorge.
Grauen beschlich sie, als sie das Boot wegfahren sah. Sie horchte ihm nach, mühte sich, durch den Nebel hindurch seine Fahrt zu verfolgen, bis ihr Boot wendete.
»Wir bringen Sie an Land«, erklärte ihr der Kapitän, als sie Fahrt aufnahmen.
»Das brauchen Sie nicht«, antwortete sie. »Ich bin okay. Sollten wir nicht lieber hierbleiben und bei der Suche helfen?« Es war ihr ein Bedürfnis, das zu tun.
Doch der Kapitän sagte: »Ich setze Sie ab und fahre gleich wieder los«, und beschleunigte weiter.
Der kalte Wind, der um ihren nassen Kopf pfiff, kam ihr eisig vor, und so suchte Julia Schutz im Ruderhaus und wartete darauf, dass sich jenseits des Windschutzes Land abzeichnete. Ein paar Minuten später erhob sich weit voraus eine dunkle Masse mit einer zerklüfteten Skyline aus dem Meer. Ein paar weitere Minuten später lichtete sich der Nebel so weit, dass ein kleines Fischerdorf erkennbar wurde, das sich an den Hang eines Hügels schmiegte.
Das Boot legte an. Aus der Menschentraube am Kai löste sich eine Frauengestalt und kam angelaufen.
Zoe Ballard war die jüngste Schwester von Julias Mutter, ein Nachzügler, gerade mal zwölf Jahre älter als Julia. Und sie war interessant und abenteuerlustig, ungezwungen und eigenständig. Sie war alles, was Julia nicht war, aber dennoch glühend von ihr bewundert.
Als sie jetzt hier in ihrer grob gewebten Patchworkjacke, der ausgefransten Jeans und mit ihrem windzerzausten, kastanienbraunen Haar, ihren Gesichtszügen, die edel waren wie Julias, stand, schwammen ihre Augen in Tränen, doch ihre Arme waren kräftig, als sie ihrer Nichte auf den Pier half und sie an sich drückte, als wolle sie sie nie mehr loslassen. Julia ließ sie gewähren. Sie zitterte noch immer, und die Kraft, die von Zoe ausging, half ihr. Sie fühlte sich sicher bei ihr. Sie war an Land und am Leben - und plötzlich von der Angst erfüllt, die anderen seien tot. Sie schaute sich nach dem Boot um. Es legte gerade wieder ab.
Die Menschen umringten sie, und Fragen stürmten auf sie ein.
»Was ist passiert?«
»Wie viele waren auf der Amelia Celeste?«
»Haben sie auch andere aus dem Wasser gezogen?«
Es ging so schnell, dass Julia nicht wusste, wen sie zuerst ansehen sollte, und so beschloss sie, sich auf Zoe zu konzentrieren. »Wir wurden von einem Boot gerammt. Es waren noch sechs, sieben oder vielleicht auch acht andere auf der Fähre.«
»Hast du irgendwelche Namen aufgeschnappt?«, fragte Zoe, und Julia begriff, warum. Fähren wie die Amelia Celeste waren keine hochoffiziellen Einrichtungen. Es wurden keine Tickets vorbestellt, keine Passagierlisten geführt. Jede Information, die Julia ihnen geben könnte, wäre eine Hilfe für die Inselbewohner.
Aber sie konnte nur den Kopf schütteln. »Ich war am Bug, und sie waren am Heck.«
Sie versuchte, sich die Gesichter zu vergegenwärtigen, die sie gesehen hatte, als sie an Bord gekommen war, doch das Bild war verschwommen. Sie war mit ihren Gedanken ganz woanders gewesen, als sie mit ihrem Gepäck die Landungsbrücke hinunterhastete, völlig erschöpft nach einer strapaziösen Siebenstundenfahrt von Manhattan. Dabei hätte es eine so schön entspannte Fahrt sein sollen und wäre es auch gewesen, wenn sie weggekommen wäre wie geplant. Doch ihr Mann hatte ihr eine ganz Latte von Last-Minute-Aufträgen gegeben, sie wie üblich wie ein Dienstmädchen behandelt, worüber sie sich zunehmend zutiefst ärgerte. Auf der Fahrt hatte sie sich immer mehr in diesen Ärger hineingesteigert, im Geist mit Monte gestritten, wie sie es in der Realität niemals wagte, der Frustration Luft gemacht, die sich in Jahren aufgestaut hatte. Die schließliche Erkenntnis, dass sie ihre Fähre versäumen würde und nicht wusste, ob noch eine andere an diesem Tag ginge, und sie keine Ahnung hatte, wo sie übernachten sollte, falls sie heute nicht mehr zur Insel rüberkäme, hatte ihre Anspannung weiter steigen lassen. Sie war den größten Teil der Strecke mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, was in mehrerer Hinsicht gefährlich war. Sie fuhr nicht oft, zumindest nicht auf dem Highway, und was sie sich als angenehm erhofft hatte, wurde zu einem Stresserlebnis erster Güte.
Doch dann hatte sie Glück gehabt, hatte die Amelia Celeste gerade noch vor dem Auslaufen erwischt.
Glück? Nun ja - sie war mit dem Leben davongekommen. Aber was war mit den anderen?
»Ihr Arm blutet.« Ein Mann trat auf sie zu. Sie schätzte ihn auf höchstens Ende dreißig, doch er strahlte Reife und Selbstbewusstsein aus. »Darf ich mir das mal ansehen?« Julia starrte erschrocken auf das Blut an der Innenseite ihres Armes.
»Er ist Arzt«, erklärte Zoe ihr leise. Sie schlüpfte aus ihren Clogs, kniete sich hin und zog sie Julia an.
Julia stützte sich auf ihrer Schulter ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Genügt da nicht ein Pflaster?«, fragte sie, denn sie wollte den Kai nicht verlassen.
»Seine Praxis ist gleich um die Ecke.« Zoe stand auf, umfasste sie und führte sie den Kai hinauf.
»Jetzt hast du keine Schuhe.«
»Mir reichen die Socken.« Sie waren noch nicht am Ende des Kais angekommen, als sich ihnen ein großer Mann in einer Khakiuniform in den Weg stellte.
»Ich muss mit ihr reden«, sagte er.
»Nicht jetzt«, erwiderte Zoe nicht im Mindesten eingeschüchtert.
»Da draußen ist etwas passiert. Ich muss der Sache nachgehen. «
»Aber nicht jetzt, John«, wiederholte Zoe ungeduldig. »Siehst du nicht, in welcher Verfassung sie ist? Jake wird sie sich ansehen, und dann bringe ich sie nach Hause.« »Ich will aber hierbleiben«, flüsterte Julia.
Zoe ging nicht darauf ein.
Der Polizeichef trat beiseite.
Von Zoe links gestützt und vom Arzt rechts, wankte Julia dahin. Als sie die Main Street hinuntergingen, nahm sie kaum etwas von der Umgebung wahr. Der Inselladen, der Fischereibedarfladen, Zeitung, Post und Polizeirevier - alles zog verschwommen am Rand ihres Gesichtsfeldes vorüber. Doch kaum hatte sie die Schwelle der Praxis überschritten, schreckte sie auf. Ein vertrautes Gefühl ließ eine Alarmglocke in ihrem Kopf schrillen - das gleiche Gefühl, vor dem sie geflohen war, das Gefühl, dass sie nicht selbst über sich bestimmen konnte.
»Ich werde nicht mit dir nach Hause gehen«, eröffnete sie Zoe. Sie sprach leise, wie ihre Tante es mit dem Polizeichef getan hatte, doch auch an ihrer Entschiedenheit war nicht zu zweifeln.
»Du musst aus den nassen Sachen raus und dich aufwärmen«, insistierte Zoe, wenn auch nicht mehr so nachdrücklich.
»Ich muss wieder zurück in den Hafen«, erklärte Julia energisch, und Zoe gab auf.
»Okay. Gib mir meine Clogs. Ich hole dir was Trockenes zum Anziehen, während Jake dich untersucht.«
Erst in diesem Moment wurde Julia klar, dass sie nichts mehr besaß. Keine Kleidung. Keine Schuhe, keine Socken.
Kein Make-up. Keine Bücher, keine Fotoausrüstung. All die Dinge, die sie so sorgfältig zusammengestellt hatte, waren weg. Desgleichen ihre Handtasche, was bedeutete, dass sie keinen Führerschein mehr besaß, keine Kreditkarte, kein Bargeld. Sie hatte kein Handy, kein Bild von Molly, das sie in ihrer Brieftasche mit sich herumtrug, keine eselsohrigen Fotos aus ihrer Teenagerzeit, die das Objekt so vieler Träume gewesen waren. Und, dämmerte es ihr, sie besaß auch keine der anderen persönlichen Unterlagen mehr, die sie so akribisch gesammelt hatte.
Während sie noch an diesen Erkenntnissen kaute, schlüpfte Zoe zur Tür hinaus. Als sie wenig später zurückkam, war Julia für gesund befunden worden - abgesehen von dem ausgefransten Riss an ihrem Unterarm, den der Arzt genäht hatte. »In einer Woche können die Fäden gezogen werden«, hörte sie ihn zu Zoe sagen, während sie die Sachen anzog, die ihre Tante ihr gebracht hatte. »Das Zittern wird bald aufhören. Ich wollte ihr ein Beruhigungsmittel geben, aber sie lehnte ab. Morgen werden ihr wahrscheinlich alle Glieder wehtun. Wenn es schlimm ist, rufen Sie mich an.«
Julia machte den Reißverschluss der Jeans zu, zog vorsichtig ein T-Shirt und einen Pullover über ihren verbundenen Arm, schlüpfte in Wollsocken und Sneakers und zu guter Letzt in eine Fleecejacke. Mit jeder Schicht wurde ihr wärmer. Sie föhnte ihre Haare, bürstete sie und setzte die »Foss Fish and Lobster«-Baseballkappe auf. Dann gesellte sie sich zu den anderen ins Vorzimmer.
»Ich bin so weit«, sagte sie leise und war dankbar, als Zoe - anstatt ihr vorzuhalten, wie blass sie sei und, dass etwas zu essen, ein heißes Bad und Schlaf ihr bedeutend besser täten, als auf dem Kai herumzustehen - einfach nur nickte.
Zu dritt gingen sie den Weg zurück, den sie gekommen waren. Der Nebel hatte sich zwar weiter gelichtet, aber nun beeinträchtigte die Abenddämmerung die Sicht. Es war jedoch noch hell genug, dass Julia das Labyrinth hölzerner Stege ausmachen konnte, die vom Kai abgingen. Die vielen leeren Anlegestellen deuteten darauf hin, dass so gut wie die gesamte Flotte sich an der Suche beteiligte. Als sie näher kamen, legte gerade wieder ein Boot ab und fuhr mit eingeschalteten Positionslampen und blendend hellen Scheinwerfern auf dem Ruderhaus auf das offene Meer hinaus.
Der Hafen war jetzt von hohen Fackeln erhellt und von Menschen bevölkert. Der ganze Ort hatte sich eingefunden, mit angespannten Minen und besorgten Blicken. Viele hielten sich an den Händen.
Zoe, die Julia untergehakt hatte, tauchte mit ihr in die Menge ein. »Was gibt es Neues?«
»Nichts Gutes«, sagte eine Frau mit einem Mobiltelefon in der Hand. »Vom Festland sind Boote ausgelaufen, und dort warten Notarztfahrzeuge.« Sie hielt inne, doch ihre Augen sprachen weiter.
»Was erwarten sie?«, fragte Julia angstvoll.
»Verbrennungen«, antwortete die Frau und hielt erneut inne.
Julia schloss die Augen, nur für eine Sekunde, aber die genügte, um sie wieder mit den anderen auf die Fähre zu versetzen, um dieses violette Boot aus dem Nebel brechen zu sehen, um die Schreie zu hören, den Aufprall zu spüren, von der Explosion ins Wasser geschleudert zu werden. Körperteile. Das war es, was die Frau nicht ausgesprochen hatte, und plötzlich erahnte Julia das Ausmaß der Katastrophe.
Aufs Neue zitternd, schlang sie die Arme um sich und wandte sich dem Wasser zu, obwohl dort wenig zu sehen war und noch weniger zu hören: Das Feuer, die Motorgeräusche der Rettungsboote, die Sirenen waren verstummt. Abgesehen von gelegentlichen, leisen Worten, die in Mobiltelefone oder Funkgeräte gesprochen wurden, hörte man kaum etwas als die Wellen, die an die Pfeiler der Landungsstege oder gegen die wenigen, verbliebenen Boote klatschten oder sich donnernd an den Granitklippen draußen brachen.
Hinter Julia unterhielten sich die Leute mit gedämpfter Stimme, gedämpft ob nackter Angst. Als sie den Blick über die Menge gleiten ließ, konnte sie ohne Schwierigkeiten die den Vermissten am nächsten Stehenden ausmachen: Sie befanden sich jeweils in der Mitte von jedem der kleinen Grüppchen. Im Kontrast dazu stand ein grauhaariger Mann ganz allein am Ende des Kais. Seine Hände steckten tief in den Taschen einer abgetragenen, braunen Jacke, die lose über einer weiten Cordhose hing.
»Matthew Crane«, sagte Zoe, die gesehen hatte, wohin sie schaute. »Die Amelia Celeste gehört ihm. Er wünscht sich wahrscheinlich, dass er am Ruder gestanden hätte statt Greg. Greg hat Familie.«
Julia dachte noch über diese Information nach, als die Frau mit dem Mobiltelefon in anklagendem Ton sagte: »Es war tatsächlich Artie Jones’ Rennboot. Sie haben violettes Fiberglas gefunden.«
»Artie Jones ist aus Portsmouth«, erklärte Zoe Julia. »Er hat ein Haus auf dem Stiel. Erinnerst du dich?«
Und ob Julia das tat. Big Sawyer hatte die Form einer Axt. Am breitesten und dichtesten besiedelt war sie am Kopf, wo auch, nahe der Schneide, der Hafen lag, sich an dem grünen Hügel das Fischerdorf hinaufzog, und, auf der Rückseite des Kopfes, mit Blick auf das offene Meer, sich die Künstlerkolonie befand. Der Stiel, der nach Südosten ragte, war lang und schmal. Hier standen die Ferienhäuser der Reichen vom Festland, was einen gewissen Abstand zwischen den luxuriösen Behausungen und Booten der Fremden und der nüchternen Zweckmäßigkeit der Einheimischen gewährleistete. Dieses Arrangement war beiden Parteien sehr recht. »Artie hat während des Internet-Booms das große Geld gemacht«, fuhr Zoe fort, »und falls es ihm schadete, als das Ganze baden ging, so war davon nichts zu merken. Sein Haus ist riesig. Er hat an nichts gespart.« Sie überlegte kurz und sagte dann: »Wenn das wirklich The Beast war, dann stand Artie am Ruder. Niemand außer ihm steuert das Boot. Dann ist er auch da draußen.«
»Ist seine Familie hier?«, fragte Julia leise.
»Nein«, antwortete die Frau. »Sie kommen erst, wenn die Kinder Ferien haben. Artie reist immer voraus, um das Haus aufzumachen und The Beast zu Wasser zu lassen.« Sie schaute an ihnen vorbei, und Zoe und Julia folgten ihrem Blick. Ein Boot lief in den Hafen ein und zog die Aufmerksamkeit auf sich. »Das ist die Willa B. Sieht aus, als brächte sie jemanden mit.« Sie lief los.
Dieser Jemand, erklärte Zoe Julia, sobald sie die Person erkannt hatte, war Kim Colella. Sie musste nicht gestützt werden und schien unverletzt. In ein großes Handtuch gehüllt und mit gesenktem Kopf wirkte sie auf Julia wie kaum der Kindheit entwachsen, doch als sie das Zoe gegenüber bemerkte, wobei ihre Stimme zitterte, wurde sie auf der Stelle von Zoe eines Besseren belehrt.
»Kimmie ist einundzwanzig und bedient im Grill an der Bar. Das Leben ist nicht gerade sanft mit ihr umgegangen.
Sie wurde von ihrer Mutter und ihrer Großmutter aufgezogen, zwei ausgesprochen taffen Frauen.«
Julias Beschützerinstinkt erwachte, nicht nur, weil ihre Tochter fast im selben Alter war wie Kimmie Colella, sondern weil das Mädchen gar nicht taff wirkte. Sie hielt den Kopf gesenkt, als man ihr vom Boot auf den Steg half, und als ihr eine Fragenflut entgegenbrandete, zuckte sie regelrecht zurück und suchte Zuflucht beim Arzt, der den Arm um sie legte und wegführte.
Das Boot, das sie gebracht hatte, war schon wieder auf dem Weg hinaus. »Wie lange können sie noch suchen?«, fragte Julia, denn inzwischen war es richtig dunkel.
»Oh, theoretisch die ganze Nacht. Die Boote sind alle mit starken Scheinwerfern ausgerüstet.«
Julia hatte sich schon bei Tageslicht zu Tode gefürchtet da draußen. Wie viel schlimmer musste es erst im Finstern sein! Sie rückte näher an Zoe heran und vergrub die Hände in den Taschen der Fleecejacke. »Vielleicht sind ja auch schon Überlebende aufs Festland gebracht worden«, meinte sie. »Das wüssten wir.« Es fiel ihrer Tante sichtlich schwer, ihr diese Hoffnung zu nehmen. »Irgendjemand hätte uns benachrichtigt. Willst du wirklich nicht nach Hause?« »Nein.«
»Tut der Arm weh?«
»Nein.« Unter normalen Umständen hätte er das sicher getan, doch das Grauen und die Angst waren stärker.
»Soll ich dir aus dem Grill etwas zu essen holen?«
»Ich glaube nicht, dass ich einen Bissen hinunterbrächte.« »Wie wär’s dann wenigstens mit einem Kaffee?«
Zu dem ließ Julia sich überreden, doch sie trank kaum etwas davon. Ihr Adrenalinspiegel war schon ohne Koffein hoch genug, aber immerhin wirkte die Wärme des Bechers in ihren Händen ein wenig tröstlich. Doch mit der Zeit verflüchtigte sich die Wärme und mit ihr die Hoffnung, dass noch weitere Überlebende gebracht würden. Trotzdem wollte sie nicht weg. Aufgewühlt, wie sie war, würde sie ohnehin kein Auge zu machen, und außerdem, solange all die anderen im Hafen ausharrten, würde sie es auch tun. Sie war auf der Unglücksfähre gewesen, und wenn sie die Inselbewohner auch nicht mit Namen kannte, so empfand sie sich in dieser Nacht doch als eine von ihnen.
Als sich um elf der Nebel endgültig auflöste, hob sich die Stimmung der Menge in der Hoffnung, dass Überlebende jetzt leichter zu entdecken wären. Doch als um Mitternacht noch keine Erfolgsmeldungen von den Booten eingegangen waren, schwand diese Hoffnung, und um eins verstummten die noch verbliebenen Grüppchen mutlos.
Kurz darauf kam die Nachricht, dass die Küstenwache die Suche für diese Nacht einstellen und am Morgen mit Tauchern zurückkehren würde. Doch die Boote von der Insel machten weiter. Aber ab zwei kehrten auch sie allmählich zurück. Ein Boot nach dem anderen glitt in den Hafen, und selbst die Motoren klangen müde. Die Gesichter der Männer, die ausstiegen, wirkten im Schein der flackernden Fackeln geisterhaft bleich und verhärmt. Sie hatten nichts zu berichten, schüttelten nur die Köpfe.
Julia ließ suchend den Blick wandern, bis sie den Mann entdeckte, der ihr unmittelbar nach dem Unfall geholfen hatte, der sie im Wasser aufgesammelt hatte, den Mann von der Amelia Celeste. Zoe nannte ihr seinen Namen: Noah Prine. Er ging zwar mit den anderen von Bord, doch darin erschöpfte sich auch schon die Gemeinsamkeit. Der Schmerz in seinem Gesicht unterschied ihn. Er hielt den Blick gesenkt, sprach niemanden an, und umgekehrt machte man ihm stumm Platz, als er mit großen Schritten den Steg heraufkam und in der Dunkelheit verschwand.
»Er war mit seinem Vater unterwegs«, erklärte Zoe leise. »Und Hutch wird noch vermisst.«
Julia war entsetzt. Sie konnte sich nur ansatzweise vorstellen, was Noah empfand, wie die Angst ihn quälte, dass sein Vater tot war. Ihr Vater lebte noch, ebenso wie ihre Mutter und ihre Brüder. Und ihre Tochter.
»Ich muss telefonieren, Zoe«, sagte sie, denn sie hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, Mollys Stimme zu hören. Das Mädchen machte eine Ausbildung zur Köchin. Normalerweise war sie in Rhode Island, doch im Moment war sie zu einem Praktikum in Paris. Dort war jetzt Morgen. Wenn Molly am Abend lange gearbeitet hatte, würde sie vielleicht noch schlafen, und unter normalen Umständen hätte Julia darauf Rücksicht genommen, doch was geschehen war und was sie empfand, war alles andere als normal.
Zoe zog ein Mobiltelefon aus der Tasche, und Julia tippte die Nummer von Molly ein. Als es klingelte, entfernte sie sich ein Stück von der Menge. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis Molly sich meldete. »Mom?«, fragte sie schlaftrunken.
Die Gefühle, die Julia in diesem Augenblick überschwemmten, waren so stark, dass sie in Tränen ausbrach. »Oh, Baby«, schluchzte sie.
»Ist was mit dir?«, fragte Molly, plötzlich hellwach, alarmiert.
»Nein, nein«, schluchzte Julia weiter. »Es geht mir gut. Aber das ist ein Wunder.«
Und dann berichtete sie, immer wieder von einem zunehmend entsetzten »OhmeinGott!« unterbrochen, mit einer Hand voll Sätzen, was geschehen war. Als sie schließlich endete, sagte ihre Tochter mit einer Mischung aus Unglauben und Ehrfurcht: »OhmeinGott! Fehlt dir wirklich nichts?« »Nein. Aber andere hatten nicht so viel Glück. Es tut mir Leid, dass ich dich geweckt habe«, sie weinte noch immer, allerdings nicht mehr so stoßweise, »aber ich musste einfach mit dir sprechen. Eine E-Mail hätte nicht ausgereicht - ich brauchte deine Stimme.«
»Ich bin froh, dass du angerufen hast. Oh mein Gott, Mom, das ist ja grauenvoll. Ich bin stinkig, weil der Küchenchef den Boss raushängen lässt, und bei dir geht es um Leben und Tod. Wann wird man denn wissen, was mit den anderen ist?«
»Morgen irgendwann.«
»Was für eine schreckliche Geschichte! Und du hattest dich so auf diese zwei Wochen gefreut. Sie sollten Ferien sein. Fährst du jetzt gleich wieder zurück?«
Die Frage verblüffte Julia. »Nein.« Seltsam, aber da regte sich nicht der geringste Zweifel. Sie konnte keine Gründe dafür angeben, dazu ging es in ihrem Kopf zu sehr drunter und drüber, doch Zurückfahren kam nicht in Frage. »Ich bleibe bei Zoe wie geplant. Die Nummer hast du ja.« »Willst du nach alldem wirklich bleiben?«
»Auf jeden Fall.«
»Soll ich kommen?«
»Nein. Du darfst dein Praktikum nicht abbrechen. Die Erfahrungen, die du dabei sammelst, sind zu wertvoll.« »Wird Dad kommen?«
Das war die zweite Frage, die Julia verblüffte. Sie hatte seit
dem Unglück noch kein einziges Mal an Monte gedacht, was ebenfalls seltsam war. Nun ja, vielleicht auch nicht. Monte und die Insel - da gab es keine Assoziation. Sie war seit ihrer Hochzeit schon dreimal hier gewesen, doch er hatte sie nie begleitet und auch diesmal nicht den Wunsch geäußert. Sie war sicher, dass er für die beiden Wochen weiter reichende Pläne gemacht hatte als die ihr von ihm mitgeteilten. Das stand für sie ebenso fest wie die Tatsache, dass sie Big Sawyer jetzt unmöglich verlassen und nach Hause zurückfahren konnte.
Da sie das Molly nicht erklären konnte, wich sie aus. »Ich weiß es nicht, Schatz. Wir werden das wahrscheinlich morgen früh klären.«
»Gib mir Bescheid«, bat Molly. »Schick mir eine E-Mail. Und ruf mich an, wenn dir danach ist. Jederzeit. Ich hab dich lieb, Mom.«
»Ich dich auch, Baby. Ich dich auch.«
Noah Prine ging mit ausgreifenden Schritten die Main Street hinunter, bog links in die Spruce ein und machte sich an den kurzen Aufstieg zu dem Haus am Hang, das er mit seinem Vater bewohnte. Es war ein Fischerhäuschen inmitten anderer Fischerhäuschen, die Schindeln von der Salzluft grau, verwittert, das Blau der Fensterläden verblasst, farbebedürftig - alles bedurfte der Farbe, die Seeluft fraß an allem, und Boote und Bojen hatten, was die Farbauffrischung anging, Vorrang. Das Haus war nicht groß, nur ein Bruchteil der Monstrosität, die Artie Jones unten auf dem Stiel besaß, doch es war mit dem Lohn jahrelanger, harter Arbeit ehrlich erworben und schuldenfrei.
Er wettete, dass Arties Anwesen das nicht war. Er wettete,
dass sowohl das Haus als auch The Beast mit saftigen Hypotheken belastet war. Und er wettete, dass der Bursche nicht versichert war, denn diese Typen dachten nicht über den Augenblick hinaus. Was bedeutete, wenn bei diesem Unglück acht Menschen umgekommen waren, könnten alle Schadensersatzprozesse der Welt nicht genug Geld erbringen, um zwei verwaiste Walsh-Kids, Greg Hornsbys Frau und Kinder, Dar Hutters Verlobte, Grady Bartz’ Eltern und wen immer Todd Slokum zurückgelassen haben mochte, angemessen zu entschädigen.
Und auch ihn nicht für den Verlust seines Vaters. Wobei er noch nicht sicher war, ihn verloren zu haben. Hutch hatte sein ganzes Leben auf dem Wasser zugebracht und war auch schon des Öfteren im Bach gelandet. Er hatte Unwetter überlebt, die einem anderen Mann vielleicht zum Verhängnis geworden wären, und außerdem war momentan nicht Winter und die Wassertemperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt. Es war Juni. Hutch konnte es schaffen. Vielleicht würde eine Nacht im Meer sogar das Wachstum des Krebses in seinem Blut verlangsamen.
Allerdings gab es abgesehen von der Kollision und der Zerstörung, die die riesigen Schrauben angerichtet hatten, noch das Problem der Explosion. Welchen Schaden sie angerichtet hatte, vermochte er nicht einzuschätzen. Er wäre ja noch immer draußen auf Suche, wenn die Leila Sue Scheinwerfer hätte. Mit Radar allein wäre ihm bei dem Seegang nicht geholfen. Er würde bei Tagesanbruch wieder auslaufen - aber womit sollte er die Zeit bis dahin totschlagen?
Er bog in den kurzen Gartenweg ein. Der Flieder seiner Mutter stand in voller Blüte. Die Nacht war pechschwarz, und er sah den Busch nicht, doch der Duft stieg ihm in die Nase, als er daran vorbeikam. Es brannte nicht einmal die Lampe über der Haustür, denn er und sein Vater hatten lange vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein wollen. Noah hatte vorgehabt, den Barsch zu braten, den er tags zuvor mit der Hummerfalle hochgezogen hatte. Hutch liebte Barsch, und da Noah ahnte, dass der Tag im Krankenhaus zum Desaster geraten würde, hatte er ihm eine Freude machen wollen.
Nicht im Traum wäre er auf das Desaster gekommen, das sie in Wirklichkeit erwartete. Sicher, vor dem Tod waren sie nicht gefeit, hatten vor drei Jahren erleben müssen, wie seine Mom starb, doch ihr Tod war nicht so gewalttätig gewesen, nicht durch eine so himmelschreiende Unachtsamkeit verursacht, nicht so vermeidbar.
Voller Zorn öffnete er die Tür, und ein vierzig Pfund schweres Geschoss donnerte an ihm vorbei in den kleinen Vorgarten hinaus. »Lucas«, sagte er mit einer Mischung aus Bestürzung und Schuldbewusstsein, die seinen Zorn verdrängte. Er hatte den Hund total vergessen. Als er ins Haus trat, ließ er die Tür einen Spaltbreit offen, damit das Tier wieder hereinkönnte.
Die Leere, die ihn empfing, drückte ihn nieder. Er stemmte die Hände in die Seiten und ließ den Kopf hängen. Nach einer Weile hob er ihn und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. War Hutch am Leben oder tot? Er wusste es nicht. Niemand wusste es. Er hatte das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, aber wen sollte er anrufen? Fast alle Menschen, die Hutch etwas bedeuteten, lebten hier auf der Insel.
Ian sollte Bescheid bekommen. Noah nahm den Hörer ab und tippte die Nummer ein, legte jedoch vor dem ersten Klingeln auf. Ian war sein Sohn, siebzehn Jahre alt und schwierig. Noah hatte sogar in guten Zeiten Probleme, mit ihm zu kommunizieren. Was sollte er ihm jetzt sagen?
Er ging ins Bad, streifte die salzwassersteifen Kleider ab und drehte die Dusche auf. Mit einer Hand an der Wand abgestützt, die andere schlaff an der Seite, ließ er das Wasser über seinen Kopf laufen, doch er spürte kaum, wie heiß es war und wie es auf seiner Haut prickelte. Er schrubbte sich akribisch, um den Fischgeruch loszuwerden, obwohl er heute gar nicht nach Fisch roch, spulte einfach das gewohnte Ritual ab. Nach dem Duschen folgten normalerweise Ankleiden und Essen, doch er sparte sich den Versuch, etwas zu essen, ebenso wie den Versuch zu schlafen. Trotzdem legte er sich aufs Bett. Als sein Blick auf den winzigen Kin- der-Sneaker fiel, der an der Wand hing, stand er wieder auf. Aber er würde noch zwei Stunden aushalten müssen, bis er wieder hinausfahren könnte, die Suche wieder aufnehmen. Er beschloss, die Zeit sinnvoll zu nutzen.
Im Vorbeigehen schnappte er sich einen Anorak vom Garderobenständer und machte sich, von Lucas begleitet, was er als überraschend tröstlich empfand, auf den Weg zu dem kleinen Schuppen am Wasser, wo er seine Hummerfangkörbe aufbewahrte. Er hatte bereits einige hundert Fallen gestellt, größtenteils im wärmeren Wasser der Untiefen, denn es war Juni, und die Hummer kamen dorthin, um sich zu häuten. Anfang Juli, wenn die Häutung abgeschlossen war, suchten sie Schutz im tieferen Wasser, um ihren neuen Panzer aushärten zu lassen. Die Fallen, die Noah jetzt stellte, würden in diese Richtung zeigen.
Die meisten der rechteckigen Fangkörbe waren einsatzbereit, türmten sich in Achterstapeln vom Boden bis zur Decke. Den Winter über hatte er die beschädigten zum größten Teil instand gesetzt, doch ein paar, Opfer randalierender Seehunde, verborgener Felsen oder schlicht und einfach vieler, strapazierender Einsätze, bedurften noch der Reparatur. Seine Fallen aus Eisendrahtgeflecht waren zwar widerstandsfähiger als die alten Holzgitterfangkörbe, aber unzerstörbar waren auch sie nicht.
Da es in dem Schuppen keinen Strom gab, musste er im Schein einer Petroleumlampe arbeiten, doch das störte ihn ebenso wenig wie der Geruchsmix aus Öl, Fisch, Tang, frischer Farbe, die auf den Bojen trocknete, die in Bündeln von den Deckenbalken hingen, und alten Handschuhen, durch die schon ein gerüttelt Maß von Ködern gegangen war. Alle diese Gerüche gehörten zu seinem Leben, zu seiner Persönlichkeit.
Er flickte mit Hilfe einer Zange ein zerrissenes Eisengeflecht, befestigte das abgerissene Fangnetz innen, reparierte eine Tür, ersetzte Ringe und brachte Namensschildchen an. So nahm er sich einen Lobsterfangkorb nach dem anderen vor, und als er schließlich fertig war, hatte er einen neuen Stapel einsatzfähiger Hummerfallen und Rückenschmerzen. Und die zwei Stunden waren nahezu verstrichen. Das erkannte er an dem Lichthauch vor dem Fenster und spürte es in seinen Knochen, die ihm zuriefen: »Es ist Zeit, Mann, es ist Zeit!«
Er blies die Lampe aus und machte sich mit Lucas, der die Strecke vor lauter überschüssiger Energie mehrmals zurücklegte, weil er immer wieder vorauslief und zurückkam, auf dem Weg zum Hafen. Am Hügel brannte hier und da Licht, und Noah wusste, in welchen Häusern es die ganze Nacht nicht ausgegangen war. Die Leute von dort würden sich bald im Hafen einfinden und ihre Wache wieder aufnehmen, während sie auf Nachricht warteten, doch vorläufig hatten die Möwen noch ungestört Zugang, ließen sich im ersten Morgenlicht auf Pollern, Relingen und Ruderhäusern nieder und verharrten - wie aus Stein gemeißelt, bis sie sich plötzlich mit einem Schrei in die Lüfte erhoben.
Als Noah in den Harbor Grill kam, erwartete ihn seine Thermosflasche mit frischem Kaffee in einer Reihe mit den Thermosflaschen der anderen Lobstermen an ihrem üblichen Platz. Doch diesmal erwartete ihn auch der Besitzer des Grills.
Rick Greene war ein Mann mit einem großen Körper, einem großen Geist und einem großen Herzen. Er hatte den Harbor Grill ganz allein zu einem begehrten Ausflugslokal gemacht. Im Sommer lockten sein Muschelsalat, Lobster- Chowder und Kabeljau-Curry, die nirgends frischer zu finden waren, scharenweise Touristen auf die Insel.
»Du musst was essen.« Er drückte ihm eine Tüte in die Hand.
Noah starrte darauf hinunter. Die freundliche Geste überraschte ihn nicht, wohl aber, wie gut sie ihm tat. Er, der so stolz auf seine Eigenständigkeit und Selbstgenügsamkeit war, spürte plötzlich, wie Rührung ihm die Kehle zuschnürte. Sein schweres Herz fühlte sich auf einmal nicht mehr ganz so schwer an, wenn auch nur für einen Moment, weil ein anderer Mensch ihm das Gefühl gab, seine Last mitzutragen.
»Hast du ein bisschen geschlafen?«, fragte Rick.
»Nein.« Noah suchte mit müden Augen den Hafen ab. »War schon jemand hier?«
»Die Trapper John ist vor zehn Minuten ausgelaufen - aber nicht, um Hummerfallen zu kontrollieren.«
Noah hörte es mit Erleichterung. Je mehr Boote sich an der Suche beteiligten, umso größer die Chancen.
»Du solltest vielleicht nicht allein fahren«, meinte Rick.
Noah lächelte ihn traurig an. »Da mein Mann am Heck nicht verfügbar ist, wird Lucas mir genügen müssen.« Rick nickte kummervoll. »Was kann ich tun?«
Noah schaute aufs Meer hinaus. Die Schaumkronen der Wellen hatten die gleiche zarte Farbe wie die Blüten des Flieders, den seine Mom so geliebt hatte. Ein neuer Tag dämmerte herauf, doch er hatte Angst im Gepäck. »Nicht viel.« Die Müdigkeit bohrte Löcher in seine Beherrschung, ließ die Verzweiflung hochkommen, die er sich bisher nicht gestattet hatte. »Ich werde mich noch mal umschauen. Vielleicht ist ja etwas übersehen worden. Vielleicht haben wir im falschen Gebiet gesucht. Vielleicht hängt ja ein ganzer Pulk an einem Stück Schiffsrumpf.«
»Halt mich auf dem Laufenden«, bat Rick. »Und wenn du was brauchst, gib es per Funk durch.«
Noah klemmte sich die Tüte unter den Arm, nahm die Thermoskanne und machte sich auf den Weg. Die Planken unter seinen Füßen waren wie immer feucht, aber die Wellen im Hafen gingen nicht hoch. Die Leila Sue schaukelte, von Hummerbooten unterschiedlicher Größe und Reparaturbedürftigkeit flankiert, sanft an ihrem Liegeplatz. Jedes Boot hatte auf seinem Ruderhaus eine Boje aufsitzen. Noahs war leuchtend blau mit zwei orangenfarbenen Streifen. Das waren seine Farben, staatlich gemeldet, in seiner Hummerfanglizenz vermerkt und wiederholt auf jeder einzelnen von den hunderten von Bojen, die er an seine Fallen hängte. Blau-orange-orange - ursprünglich die Farben seines Vaters und seit zehn Jahren seine eigenen.
Er ließ sich aufs Deck seiner Leila Sue hinunter, dicht gefolgt von Lucas, legte die Provianttüte ins Ruderhaus und warf die Maschine an. Es ließ das gelbe Ölzeug an den Haken - eins für ihn, eins für seinen Vater - Ölzeug sein. Jeans und Sweatshirt sollten heute genügen. Und seine »Patriots«-Kappe, die er nun aufsetzte. Hutch und er liebten die Mannschaft, und obwohl die Patriots beim Super Bowl für gewöhnlich baden gingen, hatten sie es tatsächlich einmal geschafft. Und das war was! Und der Snow Bowl gegen die Raider zwei Wochen vor dem Spiel - das war vielleicht was gewesen! Es war ein schöner Tag. Hutch und er hatten auf der ganzen Fahrt zu dem Spiel überhaupt nicht gestritten, ein seltener und denkwürdiger Akt.
Noah machte die Leinen los und gab der Leila Sue gerade genug Schub, um sie rückwärts zu setzen und außerhalb des Liegeplatzes zu wenden. Dann beschleunigte und steuerte er sie auf die offene See hinaus, nahm die im Hafen ankernden Boote kaum wahr, das Bojenfeld oder, als er am Leuchtturm vorbeifuhr, die von Möwen weiß gesprenkelten Felsen, die jetzt im ersten Morgenlicht zartrosa schimmerten. Ebenso wenig bemerkte er die limonengrün-traubenblaulimonengrün lackierten Bojen weiter draußen in den traditionellen Hummergründen der Fischer von Big Sawyer. Die Leila Sue strebte vorwärts, doch seine Gedanken blieben hinter ihr zurück.
Nein, auf der Fahrt nach Foxborough durch den Schnee an jenem Tag hatten sie sich nicht gestritten, aber dafür gestern. Hutch hatte Noahs Fahrstil kritisiert, kritisiert, dass er in der Cafeteria ein Tunfischsandwich bestellte, seine Unfähigkeit kritisiert, die Fragen zu beantworten, die - wie Noah konterte - Hutch dem Arzt selbst hätte stellen sollen.
Er hatte bemängelt, wie Noah sich nach dem Verlassen des Krankenhauses in den Verkehr einfädelte, dass er an der Mautstelle kein passendes Kleingeld parat hatte und es deshalb zu einer Verzögerung kam, es hatte Streit um den Radiosender gegeben und ums Auftanken des Leihwagens. Als sie schließlich, nachdem sie den Wagen zurückgebracht hatten, an Bord der Amelia Celeste gingen, hatte Noah die Nase gestrichen voll. Als Hutch knurrte, dass er nicht schon wieder sitzen wolle, nachdem er den ganzen Tag gesessen habe, und auf der Fahrt zur Insel am Bug stehen wollte, hatte Noah genug gehabt.
»Setz dich!«, hatte er seinem Vater befohlen, die Hand gehoben und die warnende Geste mit einem warnenden Blick unterstrichen, der besagte: Es reicht! Gib Ruhe! Ich brauche eine Atempause! Als er sicher gewesen war, dass Hutch ihn verstanden hatte, war er nach vorn zum Bug gegangen. Und hatte so das Unglück überlebt.
Von GPS navigiert, lenkte er die Leila Sue auf das Gebiet zu, auf das sich die Suche in der vergangenen Nacht konzentriert hatte. Auch andere Boote würden dort sein und die Küstenwache, und mit ein wenig Glück ... einem Wunder ...
Lucas lehnte sich schwer an sein Bein und schaute zu ihm auf, und für einen Moment ließ er sich ablenken. Er hatte den Hund vor drei Jahren aus dem Tierheim geholt, ihn mit knapper Not vor dem Einschläfern bewahrt. Lucas war ein Retriever, und ein besonders schöner noch dazu, rot mit weißer Schnauze, weißer Brust und weißen Pfoten, und sein langhaariger Schwanz wedelte ständig. Er hatte Sommersprossen und sanfte Augen und ein Herz voll unwandelbarer Liebe. Hutch war zwar nicht mit dem Familienzuwachs einverstanden gewesen, und es gab deswegen noch immer häufig Auseinandersetzungen, doch Noah hatte noch keine Sekunde bereut, den Hund gerettet zu haben.
Ein Hund hat nichts zu suchen auf einem Hummerboot, hatte Hutch geschimpft. Außerdem brauchen solche Hunde Auslauf. Warum, glaubst du, wollte ihn niemand haben? Er wird dich deine ganze Kraft kosten. Denk an meine Worte. Du wirst schon sehen.
Was Noah gesehen hatte, war, dass Lucas wie ein Wilder auf der Insel herumtobte, aber auf dem Boot lammfromm war. Was Hutch allerdings niemals zugegeben hätte.