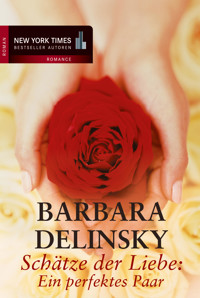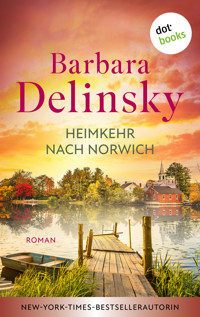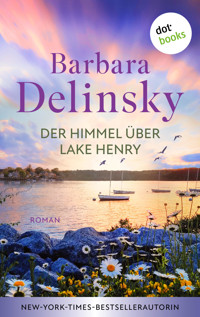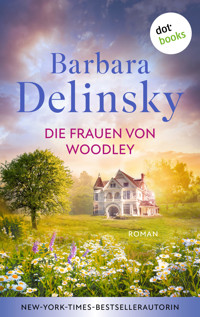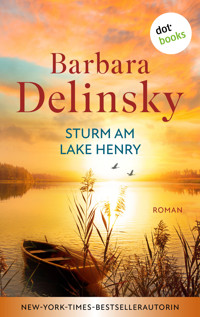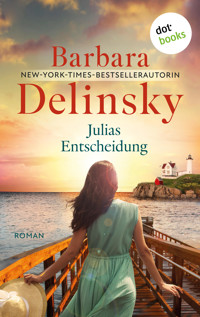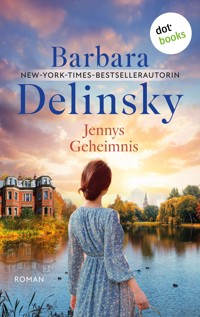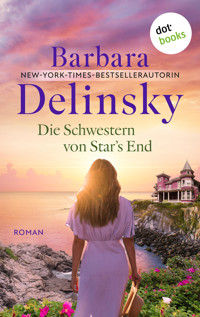5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um eine Zukunft zu haben, muss sie ihre Wurzeln finden … Der mitreißende Roman »Das Licht auf den Wellen« von Barbara Delinsky als eBook bei dotbooks. Ohne Vater aufgewachsen, hat sich Dana Clarke schon immer nach einer richtigen Familie gesehnt. Der Traum scheint zum Greifen nah, als sie den erfolgreichen Anwalt Hugh kennenlernt und in eine rosenumwachsene Villa an der reichen Ostküste zieht. Danas Schwangerschaft macht das Glück vollkommen – bis die kleine Lizzy geboren wird und ihre Haut nicht so »weiß« ist wie die ihrer Eltern. Sofort machen in der Stadt hässliche Gerüchte die Runde: Etwa, ob Dana ihren Ehemann betrogen hat – oder ob sie vorgibt, etwas zu sein, was sie nicht ist. Für Hughs angesehene Familie geht es nun um Prestige – für Dana um ihre Liebe, ihr Kind, ihr Leben. Obwohl sie nie wieder zurückblicken wollte, muss sie sich sich nun den aufwühlenden Geheimnissen ihrer Vergangenheit stellen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Das Licht auf den Wellen« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird Fans von Kristin Hannah und des Netflix-Serien-Hits »Ginny und Georgia« begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ohne Vater aufgewachsen, hat sich Dana Clarke schon immer nach einer richtigen Familie gesehnt. Der Traum scheint zum Greifen nah, als sie den erfolgreichen Anwalt Hugh kennenlernt und in eine rosenumwachsene Villa an der reichen Ostküste zieht. Danas Schwangerschaft macht das Glück vollkommen – bis die kleine Lizzy geboren wird und ihre Haut nicht so »weiß« ist wie die ihrer Eltern. Sofort machen in der Stadt hässliche Gerüchte die Runde: Etwa, ob Dana ihren Ehemann betrogen hat – oder ob sie vorgibt, etwas zu sein, was sie nicht ist. Für Hughs angesehene Familie geht es nun um Prestige – für Dana um ihre Liebe, ihr Kind, ihr Leben. Obwohl sie nie wieder zurückblicken wollte, muss sie sich sich nun den aufwühlenden Geheimnissen ihrer Vergangenheit stellen …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Lauras Hoffnung«
»Die alte Mühle am Fluss«
»Der alte Leuchtturm am Meer«
»Sturm am Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 1
»Der Himmel über Lake Henry«, Die Blake-Schwestern 2
»Heimkehr nach Norwich«
»Das Leuchten der Silberweide«
»Das Licht auf den Wellen«
»Die Frauen Woodley«
»Ein Neuanfang in Casco Bay«
»Im Schatten meiner Schwester«
»Rückkehr nach Monterey«
»Drei Wünsche hast du frei«
»Ein ganzes Leben zwischen uns«
»Jedes Jahr auf Sutters Island«
»Was wir nie vergessen können«
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Family Tree« bei Doubleday, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Vertrau nur meiner Liebe« bei Knaur Taschenbuch.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2007 by Barbara Delinsky.
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ys)
ISBN 978-3-98690-744-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Licht auf den Wellen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Das Licht auf den Wellen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Für Cassandra, ein kostbares Geschenk.
Kapitel 1
Irgendetwas hatte Dana geweckt. Sie konnte nicht sagen, ob es ein Tritt des Babys gewesen war oder ein Windstoß, der vom Meer durch das offene Fenster hereinblies, oder die Brandung oder sogar die Stimme ihrer Mutter in den sich an der Felsküste brechenden Wellen. Sie hatte wieder geträumt. Einen altbekannten Traum, der ihr, obwohl sie das Drehbuch kannte, nicht weniger peinlich war. Sie befand sich in der Öffentlichkeit, bar eines wichtigen Kleidungsstücks. In diesem Fall war es ihre Bluse. Sie hatte das Haus ohne verlassen und stand jetzt auf der Treppe ihrer Highschool – ihrer Highschool – und trug nur einen BH und noch dazu einen alten. Es war egal, dass sie ihren Abschluss schon vor sechzehn Jahren gemacht hatte und niemanden von den Leuten auf der Treppe kannte – sie war halb nackt und wäre am liebsten im Boden versunken. Lind dann – das war eine neue Variante – stand da etwas abseits ihre Schwiegermutter, die entsetzt dreinschaute und – groteskerweise – die Bluse anhatte.
Dana hätte über diese Absurdität gelacht, wenn sie nicht in diesem Moment etwas abgelenkt hätte. Flüssigkeit schoss zwischen ihren Beinen hervor, etwas, was sie nie zuvor gespürt hatte.
Ängstlich darauf bedacht, sich nicht zu bewegen, flüsterte sie den Namen ihres Mannes. Als er nicht reagierte, packte sie ihn beim Arm und sagte laut: »Hugh!« » Mm?«, brummte er.
»Wir müssen aufstehen.«
Er drehte sich auf den Rücken und streckte sich.
»Meine Fruchtblase ist gerade geplatzt.«
Erschrocken setzte er sich auf. Dann beugte er sich über sie und fragte, seine tiefe Stimme klang unnatürlich hoch: »Bist du sicher?«
»Es läuft noch immer. Aber das Baby soll doch erst in zwei Wochen kommen.«
»Das ist okay«, versicherte er ihr. »Das ist okay. Es wiegt über sieben Pfund – das ist der Mittelwert bei voll ausgetragenen Kindern. Wie spät ist es?«
»Zehn nach eins.«
»Nicht bewegen – ich hole Handtücher.« Er drehte sich um, knipste seine Nachttischlampe an und stand auf.
Sie gehorchte ihm, einerseits, weil er sich über jeden Aspekt der Geburt informiert hatte und wusste, was zu tun war, und andererseits, weil sie nicht noch mehr nass machen wollte. Sobald er zurückkam, stemmte sie sich, ihren Bauch stützend, hoch, klemmte sich eines der Handtücher zwischen die Beine, presste sie zusammen und schlurfte ins Bad.
Ein paar Sekunden später erschien Hugh, sah in dem Badezimmerlicht mehr als blass aus. »Und?« »Kein Blut. Eindeutig Fruchtwasser.« »Fühlst du irgendwas?«
»So was wie Panik, meinst du?« Sie scherzte nicht. So gründlich vorbereitet sie auch waren – sie hatten Dutzende von Büchern gelesen, mit ungezählten Freunden gesprochen, mit der Ärztin und ihrer rechten Hand und ihren Partnern und während eines Vorab-Rundgangs durchs Krankenhaus mit dem Personal der Augenblick der Wahrheit war doch etwas anderes als die Theorie. Jetzt, da die Geburt definitiv bevorstand, hatte Dana Angst.
»So was wie Wehen«, antwortete Hugh trocken.
»Nein. Ich würde es als vage Muskelanspannung beschreiben.«
»Was meinst du mit ›vage‹?«
»Schwach.«
»Ist es eine Wehe?«
»Weiß ich nicht.«
»Kommt und geht das Gefühl?«
»Ich weiß es nicht, Hugh. Ehrlich. Ich wachte auf, und da war dieser Schwall ...« Sie brach ab. »Ein Krampf!« Sie hielt den Atem an, atmete aus, begegnete Hughs Blick. »Sehr schwach.«
»Ein Krampf oder eine Wehe?«
»Eine Wehe«, entschied sie und begann vor Aufregung zu zittern. Sie hatten so lange darauf gewartet.
»Kann ich dich einen Moment allein lassen, während ich den Arzt anrufe?«, fragte er.
Sie nickte. Wenn sie es nicht getan hätte, wäre er mit dem Telefon ins Bad gekommen. Aber sie war nicht hilflos. Sosehr Hugh sie auch in letzter Zeit verhätschelt hatte, sie war ein eigenständiger Mensch, und das mit Bedacht. Sie wusste, wie es war, vollständig von jemandem abhängig zu sein und diesen Jemand dann zu verlieren. Schlimmeres konnte einem kaum passieren.
Und so verstaute sie ihren Bauch in ihrem neuesten, weitesten Jogginganzug, bewehrte sich mit einer Binde aus ihrem Vorrat, der für die Zeit nach der Geburt angelegt war, und ging den Flur hinunter zum Kinderzimmer. Sie hatte gerade das Licht angemacht, als Hugh nach ihr rief.
»Dee?«
»Ich bin hie-er!«
Die Jeans zuknöpfend, erschien er in der Tür. Seine dunklen Haare waren noch immer vom Schlaf zerzaust, seine Augen blickten besorgt. »Wenn zwischen den Wehen weniger als zehn Minuten liegen, müssen wir ins Krankenhaus fahren. Bist du okay?«
Sie nickte. »Ich wollte nur noch mal reinschauen.«
»Das Zimmer ist perfekt, Schatz.« Er streifte ein altes, marineblaues T-Shirt über. »Wie sieht’s bei dir aus?«
»Ich glaube, ich bin noch im Zehn-Minuten-Rhythmus.« »Lass uns trotzdem fahren – die Abstände werden schnell kürzer.«
»Aber es ist unser erstes«, hielt sie dagegen. »Beim ersten Kind dauert alles länger.«
»Das mag ja die Regel sein, aber keine Regel ohne Ausnahme. Bitte, hör in diesem Fall auf mich, ja?«
Sie nahm seine Hand, drückte einen Kuss auf die Handfläche und legte sie an ihren Hals. »Eine Minute noch, okay?« Dana fühlte sich hier sicher, beschützt, glücklich. Sie hatte schon viele Kinderzimmer für Kunden eingerichtet, aber das für ihr eigenes Kind war ihr bisher am besten gelungen. Alle vier Wände schmückte eine Blumenwiese mit Bäumen, deren Wipfel in der Sonne leuchteten, in allen erdenklichen Orange- und Grüntönen, in denen sich hier und da das Blau des Himmels wiederholte, der sich darüber spannte. Das Bild einer harmonischen und sicheren Welt.
Dana mochte eigenständig sein, doch sie hatte von einer Welt wie dieser geträumt, seit sie es gewagt hatte, wieder zu träumen.
Hugh kam aus einer, Welt wie dieser. War ein behütetes Kind gewesen, ein Jugendlicher, dem es an nichts gefehlt hatte. Seine Vorfahren waren mit der Mayflower nach Amerika gekommen, und seine Familie spielte seitdem eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft. Vier erfolgreiche Jahrhunderte hatten Stabilität geschaffen. Auch wenn Hugh all das herunterspielte – er war einer der direkten Nutznießer.
»Deine Eltern wollten Luftballons an den Wänden.« Sie ließ seine Hand los. »Ich fürchte, ich habe sie enttäuscht.« »Nicht du hast sie enttäuscht – wir haben sie enttäuscht. Aber das ist egal, das Kind ist nicht das Baby meiner Eltern.« Er wandte sich zum Gehen. »Ich muss mir noch Schuhe anziehen.«
Dana nahm das Strickzeug vom Schaukelstuhl – ein bis zur Hälfte fertiger moosgrüner Schlafsack – und ließ sich vorsichtig in dem Boston-Möbel nieder. Sie hatte den Stuhl vom Dachboden geholt, wo Hugh die meisten seiner Erbstücke verwahrte. Zwar hatte sie auch andere aus der Verbannung befreit und überall im Haus verteilt, aber dieses war ihr das liebste. Von seinem Urgroßvater, der es im Bürgerkrieg bis zum General gebracht hatte, in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts erstanden, hatte es eine Sprossenlehne und eine dreiteilige Sitzfläche aus Rundhölzern und war erstaunlich bequem für so ein altes Sitzmöbel. Vor Monaten, noch bevor die Wiese an der Wand entstand, hatte Dana den Schaukelstuhl von seinen Farbresten befreit und dem Holz wieder zu schimmerndem Glanz verhelfen. Hugh hatte sie gewähren lassen. Er wusste, dass sie Familiengeschichte schätzte, und das besonders, da sie keine eigene besaß.
Abgesehen von dem Schaukelstuhl war alles in diesem Zimmer neu, atmete eine Familientradition, die hier ihren Anfang nehmen sollte. Das Bettchen und die Kommode waren importiert, aber von der Wickelauflage über die von Hand gefärbten Vorhänge bis zu der Wandmalerei waren es alles Produkte ihres Mitarbeiterstabes. Dieser Stab schloss Topmaler, Schreiner, Teppich- und Vorhangfachleute ein – und ihre Großmutter und sie selbst. Am Fußende des Kinderbetts lagen eine von ihrer Großmutter gestrickte Decke und ein Kaschmir-Hase, den Dana, passend zur Wandmalerei, in sämtlichen erdenklichen Orangetönen gestrickt hatte, ein Kapuzencape, zwei Pullover, zahlreiche Mützchen und ein Stapel Kinderwagendecken. In einem Weidenkorb neben dem Schaukelstuhl bauschte sich ein voluminöses, noch im Werden begriffenes Kapuzencape aus Wintergarn, und auf ihrem Schoß lag der halb fertige Schlafsack. Die Begeisterung war sichtlich mit ihnen durchgegangen.
Langsam schaukelnd, dachte sie lächelnd acht Monate zurück. Als sie von der Arbeit kam – ihre Schwangerschaft war gerade bestätigt worden -, fand sie ein Meer von Tulpen im Zimmer vor. Violette, gelbe, weiße – alle so frisch, dass sie tagelang halten würden. Hugh hatte ihr diese Überraschung aus überströmender Freude bereitet, und Dana glaubte, dass dadurch die Atmosphäre bestimmt worden war.
Der Raum hatte etwas Zauberhaftes. Er strahlte Wärme und Liebe aus. Und Sicherheit. Ihr Baby würde hier glücklich sein, das wusste sie.
Liebkosend strich sie über ihren prallen Bauch. Sie spürte keine Kindsbewegung – das arme Ding hatte wahrscheinlich genauso große Angst wie sie -, doch sie spürte die Muskel-Bewegungen, die ihr Kind schlussendlich in die Welt hinausstoßen würden.
Langsam atmen ... hörte sie im Geist Hughs beruhigenden Bariton aus dem Lamaze-Kurs. Sie atmete noch immer tief ein und aus, nachdem die nun eindeutig als Wehe erkennbare Kontraktion längst geendet hatte, als das Schlapp-Schlapp von Flip-Flops seine Rückkehr ankündigte.
Dana lächelte ihn an. »Ich stelle mir gerade das Baby in diesem Zimmer vor.«
Aber er hatte im Moment keinen Sinn für derartige Betrachtungen. »Hattest du wieder eine Wehe?« Sie nickte.
»Achtest du auf den Abstand?«
»Noch nicht. Sie liegen zu weit auseinander. Ich versuche, mich mit schönen Gedanken abzulenken. Erinnerst du dich an den Tag, an dem ich zum ersten Mal hier war?«
Das war genau die richtige Frage. Hugh lehnte sich an den Türrahmen. »Natürlich. Du trugst etwas Neongrünes.« »Es war limonengrün, und du hattest keine Ahnung, was es sein sollte.«
»Selbstverständlich wusste ich, was es sein sollte – ich wusste nur nicht, wie man es nennt.«
»Man nennt es Pullover.«
Sein Blick hielt ihren fest. »Lach ruhig, wenn du willst – das tust du sowieso jedes Mal -, aber dieser Pullover war das Zipfeligste und Unsymmetrischste, was ich je gesehen habe.«
»Aus mehreren Elementen zusammengesetzt.«
»Aus mehreren Elementen zusammengesetzt«, wiederholte er und stieß sich vom Türrahmen ab, »und aus Kaschmir und Seide gestrickt, was ich heute problemlos erkenne aber was wusste ich damals schon?« Er stützte sich mit beiden Händen auf die Armlehnen des Schaukelstuhls und beugte sich herunter. »Ich hatte vor dir schon mit drei Designern gesprochen. Die waren allesamt aus dem Rennen, als du durch die Tür kamst. Ich hatte keine Ahnung von Garnen, keine Ahnung von Farben, keine Ahnung, ob du etwas taugtest als Innendekorateurin, wusste lediglich, dass David begeistert davon war, wie du sein Haus gestaltet hattest. Aber wir spielen hier mit dem Feuer, geliebtes Herz. David killt mich, wenn ich dich nicht rechtzeitig ins Krankenhaus bringe. Ich bin sicher, er hat das Licht bei uns gesehen.«
David Johnson wohnte nebenan. Er war Orthopäde und geschieden. Dana versuchte ständig, ihn zu verkuppeln, doch er lehnte jede Kandidatin mit der Begründung ab, dass sie nicht wie sie sei.
»David sieht das Licht bestimmt nicht«, meinte sie. »Er schläft um die Zeit doch sicher.«
Sie legte das Strickzeug in den Weidenkorb, und Hugh zog sie behutsam hoch. »Wie fühlst du dich?«
»Ich bin aufgeregt. Und du?«
»Ich bin nervös.« Er legte den Arm um ihre Taille beziehungsweise dorthin, wo sie sich einmal befunden hatte. Als er ihr ansah, dass wieder eine Wehe eingesetzt hatte, sagte er: »Das waren eindeutig weniger als zehn Minuten. Höchstens fünf!«
Sie widersprach ihm nicht, sondern konzentrierte sich darauf, langsam zu atmen, bis der Schmerz vorüberging. »Okay«, sagte sie, »letzte Ratechance: Mädchen oder Junge?«
»Mir ist beides recht«, antwortete er. »Auf jeden Fall können wir nicht länger hier rumtrödeln, Dee. Wir müssen los.« Er drehte sie in Richtung Flur.
»Ich bin noch nicht bereit.«
»Nach neun Monaten?«
Ängstlich legte sie die Hand auf seine Brust. »Was ist, wenn etwas schiefgeht?«
Lächelnd legte er seine Hand auf ihre. »Es wird nichts schiefgehen. Ich habe mein Glücks-T-Shirt an. Das trug ich bei jedem Super Bowl, den die Patriots gewannen, und während der gesamten World Series mit den Red Sox.« »Ich meine es ernst.«
»Ich auch.« Er klang überzeugt. »Wir haben Tests machen lassen. Das Baby ist gesund. Du bist gesund. Das Baby hat die perfekte Geburtsgröße. Es liegt richtig. Wir haben die beste Gynäkologin und das beste Krankenhaus ...«
»Ich rede von später. Was ist, wenn es ein Problem gibt, wenn das Kind, sagen wir, drei ist? Oder sieben? Oder wenn es ein Teenager ist und wir die gleichen Schwierigkeiten mit ihm kriegen wie die Millers mit ihrem Sohn?«
»Wir sind nicht die Millers.«
»Ich meine das große Ganze, Hugh.« Sie dachte an den Traum, mit dem sie aufgewacht war. Er ließ sich leicht deuten. Es ging darin um ihre Angst, sich als unvollkommen zu erweisen. »Was ist, wenn wir keine so guten Eltern werden, wie wir glauben?«
»Also, diese Überlegung kommt definitiv zu spät.«
»Ist dir klar, worauf wir uns da einlassen?«
»Natürlich nicht«, antwortete er, »aber wir wollen dieses Baby. Komm, Süße. Wir müssen!«
Dana bestand darauf, vorher noch ins Bad zu gehen, wo sie sich in aller Eile das Gesicht wusch, den Mund ausspülte und die Haare kämmte. Dann drehte sie sich zur Seite und betrachtete ihren Körper im Profil. Ja, sie war lieber schlank; ja, sie war es leid, dreißig Extrapfunde mit sich herumzuschleppen; ja, sie konnte es kaum erwarten, wieder normale Jeans und T-Shirts tragen zu können. Aber schwanger sein war etwas Besonderes.
»Dana«, drängte Hugh sie, »bitte.«
Sie ließ sich von ihm den Flur hinunterführen, am Kinderzimmer vorbei und auf die Treppe zu. In Architektenkreisen galt das Haus als ein Newport Cottage, wobei die Bezeichnung »Cottage« seiner Größe nicht gerecht wurde. Als ein zum Meer hin offenes U gebaut, mit vielen Fenstertüren, die auf eine überdachte Terrasse hinausgingen, einer weiten, weichen Rasenfläche und einer Apfelrosenhecke, hinter der die Brandung toste, war es mit seinen Kragsteinen, Säulen, weißen Absätzen und in der Salzluft zu einem silbrigen Grau verwitterten Schindeln ein Bild wie aus einem Traum. Ein Flügel beherbergte den Salon, das Esszimmer und die Bibliothek, der andere die Küche und das kleine Wohnzimmer. In den Flügeln im ersten Stock befanden sich auf der einen Seite Elternschlafzimmer und Kinderzimmer und auf der anderen zwei Gästezimmer. Das ausgebaute Dachgeschoss war dem Arbeitszimmer Vorbehalten, das einen Balkon besaß. Jeder Raum im Haus, außer dem Ankleidezimmer in der ersten Etage, hatte ein Fenster zum Meer.
Dana hatte sich auf den ersten Blick in das Haus verliebt. Mehr als einmal hatte sie zu Hugh gesagt, auch wenn er sich bei ihrem ersten Kuss in einen Frosch verwandelt hätte – sie hätte ihn um des Hauses willen trotzdem geheiratet.
Als sie jetzt auf die näher gelegene der beiden symmetrisch nach unten führenden Treppen zugingen, fragte sie: »Was ist, wenn es ein Mädchen wird?«
»Ich werde es lieben.«
»Aber eigentlich, tief drinnen, möchtest du lieber einen Jungen, das weiß ich, Hugh. Einen Stammhalter. Du möchtest einen kleinen Hugh Ames Clarke.«
»Ich wäre genauso glücklich über eine kleine Elizabeth Ames Clarke. Hauptsache, ich muss sie nicht selbst zur Welt bringen«, erwiderte er, als sie sich an den Abstieg machten. Bei der ersten Biegung blieb Dana stehen. Die Wehe war diesmal stärker.
Sie hatte natürlich gewusst, dass es wehtun würde, aber Theorie und Praxis waren doch zwei ganz verschiedene Dinge. »Kann ich das schaffen?« Sichtbar zitternd klammerte sie sich an Hughs Arm.
Er umfasste sie fester. »Du? Mit links.«
Hugh hatte ihr vom ersten Augenblick an vertraut. Das war eines der Dinge, die sie an ihm liebte. Er hatte keinen Moment mit seinem Einverständnis gezögert, als sie vorschlug, in die ansonsten moderne Küche einen rustikalen Bretterboden zu legen, und auch später nicht, als sie darauf bestand, die Porträts seiner Familie – große, dunkle Ölgemälde von Clarkes mit buschigen Brauen, kantigem Kinn und schmalen Lippen – im Wohnzimmer aufzuhängen, obwohl er sie lieber auf dem Dachboden gelassen hätte.
Für ihn war seine Herkunft nichts Besonderes. Nein, er rebellierte sogar gegen die Herkunftsbesessenheit seines Vaters, erklärte, sie sei ihm peinlich.
Dana musste ihn überzeugt haben, dass er selbst ein erfolgreicher Mann war, sonst hätte er ihr nicht erlaubt, die Bilder aufzuhängen. Sie verliehen dem Raum visuelle Höhe und historisches Gewicht. Sie hatte die wuchtigen Ledermöbel mit wild gemusterten Kissen aufgelockert, und auch das gefiel Hugh. Er hatte gesagt, er wünsche sich Behaglichkeit anstatt Behäbigkeit, und butterweiches Leder mit einem Durcheinander aus Rohseide und Chenille boten genau diese. Er hatte auch gesagt, er möge das Sofa nicht, das seinem Urgroßvater gehört hatte, weil es so streng sei, doch räumte er ihr in dieser Beziehung ebenfalls Spielraum ein. Sie ließ das Eichengestell des Sofas restaurieren, die Polsterung erneuern und gab dem Ganzen dann mit einem Überwurf und diversen Kissen ein ansprechenderes Gesicht.
Im Moment allerdings nahm sie nichts von alledem wahr. Sie konzentrierte sich darauf, einen Schritt nach dem anderen zu machen, wobei sie dachte, wenn diese Wehen nur der Anfang wären, könnte die Geburt ziemlich schlimm werden, und wenn es eine andere Methode gäbe, das Baby zur Welt zu bringen, würde sie sich jetzt dafür entscheiden.
Sie waren gerade am Fuß der Treppe angekommen, als Dana etwas einfiel. »Ich habe mein Kissen vergessen!« »Im Krankenhaus gibt es jede Menge Kissen.« »Aber ich brauche meines. Bitte, Hugh!«
Er half ihr, sich auf die unterste Stufe zu setzen, lief die Treppe hinauf und war in weniger als einer Minute mit dem Kissen unter dem Arm zurück.
»Und ich brauche Wasser«, erinnerte sie ihn.
Er verschwand aufs Neue, diesmal in die Küche, und kam Sekunden später mit zwei vollen Flaschen wieder. »Was noch?«
»Mein Handy. Und das Blackberry. O Gott, Hugh – ich sollte mich heute mit den Cunninghams zu einem Vorgespräch treffen!«
»Sieht so aus, als würdest du das versäumen.«
»Das ist ein Riesenauftrag.«
»Du bist in Mutterschaftsurlaub.«
»Aber ich habe ihnen versprochen, gleich nach der Geburt des Babys Zeichnungen für sie zu machen.«
»Die Cunninghams werden das bestimmt verstehen. Ich rufe sie von der Klinik aus an.« Er klopfte auf seine Tasche. »Handy, Blackberry – was noch?«
»Die Telefonliste. Die Kamera.«
»In deiner Reisetasche.« Er holte sie aus dem Garderobenschrank und schaute bestürzt auf das Garn, das zwischen dem nur halb geschlossenen Reißverschluss hervorquoll. »Dana! Du hattest es versprochen!«
»Es ist nicht viel«, beteuerte sie. »Nur eine Kleinigkeit, damit ich was zu tun habe, wenn es sich hinzieht.«
»Eine Kleinigkeit!« Er stopfte das Garn in die Tasche. »Wie viele sind das – acht Knäuel?«
»Sechs. Die Baumwolle ist dick gesponnen, und das heißt, in Metern gemessen ist es wenig. Mach nicht so ein Gesicht; Hugh – stricken beruhigt mich.«
Er schaute vielsagend zum Schrank: Oben auf der Ablage Garntüten wie unten auf dem Boden. Und in den anderen Schränken im Haus sah es ebenso aus.
»Gemessen an manchen anderen sind meine Vorräte gar nicht so groß«, verteidigte sie sich. »Außerdem – was spricht dagegen, die Zeit im Krankenhaus dahingehend zu nutzen? Gram will dieses Muster für den Herbst haben, und was ist, wenn es nach der Geburt des Babys Leerlauf gibt? Andere Frauen nehmen sich Bücher oder Zeitschriften mit, und mein Ding ist eben das Stricken.«
»Was haben sie gesagt, wie lange du im Krankenhaus bleiben musst?«, fragte Hugh – rein rhetorisch. Wenn es keine Komplikationen gäbe, wäre sie morgen wieder zu Hause. »Du bist kein Stricker. Sonst würdest du mich verstehen.« »Dagegen kann ich nichts sagen.« Er quetschte die Wasserflaschen in die Reisetasche, zog den Reißverschluss zu, hängte sich die Tasche über die Schulter und half Dana zur Tür hinaus. Sie gingen über die Veranda zu Hughs Wagen, der in der gekiesten Zufahrt parkte.
Anstatt an ihr Zittern zu denken oder daran, wann die nächste Wehe sie heimsuchen würde, dachte Dana an die winzigen Strampler in ihrer Reisetasche. Die Tasche war ein Konfektionsstück, der Inhalt war selbst gemacht. Hugh fand, dass sie zu viel eingepackt hatte, aber eine Entscheidung zwischen all diesen winzigen, kunstvoll gestrickten Baumwollmützchen und Schühchen war von ihr nicht zu verlangen, schließlich war August, außerdem brauchten sie kaum Platz, und das Baby hatte ein Recht auf Auswahl.
Ihre Schwiegereltern waren von diesen selbst gestrickten Babysachen natürlich ebenso wenig begeistert gewesen wie von der Kinderzimmergestaltung. Sie hatten ihnen eine Babyerstausstattung von Neiman Marcus geschenkt und verstanden nicht, weshalb der neue Erdenbürger nicht diese Sachen tragen sollte.
Dana verzichtete darauf, es ihnen zu erklären, denn ihre Gründe hätten sie beleidigt. Selbstgestricktes bedeutete für Dana Erinnerung an ihre Mutter, die Liebe ihrer Großmutter und die Zuneigung ihrer Ersatzfamilie von Freundinnen aus dem Wollladen. Selbstgestricktes war auf eine Weise persönlich, die den Eltern ihres Mannes fremd war. Die Clarkes waren von Rang, und so glücklich Dana auch war, Hughs Frau zu sein, sosehr sie auch das Selbstbewusstsein
der Clarkes bewunderte und sie um ihre Familiengeschichte beneidete – sie konnte nicht vergessen, wer sie war.
»Alles okay?«, fragte Hugh.
»Alles okay«, brachte sie mühsam heraus.
Sie rückte den Sicherheitsgurt so zurecht, dass er dem Baby im Fall einer Vollbremsung nicht wehtäte, doch die Gefahr war gering. Für einen nervösen, werdenden Vater fuhr Hugh so langsam, dass Dana, als die Wehen stärker wurden, wünschte, er würde schneller fahren.
Aber er wusste, was er tat. Hugh wusste immer, was er tat. Zum Glück war nicht viel Verkehr, und sie hatten grüne Welle.
Da sie angemeldet war, wurde Dana, kaum dass Hugh an der Rezeption ihren Namen genannt hatte, stationär aufgenommen. In null Komma nichts steckte sie in einem Krankenhausnachthemd, hatte ein Fötus-Überwachungsgerät auf den Bauch geschnallt und wurde von dem diensthabenden Arzt untersucht. Die Wehen kamen alle drei Minuten, dann alle zwei Minuten, und sie raubten ihr buchstäblich den Atem.
Die nächsten Stunden verschwammen, und jedes Mal, wenn der Geburtsvorgang sich verlangsamte, fragte sie sich, ob das Baby vielleicht ebenfalls Bedenken hätte. Sie strickte eine Weile, bis die Intensität der Wehen ihr die Nadeln aus der Hand nahm und Hugh zu ihrem einzigen Halt und Trost wurde. Er massierte ihren Nacken und Rücken und strich ihr die verschwitzten Haare aus dem Gesicht, und dabei sagte er ihr immer wieder, wie schön sie sei.
Schön? Sie war schweißgebadet, konnte vor Schmerzen kaum aus den Augen schauen, und ihre Haare waren völlig verfilzt. Schön? Sie musste schreckenerregend aussehen.
Aber sie klammerte sich an ihren Mann, versuchte, jedes seiner Worte zu glauben.
Alles in allem kam das Baby relativ schnell. Weniger als sechs Stunden nach dem Blasensprung erklärte die Schwester den Muttermund für vollständig geöffnet, und sie zogen in den Kreißsaal um. Hugh machte Fotos. Dana meinte später, sich daran zu erinnern, obwohl die Erinnerung von den Fotos hervorgerufen sein konnte. Sie presste, wie es ihr vorkam, eine Ewigkeit, doch in Wahrheit wesentlich kürzer, so viel kürzer, dass ihre Geburtshelferin die Geburt beinahe verpasst hätte. Die Frau war kaum eingetroffen, als das Kind kam.
Hugh durchschnitt die Nabelschnur und legte Sekunden später das greinende Baby auf Danas Bauch – das wunderschönste, vollkommenste kleine Mädchen, das sie je gesehen hatte. Dana wusste nicht, ob sie zuerst über das schrille Stimmchen lachen oder über die winzigen Finger und Zehen staunen sollte. Die Kleine schien dunkelhaarig zu sein – Dana stellte sich automatisch feines, dunkelbraunes Clarke-Haar vor –, doch, ob es so war, ließ die Käseschmiere, die den kleinen Körper überzog, nicht eindeutig erkennen.
»Wem sieht sie ähnlich?«, fragte Dana mit Tränen des Glücks in den Augen.
»Niemandem, den ich je gesehen habe.« Hugh lachte vor Freude und schoss eine Reihe von Fotos, bis die Schwester das Baby entführte. »Aber sie ist schön.« Er lächelte Dana neckend an. »Du wolltest doch ein Mädchen.«
»Ja«, gab sie zu, »ich wollte jemanden haben, dem ich den Namen meiner Mutter geben könnte.« Unglaublicherweise – und daran erinnerte sie sich später in aller Deutlichkeit – sah sie ihre Mutter in diesem Augenblick vor sich, wie sie sie das letzte Mal gesehen hatte, voller Lebensfreude und lebendig an jenem sonnigen Nachmittag am Strand. Dana hatte sich immer ausgemalt, dass sie und ihre Mutter mit der Zeit die besten Freundinnen geworden wären, in welchem Fall Elizabeth Joseph jetzt mit ihnen im Kreißsaal gewesen wäre. Von den vielen Situationen in ihrem Leben, in denen Dana ihre Mutter schmerzlich vermisste, war die Geburt die wichtigste. Das war ein Grund, weshalb sie das Kind nach ihr nennen wollte. »Es ist ein bisschen so, als würde sie mir damit zurückgegeben.« »Elizabeth.«
»Lizzie. Sie sieht wie eine Lizzie aus, findest du nicht?« Hugh lächelte noch immer. Er drückte Danas Hand an seine Lippen. »Kann man noch nicht genau sagen. Aber Elizabeth ist ein eleganter Name.«
»Das nächste wird ein Junge«, versprach Dana und verrenkte sich fast den Hals, um das Baby zu sehen. »Was machen sie mit ihr?«
Hugh stand von seinem Stuhl auf, um nachzuschauen. »Absaugen«, berichtete er. »Waschen. Abtrocknen. Namensbändchen anlegen.«
»Deine Eltern wollten einen Jungen.«
»Es ist nicht das Baby meiner Eltern.«
»Ruf sie an, Hugh. Und meine Großmutter. Und alle anderen.«
»Bald«, sagte er. Der Blick, mit dem er sie ansah, war so intensiv, dass ihr wieder die Tränen kamen. »Ich liebe dich«, flüsterte er.
Unfähig zu antworten schlang sie stumm die Arme um seinen Hals und klammerte sich an ihn.
»Da ist sie«, sagte eine freundliche Stimme, und plötzlich lag das Baby in Danas Arm, sauber und locker in ein Kapuzenhandtuch gewickelt.
Dana wusste, dass sie sich das nur einbildete – Neugeborene konnten nicht wirklich etwas fixieren -, doch sie hätte schwören können, dass das Baby sie ansah, als wisse es, dass sie seine Mutter war, die es für immer und ewig lieben und unter Einsatz ihres Lebens beschützen würde.
Die Kleine hatte ein zartes Näschen, ein rosiges Mündchen und ein perfekt modelliertes Kinn. Dana spähte unter die rosa Kapuze. Die Haare waren noch feucht, aber eindeutig dunkel – und gelockt, was eine Überraschung war. Hugh und sie hatten beide glattes Haar.
»Von wem hat sie die Locken?«
»Da fragst du mich zu viel.« Hugh klang auf einmal beunruhigt. »Sieh dir ihre Haut an!«
»Sie ist so weich.«
»Sie ist so dunkel.« Mit Angst im Blick schaute er zu dem Arzt hinüber. »Ist sie okay? Ich glaube, sie läuft blau an.« Dana blieb beinahe das Herz stehen. Sie hatte keine Blaufärbung bemerkt, doch angesichts der Geschwindigkeit, mit der ihr das Baby entrissen und untersucht wurde, wagte sie kaum zu atmen, bis der Kinderarzt seine gründliche Untersuchung abgeschlossen und der Kleinen beruhigend hohe Apgar-Werte und ein gesundes Gewicht von rund sieben Pfund bescheinigt hatte.
Nein, die Haut war nicht blau, entschied Dana, als Lizzie wieder in ihrem Arm lag. Aber sie war auch nicht so rosig wie erwartet. Ihr Gesicht hatte einen Kupferton, der so hübsch wie verwirrend war. Neugierig zog Dana das Handtuch beiseite, um sich einen der winzigen Arme anzusehen. Auch er hatte diesen Kupferton. Der ganze Körper war hellbraun, was die leuchtend weißen Fingernägel noch auffälliger machte.
»Wem sieht sie ähnlich?«, murmelte Dana ratlos.
»Keinem Clarke«, sagte Hugh. »Und auch keinem Joseph.
Vielleicht jemandem auf deines Vaters Seite.«
Das konnte Dana nicht beurteilen. Außer seinem Namen wusste sie so gut wie nichts von ihrem Vater.
»Sie sieht gesund aus«, sagte sie.
»Ich habe nirgends gelesen, dass die Haut bei der Geburt dunkler ist.«
»Ich auch nicht. Sie sieht wie sonnengebräunt aus.«
»Mehr als sonnengebräunt. Schau dir ihre Handflächen an, Dee. Sie sind hell – wie die Fingernägel.«
»Sie sieht südländisch aus.«
»Nein. Nicht südländisch.«
»Indisch?«
»Nein.«
»Indianisch?«
»Auch nicht. Sie sieht schwarz aus, Dana.«
Kapitel 2
Hugh hoffte, einen Scherz gemacht zu haben. Er und Dana waren weiß. Ihr Baby konnte nicht schwarz sein.
Trotzdem kroch, als er da im Kreißsaal das Neugeborene in Danas Arm musterte, ein ungutes Gefühl in ihm hoch. Lizzies Haut war wesentlich dunkler als die eines jeden anderen Clarke-Babys, das er gesehen hatte – und er hatte viele gesehen. Die Clarkes waren stolz auf ihre Sprösslinge, wie die Flut von Ferienfotos bewies, die Verwandte jedes Jahr schickten. Sein Bruder hatte vier Kinder – allesamt typisch angelsächsisch hellhäutig -, ihre Cousins ersten Grades brachten es gemeinsam auf mehr als sechzehn Kinder. Und keines davon war dunkelhäutig.
Hugh war Anwalt. Er verbrachte seine Tage damit, Sachverhalte darzustellen, und in diesem Fall gab es keine, die nahelegten, dass sein Baby alles, nur keine Weiße war. Er bildete sich das nur ein, machte aus einer Mücke einen Elefanten. Aber wer konnte ihm das verübeln? Er war übermüdet. Am Abend zuvor hatte er sich das Sox-Spiel im Fernsehen angesehen, war spät ins Bett gekommen, eine Stunde später von Dana geweckt worden und seitdem aufgedreht. Aber er hätte keine Sekunde der Geburt versäumen wollen. Zu sehen, wie das Baby auf die Welt kam – die Nabelschnur durchtrennen es gab nichts Schöneres als das.
Doch jetzt fühlte er sich seltsam leer. Dies war sein Kind – seine Familie, hatte seine Gene. Es sollte vertraut aussehen. Er hatte gelesen, was Babys bei der Geburt durchmachten, und war auf einen Eierkopf, fleckige Haut und sogar Blutergüsse vorbereitet gewesen. Der Kopf dieses Babys war rund und seine Haut makellos.
Aber es hatte weder das feine, glatte Haar noch den spitzen Haaransatz der Clarkes, noch Danas blondes Haar oder ihre blauen Augen.
Es sah fremd aus.
Vielleicht war es ja nur eine ganz natürliche Enttäuschung nach den vielen Monaten gespannter Erwartung. Vielleicht hieß es deshalb in den Büchern, dass man sein Kind nicht zwangsläufig auf den ersten Blick liebte. Die Kleine war ein Individuum. Sie würde ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen entwickeln, ihre eigenen Stärken, ihr eigenes Temperament, und all das wäre vielleicht völlig anders als bei Dana und ihm.
Er liebte sie. Ja, das tat er. Sie sah zwar nicht so aus, aber sie war sein Kind.
Demzufolge war er für sie verantwortlich. Und so folgte er der Schwester, als sie seine Tochter ins Babyzimmer brachte, und beobachtete durchs Fenster, wie eine Säuglingsschwester ihr Tropfen in die Augen gab und sie anschließend gründlich wusch.
Lizzies Haut blieb unverändert kupferfarben. Wirkte im Kontrast zu der zartrosa Decke und dem blassrosa Mützchen sogar noch dunkler.
Die Schwestern schienen Lizzies Hautfarbe nicht wahrzunehmen. Mischehen waren üblich, und die Frauen wussten nicht, dass Hughs Frau eine Weiße war. Außerdem gab es weitere dunkelhäutige Babys hier. Und im Vergleich zu ihnen war Elizabeth Ames Clarke hellhäutig.
Sich an diesen Gedanken klammernd, ging er in Danas Zimmer und begann zu telefonieren. Sie hatte recht damit, dass seine Eltern sich einen Jungen wünschten – als Eltern von zwei Söhnen hatten sie eine Vorliebe für Kinder, die den Familiennamen weitertrugen ‑, doch sie freuten sich trotzdem über die Neuigkeit, ebenso sein Bruder, und als Hugh schließlich Danas Großmutter anrief, fühlte er sich schon besser.
Eleanor Joseph war eine bemerkenswerte Frau. Nachdem sie ihre Tochter und ihren Mann im Abstand von vier Jahren durch tragische Unfälle verloren hatte, hatte sie ihre Enkelin allein aufgezogen und dazu noch ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut. Der reguläre Name lautete The Stitchery, doch es hieß bei allen nur Ellie Jo’s.
Bis er Dana kennenlernte, hatte Hugh keine Ahnung von Strickgarnen gehabt und keinerlei Kontakt zu Frauen, die damit umgingen. Noch heute konnte er sich nicht merken, was SKP war, obwohl Dana es ihm mehrfach erklärt hatte. Doch er schätzte die Wärme seines geliebten Alpaka-Schals, den sie selbst gestrickt hatte und der schöner war als alle, die er je gesehen hatte – und er schätzte die Atmosphäre des Ladens. In den letzten Wochen der Schwangerschaft, als Dana mit der Arbeit kürzertrat, verbrachte sie mehr Zeit dort, und er schaute oft vorbei. Offiziell, um nach ihr zu sehen, aber in Wahrheit, um die Ruhe zu genießen. Wenn ein Mandant ihn anlog oder ein angestellter Anwalt einen Fall vermurkste oder ein Richter gegen ihn entschied, spendete The Stitchery ihm Trost und Entspannung.
Vielleicht war es ja der Ausblick – was konnte erholsamer sein, als auf eine Obstplantage mit Apfelbäumen hinauszuschauen? -, aber Hugh glaubte, dass es die Menschen waren. Dana brauchte ihren Mann nicht, wenn sie in dem Laden war. Er war ein Treffpunkt für Frauen mit Herz. Viele von ihnen hatten selbst Kinder. Und sie zeigten ihre Gefühle. Er war schon mehrmals in Unterhaltungen über Sex hineingeplatzt, was ihn auf den Gedanken gebracht hatte, dass das Stricken für sie Mittel zum Zweck war. Diese Frauen gaben einander etwas, was sie in ihrem Leben vermissten.
Allen voran Ellie Jo. Vorbehaltlos aufrichtig, freute sie sich überschwänglich, als er ihr sagte, dass sie eine Tochter bekommen hatten, und brach in Tränen aus, als er ihr den Namen nannte. Tara Saxe, Danas beste Freundin, reagierte genauso.
Er rief die beiden Partner der Kanzlei an – die RAe Galli und Kohn von Calli, Kohn und Clarke – und seine Sekretärin, die versprach, die Neuigkeit an seine Angestellten weiterzugeben. Er rief David an, ihren Nachbarn und Freund. Er rief eine Handvoll weiterer Freunde an, seinen Bruder und die beiden Clarke-Cousins, denen er am nächsten stand.
Als Dana ins Zimmer zurückgeschoben wurde, wollte sie wissen, wie es dem Baby gehe und wann es ihr wieder gebracht würde. Sie wollte mit ihrer Großmutter und Tara telefonieren, doch die beiden waren bereits auf dem Weg. Hughs Eltern trafen als Erste ein. Obwohl es gerade mal neun war, waren sie tadellos gekleidet, der Vater in blauem Blazer und Ripskrawatte, die Mutter in Chanel. Hugh hatte keinen von beiden jemals anders als untadelig erlebt.
Mitgebracht hatten sie eine große Vase mit Hortensien. »Aus dem Garten«, sagte seine Mutter überflüssigerweise, denn sie schenkte zu allen Gelegenheiten zwischen Mitsommer und erstem Frost Hortensien. Mit den Worten, was für ein Glück dass in diesem Jahr mehr weiße als blaue blühten, da es doch ein Mädchen geworden sei, drückte sie Hugh die Vase in die Hand und reichte ihm die Wange zum Kuss, wie danach auch Dana. Hughs Vater umarmte beide überraschend herzlich und schaute sich anschließend erwartungsvoll um.
Während Dorothy Clark noch immer über die schnelle Geburt und die vielen Fortschritte in der Geburtshilfe seit der Geburt ihrer Kinder staunte, führte Hugh seine Eltern zum Babyzimmer. Sein Vater entdeckte sofort den Namen an dem Bettchen am Fenster und sagte: »Da ist sie.«
Hugh hoffte auf Entzückensäußerungen über die Schönheit seiner Tochter. Er wünschte sich, von seinen Eltern zu hören, dass Lizzie wie die Lieblingsgroßtante seiner Mutter aussehe oder der Cousin zweiten Grades seines Vaters oder einfach, dass sie bemerkenswert einzigartig sei.
Doch seine Eltern schwiegen, bis sein Vater schließlich mit ernster Stimme sagte: »Das kann sie nicht sein.«
Seine Mutter las stirnrunzelnd die Namen an den anderen Bettchen. »Sie ist die einzige Clarke.«
»Das kann nicht Hughs Kind sein.«
»Aber da steht ›Clarke, Mädchen‹, Eaton.«
»Dann ist das falsch.« Er war Historiker von Beruf – Lehrer wie Autor -, und auch bei ihm zählten nur Tatsachen wie bei Hugh.
»Sie hat ein Namensarmbändchen um«, bemerkte Dorothy, »aber darauf kann man sich auch nicht verlassen. Oprah hatte mal zwei Elternpaare in ihrer Sendung, deren Babys falsch ausgezeichnet waren. Geh doch mal fragen, Hugh. Die Kleine sieht nicht aus, als wäre sie dein Kind.«
»Das ist sie aber.« Hugh tat, als überrasche ihn ihr Zweifel.
Dorothy war verwirrt. »Aber sie sieht dir überhaupt nicht ähnlich.«
»Sehe ich dir ähnlich?«, fragte er. »Nein. Ich sehe Dad ähnlich. Und dieses Baby ist zur Hälfte Dana.«
»Aber sie sieht auch ihr nicht ähnlich.«
Ein junges Paar kam den Flur herunter und drückte sich die Nasen an der Scheibe platt.
»Ich würde das überprüfen, Hugh«, sagte Eaton mit gesenkter Stimme. »Verwechslungen passieren nun mal.«
»In der Zeitung stand gerade die Geschichte über eine Samenverwechslung, über eine Frau, die Zwillinge von einem Fremden bekam«, steuerte Dorothy bei, »und man kann das beinahe verstehen bei den Unmengen in diesen Samenbanken.«
»Das war eine künstliche Befruchtung, Dorothy.«
» Vielleicht, was aber nicht gegen eine Verwechslung spricht«, meinte sie. »Und wie man schwanger wird, müssen Söhne ihren Müttern ja nicht erzählen.«
Sie warf Hugh einen Blick zu, peinlich berührt.
»Nein, Mom«, sagte Hugh. »Es war keine künstliche Befruchtung. Und es ist keine Verwechslung. Ich war bei Dana im Kreißsaal, und es war dieses Kind, dessen Geburt ich miterlebte. Ich selbst habe die Nabelschnur durchschnitten.« Eaton war noch immer nicht überzeugt. »Bist du wirklich sicher, dass es dieses Kind war?«
»Absolut.«
»Nun«, sagte Dorothy ruhig, »was wir hier sehen, ähnelt weder dir noch sonst jemandem aus unserer Familie. Dieses Baby muss nach Danas Familie kommen. Ihre Großmutter spricht nie über Verwandte – wie viele Josephs waren einschließlich der Braut auf der Hochzeit? Drei? -, aber sie muss schließlich Familie haben, und dann ist da ja auch noch Danas Vater, um den ein noch größeres Geheimnis gemacht wird. Kennt Dana überhaupt seinen Namen?« »Sie kennt seinen Namen.« Hugh begegnete dem Blick seines Vaters. Er wusste, was Eaton dachte. Seine Eltern waren sich einig: Die Herkunft war entscheidend.
»Wir haben vor drei Jahren darüber gesprochen, Hugh«, erinnerte sein Vater ihn mit leiser, aber scharfer Stimme. »Ich riet dir damals dringend, nach ihm zu suchen.«
»Und ich lehnte es ab. Es gab keinen Grund dafür.« »Du hättest gewusst, was du heiratetest.«
»Ich habe kein Etwas geheiratet«, gab Hugh zurück, »ich habe eine Person geheiratet. Und ich dachte, wir hätten das Thema seinerzeit begraben. Ich habe Dana geheiratet, nicht ihren Vater.«
»Vater und Tochter, das kann man nicht immer trennen«, entgegnete Eaton, »und ich würde sagen, dieser Fall ist ein Beispiel dafür.«
Die Schwester rettete Hugh, als sie ihm zuwinkte und das Bettchen zur Tür schob.
Dieses kleine Mädchen war sein Kind. Er hatte es gezeugt und ihm geholfen, auf die Welt zu kommen. Er hatte die Nabelschnur durchtrennt, die es mit seiner Mutter verband. Dieser Akt besaß Symbolcharakter. Jetzt und in Zukunft hatte auch er, Hugh, eine Rolle im Leben dieses Kindes zu spielen. Der Gedanke war schon unter normalen Umständen beängstigend, und diese Umstände waren nicht im Mindesten normal.
»Freut ihr euch denn gar nicht?«, fragte er. »Zumindest für mich? Das da ist mein Kind.«
»Ist es das?«, fragte Eaton.
Hugh brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen – und dann wurde er wütend. Doch in diesem Moment schob die Schwester das Bettchen auf ihn zu. Er streckte ihr sein Handgelenk hin, damit sie das Armbändchen des Babys mit dem seinen vergleichen konnte. »Und das sind die Großeltern?«, fragte sie lächelnd.
»So ist es«, bestätigte Hugh.
»Dann gratuliere ich. Sie ist wunderhübsch.« Die Schwester wandte sich wieder ihm zu. »Hat Ihre Frau vor zu stillen?« »Ja.«
»Dann schicke ich jemanden, der ihr am Anfang hilft.« Die Tür des Babyzimmers schloss sich, und Hugh konnte aufhören, den Glücklichen zu spielen.
Er schaute seinen Vater herausfordernd an. »Willst du damit etwa sagen, dass Dana eine Affäre hatte?«
»Es sind schon seltsamere Dinge passiert«, warf seine Mutter ein.
»Mir nicht«, erklärte Hugh. Als sie ihm einen warnenden Blick zuwarf, fuhr er mit gesenkter Stimme fort: »Und auch in meiner Ehe nicht. Warum, glaubt ihr, habe ich so lange gewartet? Warum, glaubt ihr, habe ich mich geweigert, eines der Mädchen zu heiraten, die euch gefielen? Weil sonst ich Affären gehabt hätte. Es waren langweilige Mädchen mit langweiligen Interessen. Dana ist anders.« »Offensichtlich«, sagten seine Eltern wie aus einem Munde und in exakt demselben anklagenden Ton.
»Heißt das, dass ihr nicht alle Clarkes anrufen werdet, um ihnen von der Geburt meiner Tochter zu berichten?« »Hugh«, sagte Eaton.
»Was ist mit dem Country Club?«, fragte Hugh. »Glaubt ihr, sie wird dort willkommen sein? Werdet ihr sie beim Grillfest von Tisch zu Tisch tragen, um bei unseren Freunden mit ihr anzugeben, wie ihr es mit Roberts Kindern tut?«
»Wenn ich du wäre«, erwiderte sein Vater, »würde ich mir keine Gedanken wegen des Country Clubs machen. Ich würde mir Gedanken wegen der Stadt machen, in der ihr lebt, und wegen der Schulen, die das Kind besuchen wird, und wegen seiner Zukunft.«
Hugh hob die Hand. »Du sprichst mit jemandem, dessen Partner kubanischer und jüdischer Herkunft sind, dessen Mandanten größtenteils Minderheiten angehören und dessen Nachbar Afroamerikaner ist.« »Wie dein Kind«, sagte Eaton.
Hugh atmete tief durch, um sich zu beruhigen, doch es half nichts. »Ich sehe keine schwarze Haut in diesem Babyzimmer. Ich sehe braune, weiße, gelbe und alle Zwischentöne. Meine Tochter hat also getönte Haut. Na und? Darüber hinaus ist sie auch noch wunderschön. Solange ihr das nicht zu mir sagen könnt, solange ihr das nicht zu Dana sagen könnt, bitte ich euch ...«Er ließ den Satz unbeendet, schaute seine Eltern einen Moment lang schweigend an und schob dann das Bettchen den Flur hinunter.
»Worum bittest du uns?«, wollte Eaton wissen, der ihn mit ein paar Schritten einholte. Er hatte Hughs lange Beine. Genauer – und korrekter – gesagt, hatte Hugh Eatons lange Beine.
Dass ihr nach Hause fahrt. Dass ihr eure hässlichen Gedanken für euch behaltet und mich und meine Frau und unser Kind in Ruhe lasst,
Hugh sprach nichts davon aus, doch seine Eltern hörten es trotzdem. Als er vor Danas Zimmertür ankam, war er allein mit dem Baby.
Kapitel 3
Dana sah Hugh auf den ersten Blick an, was passiert war. Sie hatte also recht gehabt. Hughs Eltern waren rechtschaffene Leute. Sie spendeten reichlich für ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen, die Kirche bekam den größten Anteil, und zahlten gewissenhaft ihre Steuern. Aber sie liebten ihr Leben, wie es war. Veränderungen jeglicher Art bedeuteten eine Bedrohung. Dana hatte sich sehr beherrschen müssen, um sich nicht zu dem Aufruhr zu äußern, der entstand, als die alte Südküstenstadt der Clarkes trotz des erbitterten Widerstands von Eaton, Dorothy und weiteren hochkarätigen Persönlichkeiten, die eher verhungern würden als einen Big Mac zu essen, dafür stimmte, einer Fastfood-Kette die Eröffnung eines Ladens zu gestatten.
Dana liebte Big Macs. Dass ihre Schwiegereltern es nicht taten, das hatte sie schon vor langer Zeit akzeptiert.
Es kümmerte sie nicht, was Hughs Eltern dachten. Aber es kümmerte sie, was Hugh dachte. So eigenständig er war – seine Eltern konnten ihm durchaus die Laune verderben.
Und das hatten sie offensichtlich getan. Er wirkte geistesabwesend und wütend, und das zu einer Zeit, da er sie glückstrahlend in die Arme nehmen und ihr seine Liebe beteuern sollte, wie er es im Augenblick der Geburt des Babys getan hatte.
Dana sehnte sich danach und war tief enttäuscht. Er hatte das Baby mitgebracht, und sie wollte es in den Arm nehmen, verspürte das Bedürfnis, ihre Tochter zu beschützen, sogar vor ihrem eigenen Vater, wenn nötig.
Als sie sich aufsetzen wollte, bedeutete Hugh ihr, liegen zu bleiben. Seine Hände wirkten im Vergleich zu dem Baby grotesk groß. Als er ihr die Kleine gab, drückte sie sie behutsam an sich und genoss ihre Wärme. Abgesehen von Salbenresten in den Augenwinkeln war das Gesicht sauber und glatt. Dana war wie verzaubert.
»Schau dir die Bäckchen an«, flüsterte sie. »Und den Mund. Alles ist so zart.« Sogar die Hautfarbe war es.
Vorsichtig nahm sie eines der Händchen und beobachtete, wie die Finger des Babys einen Moment lang in der Luft herumtasteten, bis sie sich um ihren Daumen schlossen. »Haben deine Eltern sie auf den Arm genommen?« »Diesmal nicht.« »Sie sind irritiert.« »Könnte man sagen.«
Dana schaute zu ihm auf. Sein Blick blieb auf das Baby geheftet.
»Wo sind sie jetzt?«, fragte sie.
»Nach Hause gefahren, nehme ich an.« »Sie geben mir die Schuld, stimmt’s?« »So würde ich es nicht ausdrücken.«
»Aber es trifft zu. Ich kenne deine Eltern. Unser Baby ist dunkelhäutig. Sie wissen, dass das nicht aus eurer Familie kommen kann, also muss es aus meiner kommen.«
Er hob den Blick. »Und – tut es das?«
»Möglich wäre es«, antwortete Dana leichthin. Sie war mit Fragen aufgewachsen, auf die sie keine Antwort bekam. »Ich habe ein Foto von meinem Vater. Du kennst es. Er ist so hellhäutig wie du und ich. Aber wer weiß schon mit Sicherheit, was zwei oder drei Generationen zuvor passierte?«
»Ich.«
Ja, stimmte Dana ihm im Stillen zu. Die Clarkes wussten es. Die Josephs unglücklicherweise nicht. »Deine Eltern geben also mir die Schuld. Sie haben etwas Bestimmtes erwartet und etwas anderes bekommen. Sie sind nicht glücklich über unsere Tochter, und sie geben mir die Schuld. Tust du es auch?«
»Schuld ist das falsche Wort – es setzt eine Verfehlung voraus.«
Dana schaute auf das Baby hinunter, das ihr geradewegs in die Augen zu blicken schien. Es strahlte Frieden und Zufriedenheit aus. Elizabeth Ames Clarke hatte etwas Besonderes, und wenn das auf Genen beruhte, mit denen sie nicht gerechnet hatten, dann sollte ihr das recht sein. Die Kleine hatte keinen Makel. Sie war absolut vollkommen.
»Das hier ist unser Baby«, sagte Dana in flehendem Ton. »Ist die Hautfarbe wichtiger als die Augenfarbe oder die Intelligenz oder das Temperament?«
»In diesem Land, auf dieser Welt – ja.«
»Das werde ich nicht akzeptieren.«
»Dann bist du naiv.« Gereizt stieß er die Luft aus und strich sich die Haare aus dem Gesicht, doch die kurzen Strähnen, die ihm für gewöhnlich in die Stirn fielen, blieben auch jetzt nicht hinten. Als sein Blick ihrem begegnete, war er ausdruckslos. »Meine Mandanten entstammen sämtlichen Minderheiten, und die Afroamerikaner sagen übereinstimmend, dass sie es schwer haben. Es ist besser geworden, und es wird weiter besser werden, aber es wird nicht wirklich gut – zumindest nicht, solange du und ich leben.«
Dana ließ es dabei bewenden. Hugh war einer der tolerantesten Menschen, die sie kannte. Wenn er das sagte, dann war es eine Feststellung. Eine Feststellung, die auf Tatsachen und nicht auf Vorurteilen basierte.
Vielleicht war sie ja wirklich naiv. Das Baby war ihr bereits vertraut, obwohl sie auch mit größter Mühe kein Detail an ihm entdecken konnte, das an Hugh oder sie erinnerte.
Sie sann gerade darüber nach, als sich die Tür öffnete und ihre Großmutter den Kopf hereinstreckte. Als Dana ihr Gesicht sah, vergaß sie alles andere, empfand nur noch reine Freude. »Komm sie dir anschauen, Gram!«, rief sie. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als die Frau, der sie vertraute wie keinem anderen Menschen, auf sie zukam.
Mit vierundsiebzig noch immer eine attraktive Erscheinung, trug Ellie Jo ihr dickes graues Haar zu einem Knoten geschlungen, den zwei Bambusnadeln an Ort und Stelle hielten. Ihre Haut war glatt und ihr Rückgrat noch kräftig genug, um ihren Körper aufrecht zu halten. Sie sah aus, als habe sie ein stressfreies Leben geführt, doch der Schein trog. Sie war eine Meisterin des Überlebens geworden, hauptsächlich weil sie sich – und Dana – ein sinnvolles, produktives und ehrfurchtvolles Leben aufgebaut hatte.
Strahlend trat sie ans Bett, und ihre Hand zitterte, als sie die zartrosa Decke behutsam zur Seite zog. Dana hörte, wie sie den Atem anhielt und dann langsam ausstieß. »Du meine Güte, Dana Jo! Sie ist das hübscheste kleine Ding, das ich je gesehen habe!«
Dana brach in Tränen aus. Sie schlang ihren freien Arm um den Hals ihrer Großmutter und klammerte sich schluchzend an sie. Ellie Jo hielt Dana in einem Arm und das Baby im anderen, bis die Tränen versiegten.
Schniefend griff Dana nach einem Papiertaschentuch und putzte sich die Nase. »Entschuldige.«
»Das sind die Hormone«, konstatierte Ellie Jo und wischte ihr mit dem Daumen die Tränen unter den Augen weg. »Wie fühlst du dich?«
»Wund.«
»Eis, Hugh!«, kommandierte Ellie Jo. »Dana muss auf etwas Kaltem sitzen. Schaust du mal, was du kriegen kannst?« Dana sah ihrem Mann nach, bis die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte. Dann wandte sie sich wieder ihrer Großmutter zu. »Was meinst du?«
»Eure Tochter ist eine Schönheit.«
»Was sagst du zu ihrer Hautfarbe?«
Ellie Jo versuchte nicht zu leugnen, was sie beide deutlich sahen. »Ich finde, die Hautfarbe macht einen Teil ihrer Schönheit aus – aber wenn du mich fragst, woher sie sie hat, dann muss ich passen. Als deine Mutter mit dir schwanger war, scherzte sie immer, dass sie keine Ahnung hätte, was dabei herauskommen würde.«
»Gab es auf eurer Seite der Familie irgendwelche Unklarheiten?«
»Unklarheiten?«
»Unbekannte Wurzeln, wie zum Beispiel eine Adoption?« »Nein. Ich kannte meine Eltern. Und mein Earl kannte seine ebenfalls. Aber deine Mutter wusste so wenig über deinen Vater.« Während sie sprach, spähte sie unter die winzige blassrosa Mütze. »Schau dir diese Löckchen an!«, flüsterte sie hingerissen.
»Mein Vater hatte keine Locken«, sagte Dana. »Er sah nicht wie ein Afroamerikaner aus.«
»Das tat Adam Clayton Powell auch nicht«, erwiderte ihre Großmutter. »Viele schwarze Gruppierungen mieden ihn, weil er so hellhäutig war.«
»Akzeptierten ihn die Weißen denn als ihresgleichen?« »Größtenteils.«
Also nicht alle, schlussfolgerte Dana im Stillen. »Hugh ist irritiert.«
»Sprichst du von Hugh oder von seinen Eltern?«
»Von seinen Eltern – aber es hat auf ihn abgefärbt.« Wieder füllten Danas Augen sich mit Tränen. »Ich möchte, dass er sich freut! Sie ist doch unser Baby!«
Ellie Jo streichelte sie eine Weile beruhigend und sagte dann: »Er freut sich, glaub mir – er kann nur nicht so schnell akzeptieren, was er sieht. Wir sind flexible Menschen, du und ich – er war darauf fixiert, einen typischen Ames-Clarke-Spross zu sehen.«
»Er wird keine Ruhe geben, bis er die Erklärung für Lizzies Aussehen gefunden hat«, prophezeite Dana. »Und das bedeutet, dass er sich unseren Stammbaum vornimmt. Möchte ich das? Möchte ich nach all dieser Zeit meinen Vater finden?«
»Hey!«, rief es fröhlich von der Tür her.
Tara Saxe war Danas beste Freundin, seit sie beide drei Jahre gewesen waren. Sie hatten gemeinsam den Tod ihrer Mütter durchlitten, endlos erscheinende Schuljahre, die Verehrung pickeliger Teenager und die Phase, in der sie nicht wussten, was sie werden wollten. Tara hatte gleich nach dem College einen Pianisten geheiratet, der damit zufrieden war, in dem Haus zu leben, in dem sie aufgewachsen war, sie hatte drei Kinder unter acht Jahren, einen Abendschulabschluss als Buchhalterin und einen Teilzeitjob, den sie hasste, ohne den sie und ihre Familie jedoch nicht existieren könnten. Das einzig Chaotische an ihr waren ihre braunen, kinnlangen, so gut wie nie gekämmten Locken. Ansonsten war sie eine Perfektionistin, die die Jongleurnummer mit den zahlreichen Bällen ihres Lebens bravourös meisterte.
Darüber hinaus war sie auch noch eine passionierte Strickerin und Danas begeisterte Partnerin beim Kopieren neuer Designermodelle. Zu Beginn jeder Saison durchforsteten sie die exklusivsten Geschäfte für Damenbekleidung in Boston und machten sich Notizen. Anschließend, obwohl sie beide Jobs hatten und eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, kreierte Dana Muster, die sie dann beide strickten, gelegentlich den gleichen Pullover mehrmals, jedoch in verschiedenen Farbstellungen oder Größen. Taras Meinung zu den Varianten zeigte Dana und – noch wichtiger – Ellie Jo, ob die jeweilige Version für den Laden in Frage käme.