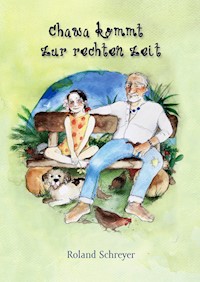Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Chawa und Robin haben das Abitur geschafft und bekommen die Teilnahme an einem Folkfestival an einem bayrischen Waldsee geschenkt. Die beiden 18-Jährigen, sie aus Schweden, er aus Hannover, kennen sich von früher. Sie hatten sich aus den Augen verloren. Ein Bayernhaus ist für das Wochenende gemietet. Unsicher knüpfen die zwei an der früheren Vertrautheit an. In die vorsichtige Annäherung bricht ein Nazi-Pärchen ein. Das Festival bietet in drückender Hitze Höhen und Tiefen. Undurchsichtige neue Freunde machen sich an die beiden heran. Sängerinnen aus St. Petersburg nehmen sie in ihrer Mitte auf. Die Nazis haben grausame Pläne. Ein verständnisvoller Lebensphilosoph weicht nicht von ihrer Seite. Aller Trubel, alle Widrigkeiten und alles Großartige nehmen den beiden die Scheu voreinander und schweißen sie zusammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allein schon die Gerüche! Wer in Hannover am Sallplatz wohnt, vierte Etage, und wem von der Straßenkreuzung her der Gestank und das Aufheulen der Motoren und das Quietschen der Bremsen und das gellende Tatütata von Feuerwehr, Rettung und Polizei ins offne Fenster schwappen, der hat im Bayernland das große Los gezogen, dachte Robin im Überschwang. Ja, sogar die Luft wirkt wie frisch gewaschen.
Mitten im Dorf, wo eine hölzerne Kioskbude mit Backwaren stand und daneben auf einem kleinen Parkplatz gockelnde Halbmänner an tiefergelegten Audis und BMWs lehnten, da hatten sie die breite Straße nach Starnberg verlassen und waren in eine schmalere eingebogen, An der Ewigkeit beschildert. Es ging kurvig dem Wald zu, über dem ein Bussard seine Kreise zog. Oder ein Habicht.
Chava fuhr vorneweg. Chava mit Zotteldutt. Manchmal sah sie sich nach ihm um, dabei driftete ihr Rad zur Straßenmitte. Das war riskant, denn hin und wieder überholten Autos, die die Kurven schnitten wie Rennfahrer.
Am Morgen noch gehörte das Gebimmel der Kuhschellen von den Wiesen im Westen her zur Dauerbeschallung. Allmählich war es verstummt. Als sie nachmittags losfuhren, lagen die Kühe an schattigen Plätzen und käuten träge wieder. Träge auch bimmelten die Schellen.
Robin wusste nicht, woran es lag: Chava anzusehen war ihm gestern und heute schwergefallen. Vor drei Jahren war das anders, alles war einfacher, dort in Greifswald, im kleinen Hafen der Ryck, als sie zusammen auf dem Deck des Seglers Dakota Liberty lagen und mal über Stockholm, mal über Hannover redeten. Oder über ihre Mütter, die besten der Welt. Und mal ins Wasser sprangen und um die Wette schwammen. Jetzt erschien das Damals schwerelos und das Jetzt bleischwer.
Auch wie sie sich damals geküsst hatten. Ohne nachzudenken. Ihre Augen hatten geglänzt, ihre magischen Augen. Und wie die halbnassen Haare wirr das braune Gesicht eingerahmt hatten. Alles war leicht und hell.
Er hatte sich Germans Rad ausgeliehen. Der zweite Gang hielt ein paar Meter, sprang dann raus. Ähnliches passierte beim dritten Gang. Nur der Berggang blieb drin. Immerhin fuhr das Ding.
Damals, nach den Sommertagen in Greifswald, hatte es über ein Jahr gedauert, bis er aufhörte, von ihr zu träumen. Dann wurde ihm das Erlebte unvorstellbar. Auch jetzt. Obwohl sie sich unbefangen bewegte. Offenbar noch immer ohne Bewusstsein davon, wie verwirrend sie wirkte. Verwirrender noch als früher. Sah er sie an, war er voll Scheu. Bestimmt fiel das auf.
Die Straße roch nach heißem Teer. Ein Weizenfeld rechts streckte sich sandgelb mit roten und blauen Sprenkseln darin und roch nach Erde und Kornblumen und Mohn. Von der Weide links kam es feucht herüber, es roch nach Gras und dumpf nach Kühen. Germans klappriges Fahrrad roch nach Rost.
Ganz fern im Süden sah man die Alpen, elefantengrau und gigantisch. Ein bisschen erinnerte das Wettersteingebirge auch an eine kaputte Zahnreihe. Wie Herr Wiechmann, sein Zahnarzt, ihn, das Kind, zu gewissenhafter Zahnhygiene gemahnt hatte, schoss ihm bei dem Anblick durch den Kopf. Ritsche, ratsche, hin und her, Zähneputzen is nich schwer.
Der Picknickkorb auf ihrem Ständer verrutschte.
»Halt mal!«, rief Robin.
»Warum?« Sie sah zurück und machte dabei wieder den gefährlichen Schlenker.
»Der Korb verrutscht!«, rief er.
Sie stieg vom Rad und blickte sich um. Er richtete die Haltebänder neu, mit denen der Picknickkorb auf ihrem Gepäckträger befestigt war. Er beobachtete sie, als sei dazu noch keine Gelegenheit gewesen. Sie war verändert. Anders als er sie in Erinnerung hatte, dachte er. Atemberaubend anders. Absolut die Sunny, würde Orhan sagen.
»Schön hier!« Ihr Blick wanderte. »Die Vögel … Die Sonne … Über den Wiesenblumen summen Bienen. Cowbells klocken. Bisschen Wind … Die Alpen … Himmlisch!« Sie wandte sich zum Dorf zurück. »Hej, und unser Haus – so gemütlich. Zugewachsen mit Efeu und Wein. Wie das lite Hus meines Großvaters in Spanien.«
»Efeu – na ja …«, sagte er ungewollt schroff. War er eifersüchtig auf ihre schönen Erinnerungen?«
»Warum fährst du eigentlich wie ne Schnecke?«, fragte sie. »Wir brauchen ewig. Moa tritt um vier auf.«
»Die schaffen wir locker«, beruhigte er sie. »Übrigens tret ich wie’n Bekloppter in die Pedale. Die Schaltung ist Murks. Gibt nur noch den kleinen Gang. Ich glaube, German mag es schweißtreibend.«
Sie stieg auf. Ihre abgeschnittenen Jeans endeten oberhalb der Knie. Sie hatte leicht gebräunte Beine.
»Apropos ewig«, sagte Robin, das Weiterfahren hinauszögernd, »das passt doch zum Namen der Straße hier.«
Sie lachte kurz. Es war ein ruhiges, sanftes Lachen. »Komischer Name für ne Straße, stimmt.«
»Hab ich auch gesagt, als German mir den Weg erklärte. Die Bauern nennen den Wald da vorn Ewigkeit, weil es darin Toteislöcher gibt. Früher waren das kleine Seen. Gletscherreste eben. Jetzt sind es Kuhlen ohne was drin. Alles schon ewig. Hier tobte das Leben. Er, sagte German, er fühle sich, wenn er hier vorbeikomme, wie ein Zufälliger. Wir Menschen seien beliebige Gäste. Der Wald auf der rechten Seite übrigens sei eigentlich ein Gräberfeld, sagte German. Aus der Eisenzeit.«
»Damit kenn ich mich nicht aus.«
Wahrscheinlich wollte sie von all dem nichts wissen. Gegen das Licht war ihre Bluse fast durchsichtig. Darunter trug sie ein schlichtes Unterhemd.
»Ungefähr vor 2500 Jahren war hier alles besiedelt«, brachte er sich auf blusenlose Gedanken. »Man betrieb Ackerbau. Und man bestattete die Toten in Hügelgräbern. Frauen, Männer, Kinder, mit Waffen und Schmuck.«
»Sagte German«, ergänzte sie ihn. »Der hat hier bestimmt über jeden Stein was zu erzählen. Schade, ich hab ihn manchmal nicht verstanden«, bekannte sie.
»Ging mir auch so. Immer, wenn er Fränkisch gesprochen hat: No fraali, Gitti, mei Schpoz, mei glanna.«
»Klingt für mich wie Papageiensprache. Und witzig, wie er sein Gedicht vom korsischen Rosé-Wein vorgelesen hat. Wanns finschter wird in Höherai do konnscht prima luschti sei.«
»Nee, dass du dir das gemerkt hast«, wunderte sich Robin, auf dem hochgeschraubten Sattel sitzend und sich mit den Zehenspitzen im Gleichgewicht haltend. »Übrigens hat heute Morgen vor der Abfahrt eine ferne Verwandte angerufen. Sie wolle zum Übernachten vorbeikommen, sagte German. Er: Das komme nicht in die Tüte! Etz langts! Das Haus sei vermietet, solang er und Gitti auf Korsika seien. Das sollten wir der Verwandten sagen, wenn sie wieder anrufe. Naa, de Weibertsche daung scho ollamidanandnix!, hat er geschimpft und gelacht.«
Chava lachte auch. Sie fuhren weiter. Wer weiß, dachte Robin, ob er German richtig verstanden hatte. Der wollte mit seinem Campingbus losfahren, in eins durch bis Livorno. Doch über Nacht hatte ihn ein blauer Kleinbus zugeparkt. Viel Mileckstamarsch-Gefluche war die Folge. Dann, fertig mit der Kutschiererei und völlig ausgewechselt, hatte German ihm zugenickt. »’s wead scho!«, hatte er gesagt.
Robin war schon mal besser drauf gewesen. Im Nebenhaus war es nachts laut zugegangen. Schuld waren wohl die Insassen des blauen Kleinbusses, eines Russenautos laut Kennzeichen. Türenschlagen hatte ihn geweckt, Stimmengewirr, Poltern, Klospülung und wieder Türenschlagen und Poltern. Da ging es treppauf und treppab.
Das Schild Fremdenwohnung am Gartenzaun, heute Morgen entdeckt, hatte alles geklärt.
Er musste doppelt so oft wie Chava in die Pedale treten und sah zu, dass er nicht aus der Puste kam, die Blöße wollte er sich nicht geben.
Kurvig und auf- und abwärts ging es vorbei an Kuhweiden voller Blumen im Grün, weiß und blauviolett und rosarot und fettglänzend leuchtendgelb, und an kindsgroßen Mais-Armeen. Hatten sie die Straße für sich, hörte man eine Lerche. Robin mochte das Surren der Reifen auf dem Asphalt. Irgendwas an der Hinternabe knirschte, als zerdrücke man Nussschalen. Da war auch noch das feine Tickern der Nabenschaltung im Leerlauf.
»Sieht aus wie bei uns, so hügelig«, rief Chava. »Eiszeitlandschaft, ja?«
»Muss wohl«, antwortete er. Mehr nicht, denn ein VW-Camper ratterte vorbei, bremste quietschend und bog auf den Behelfsparkplatz ein, auf die Wiese vor dem Gräberwald. Eine Menge Autos stand da in unordentlichen Reihen, oder sie kurvten herum. Es war laut, es stank. Die Ausgestiegenen waren hektisch, liefen auf der Ewigkeits-Straße weiter und in den Wald hinein. Viele mit Kühltaschen und Decken, einige mit Zelt und Schlafsack. Andere mit Schlauchboot. Kinder rannten hin und her. Provisorische Wegweiser Open-Air Festival und Buchsee 400 m gaben die Richtung an. Der Wald war dunkel und kühl. Krähen krächzten.
Mitten im Wald bog die See-Zufahrt von der Straße ab. Zwei Security-Gestalten im Türsteherformat und ein handgemaltes Verbotsschild zwangen Motorisierte zu komplizierten Wendemanövern. Das steigerte die Nervosität. Manche sahen aus, als fürchteten sie, das Festival zu verpassen.
Es roch modrig. Unruhe auch über den ausladenden Wipfeln. Die Krähen wirbelten durcheinander und schrien aggressiv.
Chava und Robin kamen nur im Schritttempo voran. Noch eine Stunde bis zum Beginn. Und der erfolgte gleich mit Chavas Liebling Moa, deretwegen sie sich überhaupt nur auf das Bayernabenteuer eingelassen hatte.
Das jedenfalls, Moa hier und Moa da, hatte Chava sie gestern Abend wissen lassen, als Gitti und Robin sie mit dem Auto von der S-Bahn in Icking abgeholt hatten. Chava hatte ihn angesehen mit einem Gesichtsausdruck, als habe er sich gestern erst verabschiedet. Als sei nichts geschehen. Aber auch, als erwarte sie was Besonderes.
Das lähmte ihn noch mehr. Dabei war er wie vom Blitz getroffen. Er konnte sich das nicht erklären. Vielleicht war es das Beben in ihrer Stimme und ihr entwaffnendes Lächeln. Oder weil alles wieder hochkam, weil doch nichts vorbei war. Er hatte sicher bescheuert dreingesehen.
Gleich aber hatte sie über den weißblauen Button Ingen plast!, der ihr Shirt zierte, und über die spannenden Aktionen ihrer Widerstandsgruppe berichtet. Und Bella, ihre Mutter, erklärte die aufgedrehte Chava dann auch noch während der kurzen Fahrt, habe sie mit diesem Bayern-Event zum bestandenen Abitur belohnen wollen. Und dann – Robin wusste das ja alles – habe Bella mit seiner Mutter Phili vereinbart, dass ihre Kinder das doch gemeinsam erleben könnten. Danach habe Bellas allmächtiger Vater Harry Voss seine Verbindungen spielen lassen, und schon sei das zeitweilig zu mietende Ferienhaus Lüberl gebucht gewesen. Nahe dem Festival und erschwinglich. Das einzige Risiko seien die Kinder, also sie. Würden sie miteinander klarkommen? Das seien Philis Bedenken gewesen.
Was ihn anging, dachte Robin, waren die angebracht, die Bedenken. Gut, er hatte sich trotzdem darauf eingelassen. Auch sein Freund Orhan hatte ihm zugeredet. Dass vor drei Jahren Chava ihn gegen diesen Brasilianer drangegeben habe, sei echt fies gewesen. Aber so richtig seien sie ja noch nicht zusammengewesen, oder? Und jetzt, die paar Tage … Mach was draus!, hatte ihn Orhan, der nie was anbrennen ließ, ermuntert.
Chava war nicht zu durchschauen. Er war jedenfalls, wie gesagt, sofort wieder hin und weg, leider, wie damals, oben an der Ostsee. Als sie nämlich aus der Bahn stieg, den Rucksack geschultert, standen sie sich erst zögerlich gegenüber. Da hatte er die Hand ausgestreckt, und sie hatte ihm die ihre gegeben, die in seiner Pranke verschwand. Und urplötzlich hatte merkwürdigerweise er ein Gefühl der Geborgenheit. Vielleicht weil sie lächelte. Weil sie strahlte. Völlig uneitel. Da umarmte er sie. Seine Arme umschlangen sie und den sperrigen Rucksack. Das war wirklich ungeschickt. Beide mussten lachen. Und Amadeo, der Austausch-Brasilianer, den sie und ihre Klasse ein ganzes Jahr betreut hatten, damals, und den sie im Sommer darauf, als sie drei, Bella, Chava und er, eigentlich zu einem Segelturn durchs Mittelmeer hatten aufbrechen wollen, nur sie drei, den sie da unbedingt aber hatte mitnehmen wollen, weshalb er, der verratene Robin, lieber zurückgetreten war, endgültig, was ihm unausweichlich schien, damals, dieser Amadeo also war gerade völlig verschwunden. Adios Amadeo!
Sie wiesen bei einem Kontrolleur ihre Karten vor und stellten die Räder bei den anderen Rädern ab, noch außerhalb des weitläufigen Festival-Geländes, hinter einem Bauern-Gehöft, dessen Wohnhaus oben, wie im Bilderbuch, urbayrisch von Holzbalkonen umgeben war.
In einem Nebengebäude muhten Kühe. Ein anderes, kleines Gebäude war zu einem Kiosk umgerüstet. Biertische und -bänke reihten sich davor. Dort saßen welche, die Würstl mit Kartoffelsalat oder Streuselkuchen aßen oder Kaffeeplörre tranken oder Bier. Unweit davon hatten ein paar Leute Decken mit Selbstgebasteltem darauf ausgebreitet. Esoterische Schriften gab es. Schmuck und Selbstgebackenes und bedruckte Shirts und Ansteckbuttons. Der Schmuckhändler saß gekrümmt. Er trug eine superweite Aladinhose, nichts sonst, und bastelte Ohrgehänge.
Schlangen bildeten sich vor den ungegenderten Dixi-Klos hinter dem Kiosk. 50 Cent kostete die Benutzung. An der Klofrau führte kein Weg vorbei. Immer wieder gab sie mit Zeterstimme Kommandos: »Haxn aufn Boden, ned auf de Bruin! Pfui Deifi! Brunzn im Hogga! Host mi?«
Etwas zurückgesetzt standen zwei Großzelte. Head Office verhieß ein Schild am ersten, Medical Service am zweiten. Neben dem Head Office parkten ein paar Autos. Privilegierte. Hinter einer dünnen Hecke erstreckte sich eine Wiese mit unzähligen Zelten darauf. Das war ein völliges Durcheinander, gruppiert um einen Toilettenwagen und ein großes Badmobil.
Zwischen Bauernhof und Zeltlager standen da, wo jeder vorbeimusste, zwei junge Frauen und hielten ein Transparent hoch und verteilten Flyer. Eine der beiden glich haargenau Violetta, der Aktivistin aus seiner Klasse, der blonden und klugen und bescheidenen Violetta, von den einen als Weisheitszahn de luxe respektiert, von den anderen als Jean d’Arc angehimmelt. Sein Freund Orhan, dessen Schwester Seray und er hatten sie bei den Demos gegen Kernkraft und fossile Brennstoffe begleitet. Violetta Hjertefölge, die Tochter eines norwegischen Baubiologen und einer deutschen Gewerkschafterin. Er bewunderte sie, was Seray akzeptierte, denn Violetta stritt auch für die Frauenrechte der Migrantinnen.
Das fiel Robin blitzartig ein, als er auf Violetta zusteuerte, um sie mit einem lässigen Ej, du zu umarmen. Doch da hörte er sie zu der anderen Frau, die ein Baby im Tragetuch vor der Brust trug, Vui los heid sagen. So was hätte seine Violetta bestimmt nicht über die Lippen gebracht. Sie war es nicht. Irre, diese Ähnlichkeit. Er nahm wortlos einen Flyer, in dem die Risiken des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat aufgelistet waren, und lächelte die Frau unwillkürlich an, was die auf typisch violettamäßige Weise beantwortete, spröde und doch herzlich. Weiß der Himmel, wie sie das genau so zustandebrachte.
In dem Moment war er auch wieder da, der Abschiedsschmerz, den er beim letzten Treffen seiner Klasse gespürt hatte, wo ihm klar geworden war, dass sie sich in alle Himmelsrichtungen entfernten. Violetta hatte in die Arabischen Emirate gewollt. Warum eigentlich?
Der Buchsee lag in einem Trog und war gut 100 Meter breit und 200 Meter lang. Bis auf einen kiesbestreuten Einstieg war das Seeufer von Schilf eingenommen. Rings um den See stieg das Gelände sanft an und war Liegewiese, gemäht und vertrocknet. Und die war dicht bevölkert, sehr dicht. Tausende lungerten da herum und warteten.
»Hätte nicht gedacht, dass das so galaxomäßig voll ist«, sagte Robin. Chava zuckte mit den Schultern.
»Stell dir vor, gerade dachte ich, meine süße Freundin Luna sei da.« Ihr Finger zeigte zum Kiosk. »Die Blonde mit der Scheitelfrisur. Rote Shorts.«
Robin entdeckte die Beschriebene. Sie sah tatsächlich süß aus. Ein Blickfang. Aber er hatte ja nur Augen für Chava.
»Mir gings auch so«, meinte er und wies auf die bayrische Violetta. »Ich hielt sie für eine aus meiner Klasse.«
»Witzig. Luna hat mich gestern Mittag zum Flughafen gebracht, am Abend haben wir telefoniert. Jetzt ist sie mit ihren Eltern im Sommerhaus in Sandhamn. Sie ist nicht so brunbränd wie die Frau dort.«
»Womöglich haben wir alle mehrere Doubles irgendwo in der Welt«, spekulierte Robin.
»Cool!«, freute sich Chava, »ich will alle Robins.«
Zog sie ihn schon wieder auf? Genügte er allein ihr nicht? Oder war er auf dem falschen Dampfer, und sie hatte ein liebes Kompliment gemacht? Wohl kaum.
Auf der Wiese gab es lichte Flecken, einen davon steuerten sie an. Von da aus, über den See hinweg, würden sie einen guten Blick auf die Bühne haben. Um die Wiesen herum erhob sich ein Waldgürtel, Büsche erst, dahinter Birken, danach Fichten und Buchen. Der Ewigkeitswald.
»Schön hier«, sprach Chava wieder aus, was er auch dachte. Nur die vielen Leute störten. Das sagte er natürlich nicht. Sie könnte ihn für den Freak halten, der er vielleicht war.
Während sie ihre Decke in einer Lücke ausbreiteten, machte sich Chava laut Gedanken, weshalb ihre Moa gleich zum Auftakt hatte drankommen wollen. Wahrscheinlich hatte sie am Abend einen weiteren Auftritt. Was schade wäre, denn gern hätte sie sich mit ihr zusammengesetzt: beide fern der Heimat.
»Meinst du, sie würde das mitmachen?«
»Hej, ja, sie ist zwar in Skandinavien ein Star. Aber du musst wissen, dass sie am Anfang ihrer Karriere kein Geld hatte, deshalb war sie an unserer Schule …«
»… an der DSS …«, schob er schnell ein, um zu zeigen, dass er sich das Wenige, das sie ihm vor Jahren mitgeteilt hatte, trotz allem gemerkt hatte.
»Genau, der Deutschen Schule Stockholm. Da war sie eine Art Assistant Teacher. Ich war in ihrem Musikkurs. Vielleicht kennt sie mich noch. Damals mochte sie mich. Ich sie auch.«
»Versuchs einfach«, ermutigte er sie und packte weiter den Picknickkorb aus. Das erforderte nicht viel Zeit. Da waren nur die Brezeln mit Butter, die aber geschmolzen war. Und die Brote mit Leberwurst und Erdnussmus. Dazu Wasserflaschen. Verglichen mit dem, was ihre Nachbarn links und rechts vor sich ausgebreitet hatten, war das mickrig. Sie waren aber auch noch nicht zum Einkaufen gekommen. Da war zuviel los. Die Abfahrt der Lüberls in der Morgendämmerung, danach noch mal in die Kiste, dann das Sturmklingeln von Sir Ivanhoe, dem Schwarzen Ritter, einem Unbekannten in schwarzer Motorradkluft. Doch entpuppte der Ritter sich nach Abnahme des Helms als Olga Schepp aus der nördlichen Nachbarschaft jenseits der großen Blumenwiese. Sie, die ein faltiges braunes Gesicht hatte, sie hatte mitgeteilt, dass sie auch einen Schlüssel zum Haus habe, für den Notfall, und dass sie jetzt nach Berg fahre und ob sie was mitbringen solle. Sein Gestammel, das in einem Ich-weiß-Nicht endete, hatte sie sich angehört, hatte wohlwollend genickt und den Helm übergestülpt und war abgebraust. Dann Frühstück und stockendes Erzählen und das Klingeln des östlichen Nachbarn, des Herrn Leopold, der den Starnberger Merkur brachte und ebenso hilfsbereit fragte, ob er was tun könne für die jungen Leute.
Und nebenan waren das Poltern und Stimmengewirr erwacht, manchmal in Stimmübungen und Trällern mündend. Und das beharrliche Telefonklingeln im Flur, auf das sie nicht reagierten – eingedenk der Ermahnungen Germans. Bis es Robin zu viel wurde und er gegen Mittag abhob und einen Hans Hörrel in der Leitung hatte, der vom Großvater der Chava Tronki, Harry Voss aus Greifswald nämlich, sprach, seinem Freund. Er komme stellvertretend vorbei, sagte der Anrufer, um seine Hilfe anzubieten.
Robin hatte ein ungutes Gefühl: Heute gehe es auf keinen Fall!, wies er den hartnäckigen Anrufer ab. Doch auf den morgigen Vormittag, 11 Uhr, musste er sich einlassen.
Die Stunden waren verflogen. Aufgebraucht auch von den mysteriösen Männern, die dem grellgelben Rüttelmonster entstiegen waren. Das waren zwei Niederländer in grellgelber Montur, die plötzlich auf der Terrasse standen. Genau von hier aus müssten sie die seismischen Wellen mit ihrem Geophon messen, behaupteten sie, das Echo auf die Erschütterungen, die ihr Rüttler draußen an der Kreuzung in die Tiefe schicke, Schwingungen, die die Bodenverhältnisse bis in 5000 Meter Tiefe nachzeichneten, wenn sie wieder zurückkamen. Das geschehe im Auftrag des Freistaates Bayern.
Robin verstand erst mal nichts und überlegte, ob er Einspruch erheben musste. Aber der Hinweis, der Staat habe den Auftrag gegeben, ließ ihn stumm bleiben. Es gehe um Geothermie, hörte er. Irgendwo hier werde schließlich gebohrt und Heißwasser aus der Erdtiefe hochgeholt und kaltes zurückgepumpt. Robin war sicher, dass German von alledem wusste und dass er dafür gesorgt hatte, sein Haus nicht zur Geothermiezentrale umbauen zu lassen. Sowieso waren nach ein paar Minuten die Männer weitergezogen, zu den Nachbarn. Das Rütteln war noch lang zu spüren.
Von Bedeutung war was anderes. Sie redeten miteinander, Chava und er, wenn sie allein waren. Aber sie redeten aneinander vorbei. Tja, was hatte er erwartet?
War vor drei Jahren umstandslose Nähe kurz möglich – jetzt eben nicht mehr. Der Casanova Amadeo hockte unsichtbar als Dritter mit dabei. Sie breitete ein bisschen Chava-Leben aus, weil er fragte – ohne allerdings zum Kern zu kommen. Und er hatte von sich erzählt, dabei aber die Freundschaft mit Seray herunterspielend, als verletze es Chava, wenn er zum Beispiel die Küsschen erwähnte, die sie neuerdings tauschten. Nichts Verliebtes, nein. Party-Küsschen, huschhusch, das Übliche. In den Augen der anderen war sie seine Besti. Für Orhan stand sowieso fest, dass seine Singdrossel-Schwester Seray und Robin, sein verträumter Freund, später mal das Paar der Paare werden müssten. Nicht dass so ein großmäuliger anatolischer Grauer Wolf sie in seinen Harem holte und erniedrigte! Die und die pantürkischen Idealisten mit ihrer Wahnidee vom großen Turan hasste Orhan, der Deutschtürke, wie die Pest. Und wenn Orhan sagte, er hasse, dann sprühten seine schwarzen Augen Drachenfeuer.
Nein, das mit Seray war was anderes. Oft sprach die von ihren Jungs, also ihrem freundesgleichen Bruder Orhan und dem brüderlichen Freund Robin. Irgendwie gehörte er zur Familie. Sie war wie eine Schwester. Und er war stolz auf sie. Sie war in allem eigen. Ein Beispiel? Im Februar gab es ihretwegen einen Skandal. Bei der Holocaust-Gedenkfeier der Schule hatte sie, der Star am Schulhimmel, eine Rede über die in Auschwitz ermordete jüdische Dichterin Gertrud Kolmar gehalten. Dabei hatte sie von der Lebenslust der Dichterin gesprochen und aus einem Kolmar-Gedicht zitiert, in dem Leda ihren Geliebten erwartet: O komm. O komm. Mein Kelch ist aufgetan / Und badet, schwer von Demut und von Duft, / Sich blühend in der winterklaren Luft / Und wartet auf den Schwan. Erst hatten die Illustren in der Aula mitfühlend genickt. Danach wurde sie aber vom Schulleiter zusammengefaltet, halb öffentlich. Reporter schossen Bilder. Alle sollten hören, wollte der Schulleiter, dass man sich an dieser Schule einer hohen Moral verschrieben habe. Verrat der abendländischen Werte warf er ihr vor. Mangelnde Sensibilität! Sie mit ihrem Migrationshintergrund müsste doch …! Die Schüler ringsum murrten. Großes Kino. Das ließen sich die Medien nicht entgehen. Ein Sturm zog auf in Hannover. Die jüdische Gemeinde aber pries Serays Offenheit. Eine jüdische Uni-Professorin klagte sogar, unbelehrbare alte Gojs nähmen ihrer geliebten Schwester Kolmar noch einmal das Leben. Der Schulleiter leistete reuige Abbitte, wo er ging und stand. Und mittendrin Seray.
Die Hitze nahm zu. Sie schmorten. Auf der vollgestellten Bühne hoben, schoben und schraubten Techniker an Geräten. Vor der Bühne waren Kameras aufgebaut. Am Ende der ersten Wiese die Mischkonsole. Von da erhielten Ton und Licht und Kameras ihre Impulse, wusste Robin, der erfahrene Festivalist, und sah einen Moment lang dem Sounddesigner zu, der einen Riesensombrero über den Kopfhörern trug und schwitzte.
Unter den begeisterten Zurufen seiner Eltern machte unweit ein Kind erste Gehversuche.
Drei junge Frauen mit festgezurrten weißen Kopftüchern hockten, verschneiten Ameisenhaufen gleich, in ihren hellen Umhängen daneben. Ihre nackten Füße in zierlichen, strassglitzernden Sandaletten lugten aus den Tüchern hervor, elegante, unstrapazierte Füße. Die Zehennägel waren bunt lackiert. Eine holte aus einer Umhängetasche Tabak, Blättchen und Feuerzeug. Auf der Tasche Frida Kahlo mit Damenbart.
Der winzige Hosenmatz torkelte, hielt sich aber lang aufrecht. Die Eltern sahen sich stolz um.
»Cremst du mich ein? Keine Lust auf Hummerhaut.«
Chava reichte ihm ein Sonnenschutzmittel und schälte sich aus der Bluse. Es blieb das dünne, weite Unterhemd, das wenig verhüllte. Sie schien nichts dabei zu finden. Als er an Amadeo dachte, vermieste ihm das kurz den Anblick. Nur kurz. Seray übrigens zierte sich in punkto solcher Freizügigkeit. Im Freibad sowieso. Aber das machte sie für ihre vielen Bewunderer nicht weniger anziehend.
Chavas Anblick ließ ihn schlucken.
«Hej, was ist? Angst vor der liten Chava?« Sie wartete. Robin wünschte sich Eiswasser in den Adern und cremte sie sorgsam ein. Ihre Haut war vertraut. Was hatte er falsch gemacht, dass sie nach den schönen Sommertagen vor drei Jahren so schnell Ersatz gesucht hatte? In ihren Nachrichten hieß es immer nur Amadeo, Amadeo, Amadeo. Vermutlich hatte sie die zwei Greifswalder Tage damals, zurück in Schweden, gleich als unbedeutend abgehakt. Er hatte sich das erste Mal im Leben total einsam gefühlt.
»Wow, des riecht aba guad!«, sagte die Sonnenbrillenfrau im gelbroten Bikini neben ihnen, die neugierig zusah, was bei der Enge unvermeidlich war. »Wos is des fia a Markn?«
Die Frau war sehr gebräunt und hatte ein freundliches Gesicht unter den Dreadlocks, soweit das die große Sonnenbrille erkennen ließ.
»Ist von meiner Mutter«, sagte Chava, »was Schwedisches, denk ich.«
Robin hielt der Frau die Tube hin.
»The Organic Pharmacy. Cellular Protection …«, las die. »Hört sich eha Englisch an.«
»Kann sein«, sagte Chava, deren Rücken jetzt an der Reihe war.
»Ihr seids aus Schweden?«, fragte die Neugierige.
»Robin nicht«, antwortete Chava, »ich ja.«
»Ehrlich? Siagst aus wia a Spanierin. Dunklere Haut und so. Und du«, wandte sie sich an Robin, »siagst wie an Araba aus.«
»Wenn Hannover in Arabien liegt, dann hast du’s getroffen«, sagte Robin, der Ähnliches schon öfter klargestellt hatte. Erst recht, seit er sich den Bart des Propheten wachsen ließ. Ein Lachflash der Bayerin war die Folge, der falscher nicht klingen konnte.
»Auf de Araba san mia ned so guad zua sprichn«, holte sie danach aus. »Weil de Scheichs kaffn uns olle Grundstuggn an unsan Seen weg. Aba fesche Mannsbuida sans, mid ihrn samtbrauna Augn. Übrigens: I bin de Mala aus Murnau. Is ned weit von hia. Und da Moo do«, sie wies auf den langen Blonden mit gescheitelter Donauwellenfrisur, der sich gerade über den athletischen Bauch strich, »da Lackl mim Waschbrettmong, da oiwei auf de Fiaß vo da arobischn und andern Weiberleid schaugt, da is da Adi und aa aus Murnau.«
Der Genannte grinste, vielleicht verlegen.
»S’glangt scho«, versuchte er sie zu bremsen.
»Weng de Fiaß? Hosd jo Recht. Isscho derb: omrum vahüllt, undn nackert«, zeigte sie Verständnis für sein Füße-Faible.
Adi hatte ein Pferdegesicht und tätowierte Arme.
»Nuuk-näch!«, stieß er rau hervor und schlug sich mit der Faust aufs Herz.
»So is ea, da Adi, des Juwl«, erklärte die Frau, »spricht gern moi klingonisch und hofft, dass ea auf vawandte Aliens stößt. Solche, wie er als Tatoo hat. Is sei Peace-Ausweis, wenn’s keman.«
»Hej«, sagte Chava. »Hallo«, sagte Robin.
»Was hat euch zwoa Hübschn hierher vaschlogn mid eura englischn Sonnencrem aus Schwedn?«, wollte Mala wissen.
»Schlogn?«, fragte Chava nach.
»Warum seids da?«, übersetzte der Klingone. Er sagte das fast unhörbar, als sei es für ihn eine Plackerei zu reden. Bestimmt hätte er auch lieber über die kosmisch verschlungenen Formen auf seinen Armen gesprochen als über schwedische oder englische Sonnencremes.
»Unsere Mütter haben uns die Reise spendiert«, sagte Chava. Robin dachte dabei, dass das andere nichts anging und dass es sich jedoch mega gut anhörte, das euch zwoa und das uns, als seien sie eine Ganzheit, trotz allem, »als Belohnung für unser Abitur.«
»Gratuliere!«, sagte Mala. Der Lackl nickte höflich. Smaltalk eben.
»Da kursierte das Gerücht über Joan Baez als Überraschungsgast. Die wollte ich erleben. Meine Mutter liebt sie«, sagte Robin.
»I hob aa von so am Gricht ghört«, nickte die Sonnenbrille, »zuzutraun waarad ihr so a spontana Auftritt oiemoi. Aba is the best fake news ever.«
»Für mich ist Moa Lignell der Grund«, bekannte Chava. »Kennt ihr Lady’s Smile oder Home tonight von ihr?«
»Naa«, schüttelte Mala den gegerbten Kopf. Die Rastas gerieten außer sich. Überhaupt, machte Robin die Entdeckung, waren Rastafrisuren, Cornrows oder so hier angesagt. Da fielen sie glatt auf, Chava und er, die ihre langen Haare einfach so wachsen ließen.
»Des is de Easte«, sagte Mala, »de Moa. Bin gspannt.« Sie setzte sich einen tomatenroten Strohhut mit breiter Krempe auf, an deren rechten Seite eine erblühte gelbe Seidenrose befestigt war und ein vielfarbiger Schmetterling mit strassbesetzten Flügeln Ruhe gefunden hatte.
Chava kramte im Picknickkorb. Eine Meise hüpfte durchs Gras und sah ihr zu. »Kommst du mit in den Wald, ich muss mal? Bevor’s losgeht«, fragte sie Robin leise. Dennoch hatten die Murnauer das gehört.
»Vabodn, vabodn! Do hängn Schilda, und de Security kontrolliad«, mahnte Mala. Der Lackl lachte schäbig.
»Im Walde pieselt nur das Wiesel. Wer im Walde scheißt, den die Zecke beißt«, zitierte er eines der Schilder genüsslich. Die Benachbarten drehten sich her und lachten mit. Peinlich! Die Meise suchte das Weite.
»Aa scho glesn …« freute sich einer in knielanger Badehose und flachsfarbenem Brusthaar.
»Un hindda je’m Baam hockt a Drogendeala«, komplettierte das dumpf ein rosafarbener Schmerbauch. Sein Kopf lag unter der BILD-Zeitung. »De frein si den Oasch ob üba jedn Fixa, da kimmd.«
Wie zur Warnung stiegen Krähen von den Baumwipfeln auf und krächzten böse.
Chava hatte wohl die Nase voll, sie stand wortlos auf. Robin kam mit. Sie reihten sich vor den Dixiklos in eine der Schlangen ein.
Nur biologisch abbaubare Mittel (ohne Desinfektionswirkung) sind im Einsatz verhieß ein Schild an den Türen der Häuschen. Die Klofrau rief ihre Anweisungen. Sie standen da noch, als einer im Hawaiihemd sich auf der Bühne als Veranstalter Anton vorstellte und ohne Umschweife den Überraschungsgast Freya ankündigte. Freya aus der Chemnitzer Folk-Scene, die jetzt mit alten schottischen und irischen Liedern ihren Feen-Glow über ihnen ausbreite. Höfliches Klatschen, aber auch Murren antworteten ihm. Einer schrie Mo-a!, Mo-a!
Auftrat eine 50-jährige Walküre in wallendem Kleid. Sie bewegte sich majestätisch. Ihr breites Gesicht war von rabenschwarzem Langhaar umgeben. Die schwarz umrandeten Äuglein glitten über die Menge, die sie kaum beachtete. Die Herrscherliche griff in die Gitarrensaiten.
»An meinem Hochzeitstage, wohl mitten in der Hochzeitsnacht, hat uns ein alter Seemannsmaat um unser Vergnügen gebracht …«, sang sie. Ihre Stimme bebte. Die angeschlagenen Akkorde passten nicht zur Melodie.
Chava und Robin bahnten sich indessen ihren Weg zurück. Malas roter Strohhut markierte das Ziel. Kaum saßen sie, erhob sich die Murnauerin ihrerseits, rückte sich ihren Royal Ascot Hut zurecht. Der Schmetterling zitterte. Sie wolle zum Büdchen, Bier besorgen. Oder einen Smoothie? Oder labbriges Zuckerdingsda? Verneinendes Kopfschütteln.
»Oiso seids koane Aquaholiker oder Bionadepussies«, stellte sie zufrieden fest und ging. Freyas Lied endete. Wenige klatschten. Einer juchzte hämisch Yippie! Unangefochten rückte sich Freya ihre unsichtbare Krone zurecht und strahlte.
»Danke, ihr Lieben!«, rief sie schmelzend und begann schon das nächste Lied, ein düsteres, wie sie gewarnt hatte.
»… Vergnügen sucht ich eines Abends, wollte wohl um die Häuser ziehn, da kam eine gar zarte, gar holde Maid, es zog mich sogleich zu ihr hin …«
Einzelne Pfiffe ertönten, dazu erneut Mo-a!, Mo-a!-Rufe.
»De Krawallschachtel merkts ned«, zürnte der enttarnte Fußfetischist. »Schluffig singts, des kaputte Zeiserl, wenn ihr mi frogt. Plärrig!«, knurrte er missgelaunt. Träte die Selbstgekrönte barfuß auf, würde das den Pedophilen vielleicht antörnen.
Mala war mit vier Bechern voll schaumlosem Bier eingetroffen und hatte Adis Ausbruch mitbekommen.
»Adolf, du bist eine Giftspritze!«, schimpfte sie in ihrer Empörung auf Hochdeutsch.
»Ich? Glaub mir, ich denk durch die Bank positiv. Beweis erforderlich? Über diese Dame eben? Auch ein grottenschlechter Liedvortrag hat was Saucooles«, hier legte er, der auch sein Bairisch vergessen hatte, eine Pause ein, um endlich fortzufahren: »den letzten Ton nämlich.«
»Bei dir ist Hopfen und Malz verloren.« Mala schüttelte den Kopf, ihre Rastas empörten sich. »Stellt euch vor, da sind Bierbiker mit einem Rollfass von Starnberg bis hierher gestrampelt!«, sagte sie.