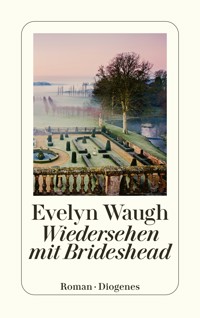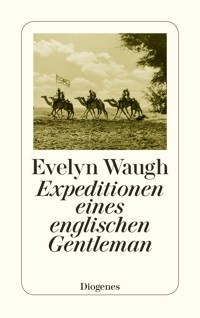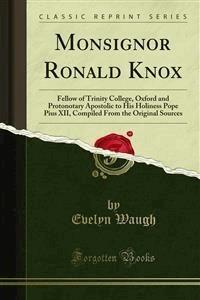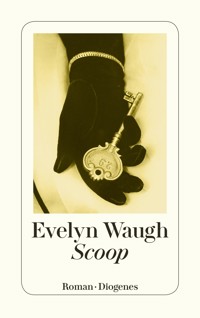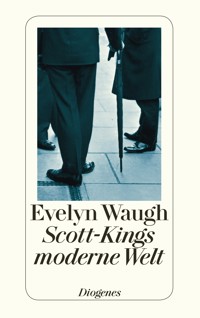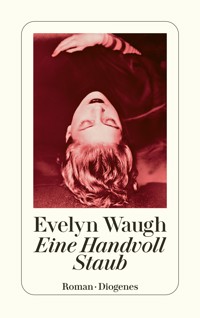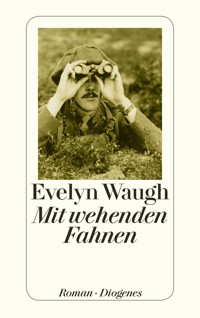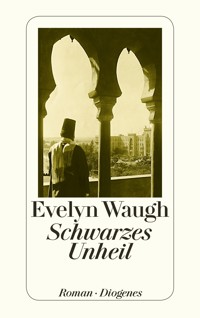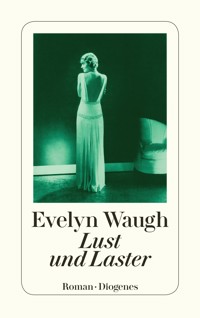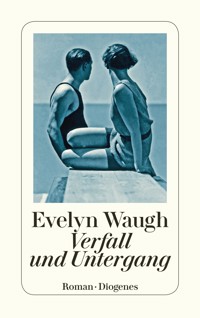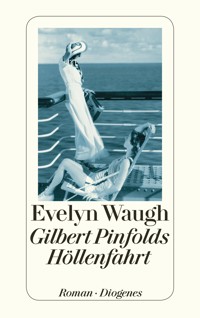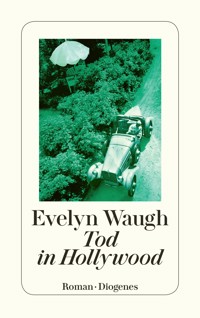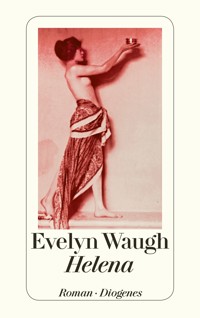
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kaiserin Helena, Mutter Konstantins des Großen, begründete die legendäre Pilgerreise nach Palästina, wo sie angeblich Teile des echten Kreuzes Christi fand. Ihr ungewöhnliches Leben, die enormen Konflikte dieser Zeit, Korruption und Verrat, und der Wahnsinn des imperialistischen Roms gaben Waugh ausreichend Stoff für einen hervorragenden, äußerst spannenden Geschichtsroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Evelyn Waugh
Helena
Roman
Aus dem Englischen von Peter Gan
Für Penelope Betjeman
{7}Vorwort
Wie man sich erzählt (und ich will es ausnahmsweise glauben), kehrte eine für ihre kirchenfeindliche Gesinnung allgemein bekannte Dame vor einigen Jahren triumphierend von einer Reise nach Palästina zurück. »Endlich habe ich herausgefunden, wie es wirklich war«, verkündete sie ihren Freunden. »Die ganze Kreuzigungsgeschichte hat eine Engländerin, eine gewisse Ellen, erfunden. Der Fremdenführer hat mir sogar genau den Platz gezeigt, wo es passiert ist. Selbst die Priester geben es zu: Sie nennen ihre Kapelle Inventio Crucis, die Erfindung des Kreuzes.«
Es geht mir keineswegs darum, der Dame, die »Erfindung« und »Auffindung« nicht unterscheiden konnte, ihre Illusion zu nehmen – ich will nur eine alte Geschichte neu erzählen.
Dieses Buch ist ein Roman.
Ein Schriftsteller arbeitet mit Erlebnissen, die seine Phantasie in Gang bringen. In meinem Fall war es das planlose Herumlesen in historischen und archäologischen Werken. Das daraus entstandene Buch ist natürlich weder Geschichte noch Archäologie. Wo bei den Fachleuten gewisse Zweifel bestehen, habe ich des Öfteren die bildhafte Version der plausiblen vorgezogen; an ein oder zwei Stellen, wo die Quellen stumm blieben, habe ich sogar frei erfunden. {8}Dennoch glaube ich nicht, dass ich von der Geschichtsschreibung abweiche (abgesehen von einigen absichtlichen und erkennbaren Anachronismen zugunsten der »dichterischen Wahrheit«); auch dürfte wenig vorkommen, das sich nicht irgendwie auf Überlieferung und frühe Quellen berufen kann.
Zu Recht darf sich der Leser fragen: »Wie viel ist nun wirklich wahr?« Die Zeit von Kaiser Konstantin ist sonderbar undurchsichtig. Die Mehrzahl der Daten und Fakten, die Enzyklopädien vertrauensvoll nennen, halten keiner näheren Prüfung stand und lösen sich in Nebel auf. Das Leben der heiligen Helena beginnt und endet in Vermutungen und Legenden. Immerhin dürfen wir davon ausgehen, dass sie die Mutter Konstantins des Großen war (und Constantius Chlorus sein Vater); dass ihr Sohn sie zur Kaiserin erhob; dass sie sich im Jahr 326, als Crispus, Lician und Fausta ermordet wurden, in Rom aufhielt; dass sie kurz darauf nach Jerusalem reiste und sich an dem Bau der Kirchen in Bethlehem und auf dem Ölberg beteiligte. Es ist ferner so gut wie sicher, dass sie Ausgrabungen leitete, bei denen Holzstücke gefunden wurden, in denen sie sogleich, wie die ganze damalige Christenheit, das Kreuz erkannte, an dem unser Herr verschied; dass sie einen Teil davon zusammen mit vielen anderen Reliquien entführte und den Rest in Jerusalem ließ; dass sie längere Zeit im dalmatischen Nisch und in Trier lebte. So mancher Hagiograph glaubt, dass sie 325 in Nicäa war. Aber darüber wissen wir nichts.
Wir wissen weder wo noch wann sie geboren wurde. Britannien ist nicht unwahrscheinlicher als jedes andere Land. Jedenfalls haben britische Geschichtsschreiber sie {9}von jeher für sich in Anspruch genommen. Wir wissen nicht, ob Constantius im Jahr 273 in Britannien war, da uns alle Einzelheiten aus seiner Jugend fehlen. Seine Stellung und Fähigkeiten hätten ihn durchaus zu einem Gesandten von Tetricus befähigt; aber wenn wir ihn als solchen schildern, stützen wir uns nur auf Vermutungen. Helenopolis (das alte Drepana) am Bosporus behauptet aufgrund seines Namens, der Geburtsort von Helena zu sein; aber Konstantin war willkürlich in der Bezeugung seiner Familiengefühle. So hat er mindestens eine weitere Stadt, und zwar in Spanien, nach seiner Mutter benannt, und man weiß, dass er die palästinensische Hafenstadt Maiouma nach seiner Schwester Constantia umtaufte, die natürlich nicht in Palästina zur Welt kam. Dass ich aus York Colchester gemacht habe, liegt daran, dass ich mich vom Bildhaften habe leiten lassen. Das Geburtsdatum ist ungewiss, wie alle Daten dieser Epoche. Helenas Lobredner schildert sie auf ihrer Reise nach Jerusalem als eine Frau von über achtzig Jahren, was ich für eine fromme Übertreibung halte.
Wir wissen nicht, ob die Holzteile, die Helena fand, wirklich vom Kreuz Christi stammten. Die Frage seiner Konservierung braucht uns nicht kümmern, da Helena von unserem Heiland durch keine größere Zeitspanne getrennt war, als wir selbst von König Charles I. Gehen wir aber von seiner Echtheit aus, so müssen wir bei seiner Entdeckung und Wiedererkennung meines Erachtens auch dem Wunder einen gewissen Einfluss einräumen. Wir wissen, dass die meisten der heute an verschiedenen Orten verehrten Reliquien des wahren Kreuzes eindeutig von der in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts verehrten Reliquie {10}abstammen. Gemeinhin heißt es bekanntlich, es gebe genügend Holzstücke von jenem »wahren Kreuz«, um ein Kriegsschiff daraus zu bauen. Indessen hat im vorigen Jahrhundert ein französischer Gelehrter, Charles Rohault de Fleury, sich die Mühe gemacht, sämtliche Splitter nachzumessen. Er stellte eine Gesamtziffer von 4000000 mm2 fest, wohingegen das Kreuz, an dem unser Heiland litt, wahrscheinlich der Größe von 178000000 mm2 entsprach. Die Holzmenge braucht somit den Gläubigen keineswegs zu beunruhigen.
Folgende Namen sind reine Erfindung: Marcias, Calpurnia, Carpicius, Emolphus.
Die Gestalt des Ewigen Juden ist früher nicht mit Helena in Verbindung gebracht worden. Ich meinerseits habe es getan, um zwei sich widersprechende Geschichten über die Auffindung des Kreuzes dichterisch zu vereinen: die eine berichtet, dass Helena von einem Traum an den Fundort geleitet wurde; die andere, weniger glaubwürdige Geschichte, behauptet, dass sie einem alten Rabbiner die Wahrheit darüber abzwang, indem sie ihn in eine Zisterne hinabgelassen und dort eine Woche lang gefangen gehalten habe.
In ähnlicher Weise habe ich Constantius Chlorus eine Mätresse gegeben, obwohl er als außergewöhnlich tugendhaft bekannt war.
Ein Historiker macht aus Helena eine ältliche, aus Drepana stammende Konkubine. Den ertrunkenen Bithynier habe ich erfunden, um anzudeuten, dass ich nichts auf die Glaubwürdigkeit dieses Berichts gebe.
Weitere Erwägungen dieser Art klingen auf den folgenden Seiten hie und da an, doch wäre es langweilig, hier {11}darauf hinzuweisen. Sie sind für jeden da, der Vergnügen an ihnen hat.
Die ganze Erzählung ist eben weiter nichts als »etwas zum Lesen«: eine Legende.
{13}Helena
{15}Am Hof
Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, noch ehe all die Blumen einen Namen hatten, die unten am Fuß der regengepeitschten Mauern im Wind schaukelten, eine Prinzessin; sie saß oben am Fenster, und ein Sklave las ihr eine Geschichte vor, die schon damals uralt war. Oder, um es ganz nüchtern zu sagen: An einem nassen Nachmittag an den Nonen des Mai, im Jahr des Herrn 273 (wie spätere Berechnungen ergaben), blickte in der Stadt Colchester die rothaarige jüngste Tochter Coels, des Königs der Trinovanten, Helena mit Namen, in den Regen hinaus, während ihr Lehrer ihr aus einer freien Wiedergabe der Ilias vorlas.
Hier im entlegenen Winkel der Festung bildeten die beiden ein ungleiches Paar. Die Prinzessin war schlanker und größer, als es der damalige Geschmack verlangte. Ihr Haar, das in der Sonne bisweilen golden schimmerte, sah in dem düsteren Heim meist wie mattes Kupfer aus. In den Augen lag eine knabenhafte Schwermut: Es war die halb unwillige, halb zerstreute und doch leicht ehrfürchtige Stimmung einer britischen Heranwachsenden bei der Lektüre der Klassiker. In manchen Epochen der künftigen siebzehn Jahrhunderte hätte sie als Schönheit gegolten, aber sie war zu früh geboren und hieß bei ihren eigenen Leuten die »Reizlose«.
{16}Ihr Lehrer war zwiespältig, da sie ihm gleichzeitig seine niedere Stellung und seine lästigen, täglichen Pflichten zu Bewusstsein brachte. Er hieß Marcias und stand in der Blüte dessen, was man seine Männlichkeit nennen könnte: Dunkle Haut, schwarzer Bart, Adlernase und heimwehkranke Augen zeugten von seiner exotischen Herkunft, und sein chronischer Schnupfen protestierte winters wie sommers gegen seine Verbannung. Die Tage der Jagd waren sein Trost; dann war die Prinzessin von früh bis spät unterwegs, und er konnte als alleiniger Herrscher des Schulzimmers seine Briefe schreiben. Sie waren sein Leben: Ihre elegante, esoterisch-spekulative und rhapsodische Prosa durchmaß die ganze Welt von Spanien bis nach Bithynien, als freier Rhetoriker bis zum höfischen Gelegenheitsdichter. Man sprach viel über diese Briefe, und Coel erhielt mehrere Angebote auf ihren Verfasser. Er war einer der jüngeren Intellektuellen, aber hierher hatte ihn das Schicksal verschlagen, in dieses ständige Wind- und Regenwetter als Sklave eines geselligen kleinen Königs und täglicher Begleiter eines jungen Mädchens. Es war nichts Unschickliches an dieser Verbindung; denn in seiner Kindheit ließ eine frühe und vorübergehende Vorliebe fürs Ballett Marcias für den östlichen Markt geeignet erscheinen, und er war vom Wundarzt einer entsprechenden Operation unterzogen worden.
»Und sogleich vergoss Helena mit den weißen Armen, die schöne unter den Frauen, eine Träne, hüllte ihr Gesicht in weißschimmerndes Leinen und eilte zum Skäischen Tor, begleitet von ihren Dienerinnen, Aithre, des Pittheus Tochter, und der kuhäugigen Klymene. Glaubst du, ich lese das zu meinem eigenen Vergnügen?«
{17}»Es ist nur wegen der Fischer«, sagte Helena, »sie kommen gerade vom Meer herauf zu dem Fest heute Abend. Sie haben körbeweise Austern dabei. Verzeihung; lies weiter vor über die kuhäugige Klymene.«
Dort aber saß nun Priamus unter den Ältesten der Stadt und sprach: ›Kein Wunder, dass die Troer und Griechen in Waffen liegen wegen Prinzessin Helena. Sie gleicht fürwahr einer Göttin von Ansehn! Komm her, liebes Kind, und setz dich zu mir. Du trägst keine Schuld; den Göttern haben wir es zu verdanken.‹«
»Priamus ist entfernt mit uns verwandt, weißt du.«
»Das habe ich des Öfteren von deinem Vater vernommen.«
Von diesem geschützten Raum aus konnte man an einem klaren Tag das Meer sehen, aber jetzt verlor sich die Weite im Nebel, der sich direkt vor ihren Augen über Moor und Weideland, Villen und Hütten zusammenschloss, und über den Bädern, die der General und sein Gast vor kurzem betreten hatten. Er fülllte den Graben und erklomm die Wände unter ihr. Nicht zum ersten Mal dachte Helena an Tagen wie diesen – denn solche Tage waren im hellen Frühling durchaus nicht ungewöhnlich –, dass die Stadt auf dem Hügel, der sich so bescheiden aus dem Moor erhob, geradeso gut über den Wolken in den windumtosten Bergen stehen und diese gedrungenen Zinnen einen endlosen Meerbusen überblicken könnten; und während sie mit halbem Ohr der Stimme hinter sich lauschte – Denn sie wusste nicht, dass ihre leiblichen Brüder in Sparta unter der Erde ruhten, in ihrem eigenen Land, unter der Leben spendenden Erde –, meinte sie beinah einen Adler aus der weißen Leere unter ihr emporsteigen zu sehen.
{18}Dann verzog sich die Bö, der Nebel brach wieder auf und holte sie auf die Erde, die ein paar Meter unter ihr wieder sichtbar wurde, zurück. Nur die steinerne Kuppel der Bäder blieb vernebelt, gefangen in den eigenen Ausdünstungen von Dampf und Rauch. Wie nah sie doch dem Boden waren!
»Waren die trojanischen Mauern höher als unsere in Colchester?«
»O ja, ich glaube schon.«
»Viel höher?«
»Sehr viel höher.«
»Hast du sie gesehen?«
»Sie wurden damals gänzlich zerstört.«
»Ist nichts mehr davon übrig, Marcias? Nichts, das noch daran erinnert, wo sie standen?«
»Es gibt eine moderne Stadt, in die die Touristen strömen. Die Fremdenführer dort zeigen einem alles, was man sehen möchte – die Gruft des Achilles, Paris’ geschnitztes Lager, den Holzfuß des großen Pferdes. Aber von Troja selbst ist nichts geblieben als Poesie.«
»Ich kann mir nicht vorstellen«, sagte Helena mit Blick auf das grobe Mauerwerk, »wie sie jemals eine ganze Stadt zerstören konnten.«
»Die Welt ist uralt, Helena, und voller Ruinen. Hier, in einem jungen Land wie Britannien, kann man sich das kaum vorstellen; im Osten aber gibt es endlose Sandhaufen, die früher einmal große Städte waren. Man sagt, sie bringen Unglück, selbst die Nomaden meiden sie aus Angst vor Geistern.«
»Ich hätte keine Angst«, sagte Helena. »Warum graben {19}die Leute nicht? Etwas von Troja muss doch noch unter der Touristenstadt vorhanden sein. Wenn meine Bildung abgeschlossen ist, werde ich hinfahren und das wirkliche Troja finden – Helenas Troja!«
»Unzählige Geister gibt es dort, Helena. Die Dichter haben jene Helden nie in Frieden ruhen lassen.«
Der Sklave beugte sich wieder über das Manuskript, aber ehe er die Lektüre von neuem aufnehmen konnte, fragte Helena:
»Marcias, glaubst du, dass Rom jemals zerstört werden könnte?«
»Warum nicht?«
»Hoffentlich nicht – jedenfalls nicht so bald. Nicht ehe ich Gelegenheit hatte, hinzufahren und es mir anzusehen … Weißt du, dass ich noch nie jemanden getroffen habe, der in der Ewigen Stadt war?«
»Seit den Unruhen fahren nur wenige von Gallien nach Italien.«
»Ich werde eines Tages hinfahren. Die gefangenen Barbaren kämpfen im Kolosseum gegen Elefanten! Hast du je einen Elefanten gesehen, Marcias?«
»Nein.«
»Sie sind so groß wie sechs Pferde.«
»So sagt man.«
»Eines Tages, wenn ich meine Bildung abgeschlossen habe, werde ich mir alles selber ansehen.«
»Mein Kind, niemand weiß, wohin er geht. Einst hoffte ich nach Alexandria zu ziehen, wo ein Freund von mir wohnt, ein hochgelehrter Mann, den ich nie gesehen habe. Wir hätten uns so viel zu sagen, was sich nicht schreiben {20}lässt. Eigentlich hätte das Museion mich kaufen sollen. Stattdessen wurde ich in den Norden verschickt und in Köln an den unsterblichen Tetricus verkauft, der mich dann hierherschickte als Geschenk für deinen Vater.«
»Vielleicht lässt Papa dich frei, wenn ich ausgelernt habe.«
»Er spricht manchmal davon – nach dem Essen. Aber was ist Freiheit, die man geben und nehmen kann? Die Freiheit, ein Soldat zu sein, den man hierhin und dorthin kommandiert, bis ihn zu guter Letzt die Barbaren in einem Sumpf oder einem Wald niedermetzeln? Oder die Freiheit, ein Vermögen anzuhäufen, so groß, dass dann der unsterbliche Kaiser eifersüchtig wird und es durch seinen Scharfrichter beschlagnahmen lässt? Ich habe meine eigene, geheime Freiheit, Helena. Was könnte dein Vater mir mehr geben?«
»Zum Beispiel eine Reise nach Alexandria, um deinen hochgelehrten Kumpanen zu besuchen.«
»Der Geist eines Menschen ist keinem Gesetz untertan. Niemand kann sagen, wer freier ist: ich oder der unsterbliche Kaiser.«
»Manchmal glaube ich«, sagte Helena, die ihren Lehrer frei im Äther schweben sah, in dessen Kälte es ihm behagte –, »manchmal glaube ich, dass es zu den Zeiten von Helena sehr viel angenehmer war, ein Unsterblicher zu sein als heutzutage. Weißt du, was aus dem unsterblichen Valerian geworden ist? Papa hat es mir gestern Abend erzählt und sich köstlich darüber amüsiert. Sie haben ihn in Persien öffentlich zur Schau gestellt – ausgestopft.«
»Vielleicht«, sagte der Sklave, »sind wir alle unsterblich.«
»Vielleicht«, meinte die Prinzessin, »sind wir alle Sklaven.«
{21}»Manchmal, mein Kind, machst du erstaunlich kluge Bemerkungen.«
»Marcias, hast du den neuen Stabsoffizier gesehen, der aus Gallien gekommen ist? Ihm zu Ehren gibt Papa heute Abend das Bankett.«
»Alle sind wir Sklaven – der Erde, ›der Leben spendenden Erde‹. Man redet jetzt viel von einem ›Weg‹ und einem ›Wort‹, einem Weg der Läuterung und einem Wort der Erleuchtung. In Antiochia soll das zurzeit die große Mode sein, wie ich höre; dort unterrichten jetzt über zwanzig echte indische Weise eine neue Art zu atmen.«
»Er sieht sehr blass und ernst aus. Sicher ist er in einem sehr geheimen, wichtigen Einsatz hier.«
Währenddessen beschäftigten den Heeresführer in den Dampfbädern ähnliche Gedanken, wenn auch mit weniger Muße. Der kräftig schwitzende General war, abgesehen von den zahlreichen Narben, die von seinem Dienst an der Grenze zeugten, am ganzen Leibe krebsrot. Sein zäher, alter Körper hatte allerlei mitgemacht; hier fehlte ein Finger, dort eine Zehe, und anderswo war eine Sehne zerhauen. Das Gesicht unter dem tropfenden Kahlschädel hatte jedoch den unschuldig verwunderten Ausdruck der Jugend behalten. Ihm gegenüber lag im heißen Zwielicht wie eine Leiche im Totenhaus Constantius, genauso bleich, wie er hereingekommen war, feucht, weiß und drahtig, und stellte Fragen über Fragen. Das tat er seit seiner Ankunft vor zwei Tagen: ehrerbietig, wie es sich für einen jüngeren Offizier schickte, und nachdrücklich wie jemand, der ein Recht auf Auskunft hatte. Es waren treffende, heikle Fragen zu {22}Dingen, die, wenn sie überhaupt zwischen einem älteren und einem jüngeren Offizier zur Sprache kamen, vom General hätten aufgebracht werden sollen.
»Ein Skandal, was da mit dem göttlichen Valerian geschah«, sagte der Heeresführer, um der Unterhaltung eine allgemeinere Wendung zu geben.
»Durchaus skandalös.«
»Erst ein Trittstein, dann ein Fußschemel, und jetzt eine Kleiderpuppe, gehäutet, gegerbt und mit Stroh ausgestopft, schaukelt sie vom Dachbalken, damit die Perser ihren Spaß damit treiben. Ich habe die ganzen Einzelheiten erst gestern erfahren.«
»Die Folgen für unser Ansehen im Fernen Osten sind katastrophal«, sagte Constantius. »Ich war letzten Winter in Persien, wo ziemlich dicke Luft herrschte. Glauben Sie, dass die Sache, wenn sie sich herumspricht, Einfluss auf die Grenzlegionen haben könnte, zum Beispiel auf die Zweite Augustäische Legion? Wie steht’s überhaupt mit denen?«
»Ausgezeichnete Männer. Würden den Persern zu gerne eins auswischen. Die würden’s denen zeigen!«
»So? Meinen Sie? Sehr interessant. Wir hatten ziemlich beunruhigende Berichte über die Zweite Augustäische Legion. War da nicht im November irgendetwas wegen der Winterquartiere im Gange?«
»Nein«, sagte der General.
»Nun, ich glaube, wir können die Perser getrost dem unsterblichen Aurelian überlassen.« Constantius erhob sich von seiner Marmorplatte. »Wir sehen uns nachher im Tepidarium wieder, Herr General.«
Der General grunzte und legte sich auf den Bauch. Er {23}war froh, den Burschen los zu sein, ärgerte sich aber über die Art, wie er sich verabschiedet hatte. Als er unter dem göttlichen Gordianus ins Heer eingetreten war, hatten die jüngeren Offiziere ihren Vorgesetzten mehr Achtung gezeigt oder was zu hören bekommen.
»Ich könnte schwören, dass der Bursche was im Schilde führt«, dachte der General bei sich und fühlte sich keineswegs behaglich, obwohl dies die behaglichste Stunde des Tages war, wo sich nach alter Gewohnheit der Verdruss des Fleisches löste und weggewaschen wurde; wo die steifen alten Muskeln sich entspannten und er tief im Inneren die Verdauungssäfte in froher Erwartung des Abendessens aufs Neue strömen fühlte.
Constantius’ Papiere waren in Ordnung; sie trugen das Siegel des Tetricus und wiesen ihn als Verbindungsoffizier auf einer der üblichen Provinzreisen aus.
»Provinzreise, von wegen«, dachte der General. »Wer ist dieses ›Wir‹, das so viel weiß und noch viel mehr wissen möchte? Sicher nicht Tetricus, oder man soll mich einen Pikten nennen«, dachte der General. »Woher wissen ›wir‹ denn so viel von der peinlichen Geschichte der Zweiten Augustäischen Legion bei Chester?« Der General klatschte in die Hände, und der Sklave brachte das für ihn bereitstehende Getränk, das er immer um diese Stunde zu sich nahm: kaltes, keltisches Bier, mit Ingwer und Zimt gewürzt, so wie der General es ihnen beigebracht hatte. Dadurch reizte und stillte es den Durst zugleich. Der General tat einen tiefen Zug und rieb sich die alten Hüften.
Als er schließlich ins Tepidarium hinüberging, war Constantius gerade mit seiner Massage fertig.
{24}»Ich erwarte Sie im Frigidarium«, sagte er und tauchte in das kalte Wasser: nicht mit viel Gespritze und Gepruste wie der General, sondern ruhig und bestimmt stieg er Stufe um Stufe hinab wie zu einer religiösen Reinigung, worauf er sich dann in die heißen Badetücher wickelte und gemessen zu seinem Lager in der Halle ging, als schritte er im Festgewand zum Altar.
Der Sklave kannte jede Stelle am Leib des Generals, trotzdem vollzog sich die Nachmittagsmassage fast nie ohne ein stattliches Register von Flüchen. Heute war der General gereizt, aber still. Er planschte nur kurz in dem kalten Wasser und schritt dann entschlossen zu der Bank neben Constantius. Er wusste jetzt, was er wollte. Er wurde mit einer Frage empfangen, noch ehe er sich völlig ausgestreckt hatte.
»Sagen Sie bitte, dieser Coel, bei dem wir heute Abend essen – was ist das eigentlich für einer?«
»Das werden Sie schon selber sehen. Er ist nicht übel. Vielleicht fehlt es ihm manchmal an Ernst.«
»Spielt er eine Rolle in der lokalen Politik?«
»Politik«, meinte der General, »Politik.« Und nach einer Pause sagte er, was er sich überlegt hatte, als er allein im Tepidarium lag. »Sie werden sehen, dass Britannien sich in einer Zeit des Wohlstands befindet, mehr als jede andere Provinz des Imperiums. Der Grund dafür ist meiner Ansicht nach, dass wir hier keine Politik machen. Wir gehören zu Gallien und bekommen von dort unsere Befehle –, und wenn es zu viele werden, vergessen wir sie ganz einfach. Posthumus, Lollianus, Victorinus, Victoria, Marius, Tetricus – wir machen da keinen Unterschied.«
{25}»Glauben Sie, dass Tetricus nennenswerte Anhänger hat unter den …?«
»Einen Augenblick, junger Mann, ich bin noch nicht fertig. Ich bin mein ganzes Leben lang Regimentssoldat gewesen, bis ich hierhin versetzt und außer Dienst gestellt wurde. Ich habe mich nie um Politik, Geheimdienst oder Sondereinsätze gekümmert. Sie haben mir in diesen beiden Tagen eine Menge Fragen gestellt, ich Ihnen aber keine einzige, weder was Ihre Person betrifft noch den Zweck Ihres Aufenthalts. Ihren Papieren zufolge gehören Sie dem Stab des Tetricus an; das genügt mir vollkommen. Wie ich Ihnen schon sagte, habe ich mich nie für den Geheimdienst interessiert, und jetzt ist es dafür zu spät. Aber noch bin ich kein völliger Dummkopf. Erlauben Sie mir, Ihnen einen kleinen Rat zu geben. Wenn Sie sich wieder einmal als Stabsmitglied von Tetricus ausgeben wollen, prahlen Sie lieber nicht mit Reisen in Persien; und wenn Sie mich glauben machen wollen, Sie kämen von Köln, dann wählen Sie sich Ihren persönlichen Diener nicht gerade aus einer Legion, die seit nunmehr fünfzehn Jahren an der Donau stationiert ist.
Und wenn Sie einem alten Mann seine Gebrechen nicht verübeln wollen, schlage ich nun vor zu schlafen.«
»Und Aphrodite hüllte Paris in eine dunkle Wolke und trug ihn in sein wohlriechendes, hochgewölbtes Gemach und suchte dann Helena, die mit den Frauen am Skäischen Tor stand. Sie zupfte sie an ihrem duftgetränkten Kleid und sprach: ›Komm, Paris wartet auf seinem geschnitzten Lager, strahlend und anmutig gekleidet, als ruhe er aus vom Tanze.‹ Und Helena, die Tochter des Zeus, entschlüpfte ihren Dienerinnen und stand in ihren schimmernden Schleiern im {26}Gemach des Paris. Die lächelnde Venus stellte einen Stuhl für sie ans Bett, und Helena sagte: ›Wärest du doch in der Schlacht gefallen.‹ Paris aber erwiderte ihr: ›Auch wir haben Verbündete unter den Unsterblichen. Komm! Meine Liebe ist süß und heiß wie der Tag, an dem ich dich von Sparta entführte zu Schiff, und wie die Nacht auf dem meerumflossenen Kranae, wo ich das erste Mal bei dir lag. Komm!‹ So ruhten sie beieinander auf dem geschnitzten Lager, während draußen vor den Mauern Menelaos wie ein wildes Tier umherstreifte auf der Suche nach Paris, den er nicht fand in dem ganzen Heer, das ihm zusah. Nicht Griechen noch Troer hätten Paris verborgen, denn sie hassten ihn wie die schwarze Pest; und während er sorglos lag, verkündete König Agamemnon, dass Menelaos Sieger sei und Helena, die schöne, ihr Leben verwirkt habe.«
»Was für ein Streich!«, rief Prinzessin Helena. »So ein Reinfall! Man muss sich nur vorstellen, wie Menelaos herumrast und jeder ihm auf die Schulter klopft; und dabei erklärt Agamemnon ihn feierlich als Sieger, und Helena liegt die ganze Zeit mit Paris unter der Decke. Zum Totlachen!«
»Es ist ein Vorfall, der gar nicht zu den heroischen Tugenden passt«, sagte Marcias, »der große Longinus hält ihn deshalb auch für eine spätere Einfügung.«
»Aha«, sagte Helena, »der große Longinus.«
Dieser hochgeschätzte Gelehrte war für sie eine Gestalt, die sie halb spöttisch, halb ehrfürchtig betrachtete: ihr zweiter mythischer Held. Der erste war der Vater ihrer Amme, ein Pionierfeldwebel, den die Pikten gemordet hatten. Als Kind konnte sie nie genug bekommen von den Geschichten über seinen Mut und seine Unbestechlichkeit. {27}Und als sie aus dem Kinderzimmer ins Schulzimmer hinüberwechselte, bekam Longinus den wenig passenden Platz neben ihm. Marcias verehrte ihn mehr als ein Sohn seinen Vater, sein Name wurde in jeder Stunde und Aufgabe genannt. Als allwissender Universalgelehrter thronte Longinus im Glanz des sagenfernen Palmyra und hatte sich allmählich in Helenas Vorstellung mit den Legenden ihres Volkes vermischt, so dass er ihr wie einer von jenen weißgekleideten, mit Sichel und Mistelzweig geschmückten Männern erschien, deren Lehren noch immer in den Küchenräumen hinter vorgehaltener Hand und wirr weitergegeben wurden. Diese beiden einander so unähnlichen Vorbilder waren die Zwillingsgottheiten ihrer Kindheit. Sie ging mit ihnen vertraulich-humorvoll um, aber nicht ohne Ehrfurcht.
Das Schnarchen des Heeresführers dröhnte immer noch im Kuppelbau, als Constantius sich sorgfältig ankleidete und sich sodann allein durch Schlamm und Regen zu den Stadttoren begab.
»Da geht er«, sagte Helena, »der schöne, geheimnisvolle Fremde.«
Als er sein Quartier erreicht hatte, rief er den Hauptmann seiner Leibwache zu sich.
»Korporal, die Männer sollen sofort ihre Regimentsnummern ablegen.«
»Zu Befehl.«
»Und noch etwas: Schärfen Sie den Männern absolute Verschwiegenheit ein. Wenn jemand Fragen stellt – sie kommen vom Rhein!«
{28}»Das ist ihnen gesagt worden.«
»Nun, dann sagen Sie’s ihnen noch mal. Erfahre ich, dass einer geredet hat, bekommen alle miteinander Ausgangssperre.«
Daraufhin ließ Constantius seinen Diener und seinen Friseur kommen und schmückte sich für das bevorstehende Abendessen im Rahmen dessen, was sich für einen angeblich mit leichtem Gepäck und in vertraulichem Auftrag reisenden Frontoffizier ziemte.
Die Damen speisten nicht mit den Herren, aber dafür besonders köstlich. Ihr behaglicheres Zimmer lag zwischen Halle und Küche, und Helenas Tante, die den Haushalt leitete, wählte selbst die Speisen aus, ehe man sie vom Holzkohlenfeuer herunternahm, und geleitete sie unter ihrem strengen Blick hinüber: Saftig und glühend heiß waren sie zwar weniger kunstvoll garniert als die für den König bestimmten, aber voller Duft und Wohlgeschmack. Im Übrigen räkelten sich die Frauen des Hauses nicht in ihren Kissen und ließen sich auch nicht von Sklaven füttern, wie es Männersitte war, sondern kauerten an dem niedrigen Tisch vor ihren Speisen, krempelten ihre Ärmel auf und griffen selbst mit der Hand in den Topf. Das einfache, aber reichliche Mahl bestand aus in Safran gedünsteten Austern, gekochten Krabben, in Butter gebratenen Seezungen, in Milch gesottenem Spanferkel, gerösteten Kapaunen, Lammfleisch mit Zwiebeln am Spieß und einem einfachen, süßen Nachtisch aus Honig, Eiern und Rahm. Dazu gab es hausgebrauten Met in einem großen samischen Krug. In Italien oder Ägypten hätte dieses Menü keinen Beifall gefunden; {29}den Damen Britanniens war es bei dieser festlichen Gelegenheit aber durchaus willkommen.
»Was für ein Festessen!«, sagte Prinzessin Helena, nachdem sie gierig getrunken hatte. »Phantastisch!«
Die Damen machten sich fürs Konzert zurecht. Helenas Haar, das während der Schulstunde in dicken, rostroten Zöpfen herunterhing, war jetzt, wie bei einer Dame, hochgebunden und geschmückt; sie trug ein Kleid aus bestickter Seide, die mit Dromedaren, Schiffen, Maultieren und Trägern aus dem fernen China zu ihr gelangt war. Ihre flachen Schläppchen waren mit glitzernden Steinen und Goldfäden durchwirkt. Während sie ihre Hände und weißen Arme im dampfenden Wasser wusch, dachte sie bei sich: »Helena mit den weißen Armen, schön unter den Frauen.« Dann steckte sie die sechzehn verschiedenen Ringe, die sie als jüngste Tochter aus dem Juwelenschrein ihrer Mutter geerbt hatte, allesamt an ihre kräftigen jungen Finger.
»Du siehst einfach entzückend aus, mein Kind«, sagte ihre Tante und rückte das Haarband auf Helenas Stirn zurecht. »Wir wollen noch nicht gleich hinübergehen. Die Herren übergeben sich gerade.«
Ein wenig später traten die weiblichen Vertreterinnen des Königshauses ein. »Helena, die schöne unter den Frauen, Tochter des die Aegis haltenden Zeus«, dachte Helena, wie sie als Letzte und Größte nach der Tante, den drei Mätressen ihres Vaters, den drei verheirateten und zwei unverheirateten Schwestern ihren Vater begrüßte. Er winkte allen heiter von seinem Lager aus zu, worauf sie längs der Wand auf ihren zehn steifen Stühlen Platz nahmen.
Dann begann das Orchester zu spielen: drei {30}Saiteninstrumente, eine eigenwillige Flöte und die Sänger. Zuerst sang einer, dann willkürlich, wie es schien, ein zweiter; und zuletzt vereinten alle acht Bässe ihre Patriarchenstimmen aus voller Brust zu dem einleitenden Klagelied.
»Ich hoffe, Sie sind an so etwas gewöhnt«, sagte der General leise zu Constantius.
»Nicht ganz, aber Ähnliches.«
»Wir kriegen das jedes Mal vorgesetzt, wenn Coel ein Fest gibt. Es dauert stundenlang.«
Die ersten schaurigen Töne versetzten den König, den das Gastmahl bereits deutlich erfreut hatte, in unverkennbare Begeisterung. »Mein Lieblingsstück«, erklärte er, »die Totenklage für meine Vorfahren. Damit fangen wir meistens an. Wie alle große Kunst hat sie den Vorzug, von erstaunlicher Länge zu sein. Da sie in unserer Sprache verfasst ist, wird Ihnen leider einiges entgehen; aber ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn eine besonders schöne Stelle kommt. Augenblicklich singen sie von fernen, fast legendenhaften Zeiten und von der Gründung meines Hauses durch die ungewöhnliche Verbindung des Flussgottes Skamandros mit der Nymphe Idaia. Hören Sie!«
Hoch, dünn und herzlos klangen die Fiedeln und die Stimme des Vorsängers; tief, schwülstig und tränenreich sangen die bärtigen Bässe. Lässig und träge lagen die Krieger in ihren Kissen; starr und aufrecht saßen die königlichen Frauen. Sanft glitt der Page von Lager zu Lager mit dem Metkrug; schwerfällig stolperte der General wieder ins Vomitorium. Ungeschliffen und einschläfernd füllten die Stimmen die Halle von der Balkendecke zum Mosaikboden und trugen ihre Totenklage hinaus in die Nacht.
{31}»Brutus, der Enkel des Aeneas, hat jetzt Britannien erreicht«, erklärte Coel, »damit sind wir sozusagen fast in den modernen Zeiten angelangt. Er ist der eigentliche Stammvater unseres Volkes. Er fand die ganze Insel, mit Ausnahme von ein paar Riesen, fast verlassen vor, wissen Sie. Nach Brutus wird die Geschichte sehr viel reicher und klarer.«
Kein Mitglied von Coels Familie war, wie es schien, eines natürlichen und wenige von ihnen eines glaubhaften Todes gestorben. Einer von ihnen trank vergifteten Wein, den ihm seine Stieftochter vorsetzte, worauf er in grausigem Wahnsinn nackend in den Wald rannte, junge Bäume ausriss und mit den Wölfen und Bären kämpfte. Und das war keineswegs der Schlimmste. Sämtliche Todesfälle in dieser alten und unmelodischen Familie – ein misstönendes Gemisch aus klassischem Mythos, keltischen Märchen und rauher Wirklichkeit – verwoben und verstärkten sich mit dem Brodem aus Speisedunst, qualmenden Lampen und schwerem Metgeruch.
Constantius war ein Mann von mäßigen Gewohnheiten. Er hatte in den Tagen des göttlichen Gallienus mehr als einen Offizier gekannt, der sich durch Schlemmerei um eine vielversprechende Zukunft gebracht hatte. An diesem Abend aber hatte er reichlich getrunken, so dass die quälend schrille Musik nur noch abgestumpft an seine Ohren drang. Leicht benommen und durch die Nebel der Trunkenheit ein wenig entrückt, blickte er auf seine verschiedenen Talente herab, die wie geschliffene Gemmen auf dem Präsentierteller eines Goldschmieds säuberlich ausgebreitet vor ihm lagen, und so sah er sich beinahe, wie er wirklich war. Constantius empfand nur wenig Eigenliebe; nicht er, {32}wohl aber andere waren in den letzten zwei Jahrhunderten von dieser Leidenschaft erfüllt gewesen, und manche waren an diesem Übel gestorben und bereits ebenbürtige Gefährten der Götter. Constantius betrachtete sich durchaus nicht als vollkommen. Seine Gaben reichten aus für das, was nötig war – für mehr nicht: eine stattliche, aber keineswegs einzigartige Zusammenstellung; er würde damit auskommen. Was er für sich wollte, war einfach und klar: nicht für heute oder morgen, aber doch bald und ehe er zu alt war, um noch den rechten Gebrauch von ihr zu machen, begehrte Constantius für sich die Welt.
»Sie singen von der Geißelung der Boadicea«, sagte Coel. »Ein etwas heikler Gegenstand für uns Römer, aber besonders beliebt bei meinem einfältigen Volk.«
Die Erzählung war Helena kaum weniger vertraut als ihrem Vater. Sie entzog sich dem Katalog der Qualen und hing fröhlich einem Tagtraum nach, der es ihr seit frühester Kindheit besonders angetan hatte. Vielleicht beschäftigte sich jede dieser Frauen insgeheim mit so einem stillen Zeitvertreib, so regungslos thronten sie alle auf ihren steifen Stühlen. Helena spielte Pferd – ein Spiel, das mit ihrem ersten Pony begonnen hatte: ein atemloser, wortloser Hürdenlauf über unüberwindliche, alle Pferdekraft übersteigende Hindernisse, die alle glänzend genommen wurden, bis es in endlosen federnden Rasengrund überging. Ungezählte einsame Stunden war Helena so dahingaloppiert. Als dann aber mit den Jahren ihre Weiblichkeit erblühte, mischte sich ein neuer, verwegener Reiz in das Spiel. Es wurde jetzt von zweien gespielt. Da war der Wille des Reiters, der sich von der behandschuhten Rechten durch die langen Zügel auf {33}