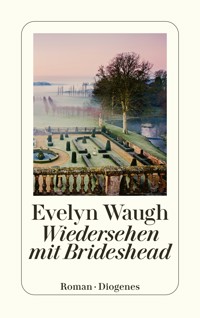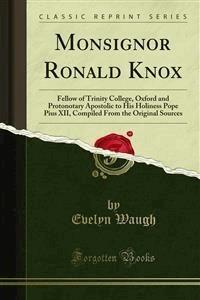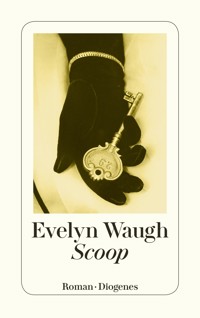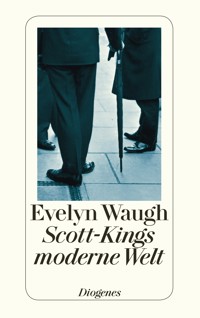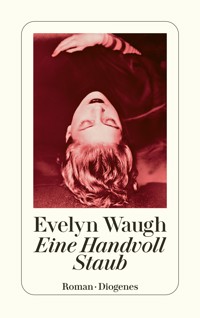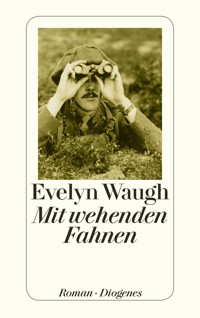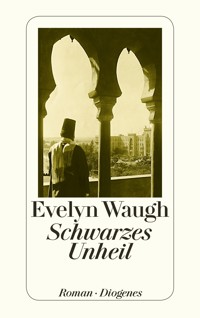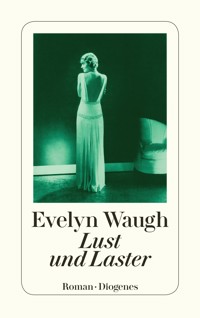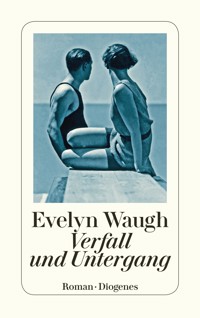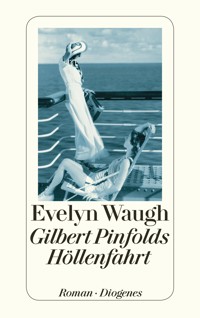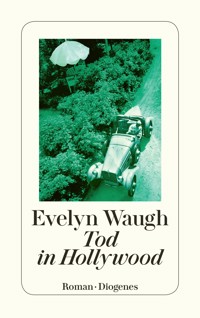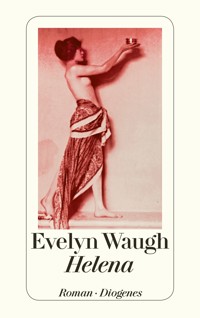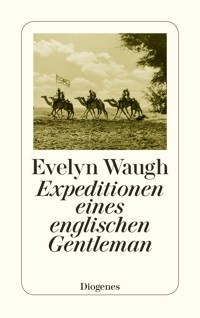
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Krönung von Haile Selassie zog 1930 ein schillerndes Publikum nach Addis Abeba. Mitten unter ihnen: ›Times‹-Sonderkorrespondent Evelyn Waugh. Es ist ein Anlass wie geschaffen für die satirische Feder des Engländers. Er mokiert sich über europäische Diplomaten und liefert das Porträt einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft, die weit weg von zu Hause, in Abessinien, ihre pompösen Feste feiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Evelyn Waugh
Expeditionen eines englischen Gentleman
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork Mit einem Nachwort von Rainer Wieland
Diogenes
{7}Äthiopisches Reich
{9}I
Sie tanzten noch immer, als die Azay le Rideau am 19. Oktober 1930 kurz vor Morgengrauen in Dschibuti einlief. Die Kapelle, ein bedauernswert leidenschaftliches Quartett im Alpaka-Smoking, hatte schon längst die Instrumente eingepackt und sich in ihre abgelegene und stickige Kabine zurückgezogen. Ein annamitischer Schiffsjunge schrubbte das Deck und stopfte Unmengen von durchnässten Papierschlangen in die Speigatts. Zwei, drei Stewards nahmen die Fähnchen und bunten Lichtergirlanden ab, mit denen das Schiff geschmückt worden war. Ein Paar blieb.
Die junge Frau, eine Passagierin der zweiten Klasse, unterwegs nach Mauritius und erkennbar ein Mischling, trug ein Tirolerkostüm, das sie für den Abend beim Schiffsfriseur ausgeliehen hatte. Ihr Partner, ein Offizier der französischen Fremdenlegion, trug eine schlechtsitzende weiße Uniform mit offenem Kragen. Er war ziemlich jung, hatte ein bläulich schimmerndes Kinn und etwas Bauch und war um einiges kleiner als sie. Langsam bewegten sich die beiden über die nassen Planken zur Musik eines tragbaren Grammophons; hin und wieder blieben sie stehen und lösten sich voneinander, um das Grammophon aufzuziehen und die andere Seite der Schallplatte aufzulegen.
Zwei heiße Tage lang war auf dem Schiff gefeiert worden. {10}Deckspiele waren veranstaltet worden, Wettläufe für die Kinder, eine Tombola mit Zwei-Franc-Losen und Gewinnen, wie es sie an Bord zu kaufen gab – Vermouth und Eau de Cologne, Tabak, Süßigkeiten, Korallen und dekorative Zigarettenspitzen aus Port Said. Eine signierte Fotografie von Marschall d’Esperez war bei einer Auktion unter stürmischem Beifall für 900 Franc an einen Pressefotografen gegangen, ein Passagier hatte auf einer flackernden Leinwand, die sich unruhig im Wind bewegte, einen Film vorgeführt. Ein Pferderennen war durch Würfel bestimmt worden, mit einem pari-mutuel und vielen heftig umstrittenen Ergebnissen. An der Deckbar wurde häufig Champagner bestellt, den sich die Familien französischer Beamter teilten, sechs bis acht Personen pro Flasche. Schließlich, am letzten Abend der Reise, fand die Party mit einem Kostüm-Dinner, einem Konzert und einem Ball ihren Höhepunkt.
Eine ziemlich bunte Gesellschaft hatte sich zusammengefunden. An meinem Tisch saß ein rothaariger Amerikaner, der nach Saigon fuhr, um dort landwirtschaftliche Maschinen zu verkaufen. Auf seiner Uhrkette prangten Freimaurerzeichen, er trug einen Ring mit den verschlungenen Initialen einer weiteren Geheimgesellschaft, Manschettenknöpfe von Froth Blowers und im Knopfloch ein Rotarierrad. Zweifellos brauchte er als Geschäftsmann derlei Beweise seiner Vertrauenswürdigkeit, denn er sprach kein Wort Französisch. Die Speisekarte musste er sich von seinem Nachbarn übersetzen lassen, einem Italiener, dem das drittbeste Hotel in Madras gehörte. Es gab ein englisches Mädchen, das grüne Sandalen trug, und seine Mutter, die überallhin ein kleines, aber aufdringliches Schoßhündchen mitnahm, das Anlass {11}vieler Beschwerden derjenigen war, die sich über die roten Zehennägel der Tochter empörten. Es gab zahlreiche französische Kolonialbeamte mit Frauen und herumtobenden Kindern, wie sie üblicherweise die Mehrheit der Passagiere an Bord eines Schiffes der Messageries Maritimes stellen; in unserem Fall kam noch ein Trupp Fremdenlegionäre hinzu, der in Indochina die Disziplin aufrechterhalten sollte. Die Soldaten reisten vierter Klasse, verteilten sich tagsüber auf dem unteren Deck und verschwanden nachts im Bauch des Schiffes. Es waren überwiegend Deutsche und Russen. Abends bildeten sie Grüppchen und sangen Lieder. Sie hatten eine Kapelle, bestehend aus Trommeln und Mundharmonikas, die am Abend des Konzerts im Erster-Klasse-Salon auftrat. Auf den Trommeln stand »Mon Jazz«. Während der Fahrt durch den Suezkanal kletterten eines Nachts zwei Männer durch ein Bullauge und entkamen. Tags darauf versuchte ein Dritter, ihrem Beispiel zu folgen. Wir waren alle an Deck, tranken unseren vormittäglichen Aperitif, als wir ein Aufklatschen hörten und hinter uns eine kahlgeschorene Gestalt sahen, die in Hemdsärmeln die Uferböschung hinaufstürmte. Der Mann trug keine Kopfbedeckung, und die Sonne brannte. Er lief durch den Sand, entfernte sich immer weiter vom Schiff, wurde allmählich langsamer. Als er merkte, dass ihm niemand folgte, blieb er stehen und drehte sich um. Das Schiff fuhr weiter. Das Letzte, was wir von ihm sahen, war die Gestalt, die hinter uns herlief und mit den Armen winkte. Niemand ließ sich durch den Vorfall im Geringsten aus der Ruhe bringen. Mein Kabinensteward erzählte mir täglich eine Geschichte vom Leben auf dem Unterdeck. Einmal begannen zwei Fremdenlegionäre eine {12}Schlägerei und wurden in die Zellen gesteckt. Ein Chinese drehte eines Nachts durch und versuchte, sich das Leben zu nehmen. An einem anderen Tag gab es an Bord einen Diebstahl und so weiter. Ich glaube, der Steward hat vieles zu meiner Unterhaltung erfunden.
Neben diesen normalen Passagieren waren noch etwa zwanzig andere Personen mit Ziel Dschibuti an Bord, die zur Kaiserkrönung nach Abessinien reisen wollten. Dass auch ich dorthin fuhr, bedarf einer Erklärung. Sechs Wochen zuvor war mir der Name Ras Tafari kein Begriff gewesen. In Irland, in einem Haus, wo Chinoiserien und viktorianische Gotik um die Herrschaft über georgianische Architektur konkurrieren, hatten wir in der Bibliothek gesessen und, über den Atlas gebeugt, über eine Reise nach China und Japan gesprochen, die ich unternehmen wollte. Wir kamen auf andere Ziele zu sprechen, so auch Abessinien. Einer der Anwesenden war auf Urlaub aus Kairo gekommen. Er kannte sich in der abessinischen Politik einigermaßen aus und wusste von der bevorstehenden Krönung. Weitere Informationen gab es aus weniger zuverlässigen Quellen. Dass die abessinische Kirche Pontius Pilatus heiliggesprochen hatte und ihre Bischöfe durch Spucken auf den Kopf geweiht wurden, dass der wahre Thronerbe in den Bergen versteckt war, an Ketten aus purem Gold gefesselt; dass die Bevölkerung sich von rohem Fleisch und Met ernährte; wir schlugen im Gotha nach, was dort über das Königshaus stand, und stellten fest, dass die Familie auf Salomon und die Königin von Saba zurückging. In einem Geschichtsbuch lasen wir: »Die ältesten gesicherten Kenntnisse, die wir von der Geschichte Äthiopiens haben, beginnen mit Kusch, dem {13}Sohn von …, der unmittelbar nach der Sintflut den Thron bestieg«; in einem veralteten Lexikon hieß es, dass »die Abessinier, obschon nominell Christen, beklagenswert lax in ihren Sitten sind, selbst unter den höchsten Ständen und in den Klöstern sind Vielweiberei und Trunksucht verbreitet«. Alles, was ich hörte, steigerte den Reiz dieses erstaunlichen Landes. Zwei Wochen später war ich wieder in London und hatte meine Schiffspassage nach Dschibuti gebucht. Zwei Tage später fuhr ich mit dem Zug nach Gloucestershire, wo ich einen Freund traf, der als Redakteur bei einer Londoner Tageszeitung arbeitet. Ich erzählte ihm von meinen Reiseplänen. Meine einzige Sorge war, ob ich als Tourist Zugang zu den wirklich interessanten Zeremonien haben würde. Er meinte, dass ich in irgendeiner Funktion für die Zeitung hinfahren könne, das ließe sich bestimmt arrangieren. Aus dem Wochenende zurückgekehrt, sprach ich also mit dem Chef der Auslandsredaktion und war anschließend, zum ersten Mal in meinem Leben, ein ordentlich akkreditierter Journalist mit einem kleinen Ausweis, der mich befugte, als Sonderkorrespondent von den zehntägigen Krönungsfeierlichkeiten aus Addis Abeba zu berichten. Fünf Tage später ging ich in Marseille an Bord der Azay le Rideau, und zehn Tage darauf stand ich im Pyjama an Deck und sah über der flachen Küste von Französisch-Somaliland und dem blassen Paar, das zum Grammophon tanzte, den Tag heranbrechen.
An Schlaf war schon seit einiger Zeit nicht mehr zu denken gewesen, nachdem die Bediensteten der ägyptischen Delegation damit begonnen hatten, das Gepäck ihrer Herrschaft genau gegenüber meiner Kabine in den Korridor zu schaffen. Unter lauten militärischen Befehlen eines {14}Sergeanten und lauten unmilitärischen Protesten seiner Untergebenen wurde Blechkiste um Blechkiste herausgeschleift. Kaum vorstellbar, dass fünf Männer so viel Garderobe hatten. Und nach den Blechkisten kamen die großen Truhen, in denen sich das Geschenk des Königs von Ägypten für den Kaiser befand. Begleitet von einer bewaffneten Eskorte, waren sie in Port Said an Bord gebracht und während der ganzen Reise demonstrativ bewacht worden; der Inhalt war Gegenstand wilder Spekulationen der Passagiere. Wir schwelgten in Phantasien von Weihrauch, Sardonyx, Madrepora und Porphyr und anderem biblischen Überfluss. Wie sich später zeigen sollte, enthielten diese Truhen hübsche, aber völlig durchschnittliche Schlafzimmermöbel.
Drei weitere Delegationen waren an Bord: aus Frankreich, Holland und Polen. Eine vierte, die japanische, erwartete uns in Dschibuti. Wenn sie nicht gerade feierlich Visitenkarten austauschten1 oder an Deck eilig auf und ab gingen, saßen die Gesandten über ihren eleganten Mappen und widmeten sich dem Verfassen, Tippen und Ausarbeiten ihrer Glückwunschadressen.
Dieses plötzliche Zusammentreffen der Abgesandten der zivilisierten Welt in Abessinien mutet auf den ersten Blick ein wenig überraschend an, und ich glaube, die Abessinier waren nicht minder überrascht. Nachdem Kaiserin Zauditu {15}im Frühjahr, unmittelbar nach der Niederlage ihres Mannes Ras Gugsa, plötzlich gestorben war, teilte Ras Tafari den Mächten mit, dass er sobald irgend möglich den Titel eines Kaisers von Äthiopien annehmen werde, und die wenigen Nationen, die diplomatische Vertreter an seinen Hof entsandt hatten, lud er zur Teilnahme an den Feierlichkeiten ein. Einige Jahre zuvor war er zum Negus gekrönt worden; damals hatten ihn seine unmittelbaren Nachbarn für ein paar Tage besucht, und man hatte auf telegraphischem Wege Höflichkeiten ausgetauscht. Für die Kaiserkrönung wurde nun etwas mehr an Aufwand erwartet, doch die Reaktion der Weltmächte übertraf die äthiopischen Erwartungen in einer Weise, die schmeichelhaft war und zugleich für Verlegenheit sorgte. Die Staaten, die sich nicht so direkt für Afrika interessierten, interpretierten die Bekanntgabe als Einladung, und diejenigen mit starken lokalen Interessen ergriffen die Gelegenheit, ihre Wertschätzung und Sympathie in einer Weise zu zeigen, die mit Blick auf die bestehenden Beziehungen zu dem Land völlig überzogen war. Zwei Regierungen entsandten Angehörige des Königshauses, die Vereinigten Staaten schickten einen Herrn mit Erfahrungen in der Elektrobranche. Die Gouverneure von Britisch-Somaliland, dem Sudan, Eritrea, der Repräsentant in Aden, ein französischer Marschall, ein Admiral, drei Piloten und eine Marinekapelle erschienen in den unterschiedlichsten Uniformen. Für geeignete Geschenke wurden erhebliche staatliche Gelder aufgewendet. Die Deutschen brachten eine signierte Fotografie des Generals von Hindenburg sowie achthundert Flaschen Rheinwein, die Griechen eine moderne Bronzestatuette, die Italiener ein Flugzeug, die {16}Briten zwei elegante Szepter mit einer Inschrift in nahezu fehlerfreiem Amharisch.
Wozu dieser ganze Aufwand? Diese Frage stellten sich viele, selbst die unmittelbar Beteiligten. Die einfachen Abessinier erblickten darin einen angemessenen Tribut an abessinische Größe: Die Könige der Welt erwiesen ihnen die Ehre. Andere, etwas erfahrener in der internationalen Politik, sahen darin einen Anschlag auf die Integrität Abessiniens – der Farangi war gekommen, um das Land auszuspionieren. Ehrliche Siedler in ganz Afrika sprachen von absurder Reverenz gegenüber einem schlichten Eingeborenen. In den Gesandtschaften selbst herrschte eine gewisse Unruhe. Die Aufgabe, den Abessiniern ihre wahre Bedeutungslosigkeit in der Welt vor Augen zu führen, würde nach alldem noch schwieriger werden. Doch was konnte man tun? Wenn einige Mächte beschlossen, Herzöge und Fürsten, Szepter und Flugzeuge zu schicken, blieb den anderen nur, diesem Vorbild nach besten Kräften zu folgen. Wer hatte mit dem Ansturm begonnen? Und die abessinische Regierung mag sich besorgt gefragt haben, wie sie all diese illustren Gäste unterbringen und die Kosten der Gastfreundschaft aus einem ungeordneten Staatshaushalt und einer schwachen Währung bestreiten sollte. Warum also dieser ganze Aufwand?
Wer eine plausible Erklärung haben will, muss nicht nach gewichtigen politischen Motiven suchen. Addis Abeba ist kein Ort, wo sich Diplomaten rasch einen Namen machen, und die Potentaten im Foreign Office verfolgen nicht mit aufmerksamen Blicken, wie sich ihre Kadetten in dieser großen Höhe machen. Als Diplomat dorthin entsandt zu werden mag für einen fleißigen Generalkonsul ein {17}angemessener Lohn sein, eine Karriere begründet es nicht. Wer könnte es diesen Gentlemen daher verübeln, wenn sich in ihre Depeschen gelegentlich Formulierungen einschleichen, die eine recht großzügige Einschätzung der Bedeutung des Landes verraten? Entspringt in Abessinien denn nicht der Blaue Nil? Will man denn ausschließen, dass dieses unprospektierte Bergland über enorme Bodenschätze verfügt? Und wenn in den langweiligen Gesandtschaftsalltag mit seinen immer gleichen bescheidenen Vergnügungen, wenn in das Leben der Diplomatengattinen – armen Halbschwestern der hohen Damen in Washington oder Rom – plötzlich Glanz käme, höfische Pracht und goldbetresste Uniformen, Hofknickse und Champagner und gutaussehende Adjutanten: Wer würde es ihnen verdenken, wenn sie ihre Männer darin bestärkten, mit Nachdruck auf eine wahrhaft imponierende Beteiligung bei den Feierlichkeiten zu drängen?
Und kann es überraschen, dass Staaten, die Afrika sehr fern sind – schlittenfahrende Polacken und blonde Schweden –, ebenfalls an der Party teilnehmen wollen? Wenn mich die Pracht Abessiniens aus einem vergleichsweise bunten und freien Leben anlockte, warum nicht all jene in ihren grauen Kanzleien? Die Jagdgewehre neben den Uniformkoffern demonstrierten, dass diese Leute das Beste aus dieser Unternehmung machen wollten, und ich weiß, dass manch einer für seine Schiffspassage selbst aufgekommen war. »Nous avons quatre citoyens ici, mais deux sont juifs«, erklärte ein Attaché und zeigte mir die Gerätschaften, mit denen er während seines Aufenthalts in Afrika seine umfangreiche Schmetterlingssammlung zu erweitern hoffte.
{18}Rasch wurde es hell, die beiden Tanzenden lösten sich schließlich voneinander und gingen zu Bett. Von der Küste näherten sich Boote, es begann das Laden von Kohle. Planken erstreckten sich zwischen Schiff und Barkassen. Eine Planke brach, so dass die somalischen Kulis drei, vier Meter tief auf die Kohle fielen. Einer lag stöhnend auf dem Rücken, als die anderen schon aufgestanden waren. Der Vorarbeiter warf ein Stück Kohle nach ihm. Der Mann stöhnte und drehte sich um. Noch ein Stück, dann rappelte er sich hoch und ging wieder an die Arbeit. Somalische Jungen schwammen um das Schiff herum, bettelten um Geld, das man ihnen zuwerfen sollte. Passagiere zeigten sich auf Deck.
Wir lagen weit draußen in der Bucht. Zwischen uns und der Reede lag das Wrack eines großen Frachters, flach auf der Seite, völlig leergeräumt und verwittert. Armandy erwähnt das Schiff in La Désagréable Partie de Campagne.
Bald setzte Regen ein.
Niemand wusste genau, wie und wann es nach Addis Abeba weitergehen würde. Der Zahlmeister hatte uns beruhigt. Er habe der Station die Zahl der Passagiere telegraphisch mitgeteilt. Ein Sonderzug werde noch am selben Tag für uns bereitstehen. Doch es kursierten widersprüchliche Gerüchte. Diejenigen, die schon einige Erfahrungen mit Abessinien hatten, wiesen darauf hin, dass es nie und nimmer so unkompliziert sein werde. Angeblich stand ein Sonderzug bereit, aber nur für die Delegationen. Anderen Berichten zufolge würden zwei Züge fahren, einer am Morgen für die Delegationen, einer am Abend für die inoffiziellen Passagiere. Eine Schiffsladung Passagiere werde an diesem Tag an Bord eines P.&O.-Dampfers aus Aden eintreffen, so {19}dass kaum Hoffnung auf Unterbringung bestehe. Für die Dauer der Krönungsfeierlichkeiten sei jeder private Reiseverkehr unterbrochen. Die Delegationen selbst wussten nichts von irgendwelchen Vorkehrungen, außer dass sie zum Lunch in der Residenz des Gouverneurs erwartet wurden.
Wir warteten, bis wir an der Reihe waren, an Land zu gehen. Die Kulis lungerten auf den Planken herum, die Jungen im Wasser bettelten um Geld oder erschienen frierend an Deck mit dem Angebot, uns mit einem Sprung ins Wasser zu unterhalten, an Land wurde jedes Mal laut Salut geschossen, wenn die Barkasse des Gouverneurs eine Delegation abholte und auslud. Unablässig fiel warmer Regen.
Schließlich durften auch wir an Land gehen. Es gab noch einen zweiten Engländer, ein älterer Herr, der privat nach Addis Abeba wollte. Unterwegs hatte er die ganze Zeit in einem Buch über Tropenhygiene gelesen und mir viele beunruhigende Dinge über Malaria und Schwarzwasserfieber, Cholera und Elefantiasis mitgeteilt. Abends bei einer Zigarre hatte er mir erklärt, wie sich Hakenwürmer von den Fußsohlen in die inneren Organe vorarbeiten, wie Sandflöhe ihre Eier unter den Zehennägeln legen und wie die Symptome langsamer Lähmung aussehen, die von Zecken übertragen wird.
Gemeinsam vertrauten wir unser Gepäck dem französischsprechenden Träger des Hôtel des Arcades an und gingen zum englischen Vizekonsul – einem liebenswürdigen jungen Reedereiagenten, der uns mitteilte, dass am Abend tatsächlich zwei Züge abfahren sollten, beide allerdings für die Delegationen reserviert seien. Der nächste Zug würde drei Tage später gehen – reserviert für den Herzog von {20}Gloucester, der nächste wieder drei später – reserviert für den Fürsten Udine. Er konnte uns wenig Hoffnung machen, dass wir nach Addis Abeba kommen würden, wollte aber sehen, was er tun könne. Entsprechend gelaunt fuhren wir zum Hôtel des Arcades. Unsere Tropenhelme saßen weich auf dem Kopf, unsere weißen Anzüge klebten an den Schultern. Der Hoteldiener sagte, ich müsse mit ihm zum Zoll gehen. Dort fanden wir einen nassgeschwitzten einheimischen Wachsoldaten vor, an dessen Gewehr das Wasser herunterlief. Der Zollchef sei auf dem Empfang im Haus des Gouverneurs, sagte er. Er wisse nicht, wann er zurückkehre oder ob er an diesem Tag überhaupt noch zurückkehren werde. Mit Hilfe des Hoteldieners wies ich darauf hin, dass wir unser Gepäck brauchten, um uns frische Sachen anziehen zu können. Solange der Zollchef nicht zurück sei, dürfe hier nichts angefasst werden, sagte er. Der Träger griff sich einfach die nächsten Stücke und lud sie, unbeeindruckt von den Vorhaltungen des Postens, in die Droschke. Anschließend fuhren wir zurück ins Hotel.
Das war ein zweigeschossiges Haus mit Arkadengang und einer kümmerlichen Stuckfassade. Auf der Rückseite führte eine Holztreppe zu zwei breiten Veranden, von denen die wenigen Zimmer abgingen. Im Hof stand ein Zitronenbaum, der einem misanthropischen schwarzen Affen als Quartier diente. Das Hotel gehörte einer hübschen Französin von großer geschäftsmäßiger Freundlichkeit. Sie gab uns warmes Wasser und ein Zimmer zum Umkleiden und lachte über unsere Schwierigkeiten. Sie profitiert von den Unzulänglichkeiten der Französisch-Äthiopischen Eisenbahn, denn niemand bleibt freiwillig lange in Dschibuti.
{21}Was nach dem ersten Augenschein hinreichend klar war, wurde noch klarer, als wir nach dem Mittagessen – der Regen hatte inzwischen aufgehört – eine Stadtrundfahrt unternahmen. Wir holperten und schaukelten in einem Einspänner durch dampfende Tümpel. Die Straßen, im offiziellen Stadtführer als »elegant und lächelnd« beschrieben, waren nicht mehr als Wüstenstriche zwischen den einzelnen Häuserblocks. Im Europäerviertel waren die meisten Häuser von der Bauart unseres Hotels – mit Arkaden versehen und völlig heruntergekommen.
»Sie sehen aus, als würden sie jeden Moment einstürzen«, bemerkte mein Begleiter, als wir an einem besonders trostlosen Bürohaus vorbeifuhren, und während wir noch hinschauten, passierte das auch tatsächlich. Ganze Stuckfladen lösten sich von der Fassade, ein, zwei Ziegelsteine fielen auf die Erde. Einige indische Büroangestellte stürzten erschrocken ins Freie, ein hemdsärmeliger Grieche trat aus dem Haus gegenüber, eine Gruppe halbnackter Eingeborener erhob sich von der Erde, die Zähne noch immer mit Holzstäbchen scheuernd, und schaute sich nervös um. Unser Kutscher wies aufgeregt mit seiner Peitsche auf die Szene und setzte uns auf Somali ins Bild. Es war ein Erdbeben, das wir in unserem rumpelnden Gefährt nicht bemerkt hatten.
Wir fuhren an einer weißgetünchten Moschee vorbei zum Kamelmarkt und dem Eingeborenenviertel. Die Somalis sind eine Rasse von außergewöhnlicher Schönheit, sehr schlank und aufrecht, mit feinen Gesichtszügen und eindrucksvollen, weit auseinanderstehenden Augen. Die meisten von ihnen tragen einen Lendenschurz und mehrere Ringe aus Kupferdraht um Hand- und Fußgelenke. Der Kopf ist entweder {22}kahlgeschoren oder mit Ocker gefärbt. Acht, neun Huren umringten unsere Droschke, bis sie vom Kutscher schließlich mit der Peitsche verjagt wurden. Unzählige nackte Kinder liefen hinter uns her und riefen nach Bakschisch. Einige prächtige speertragende Burschen vom Land spuckten verächtlich aus, als wir an ihnen vorbeikamen. Wir erreichten den Stadtrand, wo die Hütten, einst strohgedeckte Lehmwürfel, kleine kuppelförmige Gebilde wurden, die wie umgestürzte Vogelnester aussahen, gebaut aus Zweigen, Gras, Lumpen und flachgepressten Konservendosen, mit einem Loch, durch das man vermutlich bäuchlings hineinkroch. Wir fuhren auf der Uferstraße zurück, vorbei an einigen aufgeräumten Fuhrhöfen und Wellblechschuppen. Am Postamt ließ ich halten, um meinen Auftraggebern gewissenhaft von der Ankunft der diversen Delegationen zu berichten. Bei meiner Rückkehr ins Hotel fand ich dort den Vizekonsul mit der guten Nachricht, dass er für uns einen Waggon in dem ersten Sonderzug reserviert hatte, der am Abend fahren sollte. Wir waren bester Laune, aber die Hitze war noch immer unerträglich. Wir gingen schlafen.
Am Abend, und weil wir wussten, dass unsere Abreise unmittelbar bevorstand, wurde Dschibuti plötzlich sehr viel erträglicher. Wir besuchten die Geschäfte, kauften einen französischen Roman mit einem aufreizenden Umschlag, einige Burma-Zigarren und wechselten etwas Geld. Für unsere abgegriffenen und dreckigen Banknoten der Banque d’Indo-Chine bekamen wir massive Silberdollar.2
{23}Die jüngsten Bücher über Abessinien – und ich hatte viele gelesen zwischen West Meath und Marseilles – enthalten drastische Beschreibungen der Bahnreise zwischen Dschibuti und Addis Abeba. Normalerweise fährt einmal die Woche ein Zug, der für die Strecke drei Tage braucht; die beiden Nächte werden in Hotels in Dire Dawa und Awash verbracht. Es gibt mehrere gute Gründe, nicht nachts zu fahren. Einer ist, dass die Zugbeleuchtung häufig ausfällt, ein zweiter, dass während der Regenzeit nicht selten das Gleisbett weggespült wird, ein dritter, dass die Galla und Danakil, durch deren Gebiet die Strecke führt, nach wie vor ihren mörderischen Geschäften nachgehen und ihre anfängliche Praxis, Eisenschwellen herauszureißen und Speerspitzen daraus anzufertigen, noch nicht völlig {24}ausgerottet ist.3 Während der Krönungswoche stellte es sich jedoch als notwendig heraus, angesichts der vielen zusätzlichen Reisenden die Züge durchgehend fahren zu lassen. Wir verließen Dschibuti am Freitag nach dem Abendessen und kamen in Addis Abeba am Sonntagmorgen an. Es gab natürlich keinen Speisewagen, und die wenigen Schlafwagen waren von den Delegationen belegt, doch mein Begleiter und ich hatten einen Erster-Klasse-Waggon für uns allein; Mahlzeiten nahmen wir unterwegs bei Zwischenaufenthalten ein. Es war eine recht bequeme Reise.
In der Dunkelheit fuhren wir durch die unerträgliche Ödnis von Französisch-Somaliland – nichts als Wüste und Steine, ohne jede Spur von Leben – und kamen am nächsten Morgen in Dire Dawa an. Diese ordentliche kleine Stadt entstand während des Baus der Eisenbahn auf dem Land, das der französischen Gesellschaft überlassen worden war, und lebt seit dieser Zeit von der Bahn, bei tendenziell sinkendem Wohlstand. Es gibt dort zwei Hotels, ein Café und einen Billardsalon, ein paar Geschäfte und Büros, eine Bank, eine Mühle, einige Villen und die Residenz des abessinischen Gouverneurs. Bougainvilleen und Robinien säumen die Straßen. Zweimal wöchentlich sorgt die Ankunft eines {25}Zuges für ein paar Stunden Geschäftigkeit. Reisende werden in die Hotels gebracht, Gepäck wird durch die Straßen gefahren, Postangestellte sortieren die Post aus, Handelsagenten setzen ihre Tropenhelme auf und schlendern mit ihren Fakturen zum Güterbahnhof, und dann fällt Dire Dawa wieder in seine ausgiebige Siesta zurück, wie eine kleine Insel, nachdem das Postschiff abgelegt hat.
Doch dies war keine gewöhnliche Woche. Seit 1916 – dem vorletzten Bürgerkrieg, als die mohammedanischen Anhänger von Lij Iyasu im Bergland von Harar massakriert worden waren – hatte Dire Dawa nicht mehr solch radikal verwirrende Ereignisse erlebt wie diese vielen Sonderzüge, welche die Besucher zur Krönung des Kaisers brachten. Auf den Hauptstraßen standen Fahnenmasten in den abessinischen Farben, zwischen denen gelbe, rote und grüne Wimpel hingen. Aus der Hauptstadt hatte man per Güterzug (außerhalb von Dire Dawa gibt es keine Straßen) Automobile herbeigeschafft, in denen die Delegierten zum Frühstück gefahren wurden. Die irregulären Truppen der gesamten Provinz waren mobilisiert und säumten nun den ganzen Weg.
Es war ein grandioses, verblüffendes Spektakel. Mein Reisegefährte und ich blieben noch einige Minuten in unserem Waggon, bis die offizielle Begrüßung beendet war und die Delegierten den Bahnhof verlassen hatten. Dann gingen wir über den Perron auf den Platz. Er war ganz leer und ganz still. Auf drei Seiten standen die abessinischen Soldaten; vorn, wo der Boulevard zur Residenz des Gouverneurs führte, verschwand gerade das letzte Automobil. So weit der Blick reichte, weißgewandete Stammesangehörige, {26}bewegungslos, ohne Kopfbedeckung, barfüßig, das Gewehr geschultert; einige hatten olivfarbene Haut und scharfes Profil, anderen, dunkleren, mit wulstigen Lippen und flachen Nasen, war das Sklavenblut anzusehen; die meisten waren großgewachsen und kräftig gebaut, alle hatten einen schwarzen, gekräuselten Bart. Ihre Kleidung war die landesübliche – langes weißes Hemd, weiße Leinenhose, oben weit, unten eng (ähnlich wie Jodhpurs), und die shamma, ein weißer Schal, der wie eine Toga über der Schulter getragen wird, sowie ein deutlich sichtbarer Patronengurt. Vor jeder Abteilung stand der Anführer in Galakleidung, wie sie so oft für die europäische Presse fotografiert wird. Sie bestand, je nach Reichtum des Trägers, aus einem Löwenfell, einem buntgestreiften Hemd und einem langen geschwungenen Schwert; in manchen Fällen wurde das Löwenfell durch ein Kleidungsstück aus besticktem Satin dargestellt, das wie ein Messgewand aussah, vorn und hinten geschlitzt in einer Stilisierung von Schwanz und Beinen. Es war ein denkwürdiges Erlebnis, nach dem südländischen Urlaub an Bord der Azay le Rideau, dem Gedränge in Dschibuti und der unruhigen Nacht im Zug hinauszutreten in die süße Morgenluft und den Frieden, der von diesen reglos dastehenden Kriegern ausging. Sie schienen wild und zahm zugleich, große zottige Hunde von ungewissem Temperament, für eine Weile fest an der Leine gehalten.
Wir frühstückten im Hotel und rauchten auf der Terrasse eine Pfeife, wir warteten auf die Rückkehr der Delegierten. Bald mussten die Soldaten, die auf dem Boden gehockt hatten, wieder Aufstellung nehmen, als die Automobile mit den Diplomaten, die sich bei Porridge, Räucherhering, {27}Eiern und Champagner gestärkt hatten, den Hügel herunterkamen. Wir kehrten zum Bahnhof zurück und setzten die Reise fort.
Bis Awash, wo wir bei Sonnenuntergang eintrafen, ging es nun durch endlos ödes Buschland – Dornengestrüpp, Steine, kleine, bräunliche Mimosenbäume und Sand, Ameisenhaufen, einige Geier, hin und wieder ein ausgetrockneter Wasserlauf oder Felsen, sonst nichts, stundenlang. Immer wieder hielten wir an Bahnhöfen, nicht mehr als einzelne Schuppen in einem stacheldrahtumzäunten Areal, um uns mit Wasser zu versorgen. Jedes Mal begrüßten uns dort ein Posten, zwei, drei uniformierte Bahnpolizisten und der lokale Stammeshäuptling mit zehn, manchmal auch fünfzig Mann. Mittags nahmen wir an einem Ort namens Afdem in einem Zelt den Lunch ein, der aus vier verschieden zubereiteten Fleischgerichten bestand. In Awash warteten wir vier Stunden, von sechs bis zehn, während Mechaniker sich an der Zugbeleuchtung zu schaffen machten. Vor jeder Waggontür hockte ein bewaffneter Posten. In Awash gibt es mehrere Schuppen, zwei, drei Bungalows von Bahnangestellten, einen zementierten Perron und ein Gasthaus. Nach dem Abendessen saßen wir im Hof des Gasthauses auf kleinen harten Stühlen oder gingen auf dem Bahnsteig auf und ab oder stolperten zwischen den Eisenschwellen. Es gab kein Dorf, keine Straße. Es war besser, sich im Freien aufzuhalten, da es dort nicht so viele Moskitos gab. Die Zugbeleuchtung flackerte unruhig. Bald erschien ein Trupp zerlumpter Galla und begann zu tanzen. Zwei Männer tanzten, die anderen standen im Kreis um sie herum, sangen, stampften mit den Füßen und klatschten in die Hände. Sie führten die Pantomime einer {28}Löwenjagd auf. Die Wachposten wollten sie verscheuchen, doch der ägyptische Gesandte hielt sie zurück und gab den Tänzern eine Handvoll Dollar; daraufhin tanzten sie noch ungestümer und wirbelten im Staub herum wie Kreisel. Es waren außerordentlich wilde Männer, die langen Haare mit Butter und Lehm eingeschmiert, die dünnen, schwarzen Leiber mit Fetzen aus Fell und Sackleinwand behängt.
Schließlich war die Beleuchtung repariert, und wir fuhren weiter. Awash liegt am Fuß des Hochlands; während der ganzen Nacht ging es unablässig bergan. Jedes Mal, wenn wir aus dem Schlaf gerissen wurden, stellten wir fest, dass die Luft frischer und kühler war, und am frühen Morgen hatten wir uns in Decken und Mäntel gewickelt. Wir frühstückten vor Sonnenaufgang in einem Ort namens Mojo und setzten unsere Reise im ersten Licht des Tages fort. Nun sahen wir, wie sehr sich die Landschaft verändert hatte: Verschwunden waren Busch und Ebene, statt dessen ein hügeliges Land, blaue Berge am Horizont. Allenthalben sah man reiche kleine Bauernhöfe, Gruppen strohgedeckter Rundhütten, umgeben von hohen Palisaden, schöne Rinderherden auf endlosen Weiden, Getreide- und Maisfelder, auf denen ganze Familien arbeiteten. Auf dem Weg neben dem Gleis schaukelten Kamelkarawanen entlang, beladen mit Futter und Brennstoff. Die Bahnstrecke ging noch immer bergan, und zwischen neun und zehn sahen wir vor uns in der Ferne die Eukalyptuswälder von Addis Abeba. Hier, an einer Station mit Namen Akaki, wo ein indischer Händler ein großes Lagerhaus unterhält und ein Ras den größten Teil eines geplanten Hotels errichtet hatte, wurde abermals gehalten, um den Delegierten Gelegenheit zu geben, sich {29}zu rasieren und ihre Uniform anzulegen. Wieder wurden Blechkisten und Kleiderkoffer herbeigeschafft, Diener eilten zwischen Gepäckwaggon und Schlafwagen hin und her. Der niederländische Gesandte stand bald mit Dreispitz und Goldtressen neben dem Gleis, der ägyptische mit Tarbusch und Epauletten, die Japaner in Frack, weißer Weste und Zylinder; die Delegationsleiter inspizierten ihre Mitarbeiter, dann stiegen alle wieder ein, und die Reise ging weiter. Noch eine halbe Stunde ging es mühsam die kurvenreiche Strecke bergan, bis wir schließlich in Addis Abeba eintrafen.
Der Bahnhof ist ein großer, zweigeschossiger Betonbau mit überdachtem Bahnsteig. Ein roter Teppich war ausgerollt, vor dem Soldaten eines ganz anderen Schlages standen als diejenigen, denen wir unterwegs begegnet waren. Dies hier waren untersetzte, pechschwarze Burschen von der sudanesischen Grenze. Sie trugen nagelneue, gutgeschnittene Khakiuniformen, der Löwe von Juda prangte messingglänzend auf Mützen und Knöpfen; moderne Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett. Mit Ausnahme der nackten Füße unter den Gamaschen hätte dies die Kadettenformation einer englischen Internatsschule sein können. Vor ihnen, mit gezogenem Schwert, stand ein europäischer Offizier. Dies war eine Abteilung der Leibwache Tafaris. Das Blut in Gugsas verstümmelter Leiche war kaum erstarrt, und die trauernde Kaiserin ihrem Kälteschock erlegen, da war dieses Corps bereits aufgestellt worden. Diese Männer, dem Thron treu ergeben, waren in Tafaris verstreuten Provinzen rekrutiert worden. Binnen sechs Monaten stand ein ganzes Regiment, der Kern einer organisierten nationalen Armee.
{30}Als der Zug anhielt, präsentierte die Wache das Gewehr, der Großkämmerer im blauen Satinmantel trat vor, um die Delegationen zu begrüßen, und die Kapelle spielte. Auch das war eine Neuerung. Bedauerlicherweise bin ich nicht besonders musikalisch, aber mir wurde versichert, dass die Melodien, mit denen jede Delegation begrüßt wurde, in praktisch allen Fällen sofort zu erkennen waren. Eines fiel mir jedoch auf, und das war ihre ungewöhnliche Länge. Keine einzige schwierige Passage wurde ausgelassen, jede Nationalhymne in sämtlichen Strophen gespielt. In Sachen Langatmigkeit ging der erste Platz unstrittig an die Polen. Schließlich wurde die äthiopische Hymne gespielt, die wir so oft in den nächsten zehn Tagen hörten, dass sie selbst mir einigermaßen vertraut wurde. (Sie begann wie »Lichter über dem himmlischen Salem«, hörte aber anders auf.)
Schließlich verschwindet auch die letzte Delegation. Die Töchter des britischen Gesandten sind zur Begrüßung des Zuges gekommen. Auf ihre Frage, wo ich untergebracht sei, sage ich, meines Wissens nirgendwo. Betroffenheit. Sie sagen, dass die Stadt komplett belegt sei. Jetzt noch ein Zimmer zu finden sei unmöglich. Vielleicht gibt es irgendwo in der Gesandtschaft ein Zelt. Möglich, dass ich es in einem der Hotels im Hof aufstellen darf. Wir steigen ins Auto und fahren hinauf in die Stadt. Auf halbem Weg kommen wir am Hôtel de France vorbei. Vor dem Eingang steht die eindrucksvolle Figur von Irene Ravensdale im Reitkostüm. Wir halten an, um sie zu begrüßen. Ich laufe hinein und frage den Hoteldirektor, ob es ein freies Zimmer gibt. Aber ja, natürlich. In einem Nebengebäude hinter dem Hotel, kein sehr gutes Zimmer. Aber wenn ich wollte, könnte ich es haben, {31}zwei Pfund die Nacht. Ich bin sofort einverstanden, trage mich ein und kehre wieder zurück nach draußen zu Irene. Gesandtschaftsautomobil und Gepäck sind verschwunden. Auf der Straße lauter Abessinier, die auf Maultieren vom Land eintreffen, Arbeitstiere, die überall herumtrotten, den Weg versperren und wieder freigeben. Wir kehren ins Hotel zurück, essen zu Mittag und gehen schlafen. Später taucht das Gepäck wieder auf, bewacht von einem freundlichen jungen Engländer, der, als Kaffeepflanzer erfolglos, von der Gesandtschaft als Mädchen für alles angeheuert worden war. Die absurden zwei Wochen Alice im Wunderland haben begonnen.
{32}II
Tatsächlich muss ich immer wieder an Alice im Wunderland denken, wenn ich nach einer historischen Parallele für die Verhältnisse in Addis Abeba suche. Es gibt noch andere: Israel unter König Saul, das Schottland des Shakespeare’schen Macbeth, die Hohe Pforte, wie sie in den diplomatischen Depeschen des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts erscheint, doch nur in Alice findet man jene besondere Atmosphäre einer galvanisierten und verfremdeten Realität, wo Tiere Uhren in den Westentaschen tragen, Majestäten auf dem Krocket-Rasen neben dem Scharfrichter einherschreiten und eine Gerichtsverhandlung damit endet, dass plötzlich ein Kartenspiel durch die Luft segelt. Wie kann man den verrückten Zauber dieser äthiopischen Tage erzählen, lebendig werden lassen?
Zunächst einmal möchte ich ein Bild der Szenerie vermitteln. Addis Abeba ist eine neue Stadt, so neu, dass nichts an ihr wirklich fertig aussieht. Vor vierzig Jahren erwählte Menelik der Große dieses Feldlager im Hochland und nannte den Ort »Neue Blume«. Bis dahin hatte die Regierung je nach Versorgungslage zwischen den alten, von Priestern beherrschten Städten des Nordens gependelt, doch das spirituelle Zentrum war immer Axum, so wie sich die französischen Könige an Reims orientiert hatten. Menelik {33}war der erste König, der mit der Axumer Krönungstradition brach, worunter seinerzeit sogar sein enormes militärisches Prestige litt. Zeitgenössische Autoren sehen in diesem Bruch ein Zeichen von Schwäche. Tatsächlich war dies ein notwendiges Element seiner Politik. Menelik war nicht mehr bloß König der christlichen amharischen Hochlandbewohner, sondern Beherrscher eines großen Reichs, das im Westen die schwarzen heidnischen Shangalla einschloss, im Osten die nomadischen kannibalischen Danakil, im Südosten die von Somaliern bewohnte Ogaden-Wüste und im Süden den großen fruchtbaren Landgürtel, der von den mohammedanischen Galla gehalten wurde.
In Addis Abeba, inmitten seines eigenen Volkes, fand er das neue Zentrum seiner Besitzungen, noch im Hochland gelegen, aber an dessen äußerstem Rand; unmittelbar am Fuß des Hochlands liegt das Gebiet der elenden Guraghi, jenes verachteten Volkes, das Bauarbeiter und Straßenkehrer stellt; Awash ist das Land der Galla. Addis Abeba ist der strategische Ort der Herrschaft über diese auseinanderstrebenden Besitztümer. Lij Iyasu zog eine noch radikalere Veränderung in Betracht. Sein Ziel oder das seiner Berater war es offenbar, das Reich von Harar aus umzugestalten und eine große mohammedanische Macht zu errichten, die im Falle eines Sieges über die großen europäischen Mächte die gesamte somalische Küste einschließen würde – eine über die Maßen ehrgeizige Vorstellung, die auch ohne europäische Intervention scheiterte. Die genauen Umstände seines Endes werden vielleicht nie bekannt werden, ebenso wenig, inwieweit seine Pläne überhaupt klar formuliert waren. Fest steht, dass er mit dem »verrückten Mullah« {34}in Britisch-Somaliland korrespondierte. In seinen letzten Lebensjahren soll er sich vom Christentum abgewendet haben. Die mohammedanische Herkunft seines Vaters verlieh solchen Berichten zusätzliches Gewicht, und als Beweis galt sein (angeblich in Harar aufgenommenes) Porträt, das ihn mit einem Turban zeigt. Nach Ansicht vieler Leute wurde dieses eindeutige Beweisstück jedoch in Addis Abeba von einem armenischen Fotografen fabriziert. Ob diese Einzelheiten stimmen oder nicht, fest steht, dass dieser unselige junge Mann, entgegen vielen Behauptungen, nicht wegen seines aufwendigen Lebensstils stürzte, der ihn seinen einfacheren Untertanen eher sympathisch machte, sondern wegen der Vernachlässigung dessen, was noch auf Jahre hinaus die Stärke des äthiopischen Reichs ausmachen dürfte – die christliche Religion und die kämpferischen Qualitäten der amharischen Hochlandbewohner. Lij Iyasu ist seit 1916 nicht mehr gesehen worden. Er soll, teilnahmslos und krankhaft übergewichtig, unter dem Schutz von Ras Kassa in Fiche leben, doch ein Reisender, der unlängst das bekannte Anwesen passierte, berichtete von einem baufälligen Dach und einem völlig zugewucherten Eingang. Die Leute sprechen nicht gern von Lij Iyasu, denn das ganze Land wird von Spitzeln überwacht, aber mehr als nur ein Europäer, dem seine Diener vertrauen, erzählte mir, dass der Name im einfachen Volk noch immer sehr angesehen sei. Lij Iyasu hat mütterlicherseits das wahre Blut Meneliks. Man bezeichnet ihn als korpulenten jungen Mann mit faszinierenden Augen, als überaus großzügig und leichtlebig. Ras Tafaris raffinierte Diplomatie scheint manchem von ihnen weit weniger majestätisch.
{35}In Äthiopien gab es keine Verfassung. Die Thronfolge wurde theoretisch durch Proklamation geregelt, in der Praxis durch Blutvergießen. Menelik hatte keine männlichen und keine legitimen Kinder. Seine Tochter war Lij Iyasus Mutter, und er selbst hatte Lij Iyasu ernannt. Dieser bestimmte keinen Nachfolger, weshalb es keinen eindeutigen Thronerben gab. Seine zweite Tochter, in deren Adern Meneliks Blut floss, herrschte als Kaiserin Zauditu, aber ihre religiösen Pflichten okkupierten sie mehr als die Regierungsgeschäfte. Es brauchte einen Herrscher; drei, vier Adelige konnten dank ihrer Herkunft ebenfalls Ansprüche auf das Amt anmelden. Der wichtigste von ihnen war Ras Kassa, der sich aber vor allem religiösen Fragen und der Verwaltung seiner Ländereien widmete und nicht sonderlich interessiert war, größere Verpflichtungen auf sich zu nehmen. Es drohte die Gefahr, dass Meneliks Reich abermals in eine Handvoll kleiner Fürstentümer zerfallen und der Kaiserthron eine Schatteneinrichtung würde. Unter diesen Bedingungen würde die abessinische Unabhängigkeit angesichts des Vordringens europäischer Handelsinteressen kaum Bestand haben. Die Ras waren sich dieser Lage sehr wohl bewusst und erkannten, dass es nur einen Mann gab, der durch Rang, Bildung, Intellekt und Ambition für den Thron geeignet war. Das war Ras Tafari. Also beschlossen sie, ihn zum Negus zu machen. In der breiten Öffentlichkeit, außerhalb seiner eigenen Provinzen, war sein Prestige gering; er zeichnete sich weder durch Blutsverwandtschaft mit Menelik noch durch bemerkenswerte militärische Taten aus. Unter den Fürsten war er primus inter pares, von ihnen dazu ausersehen, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen und zu ihrer Befriedigung durchzuführen.
{36}Aus dieser anfangs prekären Situation baute Tafari in den folgenden Jahren seine Herrschaft allmählich aus und festigte seine Position. Er reiste nach Europa und legte großen Wert darauf, europäische Besucher mit seiner aufgeklärten Haltung zu beeindrucken. Er spielte die Rivalitäten der französischen und italienischen Gesandten gegeneinander aus und sicherte seine Position im Land, indem er das Ansehen Äthiopiens in der Welt stärkte. Er wurde in den Völkerbund aufgenommen, überall identifizierte er sich mit seinem Land, so dass Europa ihn schließlich als selbstverständlichen Herrscher betrachtete.
Gleichwohl musste er um seinen Thron kämpfen. Im Frühjahr 1930 rebellierte ein mächtiger Aristokrat namens Ras Gugsa.4 Er war der Ehemann der Kaiserin. Sie waren geschieden, unterhielten aber freundschaftliche und intime Beziehungen. Tafaris Armee warf den Aufstand nieder, und Gugsa selbst fand in den blutigen Auseinandersetzungen den Tod. Tags darauf starb plötzlich die Kaiserin, und Tafari rief sich, mit Zustimmung der anderen Fürsten, zum Kaiser aus. Als Tag der Krönung wurde der frühestmögliche Termin festgesetzt, bis zu dem alle nötigen Vorbereitungen getroffen werden konnten. Die Krönungsfeierlichkeiten waren also der letzte Schritt in einer langen, gutgeplanten Strategie. Tafari, der weiterhin an seiner klugen Taktik festhielt – das heimische Publikum mit seinen außenpolitischen Erfolgen zu beeindrucken, das Ausland mit seinen innenpolitischen –, bezweckte mit dieser Zurschaustellung {37}zweierlei. Den europäischen Gästen wollte er vor Augen führen, dass Äthiopien nicht bloß ein Haufen barbarischer Stämme war, die das Ausland ausbeuten konnte, sondern ein mächtiger, organisierter, moderner Staat. Seinen eigenen Landsleuten wollte er zeigen, dass er nicht der oberste Führer eines Dutzends eigenständiger Völker war, sondern ein absoluter Monarch, der von den Monarchien und Regierungen der weiten Welt als gleichberechtigt anerkannt wurde. Und wenn seine einfachen Untertanen nicht mehr zwischen Höflichkeit und Ehrung unterschieden, wenn der Eindruck entstand, dass diese prachtvoll gekleideten Delegierten (die sich ein paar Tage Urlaub von ihren ernsthaften Verpflichtungen nahmen, um an einer ungewöhnlichen Festlichkeit teilzunehmen und vielleicht auch auf die Jagd zu gehen) im Namen ihrer Herrscher erschienen, um äthiopischer Macht und Größe ihre Reverenz zu erweisen – umso besser. Die verstümmelten Gefangenen von Adowa waren noch immer ungerächt. Die irritierend eilfertige Reaktion der zivilisierten Staaten kam dieser Sichtweise entgegen. »Tafari stieg erst dann in unserem Ansehen«, bemerkte der Diener eines Engländers, »als wir erfuhren, dass Ihr König seinen Sohn zur Krönung entsandte«; und niemand wird bezweifeln, dass die anderen Fürsten angesichts des Ansturms der europäischen Diplomatie noch deutlicher erkannten, dass die Führung eines modernen Staates andere Qualitäten erforderte als großen Privatbesitz und eine bis auf Salomon zurückgehende Abstammung. Doch das massenhafte Erscheinen der Europäer stand dem ersten Ziel des Kaisers eher im Wege. Die mitgebrachten Jagdgewehre waren sein Unglück, denn in den Tagen nach der Krönung, als die Delegationen sich auf {38}Safari in das Landesinnere begaben, hatten sie Gelegenheit, mehr als das offiziell Vorbereitete zu beobachten. Sie sahen, wie weit das Wort des Kaisers in den entlegeneren Landesteilen reichte, sie sahen die schwachen Verbindungslinien zwischen Regierung und Außenposten, sie sahen etwas von dem wahren Charakter des Volkes und erkannten, welch unzureichende Einführung in den Alltag des Landes der Kaviar und der süße Champagner von Addis Abeba waren.
Die Krönung wurde, wie gesagt, auf den frühestmöglichen Termin festgesetzt, bis zu dem alle Vorbereitungen getroffen werden konnten. Diese Feststellung bedarf näherer Erläuterung, und sie führt mich nach diesem politischen Exkurs zurück zur Beschreibung von Addis Abeba, mit der dieses Kapitel beginnt. Denn der erste, offensichtliche, unabweisbare Eindruck war, dass für die Krönung nichts fertig war oder rechtzeitig würde fertiggestellt werden können. Nicht dass man hier und da Spuren unfertiger Projekte, Baugerüste oder halbfeuchten Beton bemerkt hätte. Die ganze Stadt schien erst am Anfang ihrer Errichtung zu stehen. An jeder Ecke sah man halbfertige, gelegentlich schon aufgegebene Gebäude, auf anderen Baustellen waren zerlumpte Guraghi bei der Arbeit. Von der Ineffizienz dieser Leute, bedingt durch Unterernährung und schlechte Behandlung, kann man sich kaum ein Bild machen.
Eines Nachmittags beobachtete ich einen Trupp von zwanzig oder dreißig Mann, die, beaufsichtigt von einem armenischen Bauunternehmer, gerade dabei waren, die Schutthaufen und Steine wegzuschaffen, die den Hof vor dem Haupteingang des Palastes verschandelten. Das Zeug {39}musste in Holzkisten gepackt werden, die an zwei Stangen wegtransportiert und fünfzig Meter weiter geleert wurden. Zwei Männer trugen jeweils eine Kiste, die wohl nicht viel mehr gewogen haben dürfte als eine normale Kippe Ziegelsteine. Ein Vorarbeiter lief mit einem langen Stock umher. Wenn er anderswo abgelenkt war, stellten die Männer die Arbeit vollständig ein. Sie setzten sich aber nicht etwa hin, um zu plaudern und auszuruhen, sie blieben stocksteif stehen, wie angewurzelt, manchmal in erstarrter Bewegung, mit einem Stein in der Hand. Sobald der Vorarbeiter wiederauftauchte, setzten sie sich wieder in Bewegung, wie in Zeitlupe; wenn er sie schlug, sahen sie sich nicht um und protestierten auch nicht, sondern bewegten sich nur etwas schneller, und wenn die Schläge aufhörten, fielen sie in ihr ursprüngliches Tempo zurück, bis sich der Vorarbeiter wieder abwandte und sie überhaupt aufhörten zu arbeiten. (Ich fragte mich, ob die Pyramiden auf diese Weise gebaut worden waren.) Überall in der Stadt, in jeder Straße, auf jedem Platz, wurde dergestalt gearbeitet.
Addis Abeba erstreckt sich über eine Fläche von etwa zehn Kilometer Durchmesser. Der Ort liegt in zweieinhalbtausend Meter Höhe, nördlich davon ein Bergzug, der Entoto, dessen höchster Gipfel etwa dreitausend Meter hoch ist. Der Bahnhof befindet sich am südlichen Stadtrand, von wo eine breite Straße zur Hauptpost und den wichtigsten Geschäftshäusern hinaufführt. Zwei tiefe Flüsse durchschneiden die Stadt, und an den Uferböschungen und in kleinen Eukalyptushainen zwischen den beständigeren Gebäuden liegen kleine Ansammlungen von tukuls, strohgedeckten, fensterlosen Hütten. Die wichtigsten Straßen {40}bestehen aus einer geteerten Fahrbahn für den Autoverkehr, links und rechts ein Seitenstreifen aus Sand und lockeren Steinen für Maultiere und Fußgänger; in kurzen Abständen stehen Schilderhäuschen aus Wellblech, bemannt von schläfrigen bewaffneten Polizisten; es gibt auch Verkehrspolizisten, die mit den europäischen Signalen vertrauter sind als die meisten Autofahrer. Gegenwärtig wird sogar versucht, den Fußgängerverkehr mit Hilfe von Stöcken und lautstarken Flüchen zu regeln – eine Mode, die den Einheimischen völlig unverständlich ist. Der abessinische Gentleman reitet normalerweise mitten auf der Straße auf einem Maultier, umgeben von einem Gefolge von zehn oder zwanzig bewaffneten Männern. Ständig kommt es zu Streitereien zwischen diesen Männern und den Verkehrspolizisten, die dabei meist den Kürzeren ziehen.
In Abessinien trägt jedermann eine Waffe. Das heißt, er trägt einen Dolch und einen Patronengurt um die Hüfte, und er hat einen Sklavenboy, der mit einem Gewehr hinter ihm hergeht. Dass diese Gewehre einsatzfähig sind, darf angesichts ihres Alters bezweifelt werden. Zum Teil sind es Henry-Martini-Gewehre, wahrscheinlich aufgesammelt auf dem Schlachtfeld von Adowa, aber auch vergleichsweise moderne Karabiner und ältere englische Armeegewehre. Sie sind einzeln via Somaliland hereingesickert und, ausgegeben als Handelsware, von so romantischen Waffenschmugglern wie Arthur Rimbaud und M. de Montfried ins Land geschafft worden. Patronen sind ein Statussymbol und dienen im Landesinnern als anerkanntes Zahlungsmittel. Ob sie für einen bestimmten Waffentyp geeignet sind, ist von zweitrangiger Bedeutung; die Munition im Gurt passt nur selten {41}zum mitgeführten Gewehr, und meist sind auch viele leere Patronen darunter.