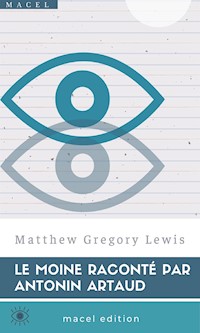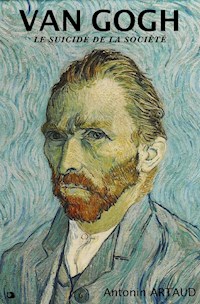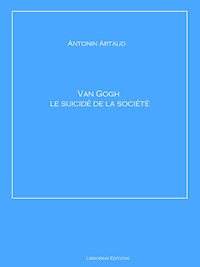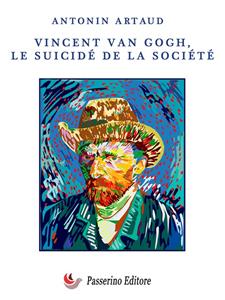Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: MSB Paperback
- Sprache: Deutsch
"Im überaus reichen Repertoire schauerlicher, lasterhafter und prunkvoller Wechselfälle aus der dekadenten römischen Spätzeit ist das Leben des Heliogabal ein Grenzfall: Gottkaiser mit vierzehn Jahren, umgebracht und in eine Kloake geworfen mit achtzehn, Priester und Wüstling, bewusster Verwalter von Zerfall und Anarchie inmitten der grandiosesten politischen Ordnung, die die klassische Welt hervorgebracht hat, und alles, was wir von seinem Leben wissen, steht bereits per se im Zeichen der Zuspitzung aller Kontraste, es ist eine Biografie, die nur aus Exzessen besteht." Roberto Calasso In dieser Romanbiografie gibt Antonin Artaud zu Beginn der Dreißigerjahre alles an Wut und Verzweiflung hinein, die er selbst gegen die Welt seiner Zeit hegt, in einer wuchtigen Sprache voller Gewalt und Übertreibung revoltiert er damit gegen die Gesellschaft, indem er sich in Heliogabal spiegelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonin Artaud
HELIOGABALODER DER GEKRÖNTEANARCHIST
Aus dem Französischenvon Brigitte Weidmann,überarbeitet von Tim Trzaskalik
Mit einem Nachwortvon Jean-Paul Curnier
Ich widme dieses Buch den Manen des Apollonios von Tyana1, der ein Zeitgenosse Christi war, sowie allem, was an wahrhaft Erleuchteten noch übrig sein mag auf dieser hinfälligen Welt;
Und um seine völlige Unzeitgemäßheit, seinen Spiritualismus und seine Nutzlosigkeit hervorzuheben, widme ich es der Anarchie und dem Krieg für diese Welt;
Ich widme es auch den Ahnen, den Heroen im antiken Sinne und den Seelen der Großen Toten.
Inhalt
I. DIE SPERMAWIEGE
II. DER KRIEG DER PRINZIPIEN
III. DIE ANARCHIE
ANHÄNGE
DAS SCHISMA DES IRSHU
DIE SONNENRELIGION IN SYRIEN
DER TIERKREIS DES RAM
ANMERKUNGEN
IDIE SPERMAWIEGE
Pulsiert um den Leichnam Heliogabals, der ohne Grab endete, abgeschlachtet von seiner Polizei in den Latrinen seines Palastes, ein mächtiger Strom von Blut und Exkrementen, so pulsiert um seine Wiege ein mächtiger Strom von Sperma. Heliogabal wird in einer Zeit geboren, wo jeder mit jedem schlief; und man wird nie erfahren, wo und von wem seine Mutter wirklich geschwängert worden ist. Für ihn als syrischen Fürsten gibt die Abkunft mütterlicherseits den Ausschlag; – was aber die Mütter angeht, schart sich um diesen neugeborenen Fuhrmannssohn ein Siebengestirn von Julien; – und alle diese Julien, ob sie regieren oder nicht, sind hochgestellte Dirnen.
Der Stammvater dieser weiblichen Quelle, dieser Flut von Schamlosigkeiten und Niedertracht, musste, bevor er Priester wurde, Fuhrmann gewesen sein, denn sonst wäre Heliogabals Versessenheit, nachdem er den Thron bestiegen hatte, sich von Fuhrleuten sodomisieren zu lassen, ganz unerklärlich.
Jedenfalls stößt die Geschichtsschreibung, die Heliogabals Abstammung über die weibliche Linie zurückverfolgt, unweigerlich auf diesen vertrottelten, nackten Schädel, auf dieses Fuhrwerk und diesen Bart, die in unseren Annalen zur Erscheinung des alten Bassianus gehören.
Dass diese Mumie einem Kult dient, spricht nicht gegen den Kult, wohl aber die stumpfsinnigen, leeren Riten, auf welche die Zeitgenossen der Julien und des Bassianus sowie das Syrien zur Zeit von Heliogabals Geburt diesen Kult schließlich beschränkt hatten.
Doch man wird erleben, wie dieser tote, auf ein Gerippe von Gesten beschränkte Kult, dem sich Bassianus weihte, mit dem Auftauchen des jungen Heliogabal auf den Stufen des Tempels von Emesa unter mancherlei Glaubensformen und Entstellungen seine Energie konzentrierten Goldes, hallenden, geballten Lichtes, zurückgewinnt und aufs Neue wunderbar wirksam wird.
Jedenfalls stützt sich dieser Ahn Bassianus wie auf Krücken auf ein Bett und macht mit irgendeiner Frau zwei Töchter, Julia Domna und Julia Moesa. Er macht sie, und zwar prächtig. Sie sind schön. Schön und fertig für ihr doppeltes Gewerbe als Kaiserinnen und Nutten.
Mit wem hat er diese Töchter gemacht? Die Geschichte kann darüber bis zur Stunde nichts berichten. Geben wir also zu, besessen wie wir sind von den vier Medaillenköpfen der Julia Domna, Julia Moesa, Julia Soemia und Julia Mammoea, dass es keine Rolle spielt. Wenn nämlich Bassianus zwei Töchter macht, Julia Domna und Julia Moesa, so setzt Julia Moesa ihrerseits zwei Töchter in die Welt: Julia Soemia und Julia Mammoea. Und Julia Moesa2, die mit Sextus Varius Marcellus verheiratet, doch zweifellos von Caracalla oder Geta (Söhnen der Julia Domna, ihrer Tante) oder von Gessius Marcianus, ihrem Schwager, dem Gatten der Julia Mammoea, oder vielleicht von Septimius Severus, ihrem Oheim mütterlicherseits, geschwängert worden ist, gebiert Varius Avitus Bassianus, später Elagabalus oder Sohn der Gipfel, Pseudantoninus, Sardanapal und schließlich Heliogabal zubenannt, ein Name, der offenbar die glückliche grammatische Verschmelzung der ältesten Bezeichnungen für die Sonne ist.
Da wäre also in Emesa am Orontes dieser vertrottelte Bonze mit seinen beiden Töchtern Julia Domna und Julia Moesa. – Es sind bereits zwei berüchtigte Weibsstücke, diese beiden Töchter, die von einer in ein männliches Geschlecht auslaufenden Krücke in die Welt gesetzt worden sind. Obwohl ganz und gar aus Sperma gemacht, und eben an der entferntesten Stelle, die sein Sperma an den Tagen erreicht, an denen der Vatermörder ejakuliert, – ich sage der Vatermörder, und man wird sogleich sehen, weshalb, – sind sie beide gut gebaut und massiv; massiv, das heißt eine Fülle an Blut, Haut, Knochen und jener gewissen aschfahlen Substanz, die durch die Hautfarbe hindurchschimmert. Die eine, Julia Domna, groß, bleiweiß gepudert, das saturnische Zeichen auf der Stirn, wie eine Statue der Ungerechtigkeit, der erdrückenden Ungerechtigkeit des Schicksals; – die andere klein, mager, feurig, explosiv, wild und gelb wie ein Leberleiden. Erstere, Julia Domna, ist ein Geschlecht, das Verstand gehabt haben soll, und Letztere ein Verstand, dem es nicht an Geschlecht fehlte.
Ums Jahr herum, da diese Geschichte anhebt, im neunhundertsechzigsten Jahr des Debakels von Latium und der eigenen Entwicklung dieses Volkes von Sklaven, Händlern und Piraten, das sich wie Filzläuse ins Land der Etrusker eingenistet und vom geistigen Standpunkt aus stets nur den andern das Blut ausgesaugt, stets nur an die Verteidigung seiner mit moralischen Geboten verbrämten Schätze und Truhen gedacht hat, um dieses Jahr 960 herum, das dem Jahr 179 der Herrschaft Jesu Christi entspricht, mochte Julia Domna, die Ahnin, achtzehn Jahre alt sein und ihre Schwester dreizehn; sie waren also in der Tat nahezu im heiratsfähigen Alter. Aber Domna glich einem Mondstein und Moesa zerriebenem Schwefel im Sonnenlicht.
Ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die beiden noch Jungfrauen waren; was das betrifft, muss man ihre Männer fragen, nämlich Septimius Severus im Falle des Mondsteins und Julius Barbakus Mercurius im Falle des Schwefels.
In geografischer Hinsicht gab es noch immer jenen Saum des Barbarischen um das sogenannte römische Reich herum, in das man Griechenland, das historisch betrachtet die Vorstellung der Barbarei erfunden hat, einbeziehen muss. Und in dieser Hinsicht sind wir Abendländer die würdigen Söhne dieser törichten Mutter, denn wir halten uns selber für zivilisiert und alles Übrige dem Ausmaß unserer universalen Ignoranz entsprechend für barbarisch.
Indes sei betont, dass alle Vorstellungen, die die römisch-griechische Welt davor bewahrt haben, in blinde Bestialität zu verfallen und unverzüglich zugrunde zu gehen, gerade von diesem barbarischen Saum herkommen; und dem Orient, der weder seine Krankheiten noch sein Elend eingeschleppt hat, verdanken wir, noch mit der Überlieferung verbunden zu sein. Prinzipien findet man nicht, erfindet man nicht; sie werden erhalten und überliefert; und es gehört zu den schwierigsten Prozessen auf dieser Welt, sich den klaren, doch zugleich im Organismus gelösten Begriff eines universalen Prinzips zu erhalten.
Dies um hervorzuheben, dass der Orient in metaphysischer Hinsicht stets in einem Zustand beruhigenden Brodelns gewesen ist; dass ihn am Verfall der Dinge keine Schuld trifft; und dass, wenn sein Chagrinleder der Prinzipien ernstlich schrumpft, das Gesicht der Welt gleichfalls schrumpft und alles seinem Untergang entgegengeht; und dieser Tag scheint mir nicht fern.
Umringt von dieser metaphysischen Barbarei, dieser sexuellen Ausschweifung, die selbst im Blut beharrlich den Namen Gottes wiederaufzuspüren sucht, sind Julia Domna und Julia Moesa geboren worden. Sie entstammen dem rituellen Sperma eines Vatermörders, des Bassianus, den ich mir immer nur als Mumie vorstellen kann.
Dieser Vatermörder hat seinen Schwanz ins enge Königreich Emesa gerammt, das ursprünglich kein Königreich, sondern ein Priesterstaat war; – und all das, Königreich, Priesterstaat, die Priester samt dem Priesterkönig an der Spitze schwören, ihr Blut sei mit einer aschfahlen Substanz versetzt, sie beständen aus Gold und stammten in gerader Linie von der Sonne ab.
Nun konnte eines Tages dieser Priesterstaat, der mit Geboten hantierte und Prinzipien herunterleierte, wie man auf gut Glück und vollkommen ahnungslos mit Stecknadeln oder Blasebälgen hantiert; dieser Priesterstaat, der ja vielleicht Göttliches barg, aber vergessen hatte, wo es abgeblieben war; in dem das Göttliche aufgerieben, zu nichts zusammengeschrumpft war wie das kleine Königreich Emesa zwischen dem Libanon, Palästina, Kappadozien, Zypern, Arabien und Babylonien, oder aufgerieben wie das Sonnengeflecht in unseren abendländischen Organismen; nun konnte dieser Kuhpriesterstaat Emesa – Kuh, das bedeutet Frau, und Frau, das bedeutet feige, geohrfeigt, nachgiebig, und versklavt –, der sein sichtbares Königtum nicht mit der Faust zu erobern vermocht hätte, sich hingegen in einer Atmosphäre der Leichtfertigkeit und Anarchie wohlfühlte, aus dem Zerfall des Königreiches der Seleukiden, der hundertsechzig Jahre später dem ungleich bedeutenderen Zerfall des Reiches Alexander des Großen folgt, Nutzen ziehen und sich unabhängig erklären.
Von der Mutter auf den Sohn vererben die Priester von Emesa, die seit mehr als tausend Jahren aus dem Geschlecht der Samsigeramiden hervorgehen, das Königreich und das Blut der Sonne. Von der Mutter auf den Sohn, weil in Syrien die Abkunft mütterlicherseits den Ausschlag gibt: Die Mutter dient als Vater, ist mit den gesellschaftlichen Attributen des Vaters ausgestattet und wird selbst hinsichtlich der Zeugung als der erste Erzeuger betrachtet. Ich sage ausdrücklich, als der ERSTE ERZEUGER.
Das heißt, dass die Mutter Vater ist, dass es die Mutter ist, die Vater ist, und dass das Weibliche das Männliche erzeugt. Das sollte in Beziehung gesetzt werden zu der Tatsache, dass der Mond männlichen Geschlechtes ist und diejenigen, die ihn anbeten, davor bewahrt, Hörner aufgesetzt zu bekommen.
Jedenfalls vererbt in Syrien, und insbesondere bei den Samsigeramiden, die Tochter das Priesteramt, während der Sohn nichts vererbt. Doch um auf die Bassianiden zurückzukommen, deren berühmtester Heliogabal und deren Stammvater Bassianus ist, so gibt es zwischen dem Geschlecht der Bassianiden und demjenigen der Samsigeramiden eine schreckliche Kluft; und diese Kluft ist durch eine Usurpation, durch ein Verbrechen gezeichnet, das die Nachkommenschaft der Sonne in andere Bahnen lenkt, ohne sie auszulöschen.
Da nun bei den Samsigeramiden die Mutter Vater ist, müsste Bassianus, damit ihn ein römischer Geschichtsschreiber »Vatermörder« nennen konnte, seine Mutter getötet haben; doch weil man nicht einer Frau, sondern einem Mann im Amte folgt und die Frau zwar das Priesteramt vererbt, der Mann indes mit seiner Wahrung betraut ist, bin ich der Meinung, dass Bassianus denjenigen getötet haben muss, der dieses Amt innehatte, dass er seinen leiblichen Vater getötet hat, seinen Vater kraft der Natur und in der Gesellschaft. – Er war also männlichen Blutes; er stand auf der männlichen Seite des Sonnenblutes, doch die Tatsache, dass er einmal mehr die Überlegenheit des Männlichen über das Weibliche und des Mannes über die Frau wiederherstellte, scheint die Sache kaum geradegebogen zu haben, da eben mit ihm das Debakel einsetzt und die Geschichte kaum ein vollständigeres Arsenal von Verbrechen, Schandtaten und Grausamkeiten aufzuweisen hat als dasjenige dieser Familie, deren Männer sich alle Boshaftigkeit und Schwäche und deren Frauen sich die Männlichkeit angeeignet haben. Man kann also sagen, dass Heliogabal von Frauen gemacht wurde; dass sein Denken durch den Willen zweier Frauen geprägt worden ist; und es ist ja bekannt, was dabei herausgekommen ist, als er aus eigener Kraft hat denken wollen, als sein männlicher Stolz angestachelt durch die Energie seiner Frauen, seiner Mütter, die alle mit ihm geschlafen haben, sich hat Ausdruck verschaffen wollen.
Ich beurteile dieses Ergebnis nicht, wie ein Historiker es vielleicht beurteilt; diese Anarchie, diese Ausschweifung gefällt mir. Sie gefällt mir vom historischen und von Heliogabals Standpunkt aus; doch zu dem Zeitpunkt, an dem ich seine Geschichte aufnehme, ist Heliogabal noch nicht geboren.
Die Könige von Emesa, diese kleinen weibischen Könige, die Mann und Frau zugleich sein wollen – wie der Megabyzos des Tempels zu Ephesos, der sich als Mann die Rute abbindet, um als Frau zu opfern, doch zum liegenden Opferstein wird, vor dem er aufrecht opfert –, haben seit langem ihre Freiheit in die Hände Roms gelegt. Vom alten Königreich Emath bleibt nur noch dieser düstere, geräumige Tempel. Es ist Sache der römischen Haudegen, den Handel, den Krieg und den materiellen Schutz der Güter zu regeln. Im Übrigen denkt jeder Syrer, was er will, und die Sonnenreligion ist immer noch da und dort mit Huldigungen an den Mond verbrämt, wobei Mondsteine, Fische, Widder und Wildschweine untergemischt werden. Ferner gelegentlich Stiere, Adler und Sperber, doch von Hähnen keine Spur! Nein, der Hahn scheint bei diesen Riten keine große Rolle gespielt zu haben.
Der Tempel des Elagabalus in Emesa ist seit Jahrhunderten Mittelpunkt krampfartiger Versuche, die Gefräßigkeit eines Gottes auszuloten. Dieser Gott, Elagabalus oder Der dem Berg Entstammende, Der strahlende Gipfel, kommt von weither. Und vielleicht nennt er sich in der alten phönizischen Kosmogonie Das Begehren; – und dieses Begehren ist, wie Elagabalus selbst, nicht einfach, da es aus der langsamen, vielfachen Vermischung der Prinzipien hervorgeht, die tief im Atem des Chaos erstrahlten. Von allen diesen Prinzipien ist die Sonne nur die reduzierte Erscheinung, ein lediglich für ermüdete und gefallene Anbeter tauglicher Aspekt.
Der Atem, der im Chaos war, verliebte sich nämlich in seine Prinzipien, und aus dieser Vorwärtsbewegung, aus dieser Art Idee, die die Finsternis tilgt, ist ein bewusstes Begehren entstanden. – Und es gibt in der Sonne selbst lebendige Quellen, die Idee eines verminderten und dann vollkommen getilgten Chaos.
Im menschlichen Körper nun wird die Wirklichkeit dieses Atems nicht etwa durch die Atmung der Lungen vertreten, die in Bezug auf diesen Atem dasselbe darstellt wie die Sonne in ihrem physikalischen Aspekt in Bezug auf das Prinzip der Fortpflanzung, sondern durch jene Art schillernden, undurchschaubaren Lebenshunger, der mit seinen Entladungen die Nerven durchzuckt und mit den geistigen Prinzipien des Kopfes in Streit gerät. Und diese Prinzipien laden ihrerseits den Atem der Lungen wieder auf und verleihen ihm alle seine Kräfte. Niemand wird bestreiten können, dass die Lungen, die das Leben erneuern, einem Atem gehorchen, der vom Kopf ausgeht. Und der Kopf des Elagabalus, des Gottes von Emesa, ist von jeher rege gewesen.
Doch im Jahre 179, als Septimius Severus in Syrien das Kommando der vierten skythischen Legion übernimmt, ist von der durch Sanchuniathon verbreiteten alten phönizischen Kosmogonie nur noch ein schwarzer, vom Himmel gefallener Stein übrig: jener Monolith, jener zugespitzte Gesteinsbrocken, zu dessen Wächter sich Bassianus aufgeworfen hat, der aber eigentlich unter der Obhut seiner Töchter Julia Domna und Julia Moesa, dieser beiden wollüstigen Syrerinnen, steht.
Septimius Severus ist schon alt und müde; der Wüstensand hat ihm längst die Sohlen versengt und die Hornhaut der Fersen zerfressen. Er hat zwei oder drei Ehen hinter sich; doch kaum ist er eingetroffen, beschließt er zu heiraten und sieht deshalb die Zivilstandsregister ein.
In diesen Registern findet er die Luna, das heißt den Mondstein, nämlich Julia Domna. Nun bedeutet Domna Diana, Artemis, Ischtar und auch Proserpina, die dunkle weibliche Kraft. Das Dunkle im dritten Erdbereich. Die im Orkus fleischgewordene Frau, die nie mehr über den Orkus hinausgelangt.
Doch Julia Domna hat ein Horoskop, das ihr bestimmt, dereinst die Gemahlin eines Kaisers zu werden; und er beschließt, Julia Domna wegen ihres Horoskopes zu heiraten. Nun, der Mondstein, Julia Domna, das Horoskop und die hydromantischen Orakel, vor denen die Horoskope der Kaiser gestellt werden, all das kommt zusammen. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass in Syrien die Erde lebt, dass es lebendige Steine gibt und dass Julia Domna sich mit allem verschworen hat.
Es gibt schwarze, wie eine männliche Rute geformte Steine, in deren Unterseite ein weibliches Geschlecht eingeritzt ist. Und diese Steine sind Rückenwirbel in kostbaren Winkeln der Erde. Und der schwarze Stein von Emesa ist der allergrößte Wirbel, der reinste und vollkommenste.
Doch es gibt Steine, die leben, wie Pflanzen oder Tiere leben und wie, wenn man so will, auch die Sonne mit ihren sich verschiebenden, sich blähenden und zusammenschrumpfenden Flecken, die einander immerzu besabbern und besabbern und sich wieder verschieben, – wobei dieses Aufblähen und Zusammenschrumpfen rhythmisch und von innen her vor sich geht, – wie auch die Sonne lebt. Die Flecken wuchern in ihr wie ein Krebs, wie schwärende Pestbeulen. Sie enthalten zu Staub zermahlene Materie, die Klumpen bildet – wie zerstoßene Sonnensplitter, nur eben schwarz. Zu Staub zermahlen nehmen sie weniger Platz ein, es ist aber die nämliche Sonne und derselbe Sonnenumfang, dieselbe Sonnenmenge, wenn auch stellenweise erloschen, die nun an Diamant oder Kohle erinnert. Und all das lebt; und man kann sagen, dass es Steine gibt, die leben; und Syriens Steine, Wunder der Natur, leben, denn es sind Steine, die der Himmel herabgeschleudert hat.
Und es gibt viele Wunder und Merkwürdigkeiten der Natur auf Syriens vulkanischem Boden. Auf diesem Boden, der scheinbar über und über mit Bimssteinen bedeckt ist, wo aber die vom Himmel gefallenen Steine ihr eigenes Leben führen und sich mit dem Bimsstein nicht gemein machen. Und es gibt wunderliche Sagen von Syriens Steinen:
Als Beleg folgender Text des Photios, eines byzantinischen Geschichtsschreibers zur Zeit des Septimius Severus:
»Severus war Römer und dem Gesetz zufolge Vater der Römer; er berichtet selbst, er habe einen Stein gesehen, auf dem man die verschiedenen Gestalten des Mondes erkennen konnte, und der alle möglichen Erscheinungsformen annahm, bald diese, bald jene, und je nach dem Stand der Sonne größer oder kleiner wurde; auch die Sonne war ihm auf geprägt.« Dabei sei erwähnt, dass dieser Text des Photios kein originales Werk, sondern der Abklatsch eines verlorengegangenen Buches ist, das offenbar, wie man anhand der zahlreichen Schriftsteller, die darauf Bezug nehmen, schließen kann, für die Alten eine wahre Bibel des Wunderbaren dargestellt hat: das Leben des Isidoros von Damaskios.
Doch die erregendste Form der syrischen Steine haben die Betyle, die schwarzen Betyle oder Steine des Bel. Der schwarze Konus von Emesa ist ein Betyl, der sein Feuer bewahrt hat, ja fast wieder ausstrahlt, denn die Betyle sind aus dem Feuer hervorgegangen. Sie ähneln verkohlten Funken des himmlischen Feuers. Bei der Ergründung ihrer Geschichte kommt man auf die Entstehung der erschaffenen Welt zurück:
»Ich sah«, sagt wiederum Severus, »einen Betyl, der sich durch die Luft bewegt hatte; bald wurde er in Decken eingewickelt, bald trug ihn ein Diener in den Händen umher; der Diener, der den Betyl hütete, hieß Eusebios; er sagte mir, er habe plötzlich ganz grundlos das heftige Begehren verspürt, die Stadt Emesa kurz vor Mitternacht zu verlassen und in die Ferne zu wandern, jenem Berg entgegen, an dessen Fuß der alte, herrliche Tempel der Athene lag; nicht lange, und er habe ihn erreicht und sich niedergelassen, um sich auszuruhen von seinem ermüdenden Weg, und an der nämlichen Stelle habe er eine Feuerkugel gesehen, die mit großer Geschwindigkeit vom Himmel gefallen sei, und einen gewaltigen Löwen, der neben der Feuerkugel stand; der Löwe sei im Nu verschwunden, er aber sei auf die bereits erloschene Feuerkugel zugerannt und habe sie aufgehoben; es sei dieser Betyl gewesen, und er habe ihn fortgetragen und dabei gefragt, welchem Gott er zu eigen sei; und dieser habe geantwortet, er sei dem Gennaios zu eigen (den Gennaios verehren die Einwohner von Hieropolis, die ihm in Gestalt eines Löwen im Zeustempel eine Statue errichtet haben); er habe ihn noch in der gleichen Nacht nachhause getragen und dabei einen Weg von gut zweihundertundzehn Stadien zurückgelegt. Eusebios vermochte die Bewegungen des Betyls nicht zu lenken, sondern musste ihn bitten und anflehen; dann erfüllte er seine Wünsche.
Es war eine vollkommen runde, weißliche Kugel, deren Durchmesser eine Spanne betrug. Doch sie wurde zu gewissen Zeitpunkten größer oder kleiner; manchmal nahm sie auch eine purpurrote Färbung an. Und er zeigte uns in den Stein geritzte Lettern, die mit einer Farbe getönt waren, die man Mennige (oder Zinnoberrot) nennt. Dann setzte er den Betyl in die Mauer ein. Durch besagte Lettern gab der Betyl demjenigen, der ihn befragte, die gesuchte Antwort. Er stieß Laute aus, die einem leisen Pfeifen ähnelten und uns von Eusebios gedeutet wurden.«
An einer andern Stelle seines Buches verspürt derselbe Photios, dem das Wundersame dieser Steine keine Ruhe lässt, das Bedürfnis, sie nochmals zu beschreiben, wobei er sich wieder hinter dem Zeugnis des Severus verschanzt:
»Severus berichtete unter anderem, er habe während seines Aufenthaltes in Alexandria auch einen Sonnenstein gesehen, doch keinen von der bekannten Art, sondern einen, aus dessen Kern goldene, scheibenförmig angeordnete Strahlen schnellten, als stecke die Sonne in ihm; auf den ersten Blick hielt man ihn für eine Feuerkugel. Aus dieser Kugel schossen Strahlen empor, die bis zu ihrer Oberfläche reichten; der ganze Stein war nämlich kugelförmig. Einen Selenit hatte er auch gesehen, aber keinen sogenannten Hydroselenit, in dem ein kleiner Mond zum Vorschein kommt, wenn man ihn ins Wasser taucht, sondern einen Stein, der sich kraft einer ihm innewohnenden Eigenbewegung mit den Drehungen des Mondes und auf die nämliche Weise wie dieser drehte, ein wahres Wunderwerk der Natur.«
Die kleine Stadt Apameia unterhalb von Emesa erhebt sich am Fuße des Antilibanon in einer Landschaft aus erstarrter Lava und Knochenstaub. Ihr kleiner, der Sonne und dem Mond geweihter Tempel ist im Besitz eines hydromantischen Orakels, eines unfehlbaren Orakels.
Ihm hätte man eines Tages in der Alten Welt im bellenden Sonnenlicht Heliogabals ganze Familie, Bassianus, den Urgroßvater, Julia Domna, die Großtante, und Julia Moesa, die Großmutter, wie eine Pilgergruppe entgegenwallfahrten sehen können. Bassianus, knallgelb, bewegt sich langsam, im Eselstrab, voran, und seine Töchter gehen vor ihm her.
Sie erreichen Punkt zwölf Uhr mittags, zur Stunde, da das Orakel spricht, die zweite Tempeleinfriedung und nähern sich dem sakralen Fischteich.
Das Leben des Isidoros von Damaskios enthält eine Beschreibung dieses Orakels, das Julia Domna angeblich die Würde einer Kaiserin eingebracht hat. Und offenbar war das Orakel an diesem Tag besonders genau und gewissenhaft, da ihm zufolge das Horoskop gestellt wurde, das Julia Domna ankündigte, sie werde eines Tages Herrscherin sein. Und bekanntlich lässt dreißig Jahre später Varius Marcellus, der mutmaßliche Vater Heliogabals, zu Ehren des Orakels eine steinerne Votivstele errichten, auf der Julia Domnas Horoskop, das zu diesem Zeitpunkt in Erfüllung ging, eingemeißelt ist.
»Wer kam, um die Göttin (die schaumgeborene Aphrodite) zu verehren«, erzählt Juvenal nach dem verlorengegangenen Buch, »brachte Geschenke aus Gold und Silber, Leinen- und Byssusstoffe sowie andere Kostbarkeiten, und diese Geschenke, sowohl Stoffe wie schwere Gegenstände, sanken, wenn sie angenommen wurden, auf den Grund. Wurden sie jedoch verschmäht und zurückgewiesen, trieben die Stoffe und sogar alles, was aus Gold und Silber oder aus so schwerem Metall gefertigt war, dass es normalerweise nicht hätte schwimmen können, an der Oberfläche.
In Form von länglichen Bronzetäfelchen, die wie etruskische Zaubereien durch ein Loch aufgefädelt werden konnten und banale, in altertümlichem Latein abgefasste Antworten in hexameterähnlichem Rhythmus aufwiesen, ist uns ein Muster dieser Talismane oder Zaubereien erhalten geblieben, von denen die italischen Orakel lebten.«
Zu Syriens Wundern und Merkwürdigkeiten, von denen die Geschichtsschreiber berichten, zählen auch sagenumwobene Erscheinungen wie die des Apollonios von Tyana vor Antiocheia und die jener geheimnisvollen Gottheit, die sich, wie Vopiscus im Leben des Kaisers Aurelian erzählt, kurz nach Heliogabals Tod vor Emesa sehen lässt.