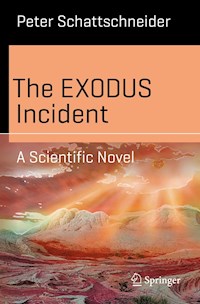12,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hinstorff Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ist real virtuell? Ein grenzenloser Roman. Es war ganz verblüffend, wie echt sich die virtuelle Realität der Hölle anfühlte. Hagen Goldberg findet seinen Freund, einen IT-Spezialisten, ermordet auf. Zufällig kommt er dabei in den Besitz eines Spiels namens "Hell Fever". Als er den Code geknackt hat, stellt er schnell fest: Es handelt sich um eine revolutionäre Erfindung. "Hell Fever" ermöglicht eine ungeahnte Perfektionierung der virtuellen Realität. Aber wer steckt hinter dieser Entwicklung? Wieso sterben oder verschwinden die Mitglieder des Entwicklerteams unter ungeklärten Umständen? Welche Rolle spielt der Vater von Goldbergs Nachhilfeschülerin, deren Verhalten auf ein Stockholm-Syndrom hinweist? Und warum begehen Schüler in einer Klosterschule Selbstmord? Bei seinen Recherchen wird Goldberg immer tiefer in die dunklen Bereiche der virtuellen Realität hineingezogen. "Hell Fever": ein gefährliches, das einzelne Leben und die Welt bedrohendes Spiel. "Höllenfieber": ein mitreißender Roman um Wirklichkeit und Illusion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Was ist real, was echt, was virtuell? Was geschieht, wenn das Virtuelle mit seinen Reizen und Abgründen in die Wirklichkeit eindringt, die Grenzen zu den künstlichen Welten verschwinden … den mehr und mehr nur noch scheinbar künstlichen Welten? Was passiert mit Tabus, die im Computerspiel „Hell Fever“ so leicht zu brechen sind? Verschwinden auch sie?
Hagen Goldberg, der anfangs nur einem Freund helfen will und diesen schon kurze Zeit später ermordet auffindet, wird immer tiefer in die dunklen Bereiche der virtuellen Realität hineingezogen. „Hell Fever“ erweist sich als ein gefährliches, das einzelne Leben und die Welt bedrohendes Spiel.
Was verstanden wir schon von den Plänen des Programmierers, der unsere kleine Zirkuswelt gestaltete. Wir glaubten naiv an Dinge, die nur in unseren Köpfen existierten. An die Freiheit, den Urknall, den Wohlstand für alle, den Aufbruch des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit und an ähnliche Schimären. Das Lachen aus dem Jenseits war angebracht.
Triggerwarnung: Einige Szenen in diesem Buch können Ihre psychische Gesundheit gefährden.
Peter Schattschneider
Hell Fever
Höllische Spiele
Science-Fiction-Roman
Herausgegeben von Jürgen Kuri
Inhalt
Ouvertüre
1. KapitelWorin eine Leiche gefunden wird
2. KapitelWorin wir das Spiel kennenlernen
3. KapitelWorin Nina etwas Beunruhigendes tut
4. KapitelWorin Hagen das Passwort findet
5. KapitelWorin in der Hölle ein Unternehmen gegründet wird
6. KapitelWorin Hagen Audrey Hepburn begegnet
7. KapitelWorin ein Oracle geplant wird
8. KapitelWorin Hagen die Freuden der Hölle kennenlernt
9. KapitelWorin recherchiert und spioniert wird
10. KapitelWorin Hagen einem Terroranschlag zum Opfer fällt
11. KapitelWorin eine Bombe explodiert und Hagen ein zweites Mal stirbt
12. KapitelWorin Zweifel an der Evolution diskutiert werden
13. KapitelWorin ein Abschiedsbrief auftaucht
Intermezzo
14. KapitelWorin die Gräfin etwas feiert
15. KapitelWorin man den Geheimgang findet
16. KapitelWorin Hagen eine Zeitreise unternimmt
17. KapitelWorin einiges aufgedeckt wird
18. KapitelWorin die schreckliche Wahrheit ans Licht kommt
19. KapitelPurgatorium
20. KapitelWorin Hagen eine alte Dame besucht
21. KapitelWorin eine Theorie falsifiziert wird
22. KapitelInferno
23. KapitelWorin einiges gestanden wird
24. KapitelParadies
Coda
Erklärungen
Dank
Als unseres Lebens Mitte ich erklommen,befand ich mich in einem dunklen Wald,Da ich vom rechten Wege abgekommen.
Dante Alighieri, Die göttliche Komödie
Ouvertüre
Er hatte Angst. Nicht vor der Injektion – ein kurzer Stich, mehr nicht. Er hatte Angst vor dem, was passieren würde. Als wüsste er.
Seine Beine waren mit Riemen fixiert. Ihm war kalt. Die Vorrichtung, an die man ihn gefesselt hatte, der Luftstrom vom surrenden Ventilator, alles war kalt. Auch das Licht war kalt, das von der Decke fiel.
Der Arzt im weißen Kittel, Instrumente, ein Bildschirm. Wenn er den Kopf drehte, sah er chromblitzende Pinzetten und Scheren. Dann kam die Frau. Er hörte ihre Stöckel schon von weitem. Sie klapperten am Steinboden wie ein kaltes, metallenes Instrument. Sein Herz schlug heftig in Erwartung dessen, was vielleicht schon geschehen war – er wusste nicht genau, was, nur dass es aufregend und gleichzeitig böse war. Sie beugte sich zu ihm, stülpte ihm eine Haube aus elastischem Stoff über. Dünne Kabel führten von der Haube zu dem Apparat, der neben dem Arzt stand.
Die Frau war sehr schön. Sie trug eine lange Perlenkette. Er mochte Perlen.
Der Arzt langte nach vorn, hielt das Glied des Knaben mit zwei Fingern, säuberte die Spitze mit einem Wattebausch und führte das Zystoskop ein. Es war unangenehm kalt, als die Kanüle eindrang, dann ein dumpfer Schmerz. Er verzog das Gesicht und atmete rascher.
Die Frau murmelte beruhigende Worte. Du Braver, hab keine Angst, es ist vorbei, alles ist gut. Dabei hielt sie seine Hand. Der Arzt sagte nichts; er arbeitete konzentriert, ohne ihn anzusehen, flanschte eine Spritze an das Instrument und drückte sie aus. Ein unangenehmer Druck in der Blase, als die Flüssigkeit eindrang. Die Kanüle wurde entfernt. Ein paar Tropfen klarer Flüssigkeit quollen hervor. Er wollte aufstehen und urinieren, aber bevor die Fesseln ihn daran hindern konnten, stoppte ihn die Frau mit einer Handbewgung.
Sie machte etwas zwischen seinen Beinen. Er bemühte sich wegzusehen. Da war ein Gummiband. Ein Kabel verband es mit einem Apparat hinter seinem Kopf, den er nicht sehen konnte. Außer Sichtweite hantierte jemand an dem Gerät, zugleich spürte er ein sachtes Kitzeln. Dann begann es in seinem Bauch zu vibrieren. Neben dem Untersuchungsstuhl war ein Kasten mit Skalen und Reglern. Der Arzt drehte an Knöpfen, und die Vibrationen wurden stärker. Aus den Augenwinkeln sah er einen Display – blinkende Zahlen, und eine Linie lief über den Schirm.
Der Arzt nickte der Frau zu. Wieder wurden die Regler verstellt. Das Kitzeln hörte auf, dann fuhr es ihm wie ein Messer zwischen die Beine. Er schrie vor Schmerz auf. Hinter seinem Rücken wurde hantiert, und gleich wich der stechende Schmerz einem rhythmischen Zucken – es war, als würde eine strenge Hand sein Glied im Sekundentakt drücken. Er versuchte vergebens die Beine zu schließen. Seine Oberschenkel zitterten in der Erwartung des nächsten Stromstoßes. Die Frau sprach beruhigend auf ihn ein und gab dem Arzt ein Zeichen. Das scharfe Pochen verwandelte sich in Kribbeln, das ihm bis ins Becken fuhr.
Die schöne Frau sah ihn ernst und liebevoll an wie der Priester bei der Erstkommunion. Ihre Linke lag auf seiner Schulter, ihre andere Hand war zwischen seinen Beinen. Sie streichelte ihn träge, und gegen seinen Willen reagierte er.
Er wandte den Kopf zur Seite, versuchte, das makellose Gesicht aus seiner Vorstellung zu verbannen, aber es blieb beharrlich da. Undeutlich sah er ihre rotlackierten Nägel; sie streichelten ihn, langsam, rhythmisch, regelmäßig. Es war wie leichtes Huschen über Samt. Sie war so zärtlich. Aber es durfte ihm nicht gefallen; es war böse und verdorben. Er schloss die Augen, dachte an den Unterricht, um sich abzulenken – Mathe, Geometrie, Dreiecke und Quadrate. Flächenberechnungen …
Die Linke der Frau kroch von seiner Schulter zur Halsbeuge und streichelte seinen Haaransatz. Sie neigte sich zu ihm herunter und ihre Perlenkette berührte seine Brust. Es warwie ein hingehauchter Kuss. Die Perlen schimmerten – Tränen eines Engels. Seines Schutzengels.
Ein Schauer fuhr ihm durchs Rückgrat. Seine Bauchmuskeln zuckten wie von einem unterdrückten Brechreiz. Es brannte, als das Sperma in Stößen herausspritzte. Die Frau murmelte beruhigende, schöne Worte.
Er schämte sich. Tränen quollen zwischen seinen zusammengepressten Lidern hervor. Der Arzt löste die Riemen, die Frau nahm ihm die Haube ab, entfernte die Sensoren und stellte eine Rolle Küchenkrepp neben den Untersuchungsstuhl, dann ließen sie ihn allein. Er fühlte sich kraftlos und benommen, blieb noch mit geschlossenen Augen liegen. Was hatten sie getan? In seinem Kopf wirbelten die Bilder durcheinander – die Fesseln, Elektroschocks, der Schmerz … die Frau … die Perlen …
Nach Minuten wurde er ruhiger. Gedankenverloren, vielleicht ein wenig erleichtert, weil er ahnte, dass die Erinnerung schwand, trocknete er sich mit Küchenkrepp, stand auf und kleidete sich an. Er spürte seine Beine kaum, alles war merkwürdig leicht. Er trödelte herum, betrachtete neugierig die Apparate, Kabel und Schläuche. Irgendwie hatten sie mit ihm zu tun, eine Untersuchung … Es war anstrengend, sich zu erinnern. Als er das Zimmer verließ, war das Geschehene nicht mehr. Nur ein unbestimmtes Gefühl der verbotenen Lust blieb ihm.
1. KapitelWorin eine Leiche gefunden wird
Tageslicht brach durch ein schmales Fenster in das Dunkel des Landeskriminalamts. Ich saß dem Kommissar gegenüber, der aussah wie ein Kommissar. Ein spartanischer Schreibtisch – Handy, ein Ordner, drei Kugelschreiber, ein rotes, aufgeschlagenes Notizbuch. Hinter einem zweiten Schreibtisch unter dem Fenster in die Freiheit saß Jane Rizzoli. Jedenfalls sah sie so aus wie die TV-Polizistin aus meinen Jugendtagen.
Kommissar Skorzil leitete die Untersuchung. Und Kontrollinspektorin Rizzoli hieß im wirklichen Leben Saskia Helfgott oder so ähnlich.
Wann war der Anruf? Was haben Sie dann gemacht? Können Sie das präzisieren? Wann haben Sie die Leiche gefunden? Beschreiben Sie den Fundort. Ist Ihnen etwas verdächtig vorgekommen? Und so weiter. Ich wurde langsam müde.
Der Kommissar prüfte wieder sein Notizbuch. „Sie sind Gymnasiallehrer, ist das richtig?“ Als wüsste er es nicht.
„Physik und Mathe“, präzisierte ich. Er starrte weiter in sein Buch.
„Hatten Sie jemals Probleme an der Schule?“
„Probleme kann man nicht sagen. Es gab dumme Gerüchte, darum habe ich vor zwei Jahren die Schule gewechselt.“
„Können Sie das erläutern?“
„Herr Kommissar, wir müssen nicht Katz-und-Maus spielen, Sie haben das sicher schon recherchiert. Es gab eine Anzeige wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Ich wurde freigesprochen. Es war ein Racheakt wegen schlechter Noten.“
Rizzoli blickte mich skeptisch an. Ich kannte diesen Blick. Du bist ein widerlicher Sexstrolch, sagte dieser Blick. Egal, was du uns erzählst …
„Nimmst du das auf, bitte?“ Dies zu Rizzoli, die sich sowieso ständig Notizen machte. Übereifrig kam sie mir vor.
„Kommen wir zur Sache: Wann hat Wunderer Sie angerufen?“ Das hatte er mich schon gefragt; er wollte mich testen, der Schlaumeier. Ich spielte mit, überlegte erneut ernsthaft, bevor ich bestätigte, dass es so gegen 19 Uhr gewesen sein musste. Natürlich wusste ich, dass Walters Anruf um 19:07 Uhr auf mein Handy gekommen war, aber ich hielt es nicht für erforderlich, ihm das auf die Nase zu binden. Zweifellos konnte die Polizei das unschwer mit einer Rufdatenabfrage herausfinden. Und eigentlich sollte er wissen, dass ich das wusste.
„Können Sie das Gespräch wiedergeben?“
„Er bat mich, rasch zu kommen, er werde verfolgt. Er sagte mir nicht, worum es ging. Das wollte er mir persönlich erklären. Und es sei eilig.“
„Eine Andeutung, was ihm Angst machte?“
„Es schien sich um seine Arbeit zu handeln. Er verwendete den Begriff unsicherer Datenkanal. Er ist – ich meine: er war IVR-Experte.“ Ich wartete auf Erklärungsbedarf seitens des Kommissars, der vermutlich nicht wusste, was IVR war, aber der nickte nur und schien sich Notizen zu machen.
„Und Sie sind gleich zu ihm?“
Ich nickte. Jetzt schwieg er, aber ich konnte auch wortkarg sein.
„Wann sind Sie bei ihm angekommen?“
„Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Die Situation war nicht danach. – Ich habe die S-Bahn und den Bus zum Institut genommen, ich denke, ich war so um 20:30 Uhr dort. Plusminus 5 Minuten.“
Der Kommissar nickte verstehend. „Plusminus, soso“, murmelte er.
Du bist ein arrogantes Arschloch, dachte ich.
„Was war dann?“
„Ich bin rein und habe ihn gefunden. Er lag auf dem Boden. Überall war Blut.“
Er blickte ganz ruhig zur Decke, als gäb’s dort was zu sehen.
„Wieso wussten Sie, dass er tot ist?“
„Ich hab’ ihn angesprochen, ihn geschüttelt, mich dann zu ihm runtergebeugt und gehorcht, ob er atmet. Und – er hatte keinen Puls.“
„Wo haben Sie den Puls gefühlt?“
„Am Handgelenk.“
„Normalerweise macht man das am Hals.“
„Das wäre schwer gewesen. Der war ja durchtrennt.“ Ich schluckte, als mich das Bild überfiel.
„Erzählen Sie weiter.“
„Das war’s eigentlich schon. Ich habe sofort die Polizei angerufen. Die ist schnell da gewesen.“
„Um 20:46 Uhr. Sie haben um 20:40 Uhr angerufen. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?“
„Was meinen Sie mit gemacht? Ich war ziemlich fertig. Ich glaube, ich habe mich auf einen der Laborstühle gesetzt.“
„Haben Sie irgendetwas berührt?“
„Sicher nicht. Grober Fehler. Das weiß ich aus dem Fernsehen.“
Wenn er mich für einen solchen hielt, konnte ich den Idioten spielen.
„Und die Leiche?“
„Die hab’ ich schon ––– Ich will sagen, als ich ihm den Puls –––“ Ich schluckte, legte mir die Hand vor die Augen, so als ob mich die Emotion plötzlich überkäme. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass ich tatsächlich den Tränen nahe war. Eine schreckliche Scheiße. Walter, wo bist du da hineingeraten? Warum hast du mir das angetan?
„Sie haben auch den Computer nicht angerührt.“ Das klang eher nach einer Drohung als nach einer Frage. Ich schüttelte nur den Kopf.
Er seufzte, schob seinen Block zur Seite. „Fürs Erste wär’s das, Doktor Goldberg. Meine Kollegin wird das Protokoll verfassen, Sie können es in den nächsten Tagen unterschreiben“, sagte er im Aufstehen.
„Haben Sie schon einen Verdacht, warum …?“
Er hob die Schultern. „Wir wissen nur, dass er neben seiner universitären Forschung für eine Firma gearbeitet hat, die IVR-Software vertreibt.“
Er wusste tatsächlich, was Immersive Virtuelle Realität bedeutete. Er war doch nicht so bescheuert, wie ich gedacht hatte.
Was ich ihm erzählt hatte, war fast wahr, wenn ich die aristotelische Logik ein wenig interpretieren darf. Walter hatte mich am Vorabend angerufen, hörbar verstört.
„Hast du Zeit?“, hatte er ohne Einleitung gefragt.
„Ja, was ist?“
„Ich möchte dir noch ein paar Dateien zur Aufbewahrung anvertrauen.“
„Hat das mit dem Koffer zu tun?“
„Das sag ich dir, wenn du da bist. Der Datenkanal ist mir zu unsicher. Kannst du gleich kommen?“
„Hmm, ich bin grad beim Schreiben. Geht‘s morgen Abend?“
„Morgen ist vielleicht zu spät. Ich wär’ dir wirklich wahnsinnig dankbar, wenn du jetzt …“
Als ich nichts sagte, fügte er hinzu: „Ich werde verfolgt.“
Ich zögerte kurz, bevor ich zustimmte: „Ich bin in einer Stunde bei dir.“
„Super. Bis gleich! – Sag, hast du den Koffer auch gut versteckt?“
„Ja, sicher, er ist in –––“
„Sag nichts!“, fiel er mir ins Wort. „Komm einfach!“
Von daher wehte der Wind also. Ich hatte schon eine Woche zuvor sehr unwillig einen Koffer angenommen, als er mich gebeten hatte, etwas für ihn sicher aufzubewahren. Vorübergehend. Walter war ganz gegen sein sonstiges Verhalten sehr fordernd gewesen. Als ich zögerte, hatte er fast beleidigt reagiert, als wäre es selbstverständlich, dass ich meinem besten Freund bei dubiosen Machenschaften half. Seither lagerte der kleine Alukoffer in einem Schließfach am Wiener Hauptbahnhof.
Seit einigen Monaten war Walter verändert. Seine freundliche Art war einer nervösen Ungeduld gewichen; es kam vor, dass er, wenn wir bei einem Bier saßen und ich eine scherzhaft abfällige Bemerkung über IVR machte, mich mit Hinweis auf meine Inkompetenz zurechtwies. Dabei schien das Feuermal auf seiner linken Wange vor Empörung aufzuleuchten. Gleich tat es ihm dann leid, er überspielte den Ausbruch ebenfalls mit einem Scherz, zu dem er keckernd lachte auf seine unnachahmliche Art, und wir waren uns wieder einig in der zynischen Betrachtung des Universums. Aber ohne Zweifel hatte er sich verändert, war unduldsam und aggressiv geworden. Vermutlich wegen seiner Arbeit an diesem Geheimprojekt.
Es ging um eine Erfindung, welche das unüberschaubare Universum der Computerspiele revolutionieren würde. Augmented, Immersive und Virtual Reality waren die Stichwörter. Das Problem der Verwertung von Forschungsergebnissen. Um wissenschaftlich weiterzukommen, muss man publizieren, aber dann ist die Katze aus dem Sack, und jeder kann die Erkenntnisse nutzen, der Erfinder schaut durch die Finger. Patentieren? Danach kann man zwar publizieren, aber das interessiert dann kein Schwein mehr. Patentschutz? Geschenkt. Große Konzerne kaufen die Lizenz und lassen die Pläne in der Schublade verschwinden, um ihre eigenen Produkte nicht zu konkurrenzieren, oder sie bauen das Ding einfach. Klagen des Erfinders sitzen die aus. Daher weder publizieren noch patentieren, sondern alles geheim halten und diskret einen Sponsor suchen. Die Unsicherheit, der Stress der Geheimhaltung, das Misstrauen, ständige Wachsamkeit – da konnte einer leicht aggressiv werden.
Um 20:25 Uhr war ich da. Die Security der Technischen Universität filzte mich nur flüchtig, da ich keinen Halbmond am Revers trug. Ein Iris-Scan, und ich war drin. Die Tür zum Labor stand offen. Drinnen brannte Licht. Ich klopfte und trat gleich ein.
„Walter?“ Ich hatte ein eigenartiges Gefühl des Schwebens. Leises Summen war zu hören, ich vermeinte auch einen schwachen ungewohnten Geruch wahrzunehmen, aber mein olfaktorischer Sinn ist einseitig auf Weinaromen fokussiert.
Das terroir des Labors war anders. Das unbestimmte Gefühl des Schwebens schon im Flur, das Summen, die Andeutung einer fremden „Nase“ … Das Summen kam vom Computer. Ein riesiger Display auf einem großen Schreibtisch, der im rechten Winkel zur Wand stand. Rundherum Stapel von Zeitschriften und lose Blätter mit Walters Gekritzel. Auf der Ablage über dem Schreibtisch ein Chaos aus Visitenkarten, USB-Sticks, badges von Konferenzbesuchen, Minikameras, Elektronikbauteilen. An der schmucklosen Wand zwei historische Fotos von Alan Turing und John von Neumann.
Der fensterlose Raum – überhoch, um große Maschinen unterbringen zu können – befand sich im Kernbereich des TU-Gebäudes. Das Labor war vollgeräumt mit Technik. 3D-Kameras, Roboterarme, Scheinwerfer, 90 Zoll-Bildschirme, Mikros hingen von der Decke, dicke Kabelbäume schlängelten sich über den Boden. Linksvon der Eingangstür ein ausgeleuchteter Bereich von etwa 3 mal 3 Metern, eine weiße Studiowand war zylindrisch als Hintergrund raumhoch aufgespannt. Ein Beamer warf ein pastorales Bild an die Leinwand – eine Kirche inmitten eines Gebäudekomplexes, umgeben von sommergrünen Wiesen und Wäldern. Die Kirche hatte einen Turm mit dunkelgrünem Zwiebeldach, und auf einer Anhöhe hinter dem Kloster lugte idyllisch ein weiterer Turm aus dichtem Wald hervor wie ein Wächter für die Ewigkeit.
Auf einem Tisch daneben Datenhandschuhe, VR-Brillen in verschiedenen Formen, eine Minidrohne mit Kamera neben dem Modell einer Stadt, es war verrutscht, einige Häuser lagen am Boden, als hätte sich jemand daran festgeklammert und sie in die Unterwelt geschleudert. Der Bürosessel war umgekippt. Walter lag daneben auf einem ovalen Teppich und blickte nachdenklich an die Decke. Ein Herzinfarkt, dachte ich. Seit wann hat er einen Teppich am Arbeitsplatz?, dachte ich. In Rot obendrein.
Es war kein Teppich. Ich brauchte einige Zeit, bevor ich begriff, dass das Blut war. Walters Blut. An seiner Kehle klaffte ein breiter Spalt.
Ich kniete mich neben ihn, schüttelte ihn, horchte vergeblich auf seinen Atem, fand keinen Puls. Er war tot.
Ich setzte mich in einen der Laborsessel und dachte nach. Ich musste die Polizei verständigen. Nur – was sollte ich wegen des Koffers sagen? Ich hatte ihm versprochen zu schweigen. Und nun hatte ihn jemand daran gehindert, mir noch etwas zur Aufbewahrung zu geben. Dokumente, die Rohfassung eines Artikels, was sonst? Alles war im Computer – üblicherweise. Es sei denn, er hatte es vorsorglich gelöscht und die Files woanders gelagert. Ich ging in die Küche, suchte, die Hände mit einem Tuch schützend, nach Einweghandschuhen, die unter der Spüle lagen. Zog sie an und kramte auf dem Schreibtisch zwischen den Zetteln. Kryptologie-Zeitschriften, ein Buch über Virtual Reality, Artikel über Alan Turing und das Halteproblem, Fuzzy Logic … massenhaft Handschriftliches. Keine Chance, das durchzusehen. Ich musste die Polizei verständigen. Bald, spätestens in fünf Minuten. Was kann ich in fünf Minuten tun?
Fünf Minuten sind lang. Lang genug für den sprichwörtlichen Lebensfilm. War der abgelaufen, als man Walters Carotiden durchtrennt hatte? Kaum, denn man verlor wohl innerhalb von Sekunden das Bewusstsein. Aber vielleicht beschleunigte der schwindende Geist das Geschehen. Kalorienverbrauch, Schlafdauer, Lebensdauer, Herzfrequenz, Reaktionszeit – die Kleiber‘schen Gleichungen beschreiben das von der Fliege bis zum Wal. Und hier lag Walter, der Wal. Seine Reaktionszeit war unendlich lang geworden.
Am Bildschirm ein geöffneter Browser, die Homepage einer Firma „RealGames“ war zu sehen, und im nächsten Tab ein Computerspiel. Ich klickte es an, eine Szenerie wie aus einem Fantasyspiel öffnete sich, der Blick ging von einer Anhöhe in ein grünes, friedliches Tal, Vögel kreisten, Blumen blühten, am Talgrund konnte man sonnenbeschienene winzige Gestalten erkennen, die ihren Tätigkeiten nachgingen. Im blauen Sommerhimmel schwebte der Titel des Spiels:
Hell Fever
©RealGames Inc.
Ein Datenbus verband den Rechner mit einem Minicluster neben dem riesigen Display. Inmitten von Kabelgewirr vier Stereolautsprecher, ein toter Bildschirm, und unter der Tischplatte eine kleine externe Festplatte an einem USB-Kabel, so versteckt, dass sie ein eiliger Eindringling vielleicht übersehen hatte.
Vermutlich enthielt sie nichts Geheimes mehr, aber einen Versuch war es wert. Ich öffnete den Taskmanager, sah, dass die letzte Aktivität Walters Skype-Anruf bei mir vor mehr als einer Stunde war, setzte die interne PC-Uhr um eine Stunde zurück, kopierte alle Ordner, die in den letzten zwei Wochen aktiv gewesen waren, auf die externe Festplatte, entfernte sie, setzte die Uhr wieder eine Stunde vor und rief die Polizei an. Es war 20:40 Uhr. Ich steckte die Festplatte und die Handschuhe in meine Brusttasche und wartete.
Das war alles reflexartig abgelaufen, ich hatte mir die Konsequenzen nicht überlegt. Erst nach dem Ermittlungsgespräch im Kommissariat nahm mein Frontallappen seine Funktion wieder auf. Walter war verfolgt worden, und es ging um viel, so weit hatte ich schon gedacht. Was hatte der Mörder gesucht? Auch das war nicht schwer zu erraten: etwas, das Walter für so wertvoll und gefährdet hielt, dass er es mir heimlich zur Aufbewahrung übergeben hatte. Und der Mörder suchte weiter, würde wieder vor nichts zurückschrecken, um es zu bekommen … wusste vermutlich schon, dass ich es hatte.
Ich musste verschwinden. Bevor ich beseitigt wurde, sollte ich das lieber selbst tun.
2. KapitelWorin wir das Spiel kennenlernen
Untertauchen – wie geht das? Es hilft, einen Arzt persönlich zu kennen. Je nach Definition einen Freund oder einen guten Bekannten. Wir hatten einige gemeinsame Interessen wie französische Weine und romanische Kirchen. Er hatte mir schon oft geholfen, wenn mir die Arbeit an der Schule zum Hals raushing. Burnout ist die beste Erfindung der modernen Psychologie.
Offiziell war die Stadt ethnisch durchmischt und überall sicher, aber die schleichende Ghettobildung hatte schon vor Jahren die herbeigelobte Yuppisierung Wiens überrollt und zu vier Quartieren geführt. Begonnen hatte es mit dem Asian Quarter, nachdem Chinatown wegen der nicht chinesischen Asiaten, die dort wohnten, als politisch unkorrekt aus der Sprache verbannt worden war, und der Volksmund hatte daraus erst As-quart, dann Asgard gemacht, was sich trefflich auf die anderen drei Sektoren übertragen ließ; jeder hatte seine eigenen ungeschriebenen Regeln. Ich meldete mich krank und zog von Bobogard nach Prologard, in ein billiges Hotel im Südosten Wiens. Zwar gab es auch dort Bürgerwehren, denen man als Ortsunkundiger nicht begegnen wollte, aber es war für hellhäutige Europäer sicherer als in Moongard, dem moslemischen Sektor. In Asgard wiederum würde ich auffallen, was zu vermeiden war.
Etwas würde mein Verschwinden problemloser machen: Meine Lebensabschnittsgefährtin hatte vor kurzem rechtzeitig erkannt, dass nach zwei immer mühsamer gewordenen Jahren ein neuer Abschnitt bevorstand, was mir viel an Erklärungen und Sentimentalität ersparte. Ob es mit den Mädchen aus der Sechsten und Siebten zu tun hatte, die mir das Leben schwer machten, wusste ich nicht. Ich wollte auch nicht darüber nachdenken. Jedenfalls würde ich ihr nicht abgehen. Außer Walter hatte ich eine Handvoll Freunde, die ich ein-, zweimal im Jahr traf; auch das war kein Hindernis für ein vorübergehendes Untertauchen. Und der Kommissar? Er hatte meine Handynummer, und bei mir zu Hause würde er kaum anläuten. Ich war unverdächtig trotz meiner geringfügig verbogenen Darstellung der Geschichte. Falls die Polizei rauskriegen sollte, dass etwas auf einen externen Datenträger kopiert worden war, dann hatte das offiziell eine Stunde vor meiner Ankunft im Labor stattgefunden, sie mussten glauben, der Mörder sei es gewesen.
Ich hatte nur einen kleinen Koffer mit dem Notwendigsten und mein Notebook dabei. Und Walters Festplatte. Die enthielt bereits eine Sicherungskopie seiner Disk; ich hätte mir also das Kopieren sparen können. Und damit war klar, was Walter mir übergeben wollte. Warum der Mörder die Disk nicht gefunden hatte, blieb rätselhaft. So versteckt war sie nicht gewesen, aber vielleicht war er gestört worden. Die Files schienen jedenfalls unergiebig – fürs Erste jedenfalls. Es gab Fotos von Urlaubsreisen mit Freundin, zahlreiche Ordner mit Fachliteratur, eigenen Publikationen, Tagungsunterlagen, einen Kalender. Ich schaute natürlich zuerst dort nach. Vorlesungstermine, Vorträge, Treffen an der Fakultät, Prüfungstermine, ein Mittagessen mit dem Rektor, am Vortag seines Todes ein Eintrag „tel. H.“, das war ich, aber er hatte es sich wohl anders überlegt. Am nächsten Tag, dem Dienstag, nochmals der gleiche Eintrag, diesmal mit Rufzeichen und rot. Ja, den hatte ich erhalten. Zu spät leider. Seine Planung war akribisch. Für den Mittwoch hatte er den ganzen Tag blockiert, da stand nur „P. !!!“, Donnerstag und Freitag war „SR“ reserviert, aber quer durchgestrichen. Danach kamen wöchentliche Lehrveranstaltungen („GL“, „Sem“ und „HVR“) über das Semester, Prüfungstermine, und in den Sommerferien waren drei Kongressbesuche eingetragen.
„Sem“ war ohne Zweifel ein Seminar. Ich suchte auf der Homepage der Uni nach seinen Vorlesungen, er las Grundlagen der immersiven virtuellen Realität und Haptic Interfaces for Virtual Reality – das waren „GL“ und „HVR“ –, jeweils fünf und drei ECTS-Äquivalenzpunkte im Bologna-Schema, und er hielt noch drei andere Lehrveranstaltungen gemeinsam mit Kollegen. Die standen nicht in seinem Kalender: das waren Praktika, die Hauptvortragenden Doktoranden, die das für ein Butterbrot erledigten. Full professors erhielten für eine Vorlesung mehr als junge angehende Professoren (tenure track candidates in politisch korrektem Neusprech, was spätestens dann paradox wurde, wenn ein full professor und ein tenure track Anwärter eine Vorlesung gemeinsam hielten. Ich kannte das Spiel, leider aus der Sicht des Doktoranden).
Was mochte „P. !!!“ bedeuten? Etwas sehr Wichtiges, das war klar. Ich ging den Kalender durch, es gab davor eine einzige Eintragung mit Rufzeichen, „VR -> H. !!“. Ich musste nicht lange überlegen, H. war ich, und die Eintragung war vor gut einer Woche gewesen, ein Dienstag, der Tag, an dem er mir den Koffer übergeben hatte. P. war noch wichtiger als H. Und jeweils dienstags, das schien sein freier Tag zu sein, an dem ihn der Unibetrieb wenig oder nicht beschäftigte. Dann war da noch „SR“, das konnte viel bedeuten. Sr war das Zeichen für das Element Strontium, ein Metall mit schlechter Reputation, dervom radioaktiven Fallout herrührte. Es fand sich aber auch in Zahngel. Darum durfte es sich jedoch mit ziemlicher Sicherheit nicht handeln. In der Physik war Sr die Strouhalzahl, in der Religion eine Abkürzung für Ordensschwester. Das polizeiliche Autokennzeichen von Steyr? Keins davon vermutlich. Ein Computerspiel vielleicht? Das würde hinkommen … Ja, es gab ShadowRun, erinnerte ich mich. Ein historisches Computerspiel aus den 80er-Jahren, auf William Gibsons legendärer Cyberpunkt-Trilogie aufbauend. Die Verbindung zu VR war offensichtlich.
Walters Fotogalerie erwies sich als umfangreich. Drei Stunden brauchte ich, um alles durchzuscrollen – Urlaube in Frankreich und Portugal, jeweils Unmengen von Architektur: Romanik im Burgund, gotische Kirchen in der Île de France und der Picardie, manuelinische Gotik in Portugal, die Loire-Schlösser, Klöster (von der Landschaft her viele in Österreich oder Deutschland), Strände, Berge, Städte, einige Fotos seiner Freundin, die ich flüchtig kannte; eine attraktivejunge Frau. Nur wenige Fotos, auf denen sie beide zu sehenwaren. Im Großen und Ganzen die übliche Einschlafpräsentation für Freunde und Verwandte.
Eine flüchtige Suche in den restlichen Ordnern ergab ebenfalls nichts Brauchbares. Aber es gab eine große Datei Finanzen ohne File-Extension. Verschlüsselt natürlich. Ich versuchte ein paar naheliegende Sachen wie Walters Geburtsdatum, seinen Namen. Die Hälfte aller User nehmen solche Passwörter. Aber es war klar, dass ein Experte wie Walter nicht zu dieser Gruppe gehörte. „SR“ war also vorläufig der einzige Anhaltspunkt. Der Kommissar hatte erwähnt, dass Walter neben seiner Lehrtätigkeit an der Uni für eine Spielefirma gearbeitet hatte. War das ShadowRun? Ich blätterte weiter in seinem Kalender, und interessanterweise kam SR fünfmal im letzten Halbjahr vor. Ich konnte kein Regelmaß erkennen, aber es handelte sich jeweils um zwei Tage. Auswärtstermine vermutlich. Also konnte SR für einen auswärtigen Kontakt stehen. Ein Treffen mit der ShadowRun-Firma in zweitägiger Klausur, das kam hin. Ist RealGames mit ShadowRun verknüpft?
Aber zuerst musste ich gründlich untertauchen. In meinem schlichten Hotel? Dort war ich bestenfalls schwer erreichbar, aber nicht untergetaucht. Die Meldepflicht garantierte die Identität. Jeder Beherbergungsbetrieb arbeitete seit den Anschlägen in Wien und Salzburg wie die Immigrationsbehörde auf US-amerikanischen Flughäfen – Personalausweis, Foto, Fingerabdruck und Iris-Scan. Nur das Personal gab sich freundlicher. Das Kleingedruckte auf den Meldeformularen verlangte, Auskunft über Drogenkonsum, Geisteskrankheiten und Religion zu erteilen. Falsche Angaben wurden strafrechtlich geahndet. Die Identität jeder Person überprüften sie in realtime. Kurioser Begriff. Ich konnte ja nur mit mir selbst identisch sein und nicht mit einem geheimdienstlich archivierten Dossier, das mein Kommissar Skorzil genau kannte. Da stand nicht viel Interessantes drin, außer einer besoffenen Geschichte mit Sachschaden (das im Weltschmerz an die Wand geschleuderte Meißnerporzellan und die an einer Harnsäurevergiftung verendete Topfpalme in einer schattigen Ecke des Kasinos hatte ich ersetzt). Und das Verfahren wegen Missbrauchs Schutzbefohlener Minderjähriger. Natürlich war nichts dran, ich rühre doch eine Zwölfjährige nicht an. Aber die Mädchen fühlen sich aus irgendeinem Grund zu mir hingezogen. Und da hatte sich eine von ihnen eine Geschichte gezimmert, wie es hätte sein können, wenn ich ihre Signale nicht ignoriert hätte. Offiziell und aktenkundig galt Rache für schlechte Noten als Ursache, obwohl Walter überzeugt war, es wäre Nichtbeachtetwerden gewesen. Zum Glück verwickelte sie sich in Widersprüche, und zum noch größeren Glück war der beigezogene Psychologe nicht vom Zeitgeist vergiftet, sondern ein kritischer, aufmerksamer Mensch, dem das auffiel. Bei der übersensibilisierten öffentlichen Meinung zu sexuellem Missbrauch konnte man nicht auf die Wahrheitsfindung der Gerichte vertrauen. Kein Wunder nach den schrecklichen Verbrechen in Klöstern und Pflegeheimen.
Ich hatte keine Ahnung, wie man sich eine neue Identität zulegte. Vielleicht war das gar nicht nötig, ich musste nur eine Zeitlang aus Wien verschwinden. Urlaub weit weg? Würde finanziell nicht lange reichen. Kloster? War nicht meins. Arbeitsplatz wechseln? Nicht, wenn die Sozialversicherung davon wusste. Also Nachhilfe gegen Barzahlung, das ging immer, außerhalb Wiens, je weiter, desto besser. Deutschland schied aus wegen der Passkontrollen, vielleicht auch nicht Vorarlberg, ich wollte schon in Kernösterreich bleiben.
Die nächsten Tage las ich Stellenangebote in den Zeitungen und in den einschlägigen Foren.
Es gab einige Anfragen nach stundenweiser Nachhilfe. Ich kreuzte eine an, die regelmäßig Englischnachhilfe suchte, 2 Stunden/Woche, in einer kleinen Stadt im Waldviertel. Nicht gerade weit weg, aber abgeschieden – besser als gar nichts, dachte ich und vereinbarte ein Treffen für den nächsten Tag. Abends stieß ich dann auf ein neues Inserat, das perfekt passte: Dringend Privatlehrer für zweite Allgemeinbildende Höhere Schule in Mathematik und Physik gesucht. Dauer: ab sofort, über das gesamte Schuljahr, Ferienunterstützung nach Vereinbarung. Quartier vor Ort (Nähe Graz) wird zur Verfügung gestellt. Angenehmes Ambiente, Lehraufwand ca. 2–3 Stunden/Tag. Beste Honorierung.
Ich rief sofort an. Der Vater war am Telefon. Eine dunkle Stimme, sehr entschieden, er klang nach Manager oder Politiker. Ich bezog mich auf das Inserat, stellte mich kurz vor. Ja, ich möge morgen zu einem Gespräch kommen, es wäre dringend, die Tochter Nina sei ein intelligentes Kind, die anderen Fächer machten keine Probleme, früher war auch Mathe o.k., aber seit dem Sommersemester habe sie große Schwierigkeiten. Es läge wohl am Lehrer, manche legten leider keinen Wert auf Verständnis usw. usw. Man habe bis zu den Osterferien zugewartet, aber jetzt sei es Zeit zu handeln. Das nächste Dorf sei 10 Kilometer entfernt, es stünde mir natürlich frei, dort im Gasthaus zu logieren, aber einfacher wäre es, auf dem Anwesen zu bleiben. Sie würden mir ein Zimmer im Gästehaus zur Verfügung stellen, in dem ich wohnen könne. Ich fiel fast vom Sessel, als er mir mitteilte, welches Honorar er bereit war zu zahlen. Nein, das sei nicht mit einer Erfolgsgarantie junktimiert. Falls seine Tochter durchkomme, gebe es zusätzlich ein Erfolgshonorar.
Wir vereinbarten einen Besprechungstermin für den nächsten Tag.
Gästehaus – das klang nach was Großem. Anwesen hatte er es genannt. Nähe Graz, und doch weit von der Zivilisation, das wirkte perfekt. Da gab es keine Anmeldeformalitäten, niemand außer der Familie würde wissen, wo ich steckte. Bei diesem Honorar allerdings dürfte ich nicht der einzige Kandidat sein. Ich musste mich morgen gut verkaufen.
Gut Fuchshaym lag im Wald, 10 Kilometer von Hinterholz entfernt, einem Dorf, das seinem Namen Ehre machte. „Nähe Graz“, der schönen Hauptstadt der Steiermark, war ein Euphemismus. Die nächste Stadt war Leoben, bis Graz waren es fast 50 Kilometer, großenteils über schmale, gewundene Landstraßen. Ich brauchte fast vier Stunden von Wien. Das lag auch daran, dass ich zu einer Generation gehörte, die noch einen Führerschein erwerben musste, um ein Fahrzeug zu lenken. Und da die Versicherungsprämien für autonomes Fahren damals noch empfindlich höher lagen, hatte ich die billigere Variante gewählt und stets manuell gelenkt. Jetzt war es umgekehrt, die Autonomen zahlten weniger. Aber nach zehn Jahren Fahrpraxis wollte ich mich nicht mehr an die selbstfahrenden Autos gewöhnen. Die sterilen Fahrgastzellen mit den Monitoren erinnerten an VR-Spiele und verunsicherten mich trotz eindeutiger Statistiken, dass autonomes Fahren sicherer war, weil diese Autos einfach alles konnten.
Ich hatte vor der Abreise gegoogelt: Felix Fuchshaym – auf der Homepage der steirischen Jägerschaft Felix Graf (!) Fuchshaym – 41 Jahre alt, altes Adelsgeschlecht mit britischen Wurzeln. Die Genealogie-Webpage belehrte mich, dass sich die katholischen Viscounts of Foxham der Suprematsakte Heinrichs des Achten und dem Schicksal des Thomas Morus durch Flucht entzogen hatten. Karl dem Fünften kam das in den Wirren der Reformation gelegen, unter seinem Schutz etablierten sich die Fuchshayms als germanisierte Briten. Allerdings passte der steirische Graf nicht zum Viscount, aber in Österreich, wo sie sich niedergelassen hatten, werden bekanntlich auch zu Unrecht verliehene Titel niemals zurückgegeben.
Fuchshaym besaß Unmengen Wald, dessen Ertrag wohl auch für ein schönes Landgut sorgte. Was gar nicht zu meiner Vorstellung eines gräflichen Großgrundbesitzers passte, war sein Doktorat in Informatik, Promotion an der ETH Zürich. Die Homepage verriet mir, dass er als Konsulent für diverse Softwarefirmen aktiv war.
Ich hatte eine Villa erwartet, mit Holzknechten, Tieren im Hof (ich hatte mir Hühner und Kälber vorgestellt, keine Schweine, weiß der Teufel warum), einen Gutsherrn im Lodenjanker, die Frau Gemahlin im Dirndl. Aber die Villa war kein Landgut, sondern fast schon ein Schloss mit Nebengebäuden, mitten in den Fuchshaym’schen Wäldern. Der sogenannte Graf empfing mich in der Bibliothek. Ein kleiner Mann, sehnig, schlank, dunkles dichtes Haar, starke, fast zusammengewachsene Brauen über dunklen, prüfenden Augen. Er trug einen anthrazitgrauen Business-Anzug, graue Krawatte. Hier konnte man sich einen teuren Schneider leisten. Und seine Schuhe knarrten nach englischer Maßanfertigung.
Er begrüßte mich freundlich, aber mit keinem Wort zu viel. Ich machte beiläufig ein Kompliment über die wunderschöne Biedermeier-Täfelung, die möglicherweise aus der Werkstatt von Joseph Danhauser stammte. Er zog die Augenbrauen hoch und bestätigte meine Vermutung, ging aber nicht weiter auf mein Detailwissen ein. Ungewöhnlich kühl, der Kerl, dachte ich. Trotzdem, ein Punkt für mich. Ich hatte Lebenslauf und Uni-Abschlusszeugnis dabei. Er nahm alles dankend entgegen, ohne einen Blick darauf zuwerfen. Dann sah er mich erwartungsvoll an. Ich zögerte, ehe ich ihm einfach erzählte, dass ich nach zwei Jahren postdoktoraler Forschung in ein Gymnasium als Mathe- und Physiklehrer gewechselt war.
„Sie wissen ja: Die Erfolgsquoten für Forschungsanträge im Euroraum waren unter die fünf Prozent-Marke gefallen – ein Schleudersitz für angehende Jungwissenschaftler. Man konnte zwei Jahre als Projektassistent angestellt werden und dann auf ein neues Projekt hoffen. Nach sechs Jahren war es endgültig aus. Man musste gehen – Arbeitsrecht, Sie kennen das ja.“
Das war gut für die Fluktuation; an den Unis erzeugte sie eine Elite von jungen, dynamischen Professoren, die clever genug waren, rechtzeitig auf das Wunschpferd der Zukunft gesetzt zu haben, eine Menge Zusatzqualifikationen erworben hatten und den Jargon der Projekteinwerbung beherrschten. Ob das für die Forschung gut war, sei dahingestellt – für mich war es jedenfalls nicht gut genug. Ich hatte mich für die Lehre entschieden.
(Das war nur die halbe Wahrheit. Ich war nicht ehrgeizig genug; und meine Fähigkeit, Beziehungen zu Entscheidungsträgern zu pflegen, um mein Fortkommen in der Wissenschaft zu fördern, war ungefähr so ausgeprägt wie mein Interesse an Sport – nämlich gar nicht. Aber das sagte ich ihm nicht.)
Er blickte mich abschätzend an, während ich sprach, so wie man eine Ware – vielleicht Ochsen am Bauernmarkt, dachte ich – inspiziert, bevor man sie kauft.
„Warum wollen Sie sich verändern?“
Das hatte ich erwartet. Ich log, dass mein Vertrag an der Schule in Wien ausliefe und man mich nach Vorarlberg versetzen würde. Ich könne zwar ablehnen, sogar für eine Region optieren, aber das hieße lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen und bis dahin als Springer in Wien zu arbeiten, was mir nun wirklich sehr ungelegen käme. Lieber würde ich mich eine Zeitlang karenzieren lassen – und deshalb sei ich extrem interessiert an seinem Angebot. Ich wollte aus ihm noch herauskitzeln, wie viele Bewerber es denn gab, um meine Chancen abschätzen zu können, wusste aber nicht, wie ich das angehen sollte, und ließ es bleiben. Er nahm eine Mappe, blätterte darin minutenlang herum, sichtlich konzentriert, legte meine Unterlagen dazu, dann klappte er die Mappe zu und schob sie zur Seite.
„Es gibt fünfzehn Bewerber für den Job. Ich brauche nicht lange für Personalentscheidungen, das ist in meinem Beruf notwendig. Ich befasse mich mit Automatisierungs-Software. Demnächst werde ich eine intelligente Haussteuerung hier einbauen lassen. Egal. Ich denke, Sie sind der Richtige für meine Tochter. Wenn Sie wollen, können Sie nächste Woche beginnen.“ Damit stand er auf und erwartete das offenbar auch von mir.
Pff … Das kam überlichtschnell. Der Mann war nicht zimperlich. Ich suchte vor Überraschung nach Worten, stammelte irgendetwas von Großzügigkeit und nicht bereuen. Er bugsierte mich regelrecht aus der Bibliothek, weil ich noch etwas verdattert war.
„Übrigens, wenn Sie einverstanden sind, können wir das Finanzielle bar erledigen, das würde den Ablauf vereinfachen“, sagte er, als wir sein Arbeitszimmer verließen.
Das ersparte mir die Peinlichkeit, es selbst vorzuschlagen. „Kein Problem für mich.“
„Ich mache Sie jetzt mit meiner Tochter bekannt.“
Wir passierten einen Korridor, der mit Ahnenbildern ausstaffiert war wie in einem richtigen Schloss. Sein Gang war selbstsicher und zielstrebig, er lief stets zwei Schritte voraus, obwohl der Korridor breit genug gewesen wäre, um nebeneinander zu gehen und Konversation zu betreiben. Wir kamen in eine Art Salon. Auch hier Biedermeier, eine Sitzgruppe, Anrichte, Regale mit Büchern, ein Schachtisch mit Thonetsesseln, bestens gepflegt, Teppiche mit Jagdmotiven, ein offener Kamin. An den Wänden zwei Gemälde im Stil Kandinskis, geometrisch, farbenreich, ein wohltuender Kontrast zur Einrichtung. Kein einziges Hirschgeweih. Meine Wertschätzung stieg.
„Das ist meine Frau Charlotte“, stellte er mir eine attraktive Brünette vor, die sich bei diesen Worten vom Kanapee erhob. „Und das ist Dr. Goldberg. Er wird nächste Woche bei uns beginnen“.
Ihr Händedruck war fest und sicher. Sehr blaue Augen musterten mich. Ich schätzte sie zwischen 35 und 40. Sie trug ein dunkelgraues Kostüm über einer hellblauen Bluse, deren obere Knöpfe offenstanden. Mittellange doppelt gelegte Perlenkette, transparent lackierte Fingernägel, schwarze Pumps – Klasse.
„Und das ist Nina. Na komm schon, begrüße deinen Retter!“
Es war kein Ersuchen, sondern ein Befehl, und zwar einer, der keinen Aufschub duldete. Hier bestimmte der Feldmarschall. Nina stand langsam auf, in irgendwelche Schulhefte vertieft, so als ob sie zu beschäftigt war und gar nicht mitbekommen hatte, dass es mich gab. Hohe Stirn, kurze aufgestellte Nase, ein eher kleiner Mund mit vollen Lippen. Leicht gewelltes Blondhaar war zu einem Pferdeschwanz straff zusammengebunden. Zwei einsame Strähnen waren der Reglementierung entkommen; sie zausten kleine ungeschmückte Ohren, auf denen eine Brille mit grünem Rahmen und strassbesetzten Bügeln saß. Ein Kindergesicht in Metamorphose. Oft ahnte man bei Mädchen in diesem Alter, was daraus einmal werden würde. In diesem Fall keine Schönheit. Nina war großgewachsen für ihr Alter, fast hager, die dünnen Beine ragten unter einer dunkelblauen Internatsuniform hervor, die wohl für ihre Kleidergröße knielang geplant war, aber bei Nina darüber endete. Mit den langen knochigen Beinen und den großen Füßen sah sie irgendwie unfertig aus. Das Kind wirkte mürrisch, was ich ihm nicht übelnehmen konnte.
„Hallo Nina.“
Sie hatte die Hände am Rücken, wackelte ein wenig aus der Hüfte, als überlege sie, ob sie diese blöde Hand von diesem blöden Pauker ergreifen sollte, aber es blieb ihr ja keine Wahl. Sie grüßte mit eingelerntem Lächeln. Dabei entblößte sie eine Lücke zwischen den Schneidezähnen.
„Wir werden das hinbringen, versprochen. Und es wird gar nicht wehtun“, versuchte ich mit einem kleinen Scherz ihre Verunsicherung zu entschärfen. Aber es ging total daneben. Ich spürte, wie sich ihre Hand verkrampfte, sie zog sie sofort zurück. Über ihrer Nasenwurzel entstand eine senkrechte Falte. Vorsicht! dachte ich. Das wird nicht einfach sein.
Fuchshaym war nichts aufgefallen.
„Sie werden im Gästehaus wohnen. Hassina kümmert sich darum. Hat sie das Zimmer gerichtet?“ Dies zu seiner Frau.
„Mir hat sie nichts gesagt.“
„Unzuverlässig. Wenn das so weitergeht, solltest du dir eine andere suchen“, sagte er genervt, drehte sich um und ging grußlos.
Seine Frau setzte zu einer unfreundlichen Antwort an, wie ihr scharfes Atemholen verriet. Ihr Blick streifte mich flüchtig, dann presste sie die Lippen zusammen, strich eine unsichtbare Haarsträhne aus dem Gesicht und wandte sich mir lächelnd zu.
Du hast dich recht gut unter Kontrolle, dachte ich.
Nina war froh, sich wieder auf ihre Hefte konzentrieren zu können, während Charlotte Fuchshaym mich zum Gästehaus führte. Ich erfuhr, dass die Tochter in Raggau in die nahegelegene Klosterschule ging. Nähe wurde offenbar in der Wildnis anders definiert als im urbanen Bereich; etwa 40 Autominuten von hier, was mit Chauffeur kein Problem bedeutete. Wer hat, der hat.
Solarleuchten säumten den Kiesweg, der vom Schloss durch einen großzügig angelegten Park mit hohen Buchen, Rasen, Blumenbeeten und einem Brunnen zum Gästehaus führte. Die Gräfin informierte mich, dass es sechs Apartments und einen Aufenthaltsraum gebe. Sie würden selten Gäste empfangen, ich sei also gewissermaßen Alleinmieter und könne über den Aufenthaltsraum nach Belieben verfügen. Mein Apartment im Gästehaus befand sich im Obergeschoss. Im Stiegenhaus kam uns eine Bedienstete mit Besen und Putzzeug entgegen. Sie grüßte kurz.
„Das ist Hassina. Sie ist unsere Perle“, stellte die Gräfin vor. „Hassina, Dr. Goldberg wird eine Weile bei uns wohnen.“
„Ich habe gerade das Zimmer fertiggemacht“, sagte Hassina mit deutlichem Akzent. Sie stammte vermutlich aus dem Nahen Osten, war mit einer der letzten Flüchtlingswellen vor der Schließung der Grenzen gekommen. Sie wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. Ihr Händedruck war kurz und fest. Sie hatte kurzes dunkles Haar, ein kantiges, doch attraktives Gesicht mit dunklen Augen unter dichten Brauen.
„Wenn Sie Sachen brauchen, nur sagen. Ich bin oft in der Küche, oder Sie rufen an, ich wohne im Ostflügel.“
Ich hatte Arbeits- und Schlafzimmer, eine Kochnische, Bad und WC. Die Einrichtung nicht ganz neu, etwas Nostalgie hing im Raum, ein Geruch nach Landhausstil und vorigem Jahrhundert. Ein großer Schreibtisch, im Schlafzimmer ein Doppelbett, Kästen. Die Fenster gingen in den Hof, man überblickte den Kiesweg und die Treppe zum Hinterausgang des Schlosses. Es war Anfang April. Primeln, gelber und blauer Krokus, Frühlingsknotenblumen leuchteten büschelweise auf den Wiesen. Auch die Bäume reckten zarte Knospen in den Frühling. In dem Brunnen in der Mitte des Hofes plätscherte ein steter Wasserstrahl über künstliche Felsen. Die Japanische Kirsche daneben war in voller Blüte. Ich war zufrieden, oder besser: sehr zufrieden.
Das Osterwochenende nutzte ich zum Recherchieren und Kofferpacken. Der Kalender zeigte Sonntag, den ersten April. Ich musste Kleidung, Lesestoff und Unterrichtsbücher aus meiner Wohnung holen, die ich seit Tagen nicht betreten hatte. Ich war überzeugt, dass in der Zwischenzeit bei mir eingebrochen worden war, aber das Schloß zeigte sich unversehrt, es war alles so chaotisch wie immer, nichts fehlte. Ich überlegte, Walters Koffer mitzunehmen, befand aber dann, dass er in seinem Schließfach besser aufgehoben war. Jetzt musste ich mich auf meinen neuen Job konzentrieren. Der Koffer kam später dran. Ich kaufte im Velvetklub ein Kartenhandy; dort war so etwas ohne Registrierung und biometrische Datenerfassung für einen stolzen Aufpreis zu haben. Den Galileo-Tracker im Auto deaktivierte ich, das war bei dem Methusalem noch möglich. Meinen Fitness-Tracker ließ ich in der Wohnung. Selbstverständlich schaltete ich die Haustechnik nicht ab – eine praktische App erlaubte es, Beleuchtung, Heizung, Kühlschrank und Geschirrspüler so zu programmieren, als wäre das Apartment bewohnt. Am Dienstag nach Ostern zog ich um.
Den AHS-Stoff der zweiten Schulstufe hatte ich im Kopf (Flächenberechnung, Volumen einfacher Körper, Proportionalität, Brüche, Prozente, lineare Gleichungen). Daher nützte ich den Nachmittag bis Ninas Ankunft, um die Website von RealGames zu studieren, selbstverständlich über ein anonymes Servernetz.
Meine frühere Suche nach ShadowRun hatte Interessantes ergeben. Entwickelt wurde es in den späten Achtzigerjahren von einer FASA Corporation nach der Vorlage von William Gibsons kultiger Cyberpunk-Trilogie. Es ging um Firmenspionage und Auftragsmorde in einer dystopischen Welt, die von Großkonzernen regiert und skrupellos zerstört wurde. Ein damals gängiger Topos, der die unterschwelligen Ängste vor Naturverlust abbildete und zu einer bis heute anhaltenden Technikfeindlichkeit geführt hatte. Die FASA Corporation hatte das Spiel nach zwölf Jahren verkauft, danach dümpelte es bei verschiedenen Lizenznehmern dahin, bis vor einigen Jahren ShadowRun Returns von Harebrained Schemes neu auf den Markt gebracht wurde. Und hier begann es interessant zu werden. Das neue Spiel hatte wenig mit den Vorversionen zu tun. Der Spieler bekommt eine Nachricht von einem virtuellen Freund, nachdem dieser ermordet wurde. Die Aufgabe besteht natürlich darin, den Mörder zu finden. Das war so verblüffend nahe am wirklichen Geschehen um Walter und mich, dass ich mich eines déjà-vu-Gefühls nicht erwehren konnte. War es ein Signal? Für mich gedacht, aber von wem? Gab es irgendwo da draußen einen allwissenden Game-Master, der das alles steuerte? Eine gigantische Verschwörung?
Blanker Unfug, natürlich. Meine Fantasie ging wieder einmal mit mir durch. Ich hatte vergeblich versucht, einen Bezug von Harebrained Schemes mit RealGames zu finden, aber das sagte nicht viel, denn in dieser Branche waren die Querbeziehungen verwickelt und undurchschaubar.
RealGames gab es viele. Nach kurzer Suche stieß ich auf einen Hersteller aus Korea mit einer Palette von Fantasy- und Strategiespielen. Einige Kurzvideos gaben einen Eindruck von der hohen Qualität der Animation, Kämpfe gegen Aliens mit erschreckenden Waffen, dann Mittelalterliches – ein Klon des antiquierten World of Warcraft. Sie boten auch VR-Brillen an, und ein haptic interface war abgebildet, ein waagrechtes Gestell mit einer Art Fahrradlenker und gepolsterten Stützen für Schenkel und Unterarme. Unter den Stützen konnte man Servomotoren vermuten. Der Spieler lag auf dem Ding wie in einem Drachenflieger und trug eine VR-Brille. Darunter wurden Wunderdinge versprochen. Nun ja, ein abgespeckter Flugsimulator mit Garantie auf Cybersickness. Das war nicht so sensationell neu.
Nach kurzem Suchen führte ein Link zu
Hell Fever
Am Schirm ein grünes, friedliches Tal unter einem wolkenlosen Sommerhimmel mit Schäfchenwolken, von einer Anhöhe aufgenommen, Vögel kreisten, Blumen blühten, am Talgrund konnte man sonnenbeschienene winzige Gestalten erkennen, die ihren Tätigkeiten nachgingen. Ich klickte versuchsweise in die Mitte des Tales, das sofort herangezoomt wurde. Das Bild verblasste wie durch eine Milchglasscheibe gesehen, und ein Text erschien:
Coming soon!
RealGames proudly presents a revolution in virtual reality. Immerse yourself entirely in this world of perdition for the villain and of heavenly rewards for the noble-minded. A new technology allows discovering the wonders and temptations of this unique world with all your senses – see, hear, taste, and feel better than in reality.
Ich suchte nach der Sprachauswahl, es gab Englisch, Französisch, Deutsch. Beim Weiterklicken erfuhr man mehr. In Hell Cottage, so hieß der idyllische Ort, konnte man sich eine Existenz aufbauen und reich werden. Das klappte umso besser, je mehr Gaunereien man beging, wie im echten Leben. Man durfte dort alles – stehlen, Banken überfallen, entführen, erpressen, ja sogar seine Konkurrenten ermorden –, es gab weder legislative noch exekutive Staatsgewalt. Ein Freibrief für Gauner, die sich ein tolles Leben machen konnten. Der Haken an der Sache war, dass für jede Tat Parfaits vergeben wurden, das waren Reward-Punkte für gutes und böses Verhalten. Nichts Neues im Westen. Der pan sapiens war zu einem Punktesammler und -jäger verkommen. Von Brötchenbons beim Bäcker bis zu Meilen im Flieger. Gutscheine, Cashback … für Normalsterbliche in €, für VIPs in der begehrten Kerneuropa-Währung Œ.
In Hell Fever bedeutete das, je niederträchtiger man handelte, desto besser lebte man. Ein kultiges Auto, ein Privatjet, ein tolles Haus mit Swimmingpool, in dem tolle Frauen warteten, bereit, sich dem tollen Hengst hinzugeben. Und wenn man der Ankündigung glaubte, würde man diese fleischlichen Freuden mit allen Sinnen erfahren. (Was natürlich nur mit einem klobigen Ganzkörperanzug möglich war und daher nur für einige Freaks und Fetischisten interessant sein würde, wie die zahlreichen Flops mit remote sex-Technik in der Vergangenheit gezeigt hatten). Aber umso tiefer sank man auch, bis das Spiel verloren war.
Und die Gerechten, die Samariter? Jene, die das Fundamentalproblem der Moralphilosophie gelöst hatten: Warum schmerzt mich dein Zahnweh weniger als meines? Kein kultiges Auto, Economy Class statt Privatjet, kein tolles Haus mit Swimmingpool, keine Superfrauen. Schnell würde man mittellos in der Gosse landen, würde Gaunereien begehen müssen, um zu überleben … Zurück an den Start. Es ging offenbar darum, sich durchzuwursteln.
Wie im richtigen Leben. Enttäuschend.
3. KapitelWorin Nina etwas Beunruhigendes tut
Um drei Uhr kam ein Anruf. Die Gräfin war am Apparat. Nina sei aus der Schule zurück. Sie mache sich nur frisch; ob sie dann zu mir kommen dürfe, den heutigen Lehrstoff durchgehen. Ich schlug vor, sie drüben abzuholen.
Im Gegensatz zu ihrem Mann war Charlotte Fuchshaym ausgesucht höflich. Wir plauderten eine Weile im Salon, wobei ich erfuhr, dass sie oft unterwegs war – Tagungsbesuche, Symposien, politische Veranstaltungen. Es schien sich um Menschenrechte zu handeln. Sie war erst vor einigen Tagen aus Frankreich von einem zweiwöchigen Aufenthalt zurückgekommen.
Ich ging also den Stoff mit Nina durch, hatte Schlimmeres erwartet, machte auf pragmatisch – Formel, Zahlen einsetzen, fertig. Nach eineinhalb Stunden hatten wir es geschafft. Loben, zu Fragen ermuntern. Auch wenn mich das nervte.
„Gut gemacht. Wenn’s dir zu schnell geht, sag es ruhig. Wir haben Zeit.“
„Nö, passt schon, danke“, verabschiedete sie sich und stakste davon. Die großen Füße schlurften am Parkett.
Wir einigten uns auf eine Zeitspanne von vier bis sechs. So hatte sie nach der Schule Zeit abzuschalten, mit ihren Puppen zu spielen oder was sie so machte, wenn sie eilig in ihrem Zimmer verschwand. Und es gab mir Gelegenheit, mit dem Chauffeur zu plaudern.
Er hieß Jerome, war seit einem Jahr bei den Fuchshayms, beschrieb das gräfliche Paar als freundlich und korrekt. Die Gräfin hatte ihn auf Empfehlung einer Bekannten aus Deutschland angeworben. Der Graf, wie seine Frau oft auf Geschäftsreisen, war unduldsam und behandelte das Personal von oben herab. Seinen Jeep Cherokee fuhr er oft selbst; Jeromes Hauptaufgabe war es, Nina täglich zur Schule und zurück zu fahren. Manchmal hatte die Gräfin Bedarf – meist zum Shopping nach Graz –, und wenn er nichts anderes zu tun hatte, kümmerte er sich um den Wagenpark. Ein großer Tesla zur Repräsentation, wenn es zu Empfängen oder Events ging, der Mercedes für die täglichen Schulfahrten, der Jeep Cherokee, den Jerome offenbar heiß liebte – geländegängig bis zu unglaublichen Steigungen, unverwüstlich, umschaltbar von manuell auf autonom, was man diesem Urgestein nicht ansah –, und ein roter Porsche 911 Carrera, Baujahr 1989, den der Graf einmal im Jahr spazieren führte. Jerome benutzte ihn, wenn Fuchshaym länger nicht da war, wie er mir nach einigen Tagen anvertraute, als wir bei einem Bier abends zusammensaßen.
Jerome war stattlich und muskulös. Ein kantiges Gesicht, glattrasiert. Er trug Uniform, ganz nostalgisch. An der linken Brust der grauen Uniformjacke fiel mir ein kaum wahrnehmbarer dunklerer runder Fleck auf. Das war die Stelle, an welcher sonst der gelbe Halbmond der Bekennenden angebracht war.
„War da mal ein Abzeichen?“ fragte ich ihn eines Tages, als wir im Hof die Frühlingssonne bei zwei Dosen Bier genossen. Das war ihm unangenehm. Er strich mit der Hand darüber, als ob der Fleck dadurch unsichtbar würde.
„Ein Abzeichen, ganz recht“, bestätigte er. „Ich dachte, man sieht’s nicht. Muss mir ein neues Jackett zulegen“, und nahm einen langen Schluck Bier.
Ich wartete. Jetzt musste eigentlich eine Erklärung kommen. Aber er sagte nichts.
„Du bist kein Moslem“, stellte ich fest und deutete auf sein halbleeres Bierglas. „Da war kein Halbmond.“
Er schüttelte den Kopf, danach folgte Schweigen.
„G für Gefährder?“, vermutete ich provozierend.
Er nickte unmerklich. „Wenn der BND der Meinung ist, dass du die Staatssicherheit gefährdest, kriegst du ein Schreiben. Dann musste den G-Sticker anbringen.“
„Und wenn du’s nicht tust?“
„Kannste im Knast landen“, lachte er.
Ich insistierte nicht. Stattdessen erzählte ich ihm, wie es in Österreich nach dem verheerenden Terroranschlag in Wien zum Bekenner-Sticker gekommen war. Ein mit Sprengstoff vollgeladener Fiaker war am Stephansplatz explodiert. Es gab über zweihundert Tote und noch mehr Verletzte. Das war drei Monate vor der Wahl gewesen, mit Bedacht vom neuen IS gewählt, und folgerichtig hatten die Ultrarechten über 70 Prozent der Stimmen erhalten und eine Alleinregierung gebildet. Schließung der Grenzen, Schießbefehl bei versuchtem Eintritt ins Staatsgebiet (wie mich das an das andere Deutschland erinnerte, von dem meine Großeltern erzählt hatten) und schließlich eine von den Rechtsextremen gepushte Verordnung, die alle Moslems zum Tragen des gelben Halbmondes verpflichtete. Es gab Demonstrationen und bürgerkriegsähnliche Zustände in Wien, Graz und Klagenfurt. Die Regierung beschwichtigte, es sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, um die Bevölkerung vor potentiellen Attentätern zu schützen – als ob ein Abzeichen Attentäter kenntlich machte. So ging es Monate, bis der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft seine Schäfchen dazu aufrief, der Verordnung zu folgen. Es sei ein Zeichen der Bekennenden zum Lob Allahs.
Der Schuss war nach hinten losgegangen. Statt Warnung vor Terroristen war der Halbmond ein Zeichen der Identität geworden. Man hatte die Verordnung bald zurückgenommen, aber es half nichts – die Bekennenden trugen den Halbmond nun mit Stolz. Paradoxerweise war dadurch das Gesprächsklima mit Moslems besser geworden. Sie traten nun öffentlich gegen Terroranschläge auf, und manche Politiker aus dem moderat-rechten Lager waren verstört, Demonstrationen von vielen Tausenden Halbmondträgern gegen Amokfahrten und Drohnenabstürze in Fußgängerzonen und Einkaufszentren kommentieren zu müssen. Der Halbmond am Revers gab der großen Mehrheit der Moderaten eine Identität. Sie waren als Islam West im Parlament vertreten. Damals hatte ich einen Hoffnungsschimmer am Horizont der zerfallenden Gesellschaft gesehen, die Vernunft schien sich wieder aus den Tiefen der Verblendung zu erheben.
Seit den letzten Nationalratswahlen regierte in Österreich ein Zweckbündnis aus Grünen, Linken und Islam West gegen die Rechtsextremen. Wir hatten einen grünen Kanzler und einen praktizierenden Moslem als Vizekanzler. Das, was Michel Houellebecq vor langer Zeit im Plauderton für Frankreich prophezeit hatte, war nun in Österreich Realität. Ob die großzügigen Dotationen aus den Golfstaaten für die Universitäten, die im Gegenzug Moslems auf Lehrstühle setzten, die Forschung förderten oder ein moralisches Problem waren, darüber stritten nicht nur Experten.
Beim zweiten Bier wurde Jerome gesprächiger. Er hatte in den heydays of terrorism auf Websites des frühen IS gesurft, um sich ein Bild zu machen. Der BND hatte seine Internet-Aktivitäten verfolgt und ihn als Gefährder eingestuft. Man versicherte ihm, dass die Kennzeichnung als Gefährder keine rechtlichen Konsequenzen habe. Sie sei schlicht eine Triggerwarnung.
„Das war aber lange vor der Besetzung durch die Alliierten.“
„Klar, Was haben wir uns gefreut, als der Bürgerkrieg beendet war. Na gut, jetzt gibt es ein neues besetztes Irak-Syrien, aber immerhin ist es dort ruhig. Ich bin damals auf die Straße gegangen, um das zu feiern, aber das hat die Idioten nicht interessiert.“
„Dein Vollkoffer von Minister hat das intelligenter gemacht als unsere Regierung“, fand ich. „Ein Trigger, von der Religion getrennt, damit sind Aufrufe religiöser Führer unwirksam.“
„Eure Idee war schon besser als unsere. Was soll denn das – Menschen nach ihrem Surfprofil zu beurteilen. Das läuft doch nicht wie bei den Pädophilen. Ich bin doch kein Terrorist, wenn ich mich für die Ursachen von Terrorismus interessiere! Triggerwarnung – ha!“
Er knallte das Bierglas auf den Tisch.
„Mal langsam, Jerome. Das passiert seit einer Ewigkeit. Wenn Google weiß, wo du surfst, wissen es auch die Geheimdienste dieser Welt.“
Er starrte in sein Glas.
„Wenn du nicht willst, dass andere erfahren, was du tust, dann gibt’s nur eine Lösung“, legte ich nach.
„Nämlich?“
„Tu es nicht.“
Von Nina konnte er nicht viel berichten. Sie war pflichtbewusst und bescheiden, hing wie alle in dem Alter dauernd am Handy, meistens telefonierte sie mit ihrer besten Freundin Hayley. Im ersten Schuljahr war sie mittelmäßig unterwegs gewesen. Die schulischen Probleme hatten um die Jahreswende begonnen. Bis dahin habe sie ihn bei der Heimfahrt immer mit echten oder vermeintlichen Skandälchen an der Schule zugelabert, aber nach den Weihnachtsferien, als sie mit der Gräfin aus Davos zurückgekommen war, sei sie plötzlich verschlossen gewesen, hatte nur noch wenig erzählt.
Ein Zeichen der Reife, behauptete ich beiläufig, während ich dachte: Hat sie wenig erzählt, oder erzählst du mir nicht alles?
Es verging eine Woche, und ich merkte, dass Nina Vertrauen zu mir fasste. Erstaunlicherweise hatte sie keine gräflichen Allüren, keine herrschaftlichen Ansprüche oder Umgangsformen. Ich hatte befürchtet, dass sie mich als Lakaien behandeln würde, aber das war nicht der Fall, sie war bescheiden. Auf die Frage, was sie in ihrer Freizeit mache, musste sie nachdenken. Klavierspielen und reiten.
Es kam heraus, dass beides eine Idee der Eltern war, eigentlich des Vaters, und sie lieber Musik hören würde, aber nicht die blöde klassische vom Klavier, und lieber mit ihren Freundinnen rumhing. Aber das war selten möglich wegen der Entfernungen. Und vermutlich wegen der Standesunterschiede. Die beste Freundin Hayley ging in die Sechste – eine Leitfigur.
Die Schularbeit auf drei war ein Erfolg. Das Mädchen war gut drauf, quirliger als sonst, und ich merkte, dass ich nicht mehr der Pauker war, sondern eine – Instanz. Instanz mit gemischter Gefühlsbindung, interessiert-misstrauisch, vorsichtig-abwartend, das sah ich an der Art, wie sie mich heimlich musterte, wenn sie dachte, ich sähe es nicht. Ich machte normal weiter, vielleicht hätte ich sie mehr loben müssen, um die Waage der Justitia noch mehr zu meinen Gunsten zu beeinflussen, aber das war nicht meine Art. Prompt kam einige Tage danach ein regelrechter Absturz. Nina war unkonzentriert, ich merkte, dass sie an etwas anderes dachte, vielleicht schmollte sie, weil sie meinte, ich ignorierte sie, obwohl ich das gar nicht tat. Ich sprach sie auf ihre Zerstreutheit an. Ja, sie träume schlecht, erklärte sie. So hatte ich es nicht gemeint.
Nach drei aufeinanderfolgenden ähnlichen Tagen machte ich einen schriftlichen Test. Von zehn Beispielen waren acht falsch, obwohl wir das alles durchgekaut hatten. Während sie in ihren Sachen kramte, schaute ich die Ergebnisse an meinem Schreibtisch durch. Eine Katastrophe.
„Das war schwach. Das wird Konsequenzen in der Schule haben“, murmelte ich eher für mich. Ich hörte, dass sie hinter mir vom Stuhl aufstand. Sesselrücken, Klappern. Ich schrieb das Ergebnis auf den Test, eine Vier minus, und das war väterlich-wohlwollend beurteilt, dann drehte ich mich um.
Sie hockte mit gegrätschten Beinen auf dem Sessel, die Oberschenkel links und rechts auf den Armlehnen. Sie stützte sich hinten ab, sodass ihr Oberkörper in Schräglage und das Becken nach vorn gedrückt war. Ihr Rock war über den Schritt hochgerutscht.
„Was – was machst du denn?“ fragte ich völlig entgeistert.
„Weil Sie’s gesagt haben.“
„Was? Was habe ich gesagt?“
„Wenn man nicht lernt, gibt’s Konsequenzen. Wie beim Pater Pius.“
„Was um Gottes willen meinst du. Wer ist Pater Pius?“
„In der Schule. Er prüft uns manchmal. Und der sagt das.“
Das war ganz und gar unmöglich. Um mich zu vergewissern, ob ich richtig gehört hatte, fragte ich noch einmal „Was sagt der Pater also?“
Sie presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf.
„Ist es zu schlimm?“
Kopfnicken.
„Also, jetzt komm da runter“, sagte ich barsch. Sie zog den Kopf ein, und ihr Oberkörper begann zu zucken.
Ich war mit zwei Schritten bei ihr, griff ihr unter die Achseln und hob sie herunter. Als sie so verloren dastand, den Blick zur Seite gerichtet, nahm ich ihre Hände, kalte dünne Hände.
„Alles gut. Bei mir gibt’s keine Strafen“, versuchte ich meine Grobheit zu lindern. Sie reagierte nicht.
„Du bist hier in Sicherheit.“ Ich berührte ihre Wange mit dem Handrücken, suchte ihren Blick.
„Du bist meine beste Schülerin.“
„Ja, Sie sind so freundlich“, schniefte sie und wischte sich die Augen.
„So, jetzt vergessen wir das ganz schnell. Aber ich würde schon gern wissen, was der Pater sagt.“
Sie druckste herum, dann meinte sie leise „Ich kann’s ja aufschreiben.“
Wir setzten uns, ich schob ihr ein leeres Blatt hin. Sie rückte ihre Brille zurecht, nahm mit spitzen Fingern einen Bleistift, kaute darauf herum, nachdenkend, sehr ernst. Eine steile Falte bildete sich zwischen ihren Brauen. Nun legte sie den Kopf schief und schrieb mit leicht geöffnetem Mund, langsam und sorgfältig, den Bogen mit der Hand verdeckend. Dann faltete sie ihn, lehnte sich zurück, rückte wieder ihre Brille zurecht und starrte finster auf den vor ihr liegenden Bleistift. Ich entfaltete den Bogen. Da stand
Lernst du nicht mit gutem MutGiebt es Hiebe auf die Fut
Ich musste mich zusammennehmen, um nicht loszuprusten. Deutsch: Nichtgenügend. Aber an Sexualkunde interessiert, denn das letzte Wort hatte sie mit starkem Druck hingeschrieben.
„Was, und dann schlägt er dich auf deine – deine Scham?“
Sie senkte den Kopf.
„Das darf er nicht! Das müssen wir anzeigen.“
„Es tut nicht weh, er macht das nur symbolisch.“
„Mit der Hand?“
Wieder angedeutetes Nicken.
„Es ist katholisch. Man muß Buße tun, wenn man faul ist.“
Herr im Himmel. Ich beschloss, die Stunde abzubrechen. Klappte Maul und Mappe zu und verabschiedete sie, als wäre nichts. Den ganzen Abend grübelte ich über diese bizarre Geschichte. Das musste doch schon jemandem aufgefallen sein. Warum wusste Jerome nichts davon? Hatte sie es nur mir gesagt, weil da Vertrauen war?