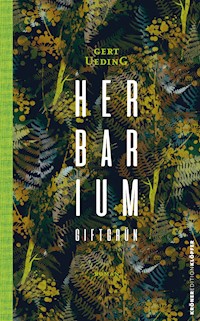
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
In einem Hörsaal des Brechtbaus der Universität Tübingen wird eine Studentin tot aufgefunden. Die Todesursache ist unklar, die Polizei tappt noch ein halbes Jahr danach im Dunkeln. In den Unterlagen der Toten findet sich eine rätselhafte Botschaft, die einerseits ihre Studieninteressen verrät, andererseits eine versteckte Drohung enthält. Durch Zufall fällt die Notiz Max Kersting, einem jungen Maler, in die Hände, den das Geheimnis und die Tote zu interessieren beginnen. Als auf ihn ein Anschlag verübt wird, beißt er sich erst recht an dem Fall fest. Was steckt hinter dem mysteriösen »Herbarium«, von dem da die Rede ist? Warum will man Kersting am Recherchieren hindern? Kommissar Neunzig nimmt den »Hobby-Detektiv« zunächst nicht ernst, da passiert ein neuer Mord: Im Parkhaus der Universität wird eine Professorin, Dozentin der toten Studentin, erschlagen aufgefunden. Gehören die beiden Fälle zusammen? Die Spuren, die Zeichen, die Kersting hartnäckig und erfindungsreich verfolgt, führen tief in die so gelehrte wie geschlossene Gesellschaft der schwäbischen Alma mater hinein – und weit über Tübingen hinaus nach Frankfurt und Konstanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
In einem Hörsaal der Eberhard-Karls-Universität wird eine Studentin tot aufgefunden. Die Todesursache ist unklar, die Polizei tappt im Dunkeln. In den Unterlagen der Toten findet sich eine rätselhafte Botschaft, die durch Zufall dem jungen Maler Max Kersting in die Hände fällt, den das Geheimnis zu interessieren beginnt. Kommissar Neunzig nimmt den ›Hobby-Detektiv‹ zunächst nicht ernst, da passiert ein neuer Mord.
Die Spuren, die Zeichen, die Kersting so hartnäckig wie erfindungsreich verfolgt, führen tief hinein in die so gelehrte wie geschlossene Universitäts-Gesellschaft – und weit über die altehrwürdige Universitätsstadt hinaus.
Gert Ueding, 1942 geboren, lebt bei Heidelberg, bis 2009 Ordinarius für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen, bis 2012 Gastprofessor an der Universität St. Gallen. Essayist, Literaturkritiker verschiedener großer Zeitungen, u. a. der FAZ und der Welt. Mitglied zahlreicher literarischer Jurys, u. a. der Jury zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels sowie zur Bücherbestenliste des SWR. Bei Klöpfer & Meyer hat er über viele Jahre die renommierte Essayreihe Promenade herausgegeben. 2016 erschien, hoch gelobt, in drei Auflagen: Wo noch niemand war. Erinnerungen an Ernst Bloch.
Gert Ueding
Herbarium, giftgrün
Roman
1. Auflage in der Edition Klöpfer
Stuttgart, Kröner 2021
ISBN DRUCK: 978-3-520-75301-4
ISBN EBOOK: 978-3-520-75391-5
Umschlaggestaltung: Denis Krnjaić
unter Verwendung eines Motivs von Liia Chevnenko, shutterstock.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2021 Alfred Kröner Verlag Stuttgart · Alle Rechte vorbehalten E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt
In dieser Universitätsluft entarten die Besten.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Ameisen – hochsoziale Insekten aus der Familie der Formicidae – sind für ihre außerordentlich gut organisierten Kolonien und Nester bekannt. In einer neuen Studie fanden Wissenschaftler der Universität Leeds und der Universität Kopenhagen nun allerdings heraus, dass Ameisen trotz ihrer organisatorischen Talente gern betrügen und korrumpieren, egal ob es sich um Arbeiterinnen, Drohnen oder Königinnen handelt.
Etwas ist nicht geheuer, damit fängt das an.
ERNST BLOCH
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
1Erste Vorzeichen
2Der Fall entwickelt sich
3Wir sind in Tübingen!
4Hinter den Kulissen
5Annäherungen
6Folgen eines Unfalls
7Neue Spuren
8Der Verdacht wird konkreter
9Das kleine Herbarium
10Die Oberfläche reißt
11Mit knapper Not
12Verräterische Bilder
13Alte und neue Indizien
14Falsche Nachrichten
15Neue Gefahren
16Uni-Sex
17Lokal-Termine in Konstanz
18Im Herbarium
19Fatale Vorfälle
20Letzte Geheimnisse
21Das Summen der Bienen
22Aufklärung
1 Erste Vorzeichen
Festlichkeiten dieser Art waren Kersting zuwider. In jedem Herbst nach den Sommerferien lud der Präsident der Universität die Spendierfreudigen unter den Absolventen zu einem Mittagessen mit anschließender Führung durch eine der vielen wissenschaftlichen Fachsammlungen ein. Diesmal sollten die archäologischen Exponate vorgeführt werden. Kersting hatte beschlossen, es beim Mittagessen zu belassen. Er kannte die archäologische Sammlung bestens und hatte sich eigentlich nur eingefunden, weil er mit seiner Arbeit nicht vorwärtskam und sich inspirierende Abwechslung erhoffte. Diesmal würde sie von einer Seite kommen, die er niemals erwartet hätte. Später stellte er sich manchmal die Frage, wie sein Leben wohl verlaufen wäre ohne dieses Treffen. Weniger aufregend, weniger gefährlich, dafür aber vielleicht förderlicher für seine Arbeit.
Es war nicht viel, was er gelegentlich aufs Unikonto überwies, doch hing eines seiner Bilder, eine großformatige Variation auf die Fassade der Alten Aula, im Versammlungsraum des kleinen Senats. Beides reichte für eine ehrenvolle Erwähnung in der glücklicherweise kurzen, völlig humorlosen Tischrede des Präsidenten. Wenn man Kersting in dieser Gesellschaft sah, hätte man ihn kaum für einen Künstler gehalten, so korrekt war er gekleidet. Schon gar nicht hätte man ihn auf Mitte dreißig geschätzt. Seinem schmalen gebräunten Gesicht mit den ins Dunkle spielenden olivgrünen Augen, sah man an, dass er gerne lächelte und der Ausdruck des Ernstes nur auf das Stichwort dafür wartete. Kersting saß neben dem Dekan der philosophischen Fakultät, auf eigenen Wunsch. Philosophie war sein Hauptfach gewesen, und wenn die Malerei ihm jetzt noch Zeit ließ, griff er am liebsten zu Montaignes Essays oder den kleinen Schriften Schopenhauers, auch lagen Lichtenbergs Aphorismen und die »Fröhliche Wissenschaft« oft in Reichweite auf dem Regal neben den Schachteln mit Pinseln, Farben, Firnissprays oder Strukturpasten. »Ein miserabler Redner und durchschnittlicher Präsident«, flüsterte ihm sein rechter Nachbar nach der drögen Rede des Rektors zu. Er kannte ihn noch aus seiner Studienzeit und erinnerte sich nach kurzem Überlegen auch wieder an den Namen: Müller-Riedel, Germanistikprofessor kurz vor der Emeritierung, eine Koryphäe der Hölderlin-Philologie und exzellenter Rezitator, noch voller Spannkraft und Bosheit. Man erzählte sich wilde Geschichten von seiner Trinkfestigkeit, Nase und Haut zeugten davon, doch die Augen blickten klar, ein wenig listig sogar in die Welt.
»Durchschnittlich?« fragte Kersting, »als Präsident meinen Sie? Er hat doch die Universität in die Exzellenz-Förderung gebracht, viel Geld eingesammelt. Die Zeitungen waren voll des Lobes.«
»Nachdem er das erste Mal alles vermasselt hatte.« Müller-Riedel hüstelte mehrmals trocken, eine Angewohnheit, die, wie sich Kersting erinnerte, seine Vorlesungen zur Qual machten, weil er fast jede Satzpause damit füllte. »Der erste Antrag vor vier Jahren war voll von Fehlern und Versäumnissen gewesen, ein schlampiger Witz. Den Posten hat er bloß bekommen, weil es an Gegenkandidaten fehlte. Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht. Wer will schon seine Wissenschaft für einen reinen Verwaltungsjob aufgeben – es sei denn, er machte auch vorher schon nichts anderes. Man braucht nur zu sehen, was er aus den Institutionen macht, die sich nicht auf ›exzellent‹ reimen: abwickeln ist da die bürokratische Losung – wie beim Universitätszeichenlehrer.«
Kersting dachte sich sein Teil, wusste schließlich, dass auch für den boshaften Müller-Riedel, der da neben ihm saß, als Dekan und damit als Vorsitzender einer großen Fakultät keine bedeutenden wissenschaftlichen Sprünge mehr möglich waren. Er sah sich in dem kleinen Festsaal der Museumsgesellschaft um, der im ersten Stock über dem Restaurant lag.
In dem schmucklosen Raum war eine ganze Anzahl runder Tische verteilt, die meisten voll besetzt, man hatte offensichtlich darauf geachtet, dass an jedem Tisch mindestens ein Professor, eine Professorin Platz nahm. Das Stimmengewirr schwoll mal hier mal da an, je nach Alkoholkonsum.
Kersting kannte kaum jemanden. Die meisten waren im vorgeschrittenen Alter, viele begleitet von ihren professionell geschminkten oder, im krassen Gegenteil, naturbelassenen Ehefrauen. Nur wenige in seinem Alter. Ein paar Tische weiter erkannte er den Besitzer eines Textilunternehmens, das seinen Erfolg vor allem luftigen Dessous und exquisiter Nachtwäsche verdankte. Wenn man nicht genau hinsah, hätte man ihn, wie auch Kersting selber, für einen frisch examinierten Uniabsolventen halten können. Beide etwa gleichaltrig, noch ohne die hier übliche Geselligkeitsroutine. Ihre Blicke trafen sich, sie nickten sich verständnisinnig zu. Kersting strich sich eine Locke seines kastanienbraunen Haares aus der Stirn.
Auch von den Repräsentanten der Universität waren ihm wenige Gesichter vertraut: der Kanzler, der Prorektor noch. Sonst auffallend viele junge Leute, deren Aussehen auch an einem Bank- oder Postschalter nicht fremd gewirkt hätte. Eine rundliche junge Frau sonnte sich in der Aufmerksamkeit ihres graumelierten Gegenüber. Ziemlich weit entfernt sah er einen zwar weißhaarigen, aber den ausdruckslos glatten Gesichtszügen nach, noch jungen Mann. Ein Professor namens Knaipp, wie er sich jetzt erinnerte. Sogenannter Kommunikationswissenschaftler und Sprecher des Rektors. Seine Affären waren Stadtgespräch. Einen sonnigen Intriganten, hatte ein Kollege ihn öffentlich genannt.
Kersting ärgerte sich jetzt doch, die Einladung angenommen zu haben. Überall im Saal beherrschte gepflegt-langweilige Plauderei die Atmosphäre, überall freundliche, doch nichtssagende Gesichter. Er hätte Besseres zu tun gehabt. An einem der näher gelegenen Tische begann immerhin ein lebhafteres Gespräch die Stimmung etwas zu heben. Er hörte Satzfetzen, von einem Artikel im ›Tagblatt‹ war die Rede, vom Versagen der Polizei. Worum es genau ging, bekam er nicht mit.
Bevor der Hauptgang kam, Tafelspitz mit Meerrettich und reicher Gemüsebeilage, erkundigte sich Kersting bei seinem Tischnachbarn nach einigen seiner früheren Professoren, die er aus den Augen verloren hatte, erhielt aber nur zerstreute Antwort. Der Grund zeigte sich bald. Müller-Riedel begann in seiner Sakkotasche zu kramen und zog einen kleinen quadratischen Zettel hervor, schob ihn zu seinem Nachbarn hinüber. »Können Sie sich einen Reim draus machen?«
Auf dem kleinen Papier standen, etwas schräg aufeinander zulaufend, drei Zeilen, per Hand mit dem Kugelschreiber geschrieben und gut lesbar: »Denk an unser herbarium sidereum oder die andere schreit und lärmt in allen Gassen. Wie immer F20« –
Die lateinische Wendung (übersetzt: ›das himmlische Kräuterbuch‹) kam Kersting von fernher nicht unbekannt vor, doch wusste er nicht, wo er sie einordnen sollte.
»Ich müsste darüber nachdenken, aber wo haben Sie das her?«
Doch bevor Müller-Riedel antworten konnte, wurden von hinten die gefüllten Teller auf den Tisch gestellt, der Präsident wünschte an seinem Platz stehend, mit erhobenem Glas, guten Appetit. Kersting wollte den Zettel zurückreichen, aber Müller-Riedel winkte ab: »Behalten Sie ihn und rufen Sie mich an, wenn Sie eine Idee haben.«
Die kleine Pause vor dem Nachtisch kam dann gerade recht, um die Frage nach der Herkunft der Notiz zu wiederholen.
»Erinnern Sie sich an die Uni-Tragödie, den Kriminalfall, vor einem halben Jahr? Die tote Studentin, die man im Seminarraum der Kommunikationswissenschaftler fand, an einem Montag, noch vor Veranstaltungsbeginn des Sommersemesters, im April?«
Max Kersting erinnerte sich natürlich. In der noch immer pietistisch geprägten Bevölkerung der Universitätsstadt hatte der Fall große Aufmerksamkeit erregt, zumal einige Indizien darauf hindeuteten, dass die junge Frau vor ihrem Tode nicht allein gewesen war. Auch munkelte man, dass Rauschgift eine Rolle gespielt hatte, obwohl niemand wusste oder wissen wollte, dass sie Rauschgift nahm. Auch sollte sie ihr Studium nicht mehr sehr ernst genommen haben, was man einem unbekannten Freund angelastet hatte. Mehr war Kersting von der Sache nicht in Erinnerung geblieben, er hatte sie nicht weiterverfolgt, zumal die Polizei Fremdverschulden schließlich ausgeschlossen hatte.
»Der Zettel stammt von ihr«, fuhr Müller-Riedel fort. »Die Polizei hat ihn bei ihr gefunden und nach der Untersuchung mit einigen aus der Bibliothek stammenden Büchern und sonstigen Seminarmaterialien zurückgegeben. Er lag in einer Mappe mit Photokopien zu einem Referat, das sie vorbereitete. Das Thema hieß ›Der Ursprung der Faust-Sage‹ und hat mit den Zeilen hier aber offenbar nichts zu tun. Mir hat die Botschaft, denn das ist es ja wohl, trotzdem keine Ruhe gelassen. Ich glaube auch, dass sich die Schlussbemerkung auf ein geplantes Treffen bezieht. Vielleicht auf das, was sie dann nicht überlebt hat.«
»Sie meinen die Schlussbemerkung ›wie immer F20‹?«
»Ja. Klingt wie eine Verabredung: ›Wie immer Freitag‹, also vielleicht der Tat-Tag, und die Uhrzeit, 20 Uhr. Man sollte doch wissen, was das Übrige heißen soll.«
»Könnte natürlich auch ein Seminarraum gemeint sein …«
»Unwahrscheinlich, gibt’s zumindest in unserm Haus nicht. Ist mir auch sonst nicht begegnet. Aber sei’s drum, wichtig wär auch das. Doch sicher ein Hinweis auf den Freund, mit dem sie in den letzten Wochen zusammen war, den auch ihre Freundinnen nicht kennen und möglicherweise der letzte, der sie lebend gesehen hat.«
Darüber sollte man nachdenken, war auch Kerstings Meinung. Auf Geheimnisse war er schon immer angesprungen. Innerlich belustigt dachte er an manchen Titel seiner Kinderlektüre. Er versprach, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, bat um einen Stift, um sich die Sätze von dem Zettel abzuschreiben.
»Behalten Sie ihn ruhig erst mal. Vermisst ja niemand.«
Müller-Riedel lehnte sich zurück, zufrieden, etwas zur Aufklärung des Rätsels getan zu haben, das ihn so sehr beschäftigte – kaum ein Kollege, den er damit verschont hätte. Kersting steckte das Papier in seine Jackentasche und wandte sich jetzt wieder der illustren Versammlung zu.
Sie hatten sich mit einigen wenigen Unterbrechungen unterhalten, ohne sich besonders um ihre anderen Tischnachbarn zu kümmern. Zu seiner Linken saß ein Unternehmer aus Mössingen in mittleren Jahren, etwas korpulent, aber in weißem Leinenanzug und vom Urlaub gebräunt; Vorstand eines kleinen Familienunternehmens, das Gardinenstoffe herstellte und in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken sollte.
Rechts von Müller-Riedel saß ein schlanker junger Mann um die dreißig, den er offenbar mitgebracht hatte, vielleicht sein Assistent, vielleicht ein Gast von außen, bei der Vorstellung war das undeutlich geblieben. Gleich gegenüber eine Frau, um die fünfzig, untersetzt, blau punktierte helle Bluse mit Wasserfall-Ausschnitt, der ihrer weichen Körperform schmeichelte. Nur die flink hin und her huschenden blassgrauen Augen störten das freundliche Bild, sie liefen oftmals wie von selbst nach oben weg, als ob an der Decke der eigentliche Film lief. Offenbar eine Kollegin seines Nachbarn, die, wie sich jetzt zeigte, das Gespräch mitangehört hatte.
»Die Polizei hat den Fall ganz nachlässig verfolgt«, behauptete sie. »Tut ja auch jetzt nichts. Das ist ein Skandal, ja ein Skandal! Nicht mal die genaue Todesursache weiß man. Wo sind wir? Auf dem Balkan?«
Inzwischen war der Nachtisch, Eis mit allerlei Früchten, verzehrt, die Weingläser geleert. In das Gespräch über den Kriminalfall mischten sich nun auch die anderen Tischgäste. Der junge Mann neben Müller-Riedel, den Kersting für einen Assistenten hielt, hatte das Ereignis etwas wegwerfend als Medienspektakel beschrieben und dafür lebhaften Widerspruch von einem fetten Mann geerntet, der ausgiebig schwitzte und ständig mit dem Taschentuch über den glattrasierten Kopf wischte. Die Frau an seiner Seite unterstützte ihn, indem sie nickend ihrem langen Gesicht einen energischen Ausdruck zu geben versuchte.
Das ging noch eine Weile hin und her, bis die Gesellschaft sich an den Rändern und den Tischen, die dem Saalausgang am nächsten waren, aufzulösen begann. Kersting hatte den Kommentaren nur noch zerstreut zugehört. Er wollte noch einen Spannrahmen in Fellbach kaufen und verabschiedete sich von seinem Tischnachbarn. Er versprach anzurufen, wenn er irgendetwas über die Bedeutung des Zettels herausgebracht hätte und ging eilig die breite Treppe des Museums-Restaurants hinunter. Auf der Straße und bevor er die Richtung zur Tiefgarage am Nonnenhaus einschlug, änderte er seine Absicht und wandte sich in Richtung Bibliothek. Er schwitzte in seinem Anzug. Der September war bisher ungewöhnlich warm gewesen.
Die nächsten zwei Stunden las er im kühlen Lesesaal alte Presseartikel zu dem Fall Verena Roeder, mit dem er sich so unvermutet konfrontiert sah und der ihn nicht losließ. Die Fakten waren dürftig, die Spekulationen umso blühender. Er sah einige Photos. Eine hübsche junge Frau Mitte zwanzig, wohl in der Endphase ihres Studiums. Lange, offenbar dunkle Haare, auf einem Bild trug sie eine Sonnenbrille mit großen dunklen Gläsern, auf einem anderen sah man sie in einem leichten, kurzen Sommerkleid. Sie stammte aus Bremen. Die Eltern beide Ärzte, ein jüngerer Bruder studierte in Frankfurt. Das gab alles nicht viel her. Dafür beherrschte der unbekannte Freund die Berichterstattung. War er ein Mitstudent? Aber warum hatte sie dann ein Geheimnis aus seiner Person gemacht?
Oder war er verheiratet oder einer ihrer Professoren oder beides? Von früheren Freunden wusste man nichts, auch die Eltern hatten keine Ahnung. Vielleicht eine Geliebte – und gerade das sollte niemand wissen? Sie hatte im Wohnheim auf der Wanne gewohnt. Eine Nachbarin wollte sie zweimal mit einer älteren Frau in Stuttgart auf der Königstraße gesehen haben.
Das alles war wenig aufschlussreich. Nur auf eine Information stieß er, die ein besonderes Licht auf sie warf. Im Hauptfach war sie Germanistin, doch hatte sie sich besonders für das Mittelalter interessiert, historische und auch philosophische Kurse über diese Epoche besucht. Eine eher ungewöhnliche, aber interessante Orientierung heutzutage, fand er.
Als Kersting die Unibibliothek verließ, wäre er beinah mit Müller-Riedels Kollegin, die so lebhaft die örtliche Kriminalpolizei kritisiert hatte, zusammengestoßen. Sie kam vom sogenannten Brechtbau her, dem üblichen Betonklotz, in dem die philologischen Fächer untergebracht waren. Er hatte sich vorhin nicht vorgestellt und beschloss, das Versäumte jetzt nachzuholen.
»Max Kersting – es gab leider gar keine richtige Gelegenheit, uns bekannt zu machen.« »Der Maler, von dem die ›Gelehrtenrepublik‹ im kleinen Senat hängt? Ich bin Sophie Jansen, versuche, die Studenten für Sprachtheorien zu interessieren. Hartes Brot, ganz hartes Brot!«
Sie sagte das lachend, fügte dann aber, sofort ernst, hinzu: »Verena, über deren Tod Sie sich mit Müller-Riedel unterhalten haben, war bis zuletzt in meinem Seminar über Sprachmystik im Mittelalter. Fleißig und interessiert, eine seltene Freude heutzutage.«
»Eine ungewöhnliche Wahl oder die Mentalität der Studenten muss sich seit meiner Zeit sehr geändert haben.« »Hat sie nicht. Acht Leute waren im Seminar, davon sechs Studentinnen.« »Fiel Frau Roeder irgendwie auf, hatte sie spezielle Fragen, haben Sie irgendetwas von ihrem Privatleben mitbekommen?«
»Na, Sie haben wohl Feuer gefangen? Ist eine rätselhafte Geschichte, das Ganze. Sie war ziemlich verschlossen, ohne eigenbrötlerisch zu sein. Ich hatte manchmal den Eindruck, ihre Zurückhaltung hatte sie sich verschrieben wie eine Medizin. Verstehen Sie? Mit Vorsatz, nicht aus natürlichem Temperament.«
»Und das hielt sie durch?«
»Im Seminar ja. Da wirkte sie auch sonst in manchem, wie soll ich sagen … unzeitgemäß. Die anderen hocken mit ihren Laptops oder Ipads da, notieren sich ihre Stichworte und referieren sozusagen vom Bildschirm aus. Aber Powerpoint, das sag ich Ihnen, gibt es bei mir nicht.
Verena war ganz anders! Sie schrieb auf einem altmodischen Papierblock mit und ihre Vorträge bereitete sie auf Karteikarten vor. Völlig selbstverständlich, auch selbstbewusst. Nur einmal habe ich sie anders erlebt. In der Sprechstunde. Sie kam schon niedergeschlagen zur Tür rein, dann begann sie aber schnell die Fassung zu verlieren, die Fassade bröckelte gewissermaßen, aber was dann …«
Frau Jansen brach ab.
»Ja?«
»Ach nichts weiter. Wir müssen jetzt Schluss machen, sonst erwische ich den Bus nach Pfrondorf nicht mehr; mein Auto steht in der Werkstatt. Hat mich gefreut, Sie kennen zu lernen.«
Sie wandte sich um und ging eilig die Wilhelmstraße hinauf. Kersting sah ihr hinterher. Eine kleine, rundliche Person, aber von höchst einnehmenden Wesen, dem auch er sich, obwohl soviel jünger, nicht entziehen konnte. Er hätte gerne etwas mehr von ihren Eindrücken über ihre unglückliche Studentin erfahren, auch über jene offenbar merkwürdige Sprechstunde. Noch war das bloße Neugier, angeregt durch die Zeitungslektüre und das Gespräch mit Müller-Riedel. Einen Augenblick wunderte er sich dann aber doch darüber, dass er an dem Fall soviel Anteil nahm und sogar stundenlang alte Zeitungsartikel studiert hatte, um sich mit Fakten und Personen vertraut zu machen.
Sollte er noch nach Fellbach fahren? Es ging schon auf den Abend zu, aber er würde es noch vor Geschäftsschluss schaffen. Brauchte auch die Leinwand. Die Pflicht siegte, im Nachhinein musste er sagen: unglücklicherweise. Er holte den alten eckigen Volvo-Kombi aus der Parkgarage und fuhr los.
Die Straßen waren um diese Zeit voll, er reihte sich in die Schlange ein und wappnete sich mit Geduld. Einmal wäre er beinah umgekehrt, hatte dann aber schon Vaihingen fast erreicht. Verena Roeder ging ihm nicht aus dem Kopf, die ganze Fahrt über. Er hatte sie nicht gekannt, auch niemanden aus ihrer Nähe, außerdem schien der Fall inzwischen unter Aktenbergen begraben. Wie kam er plötzlich zu diesem Interesse. Vielleicht lag es an den Photos von ihr? Er sah sie immer wieder vor sich, fühlte ein Bedauern über ihren Tod, so als sei er ihr im Leben begegnet. Ihre ernsten dunklen Augen sah er vor sich, wie in einem Tagtraum, der unerfüllbar bleibt. Er erinnerte sich an die elende Liebesgeschichte des Studenten in Hoffmanns Erzählungen, der einer leblosen Puppe verfiel und wahnsinnig wurde.
Ob die merkwürdige lateinische Formel auf dem Zettel in seiner Tasche aus dieser Gegend, also aus romantischem Geist stammte? Maler waren besonders anfällig für Fernlieben dieser Art, sogar wenn von Erfüllung keine Rede sein konnte, weil die Angehimmelte längst schon Geschichte war. ›Dies Bildnis ist bezaubernd schön‹. Er hatte, als er studierte, einen Zimmernachbarn, der die Uta vom Naumburger Dom auf einem fast lebensgroßen Photoplakat in seinem Zimmer hängen und sie wieder und wieder gemalt hatte. Die Fata Morgana machte ihn nicht satt, er verzweifelte schließlich, gab die Malerei auf.
Die Rückfahrt von Fellbach war nicht weniger mühsam, immerhin lagen die Keilrahmen im Auto, er konnte weiterarbeiten. Die Unterbrechung mit den Gesprächen im Geschäft und der üblichen Fachsimpelei hatten ihn wieder in die Wirklichkeit geholt. Als er sich Unterjesingen und seinem Atelier, ganz am Ende einer Wohnstraße näherte, freute er sich nur auf ein Glas Rotwein. Er rangierte auf seinen Parkplatz vor dem Haus, erleichtert, zuhause zu sein. Er stieg aus und merkte erst jetzt, da die Autoscheinwerfer ausgeschaltet waren, dass mit der Straßenlaterne vor dem Haus etwas nicht stimmte, genauer: sie leuchtete nicht, flackerte nicht einmal, so dass es ihm nicht leichtfallen würde, die Rahmen so aus dem Kofferraum zu ziehen, dass sie nicht beschädigt wurden. Ob er die Innenbeleuchtung noch mal einschalten sollte? Er kam nicht dazu. Hörte hinter sich Geräusche, schnelle Schritte, drehte sich um, sah schattenhaft zwei kräftige Gestalten auf sich zukommen.
»Raus mit dem Papier!«
»Was …«
»Komm schon, raus damit!«
Mehr Worte machten sie nicht. Der eine hielt ihn fest, der andere versuchte, in seine Jacke zu fassen. Kersting wehrte sich jetzt so gut er konnte, trat mit den Füßen, bekam einen Arm frei. Das nützte wenig, ein Faustschlag in die Nieren tat höllisch weh, er krümmte sich, ein Schlag traf seinen Kopf, ein Knie rammte gegen seine Nase, noch ein Schlag, er lag auf dem Boden, benommen und hilflos. Später wunderte er sich, dass er nicht um Hilfe geschrien hatte, aber alles war sehr schnell gegangen. Nicht ohne einigen Lärm allerdings, in dem etwas entfernt stehenden Nachbarhaus ging die Außenbeleuchtung an.
2 Der Fall entwickelt sich
»Los, weg, ich hab’s,« hörte er etwas verschwommen einen der beiden Angreifer sagen, dann war der böse Spuk vorbei. Er rappelte sich auf, schnappte nach Luft, atmete hastig und schwer und brauchte eine Weile, bevor er wieder aufrecht stehen konnte. Das Licht nebenan war jetzt ausgegangen. Er verzichtete für heute darauf, seine Einkäufe aus dem Kofferraum zu holen, schloss den Wagen ab und verzog sich etwas mühsam ins Haus.
Max Kersting bewohnte es alleine. Er hatte es auf Erbpacht von der Gemeinde erworben, als nach den beiden Ausstellungen in Stuttgart und Baden-Baden die Sammler auf ihn aufmerksam geworden waren. Der Verkaufserfolg hatte ihm etwas Geld eingebracht. Ursprünglich besaß es nur ein Stockwerk, das spitze Dach hatte er zu einem hellen Atelier mit Schlafraum und kleinem Badezimmer ausgebaut.
In dem Spiegel im Bad gab er jetzt kein besonders schönes Bild ab: auf der hohen Stirn sah er einen langen, zum Glück flachen Riss, der aber blutete, als habe ein Ring ihn aufgeschlitzt, das ganze Gesicht war blutverschmiert, die Unterlippe aufgerissen, der Unterleib schmerzte. Er säuberte sich vorsichtig, ging dann ins Atelier, wo die Cognacflasche stand, ein kräftiger Schluck, der zwar an der Lippe schmerzte, aber doch guttat, dann verzog er sich in seinen Lesesessel und überdachte das Geschehen.
Klar war, dass die beiden Schläger es auf Müller-Riedels oder vielmehr Verenas Zettel abgesehen hatten. Was sollte er jetzt tun? Die Polizei rufen? Zeugen gab es keine, und selbst wenn der Nachbar durchs Fenster gelinst hatte, bevor er das Licht anschaltete, hatte er nicht mehr als flüchtige Schatten sehen können. Er selber konnte keinen von beiden beschreiben, sie hatten etwa seine Größe, um die einsachtzig herum, glaubte er; es waren trainierte Halunken gewesen, besonders der eine, der ihm zielsicher seine Hiebe verpasst hatte. Das war alles, damit konnte man keine Suchmeldung losschicken. Und schließlich: der Zettel war zwar weg, aber die paar Worte konnte er auswendig.
Warum also, fragte er sich ziemlich ratlos, haben die Angreifer dieses Risiko auf sich genommen? Der Abend hatte gerade erst angefangen, und auch wenn er am Ende der Straße wohnte, ohne Gegenüber, hätte doch leicht ein anderer auch unterwegs sein können, den Hund ausführen oder einfach zwischen den Weinbergen spazieren. Sie mussten überdies damit rechnen, dass er sich den Inhalt des Zettels gemerkt hatte. Also kam es darauf wohl nicht an. Vielleicht weil es ihr Zettel, also der Zettel mit Verenas Handschrift, gewesen war, und dieser Zusammenhang sich jetzt nicht mehr beweisen ließ. Da hätten sie beide, Müller-Riedel und er, noch so viel bezeugen können.
Aber wie konnten sie wissen, dass er das Stück Papier eingesteckt hatte? Müller-Riedel hatte die Übergabe bei Tisch im oberen Saal des Museums nicht besonders heimlich vollzogen, sie beide hatten dabei unbefangen über die Bedeutung gerätselt. Kein Zweifel: jemand, der in den Fall auf irgendeine Weise verwickelt war und nicht weit weg gesessen hatte, musste das mitbekommen und seine Maßnahmen getroffen haben.
Eines hatten die ungebetenen Besucher aber nicht bedacht: War er vor der Attacke noch nicht sehr engagiert an des Rätsels Lösung interessiert gewesen, so wollte er es jetzt unbedingt und so schnell wie möglich aufklären.
Bloß nicht gleich. Er fühlte sich ganz zerschlagen (kein Wunder), und seine Grübelei machte ihn auch nicht munterer. Also verschob er alles weitere auf den folgenden Tag, kletterte ohne Verzug ins Bett und war im Nu eingeschlafen.
Als Kersting nach neun Stunden aufwachte, fühlte er sich elend. Der Riss auf der Stirn war nur noch eine rote Ritze und blutete nicht mehr. Aber die verletzte Lippe war angeschwollen, sein Bauch schmerzte, Kopfschmerzen kamen hinzu, kaum dass er aufgestanden war. Er saß in der Essecke seiner großen Küche, die zusammen mit Flur und einem kleinen Gästezimmer das Erdgeschoss einnahm. Der Kaffeeduft erfüllte den Raum. Vorsichtig wegen des harten Porzellanrandes, dann aber fast gierig trank er die erste Tasse.
Was tun? fragte er sich, als er sehr vorsichtig vom morgendlichen Toastbrot einen Bissen zwischen die verletzten Lippen schob. Zur Polizei wollte er immer noch nicht, aber die beiden Ganoven hätte er zu gerne identifiziert. Das präsidentielle Mittagessen erschien ihm als die einzige Möglichkeit, einen Faden in die Hand zu bekommen, der ihn am Ende zu den Schlägertypen führen konnte.
Müller-Riedel fiel aus, es sei denn, er hatte jemandem von ihrem Gespräch erzählt. Dasselbe galt wohl für Frau Jansen und die anderen Gäste am Tisch. Der Assistent oder wer immer da auf der anderen Seite seines Nachbarn gesessen hatte, schien ihm die vielversprechendste Adresse: er hatte sicher das meiste vom Gespräch mitbekommen, kam vom Alter her infrage und hatte, falls er zum germanistischen Kollegium gehörte, vielleicht sogar die Tote gekannt.
Ein paar Klicks im PC brachten Kersting auf die Seite mit dem Programm der germanistischen Veranstaltungen des letzten Semesters. Ein Seminar mit dem Thema »Para-Feminismus im Mittelalter« fiel ihm auf. Der Dozent: ein Mann namens Gregor Sautter. Das Photo auf der Seite des Instituts bestätigte seinen Verdacht. Das schmale Gesicht, die dunklen Haare und seine selbst im Bild noch auffordernd blickenden Augen: das war der Mann, der den Kriminalfall als Medienspektakel verharmlost hatte. Vielleicht ein Ansatzpunkt.
Also fuhr Kersting die paar Kilometer nach Tübingen, stellte das Auto ins Parkhaus nahe der Bibliothek. Im Seminargebäude studierte er als erstes die zum Teil recht wirr bestückten Aushängetafeln im Erdgeschoss, auf denen alle Lehrenden der hier untergebrachten Fächer mit der Angabe ihrer Diensträume verzeichnet waren. Mit der nötigen Information fuhr er in dem engen und recht betagten Aufzug ruckelnd in den 3. Stock, fand nach kurzem Suchen das Zimmer, an dem zwei Namen standen, darunter der gesuchte, und klopfte. Trotz Semesterferien hatte er Glück und konnte nach Zuruf eintreten.
Hinter dem Schreibtisch erhob sich ein mittelgroßer junger Mann, das blonde Haar kunstvoll verstrubbelt, darunter ein rundes Gesicht mit üppigem Schnauzbart, der wohl das bubihafte Aussehen kaschieren sollte, es im Gegenteil aber betonte. Die sehr hellen grauen, aber kalt blickenden Augen passten nicht dazu. Das ist der Falsche, war auf Anhieb Kerstings Eindruck. Er stellte sich vor, der Schreibtischbewohner begrüßte ihn freundlich, nannte seinen Namen: Franz Buch; er hatte ihn draußen an der Tür schon gelesen. Er erinnerte sich auch, im germanistischen Programm seinen Namen vor dem Seminarthema »Walther von der Vogelweide in der Übertragung Peter Rühmkorfs« gefunden zu haben.
»Ich habe gehofft, Herrn Dr. Sautter anzutreffen …«
»Da sind Sie im falschen Zimmer gelandet … Ja, ich weiß: ich muss das Namensschild an meiner Tür ändern. Aber mein Kollege ist sowieso gerade heute nach Berlin abgereist, um an einem Kongress teilnehmen zu können. Über Paracelsus in der deutschen Literatur. Er kommt wohl erst am Wochenende zurück.«
»Hm, schade. Ich hätte mich gerne mit ihm über sein Seminarthema vom letzten Semester unterhalten. Wir suchen einen Referenten über die Geschichte des Feminismus.«
Kersting fiel es wegen seiner verletzten Lippe immer noch schwer, deutlich zu artikulieren. Buch schienen erst jetzt die Blessuren seines Gastes aufzufallen. Er musterte ihn jedenfalls genauer.
»Wem sind Sie in die Quere geraten?«
»Bloß meiner Haustür, aber das genügte. Die Sache ist eilig, deshalb bin ich trotzdem hier.«
»Ob Sie da bei ihm an der richtigen Adresse sind? Der interessiert sich jetzt mehr für allerlei Elementargeister. Eine Mode, wie so vieles in unserer Wissenschaft. Auch wenn Sie der Titel seines letzten Seminars angelockt hat …«
»Genau deshalb bin ich hier.«
»Mit Feminismus in unserem Sinne hat das wenig zu tun.« Kersting spürte eine Spur von Geringschätzung im Tonfall, machte aber ein fragendes Gesicht.
»Es ging viel mehr um so etwas wie die Chemie der Geschlechter, wenn Sie wissen, was ich meine – aber nehmen Sie doch Platz«, unterbrach er sich, wies auf einen Stuhl schräg vor seinem Schreibtisch, und setzte sich selber wieder nieder.
»Ich glaube schon, dass ich weiß, worauf Sie hinauswollen. So etwas, wie Goethe es in den »Wahlverwandtschaften« thematisiert hat, nehme ich an.«
»Das hat natürlich mit Feminismus nichts zu tun. Aber dessen Verfechter nehmen’s nicht so genau. Eine Kollegin behauptete, Paracelsus habe seine ganzen medizinischen Kenntnisse aus weiblicher Quelle und begründete das mit einem angeblichen Zitat: ›Alles, was ich weiß, weiß ich von weisen Frauen‹. Nirgendwo belegt, hat man ihm untergeschoben.« Buch begleitete seine Kritik mit einer wegwerfenden Handbewegung.
»Erstaunliches Thema für das kurzatmige Studium, das man den Studenten heute zumutet. Ist das denn modulgerecht?«
Kerstings Spott fiel auf fruchtbaren Boden. Buch kicherte. »Wenn man danach gehen wollte, gäbe es nur noch Kurse wie »Drama 1« oder »Drama 2« oder »Romantischer Roman 1« und so weiter, wie bei den Maschinenbauern. Aber etwas anderes wollen die Studenten, pardon, die Studierenden nicht. Schön wär’s ja, wenn unsere Studenten Studierende wären, aber studieren tun nur die wenigsten, die aber sammeln sich dann in Kursen über Paracelsus oder Niklaus von Flüe.«
»Immerhin gibt es noch die, die nicht den Trampelpfad gehen.«
»Eine ganz kleine Minderheit. Die meisten wollen billiges Grundwissen, leblos und breitgetreten. Dann werden sie möglichst schnell auf die Schüler losgelassen und lesen mit denen den »Wilhelm Tell« als Comic. Unsere didaktischen Kollegen finden das super und liefern noch das gute Gewissen dazu. In Sautters Seminar saßen sieben Teilnehmer, davon fünf Studentinnen.«
Da hatte Kersting offenbar einen Nerv getroffen! Wie aber nun zu den Fragen kommen, die ihn interessierten?
»Warum soviel Studentinnen?«
»Einmal, weil sie prozentual in der Mehrheit sind. Aber sie sind auch hartnäckiger. Paracelsus lesen, ist nicht so einfach, man muss die Sprache regelrecht lernen. Dann aber begeistert sie einen, so kernig, so bildhaft, dagegen wirkt unser heutiges Deutsch wie eine Verfallssprache. Eine von Sautters Studentinnen wollte darüber ihre Doktorarbeit schreiben. Daraus wird nun nichts …«
»Lust verloren?«
»Nein, tot. Sie haben bestimmt vor ein paar Monaten darüber gelesen. Man fand sie tot im Gebäude nebenan.«
»Ja, ich erinnere mich. War nicht die Todesursache rätselhaft?«
»Meint jedenfalls die Polizei, oder verbreitet diese Meinung aus ermittlungstaktischen Gründen. Wie auch immer. Man wird schon wissen, woran sie gestorben ist! Auch junge Leute können schon mal an Herzversagen sterben, ganz natürlich.«
»Sie schließen ein Verbrechen aus?«
Kersting wollte ihn am Ball halten; vielleicht erfuhr er etwas über sein Zeitungswissen hinaus. Seine Hoffnung wurde aber gleich enttäuscht. Buch erwiderte lapidar: »Ich bin sicher« und riet ihm dann, sich im Sekretariat um einen Gesprächstermin bei Herrn Sautter zu bemühen.
Als Kersting das Zimmer verließ, trat er in den immer noch leeren Flur, überlegte einen Augenblick, ob er vielleicht an Müller-Riedels Tür klopfen sollte, der auch hier oben sein Dienstzimmer hatte. Verzichtete dann darauf, da er mit der Aufgabe, die der ihm gestern zugeschanzt hatte, nicht weitergekommen war.
Aber sein Besuch im Brechtbau sollte Kersting noch einen unvermuteten Erfolg bringen.
Als er ins Erdgeschoss hinuntergefahren war und sich in der Eingangshalle aus etwas zerstreuter Neugier auf den Tischen umsah, die überall standen und mit Prospekten über Veranstaltungen, Zeitungsabos und Firmenanzeigen überfüllt waren, fiel ihm ein Faltblatt besonders ins Auge. Ein Fitness-Studio annoncierte darin Sonderkonditionen für Studenten. In der ersten Spalte ein Photo mit mehreren Trainerinnen und Trainern, von denen ihn das Bild eines jungen Mannes stutzen ließ. Es war die Frisur, die ihn aufmerksam machte: die Seiten des Kopfes kahlgeschoren, oben das Haar wie ein Vogelnest mit Gel geformt. So ähnlich (der Einfall kam ihm ganz unvermutet) hatte das James Bonds schwarze Gegnerin in einem der alten Filme schon getragen.
Inzwischen war diese Frisur Mode geworden. Irgendeine Fußballergröße hatte sie populär gemacht. Am vorigen Abend hatte er zwar keinen seiner Angreifer erkennen können, doch trug zumindest der, der ihn niederschlug, eine Frisur wie diese – Kersting hatte das, am Boden liegend, sehen können, als sich die Silhouette des Schlägers einen Augenblick gegen den trotz der Wolken nicht ganz schwarzen Himmel abhob. Er nahm das Faltblatt mit und ging zu seinem Auto.
Ein Blick auf die Uhr. In ein paar Minuten könnte er in der Weststadt im hier angezeigten Fitness-Studio sein.
Der Laden unterschied sich nicht von anderen Etablissements dieser Art. Gleich nach dem Eingang der lange Tresen, hinter dem sich zwei junge Frauen angeregt über Tübinger Friseure unterhielten. Beide blond und mit trainierter Figur, in eng anliegende Trikots gekleidet, denen der Studioname aufgedruckt war, verrieten in Gestalt und Aussehen, dass sie das hier herrschende Körperbewusstsein auch anregend zu repräsentieren hatten. Neben ihnen ein untersetzter junger Mann mit glattrasiertem Schädel, der gerade aus der Kaffeemaschine seine Tasse füllte. Das Kaffee-Aroma überdeckte kaum die sonst herrschende Geruchsmischung aus Duftspray und Schweiß.
Kersting fragte, ob er sich umsehen könne, er trüge sich mit dem Gedanken, seiner körperlichen Verfassung etwas auf die Sprünge zu helfen.
Die etwas Ältere von den beiden maß ihn mit einem Blick, der im umgekehrten Falle sofort die feministische MeToo- Bewegung alarmiert hätte. Kein Zweifel, er gefiel ihr: mit seinem etwas dunklen Teint, dem freundlich-strahlenden Augenausdruck und der schlanken Figur. Sie erbot sich jedenfalls sofort, ihm die Trainingsräume zu zeigen. Der große saalartige, im Hintergrund etwas verwinkelte Raum stand voller Marterinstrumente, von deren teilweise weit in die Gegend krakenden Armen Lederschlingen herabhingen oder Gewichte baumelten, oder die sich bei näherem Zusehen als überdimensionale Fahrräder, Schlitten oder Laufbänder entpuppten. Ein Paradies für alle mittelalterlichen Hexenmeister oder Folterkünstler, von denen es ja wieder viele gab.
Bei jeder Maschine erläuterte die Begleiterin Funktion und Aufgabe. Bauchmaschine (»Haben Sie ja nicht nötig!«), Bizeps- und Trizeps-Trainer, Rückendehner. Kersting musste sich gestehen, dass seine nachlässige Haltung und sein schlaksiger Gang durchaus ein korrigierendes Training vertragen könnten, ließ es sich aber dennoch nicht anmerken, dass ihn die Benutzer mehr interessierten als diese beeindruckenden Apparate. Er war enttäuscht, dass nicht mehr als ein Dutzend schwitzender Gestalten sich in dem reichhaltigen Angebot abmühten. Einer von ihnen stemmte ein Gewicht und stieß dabei Laute aus, die man sonst nur in zoologischen Gärten oder aus einschlägigen Hotelzimmern hören konnte.
Auf seine Bemerkung hin erfuhr Kersting, dass die Mittagszeit von den meisten Mitgliedern gemieden wurde. Er hatte also die falsche Zeit erwischt.
Sie gingen durch einen Bogengang in einen großen, seitlich angegliederten Raum, der vor allem der Muskelbildung gewidmet war. Hier war mehr los, vor allem junge Leute, Männer mit Muskelpaketen bepackt und von obskuren Tattoos überzogen stemmten unter Ächzen und mit schweißdurchtränkten Trikots Gewichtstangen oder zogen schwere Blöcke zu sich herab. Kersting kam es so vor, als ob nicht sie die Maschinen lenkten, sondern die Maschinen ihnen jede Bewegung diktierten.
Inzwischen hatte er allerdings eingesehen, dass ihm sein spontaner Einfall nicht den gewünschten Erfolg bringen würde. Nicht nur die Tattoo-Uniformen, auch die Frisuren verrieten auffälligen Corpsgeist: beinah jeder dieser Verrenkungskünstler hatte sich die Kopfseiten kahl rasieren und auf dem Kopf ein dichtes Haarbüschel stehen lassen, das jene Silhouette formte, wie er sie in der vorigen Nacht bei einem seiner Peiniger bemerkt hatte.
Er ließ sich den Rest der Führung mit guter Miene gefallen. Was ihm nicht schwer fiel. Einige junge Frauen bemühten sich, es ihren Kombattanten möglichst gleich zu tun. Der Anblick gefiel ihm und war von einem leichten Frösteln begleitet, wenn er sich diese Verrenkungen in andere Situationen übertragen vorstellte.
Als er sich verabschiedete, drückte ihm die hinter dem Tresen gebliebene Hostess einen Prospekt in die Hand.
»Darin finden Sie alles, Kursprogramme, Öffnungszeiten, Kosten. Wenn Sie wollen, können wir gleich eine Probewoche vereinbaren. Dann wird einer unserer Trainer (sie wies auf den Kahlköpfigen, der inzwischen seinen Kaffee ausgetrunken hatte und in einem Magazin blätterte) Ihnen für ihre Wünsche ein Trainingsprogramm zusammenstellen.«
Kersting überlegte einen Augenblick, ob er seine Suche auf diese Weise vertiefen sollte. Er hatte geradezu hautnah gespürt, was ihm fehlte, seit Christa ihn verlassen hatte. Doch war er vom Anblick der uniformierten Geräte-Artisten auch entmutigt. Er dankte, erbat sich Bedenkzeit, verließ, betont ernst und aufmerksam um sich blickend, die schweißtreibende Stätte und fuhr nach Hause.
Auf der Staffelei wartete nun schon einige Tage das gerade erst begonnene Bild der Tübinger Neckarfront. Er hatte das Motiv ausgewählt, weil er aus diesem meistphotographierten und von Ansichtskarten und Prospekten völlig verschlissenen Ensemble etwas Neues machen, es so verfremden wollte, dass man seine Schönheit wieder wahrnehmen konnte. Als er das erste Mal in die Neckarstadt gekommen war, hatte ihn der Anblick beinah umgeworfen, diesen Moment vergaß er nie.
Eine überzeugende Idee war ihm bisher nicht eingefallen, so dass ihm die Erinnerung an den geraubten Zettel mit der rätselhaften Botschaft als Ausrede gerade recht kam. Oder sollte er sich nicht gleich offen eingestehen, dass er höchst zufrieden war über die Störung mitten in seiner Arbeit? Als hätte er eine neue Begabung entdeckt, die ihn nicht bloß von der Staffelei fernhielt, sondern ihm andere Erfahrungen, neue Reize und Genüsse versprach, die ihm bislang unbekannt waren, aber seine Malerei durchaus bereichern könnten.
Er schrieb sich die Zeilen aus Verenas Nachlass in sein Notizbuch. »Herbarium sidereum«, himmlisches Kräuterbuch, wo war ihm das schon einmal begegnet?
Mit einem Male (er musste über sich selber lachen) wurde ihm bewusst, wie überflüssig diese Frage im Zeitalter der Computer und Suchdienste war. (Wieso war Müller-Riedel nicht auf dieselbe Idee gekommen?) Und wirklich, das lateinische Stichwort führte auf mehrere Treffer. Im Handbuch der Geschichte der Medizin fand er den Eintrag »Herbarium spirituale sidereum« und den Hinweis auf die Entsprechungslehre des Paracelsus: Jedem elementar körperlichen Gegenstand entspricht ein geistig himmlischer, hat von dorther seine Form – was eben auch für alle Heilkräuter, jede Arznei gilt.
Aber was sollte das nun in diesem Falle bedeuten?
In der Hoffnung, auf irgendeine Spur zu stoßen, nahm er sich die Zeitungsartikel vor, die er in der Universitätsbibliothek gesichtet und von denen er die wichtigsten mit dem Smartphone abphotographiert hatte. Darunter auch ein Interview mit einer Freundin der Toten. Er überflog noch einmal den Text, und fand gleich zu Beginn die Antwort auf die Frage, wann und wo sich die beiden kennengelernt hatten: »Das war im Sommersemester vor zwei Jahren, in einem Cusanus- Seminar, wir arbeiteten gemeinsam an einem Referat über die Entsprechung von Mikrokosmos und Makrokosmos …«
Nun, aber was sollte diese Reminiszenz an eine vergangene Seminararbeit auf dem später gefundenen Zettel bedeuten, zudem offenbar verbunden mit der Bestätigung einer Verabredung? Und dann die Fortsetzung: »oder die Andere schreit und lärmt in allen Gassen«? Klang das nicht fast wie eine Drohung?
Er richtete sich noch einmal an seinen Laptop und gab die Wendung ein. Nach einigen Fehlschlägen landete er beim Stichwort »Anderheit«, das für den Cusaner eine wichtige Kategorie gewesen war; und da, noch ein Treffer: sie kommt aus dem Nichts, diese Anderheit, hält es eben deshalb nicht bei sich aus, ein Vakuum, das nach Sein schreit und sich füllen will. Es ging der Schreiberin also darum, dem Adressaten ihrer Nachricht sehr eindringlich klar zu machen, wie lebenswichtig ihr Anliegen sei. Und sie musste damit gerechnet haben, dass der andere die verschlüsselte Botschaft auch verstand.
Befriedigt lehnte sich Kersting zurück, musste sich aber bald eingestehen, dass er mit seinen Erklärungen nur scheinbar weitergekommen war. Im Gegenteil: das Ganze erschien ihm jetzt noch rätselhafter. Er suchte noch etwas herum, dann gab er es für diesmal auf.
Mit ein paar Schritten war er am Regal mit seiner kleinen philosophischen Bibliothek und zog einen flachen Karton heraus. Er öffnete ihn, eine hölzerne Spielschale, etwa 30 Zentimeter im Durchmesser, mit nummerierten Außenfeldern kam zum Vorschein. Eine kleine Holzkugel und ein etwas kantiger Holzkreisel gehörten dazu. Wenn man Glück hat, befördert der Kreisel die Kugel in eines der äußeren Gewinnlöcher. Eine viertel Stunde spielte Kersting wie abgeschaltet von der Welt mit diesem Roulette, dann wendete er sich wieder der Staffelei zu. Immer noch gingen ihm die Begriffe und Cusanischen Ideen im Kopf herum: Anderheit, das Andere, das Chaos, das zum Baumaterial der Welt wird, die der Philosoph die »kleine Welt«, parvus mundus, genannt hatte. Wie von selber begann er, den Gedanken ins Bild und auf die kleine Leinwandwelt da vor sich auf der Staffelei zu übertragen, Mauern in halbfertige Quader und Fenster in pflanzliche Form zu verwandeln. Zufrieden war er dennoch nicht, holte den Kohlestift hervor und fing an zu skizzieren.
Der Nachmittag verging im Nu. Erst als das schwindende Licht anfing, ihm Probleme zu bereiten, unterbrach er seine Arbeit und machte sich einen Imbiss. Die Tote aus dem Germanistik-Seminar und ihre Zettelhinterlassenschaft waren weit weggerückt.
Max Kersting sollte höchst unsanft wieder an sie erinnert werden.
3 Wir sind in Tübingen!
Nach dem Abendimbiss hatte er sich die Tagesschau angesehen und musste in seinem Sessel einen Augenblick eingenickt sein, als er aus dem Erdgeschoss unter sich zwei Mal kurz hintereinander ein lautes Scheppern mit anschließendem Aufprall hörte. Er schreckte auf, sprang, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter, in die Küche, aus der die Geräusche gekommen waren. In beiden Fenstern ein großes Loch, auf der Arbeitsplatte und dem Boden die Scherben, dazwischen zwei große Steine, auf einem der beiden, mit Paketband festgeklebt, eine Spielzeugpistole. Draußen war es schon ziemlich dunkel, er hörte und sah niemanden. Die Straßenlaterne war immer noch defekt, obwohl er gestern deswegen bei der Stadtverwaltung angerufen hatte.
Das hier war kein Streich dummer Jungen, sondern eine gezielte Aktion, eine Warnung an seine Adresse, daran zweifelte er nicht. Ob prophylaktisch als Verlängerung des gestrigen Überfalls? Oder ob es mit seinem Besuch im Fitness-Studio zusammenhing? Das erschien ihm zwar wenig wahrscheinlich; wäre doch ein zu großer Zufall gewesen, wenn wirklich einer seiner gestrigen Gegner Mitglied dieses Clubs, außerdem just anwesend gewesen war und ihn erkannt hätte. Aber ganz ausschließen konnte er das natürlich nicht.
Diesmal allerdings wollte er die Polizei benachrichtigen. Die kleine Spielzeugpistole, ein symbolisches Ausrufezeichen gewissermaßen, beunruhigte ihn nun doch.
Die beiden Beamten brauchten fast eine ganze Stunde von der Tübinger Adenauerstraße hinaus nach Unterjesingen. Sie waren noch jung, schienen kaum dem Schulalter entwachsen. Ein lang aufgeschossener Kerl mit etwas sauertöpfischem Gesicht und ein alert wirkender, mehr als einen Kopf kleinerer Kollege, der forsch nach dem »Tatort« fragte. Beide waren offenbar zunächst entschlossen, die Angelegenheit nicht ganz so dramatisch zu nehmen, wie sie ihm selber erschien. Erst als er nun auch vom gestrigen Überfall berichtete, merkten sie auf.
»Warum haben Sie uns da nicht gleich gerufen?« fragte der kleinere und, wie Kersting glaubte, aufgewecktere von beiden.
»Gestern kam mir das wenig sinnvoll vor, Sie hierher zu bemühen. Ich hatte ein paar Schrammen, die beiden waren abgehauen, ich hätte nicht mal eine gute Personenbeschreibung geben können, an eine Wiederholung glaubte ich nicht.« (Zumal sie ja bekommen hatten, was sie wollten, dachte er, ohne das aber auszusprechen – hätte arg abenteuerlich und verschwörungsgläubig geklungen.)
»Haben Sie Feinde, denen Sie derartige Gewalttätigkeiten zutrauen?«
»Fällt mir niemand ein.«
Sie rätselten noch ein wenig an dem Motiv herum, die beiden machten ein paar Photos mit ihren Handys, sammelten Steine und Plastikpistole ein (»Werden sicher keine Fingerabdrücke drauf zu finden sein.«) und fuhren dann wieder ab, nachdem sie Kersting gebeten hatten, am nächsten Tag vorbeizukommen, um das Protokoll des Vorfalls und die offizielle Anzeige zu unterschreiben.
Kersting schloss die alten, aber noch festen Fensterläden im Erdgeschoss, fegte die Scherben zusammen und stieg wieder die Treppe hoch in sein Atelier, wo er sich instinktiv sicherer fühlte.
Eines war ihm klar geworden. Irgend etwas stimmte nicht mit den Umständen um den Roeder-Fall, und jemand versuchte, ihn sehr handfest vom weiteren Nachforschen abzuhalten. Was seinen Eigensinn freilich nur stimulierte: Jetzt gerade! Doch wie sollte er sich gegen weitere mögliche Attacken schützen?
Eine richtige Waffe? Besser nicht. Würde nur zur Eskalation beitragen. Außerdem: wie drankommen? Schießen hatte nicht zu seiner Ausbildung gehört.
Dann erinnerte er sich, dass er Christa, als sie beide noch zusammen waren und sie von einsamen Waldgängen nicht ablassen wollte, einen angeblich höchst wirksamen Pfefferspray gekauft hatte. Auch würde er sich eine von den neuen und sehr lichtstarken LED-Taschenlampen besorgen. Am besten eine von den schweren röhrenförmigen Exemplaren, die auch als Waffe dienen konnten? Und ganz sicher würde er je einen starken Scheinwerfer vorne über der Tür und hinter dem Haus anbringen lassen. Mit Bewegungsmelder.
Die konkreten Pläne erhöhten sein Sicherheitsempfinden, noch bevor sie in die Tat umgesetzt waren und beruhigten ihn nach der Aufregung des Abends. Aber wie sollte es jetzt weitergehen? Dass er nicht aufgab, verstand sich. Er wurde den Verdacht nicht los, dass die Ereignisse der beiden letzten Tage mit dem eigentlichen Roeder-Fall nur weitläufig zusammenhingen oder ihr Zusammenhang erst wichtig und ersichtlich wurde, wenn er mehr wusste.
Es ging also darum, mehr zu erfahren: Von den Studienbedingungen, die Verena Roeders Leben bestimmt hatten, von ihren Freunden und Freundinnen, ihren Dozenten – er musste mehr ins studentische »Milieu« hinein, durfte nicht so weit entfernt von außen agieren, da entgingen ihm die wichtigen konkreten Details. Er spürte, wie er sich wieder in den Fall zu verbeißen begann. Die Angriffe auf sich nahm er persönlich, das mochte falsch sein, doch offene Rechnungen hatte er nie gemocht. Auch gab es Ansatzmöglichkeiten genug, wenn er an seinen Besuch bei den Germanisten dachte.
Als erstes wollte er morgen den Namen der Studentin herausbekommen, die in dem Interview den Hinweis auf das Cusanus-Seminar gegeben hatte. Im Zeitungsartikel war sie nur mit dem Namenskürzel J. O. aufgetaucht, aber ihr Zeitungsbild hatte er zusammen mit dem ganzen Interview-Text im Photospeicher seines Smartphones.
Unterdessen war es spät geworden, beinah zweiundzwanzig Uhr, doch er war noch hellwach und zum Lesen zu aufgeregt. Er griff zum Handy und wählte die Nummer von Boris Karlsdorf, einem befreundeten Redakteur des Südwestrundfunks, der im Studio oben auf dem Tübinger Österberg arbeitete und ihn auch schon zwei Mal interviewt hatte. Als er sich meldete, hörte er im Hintergrund lautes Stimmengewirr, sicher aus Boris’ Stammkneipe.
»Ich bin noch zu nervös zum Schlafen und brauche einen Auslauf. Wo bist du gerade?«
»Im ›Bären‹.«
»Dacht’ ich mir. Ich setze mich ins Auto und komme für eine Stunde dazu.«
»Schön, ich warte. Ist wenig los hier, die Studenten fehlen.«
Als Kersting die Tür in den stickigen Gastraum aufstieß, sah er nur an zwei Tischen die volle Besetzung, aber in so lebhafte, laute Unterhaltung verstrickt, dass sie es zumindest akustisch mit der doppelten Anzahl hätten aufnehmen können. Boris saß am Tresen, nahm, als er ihn erblickte, sein halbgefülltes Glas und steuerte einen Tisch in der hinteren Ecke an. Er war etwas größer als Kersting, breitschultrig und beleibt, mit braungesprenkelten Augen und Dreitagebart im ovalen Gesicht, das sonst Gutmütigkeit und Witz ausstrahlte, jetzt aber misslaunig wirkte.
»Ich habe gerade die zweite Attacke hinter mir«, begann Kersting.
»Welcher Kritiker hat dich denn diesmal aufs Korn genommen? Nicht so ernst nehmen. Kritiker sind die skrupellosesten aller Menschen, und die bestechlichsten und faulsten aller Menschen: eine ganz und gar niederträchtige Sorte …«
»Ach, du weißt ja noch gar nicht – « Kersting hatte ihm tatsächlich bisher noch nicht von dem gestrigen Überfall vor seinem Haus berichtet und holte das jetzt nach.
»Du glaubst, das hängt alles mit dem Fall Roeder zusammen?«
»Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein. Auch wenn es mir immer noch schwerfällt, unsere beschauliche Stadt als Schauplatz von Mord und Totschlag zu akzeptieren.«
»Beschaulich? War Tübingen wahrscheinlich nie. Dafür hat die Universität schon gesorgt. Die Professoren sind die verlogensten Kreaturen, verlogener und korrupter als die Politiker. Egozentrisch, niederträchtig und korrupt. Wenn ihnen Geld oder Ruhm winkt, sind sie zu jeder Schandtat bereit. In Deutschland waren sie immer zuerst Staatsdiener oder Parteidiener oder beides zusammen und dann lange nichts, irgendwann mal Wissenschaftler, aber ganz zum Schluss. Verdorbene Charaktere, die ohne Verdorbenheit gar nicht auf einen Lehrstuhl gekommen wären, und wenn sie ihn haben, dann wachsen sie dran fest, wie geklebt, und verderben alles, was sich ihrer Verdorbenheit widersetzt.«
»Boris, du klingst wie Thomas Bernhard, wenn er auf die Künstler schimpft. Was für eine Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«
»Nicht eine Laus, sondern zwei Läuse, ich meine Professoren, die auf den Köpfen der Dichter sitzen und saugen und schaben bis sie das schönste Werk ruiniert haben. Sie ruinieren die Kunst, wo sie sie antreffen. Diesmal im Hölderlinturm. Ich sollte das moderieren. Aber moderiere du mal gespreizte Eitelkeit und hochtrabende Dummheit!«
Kersting lachte über den Furor des Freundes, dessen gerötete Wangen zeigten, dass auch einige Gläser Bier sein Temperament angestachelt hatten. Nach kurzem Zögern stimmte er aber in Kerstings Heiterkeit ein.
»Manchmal muss man übertreiben, um der Wirklichkeit wenigstens nahe zu kommen. Mich wundert in Unisachen gar nichts mehr. Ein Studentenvertreter hat mir aus der Sitzung berichtet, in der die Philosophische Fakultät zu der unsinnigen Bologna-Reform Stellung nehmen wollte. Du weißt: Umstellung auf Bachelor- und Master-Studiengänge. Der Ruin unserer Universitäten. Haben die nach so vielen Jahren nun auch gemerkt! Waren natürlich alle ›eigentlich‹ dagegen, aber öffentlich zu protestieren hat sich keiner getraut. Handlanger des Staates, dem sie ein Leben lang dienen und dabei so tun, als gehe er sie nichts an, aber sie lecken ihm die Pranken, wo es nur geht, und wenn es drauf ankommt, machen sie den täglichen Kotau noch ein bisschen tiefer.«
»Du bist vielleicht geladen heute!«
»Wir sind in Tübingen! Wenn du, wie ich, jeden zweiten Tag mit diesen Leuten zu tun hättest, würdest du auch nicht anders reden. Der Roeder-Fall bestätigt doch alles, was ich sage. Erst vergiften sie die Köpfe ihrer Studenten, dann bringen sie sie noch um, Existenzverhinderer allesamt und mit der Polizei im besten Ruhe-und-Ordnung-Einvernehmen. Oder hast du etwas anderes als ›weiß nicht, weiß nicht‹ gehört? Keiner will etwas wissen! Und wenn dann einer die Ruhe stört wie du, muss man ihn eben zur Ordnung rufen. Wenn nötig mit Gewalt.«
Jetzt kamen Kersting die Reden seines Freundes arg überhitzt und gallig vor, dem frustrierenden Tagesgeschäft eines Journalisten entsprungen, der sich endlich mal Luft machen konnte. Er sollte bald schon etwas anders darüber denken.
Der schöne Septembertag, der sich am nächsten Morgen anmeldete, würde sicher ideales Licht für seine Arbeit bringen. Als Kersting zum Fenster hinausblickte, sah er einen fast provenceblauen Himmel, über den einige weißgelockte Wolken strichen. ›Und der Himmel, so weit, so weit.‹ Doch ihm fehlte die Ruhe, die tote Verena ließ ihn nicht los. Er kannte den Kulturredakteur des ›Schwäbischen Tagblatts‹, der über seine Ausstellungen geschrieben und mit ihm vor einigen Wochen ein ›Interview im Atelier‹ gemacht hatte. Er musste einen plausiblen Grund finden, um an den Namen der Freundin, vielleicht sogar an ihre Adresse zu kommen; die neuen Datenschutzregeln erschwerten solche Recherche.
Er habe (könnte er sagen) von ihr einige Skizzen gemacht, einmal habe sie ihm sogar einen ganzen Nachmittag gesessen, die Porträtzeichnung, die daraus entstand, solle nun in eine Ausstellung in … (besser nicht zu nah), in … Bonn gehen, er brauche ihr Einverständnis, habe aber die Adresse verlegt … Ja, so müsste es gehen.
Er hatte Glück und erreichte Uwe Sprenger in der Redaktion.
»Aber wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ich Ihnen da helfen könnte?«
»An jenem langen Nachmittag, als ich eine ganze Reihe von Skizzen von ihr machte, haben wir auch über den Tod ihrer Freundin Verena gesprochen; sie erwähnte, dass sie vom ›Tagblatt‹ interviewt worden war.«
»Ich erinnere mich. Wir haben in der Konferenz damals darüber debattiert, ob wir das Gespräch wirklich machen sollten. Ich war dafür nicht zuständig, der Kollege Kurz ist unser Uni-Mann. Ich frage ihn und rufe zurück.«
Ausgerechnet! Hermann Kurz kannte er flüchtig, er war ihm einige Male begegnet. Ein kleingewachsener Giftzwerg und unangenehmer Zeitgenosse, der seinen Ehrgeiz dareinsetzte, andere »zu packen«, wie er sich ausdrückte. Was nichts anderes hieß, als sie durch Fangfragen, scheinbare Freundlichkeit und geheucheltes Verständnis reinzulegen. Dass er mit der gewünschten Information herausrückte, bezweifelte Kersting. Zumal, wenn er vom Fragesteller erfuhr: die Antipathie war gegenseitig.
Das Telefon schepperte (es stand noch auf der leeren Obstschale, wohin er es gedankenlos abgelegt hatte). »Der Kollege ist unterwegs, aber unsere Sekretärin hat schnell in die Mails gesehen. Jana Olivier wohnt hier, in der Nauklerstraße, irgendeine Nummer offenbar in den 40ern, jedenfalls stand hinter der 4 ein Fragezeichen.«





























