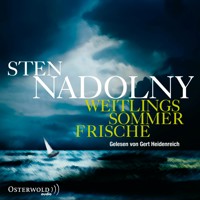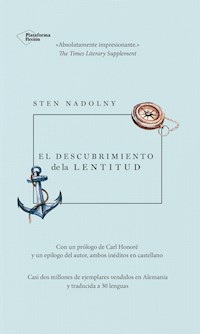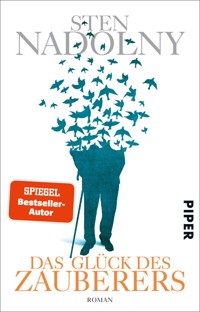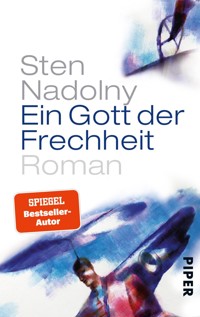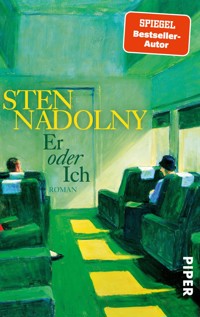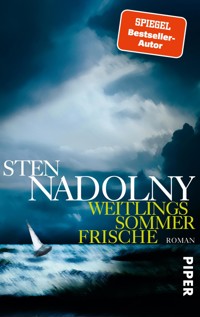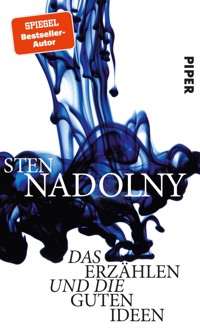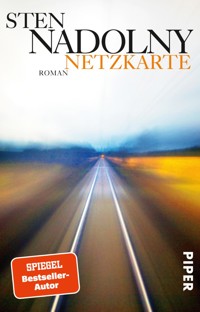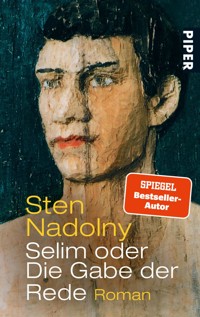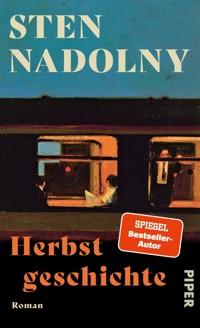
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Freunde – Lebenswege, Trauma, tiefe Verbundenheit Über die Kraft der Kunst und der lebenslangen Freundschaft Der Schauspieler Bruno und sein Freund Michael, Schriftsteller, lernen auf einer Bahnreise die junge Marietta kennen. Die Kunststudentin ist merkwürdig unruhig und scheint vor etwas auf der Flucht zu sein. Spontan nehmen sich Bruno und Michael ihrer an und begleiten sie bis nach Venedig, wo sie nach wenigen Tagen einfach verschwindet. Erst Jahre später begegnet Michael ihr auf einer Lesung wieder. Diese Begegnung ist der Beginn einer Fürsorge für eine traumatisierte Frau, deren Geschichte auch die Lebenswege von Michael und Bruno verändert. Sten Nadolny hat einen klugen, hintersinnigen Roman über lange Freundschaften, tiefe Versehrungen und die Kraft des Erzählens geschrieben. »Sten Nadolny ist ein Erzähler unvergesslicher Geschichten.« FAZ Sten Nadolnys Longseller »Die Entdeckung der Langsamkeit« ist ein moderner Klassiker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: Ben McLaughlin. All Rights Reserved 2025 / Bridgeman Images
Coverabbildung: Cornelia Niere, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Disclaimer
Prolog des erfundenen Autors
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Epilog des nicht erfundenen Autors
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Disclaimer
»Mut ist wie eine Pflanze. Er gedeiht nicht im Vorratskeller. Wir müssen ihn ans Licht bringen, ihn überhaupt wahrnehmen und gut behandeln, bei uns selbst und bei anderen.«
Prolog des erfundenen Autors
Prolog des erfundenen Autors
Mein Name ist Titus. Ich habe bisher vor allem Drehbücher geschrieben und erst jetzt, mit gut achtzig Jahren, einen Roman – hier ist er. Seine Kapitel sind hauptsächlich 2024 entstanden, und in einer anderen Reihenfolge als der hier präsentierten. Alles, was 2025 geschah und weiter geschehen wird, konnte sich in ihm allenfalls ankündigen.
Ich erzähle die Geschichte von Bruno und Michael, und zwar ab deren gemeinsamer Reise im Jahre 1998, auf der sie eine junge Frau namens Marietta kennenlernten.
Die beiden waren als Jugendliche auf derselben Schule wie ich, sogar in derselben Klasse. Sie haben Marietta erlebt, ich selbst bin ihr nie begegnet. Das meiste über diese Frau weiß ich aus den Mitteilungen und Aufzeichnungen Michaels. Aber dieser, obwohl er Schriftsteller ist und mehrere Bücher veröffentlicht hat, wollte die Geschichte nicht schreiben. Er meinte, sie brauche einen Autor, der nicht selbst Teil der Handlung und wie er, Michael, auch Teil des Problems sei. Er sah in diesem Stoff überhaupt eher einen Film als einen Roman, und daher hat er mich zu interessieren versucht. Aber aus Gründen, die ich an dieser Stelle nicht ausbreiten möchte, wird es jetzt doch »nur« ein Buch.
Als Freund der männlichen Hauptfiguren werde ich, Titus, in diesem Buch hin und wieder selbst vorkommen. Mit Bruno Gnadl und Michael Waßmuß verbinden mich viele Erinnerungen. Eine aus der Schulzeit erzähle ich vorweg, weil sie zeigt, wie verschieden diese beiden Jungen waren:
In der letzten Klasse vor dem Abitur mussten wir auf einem sogenannten »Konzentrationstag« Referate über Themen unserer Wahl halten. Michael las ein wohlformuliertes Manuskript über den englischen Philosophen George Berkeley vor, bebte dabei aber vor Aufregung, wir litten alle mit ihm mit. Bruno hingegen hatte sich auf sein Thema »Tennessee Williams und das amerikanische Theater« nicht im Geringsten vorbereitet. Er sprach zwar frei und unbefangen, wurde aber von seinen Einfällen in manches Dickicht gelockt, aus dem er nur unter Verlusten wieder herauskam – es war, obwohl selbstsicher vorgetragen, ein ziemlicher Wirrwarr. Bei der folgenden Diskussion wollte niemand etwas sagen, nur Michael meldete sich und sprach mit vor Aufregung hochrotem Kopf, das sei das Klügste und Beste, was er je über Tennessee Williams gehört habe (er hatte bisher noch nie etwas über ihn gehört), und insbesondere die philosophischen Aspekte des Stücks »Glasmenagerie« seien ihm wunderbar klar geworden. Alle staunten, einige grinsten, aber es war einfach beeindruckend, mit welcher Leidenschaft Michael das Referat schönredete und in diesem großen Haufen Unsinn eine überzeugende Architektur erkannte. Ich ging danach zu ihm hin und sagte ihm, die Verteidigung seines Freundes habe mir gefallen.
Michael war ein rätselhaftes Wesen. Er sah gut aus, was ihm etwas Schonung verschaffte, wenn er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte. Das geschah allerdings regelmäßig. Dass er zu Depressionen neigte, habe ich erst nach und nach begriffen: Mal war er in einer Stimmung, in der ihm alles gelang, dann wieder redete und handelte er ohne Zuversicht und scheiterte verlässlich. Er war ein angepasster und bemühter Schüler, der aber bei vielen Aufgaben den Wald vor lauter Bäumen nicht sah, das gilt auch für die Zeit nach dem Abitur. Es wurde etwas besser, als er mit dem Schreiben begann. Wir wohnten in München im selben Studentenheim, er las mir öfters etwas vor. So wie ich ihm, ich versuchte mich damals noch an Gedichten.
Bruno war anders. Er begriff schnell und sicher, aber er konnte als junger Mensch das, was er begriffen hatte, noch nicht gut ausdrücken. Seine Eltern, Bauersleute, hatten ihn für den geistlichen Beruf vorgesehen, aber er flog wegen Schwererziehbarkeit (genauer gesagt, wegen besorgniserregender Furchtlosigkeit) aus dem Priesterseminar. Niemand hat es je geschafft, diesem Rebellen und Provokateur Anpassung beizubringen. Ich erlebte ihn später einmal in einer ganz anderen Situation: Wir gerieten beide mit unseren Fahrzeugen auf der Autobahn in eine Karambolage. Er ging von einem Autowrack zum anderen, fragte, befreite, verstand sich auf Erste Hilfe, brachte in Sicherheit. Seitdem weiß ich eines: Wenn du Verletzten und Verstörten helfen musst, sprich laut, langsam und beruhigend. Und wenn du einen Dialekt kannst, dann sprich in diesem – Hochdeutsch hilft relativ wenig gegen Panik.
Dass Bruno und Michael Freunde waren, hat manche Beobachter gewundert. Mich nicht, denn sie waren beide, obgleich auf unterschiedliche Weise, Idioten im besten Sinn (was ich auch für mich selbst nicht ausschließe). Bevor ich versuche, das gleich hier zu erläutern, lasse ich lieber die Geschichte beginnen. Obwohl ich als ihr Autor auftrete, werde ich sie am Ende nicht allein geschrieben haben. Denn ohne die Aussagen, Aufzeichnungen und Briefe der handelnden Personen selbst wäre sie gar nicht erst zustande gekommen.
Ich widme das Buch Helen d’Arezzo, und das nicht nur, weil sie darin vorkommt.
Lido di Venezia, Februar 2025Titus
1. Kapitel
Die Reise nach Zürich
1998 ist jetzt über ein Vierteljahrhundert her. Ich erinnere mich an den zweigeteilten Geisteszustand, der damals in Deutschland herrschte. In dem Gebiet, das früher einmal DDR geheißen hatte, gab es viel Enttäuschung und Pessimismus, zumal der Prozess der deutschen Vereinigung, der von der westlichen Seite dominiert worden war, Wunden hinterlassen hatte. In den alten Bundesländern fühlte man sich dagegen eher im Aufbruch, viele hielten eine problemlose Zukunft für möglich – das Wort dafür war »machbar«. Der Sozialismus schien ein vergangener schwerer Traum zu sein, und in Russland, seinem langjährigen Zuhause, schlug das Pendel in die Gegenrichtung aus, dort zeigte sich – freilich nicht bei allen – ein ungehemmter Wille zur Bereicherung. Einige Schlauberger wurden schwerreich, der Staat aber ging bankrott.
Von der Digitalisierung erhoffte man sich weltweit die Beschleunigung aller Verbesserungen und den Schutz vor allen Verschlechterungen, womöglich sogar den endgültigen Weltfrieden durch Vernetzung und Kommunikation. An den hatte man übrigens schon beim Siegeszug des Radios geglaubt, gut drei Generationen früher.
Die wachsende Zahl von Computern und »Handys« – so hießen die Mobiltelefone in Deutschland – verbreitete aber schon viel Unsicherheit: Ältere und Störrische lehnten es ab, ihre Kommunikationsgewohnheiten zu ändern und sich der neuen Technik anzupassen, sie wollten oder konnten nicht einmal deren Bedienungsregeln lernen und liefen Gefahr, den Anschluss an die Entwicklung zu verpassen. Die Fortschrittsbegeisterten (es hat sie in jedem Jahrhundert gegeben) waren in der Überzahl. Die besondere Dramatik der Neunzigerjahre lag in der Beschleunigung der technischen Innovationen, der weltweiten Mobilität, des globalen Handels und gegen Ende des Jahrzehnts schon sehr deutlich in Veränderungen der Lebensweise, vor allem durch das Internet. Anderes beschäftigte die Gefühle weniger: dass die Ära des Kanzlers Kohl zu Ende ging (1998 war das entscheidende Wahljahr) oder dass die Autorität von Prominenten, darunter die von gewählten Staatsoberhäuptern, durch intime Enthüllungen stärker denn je beschädigt werden konnte (der US-Präsident Bill Clinton musste sich öffentlich über erotische Eskapaden befragen lassen). Dem Optimismus taten solche Dinge jedenfalls in den »alten« Bundesländern keinen Abbruch.
Was gab es sonst in diesem Jahr?
Es wurde beschlossen, den »Euro« als Währung für fast alle EU-Mitgliedsstaaten einzuführen. Auch das war der Beginn einer beträchtlichen Verunsicherung. Noch galten die alten Währungen, aber man hörte schon Unkenrufe. Die Unke, übrigens, war zum »Tier des Jahres« ernannt worden.
Eine auf die deutschsprachigen Länder beschränkte Erregung betraf die Rechtschreibreform: Eine Gruppe von hochgelehrten Vormunden des sprechenden und schreibenden Volkes war bei Politikern und Institutionen auf erstaunlich wenig Widerstand gestoßen. Die historisch hergebrachte Rechtschreibung, so lautete eine der Begründungen, sei für ausländische Mitbürger zu wenig nachvollziehbar. Menschen, die sich in der deutschen Sprache nebst deren Schreibung zu Hause fühlten, litten und protestierten vergebens. Inzwischen scheint das Thema für die Öffentlichkeit nur noch etwa so aufregend zu sein wie das Aussterben des afrikanischen Wildhundes.
Ein Thema kündigte sich damals an, das erst später heftige Emotionen ausgelöst hat: Missbrauch. Zur strafbaren Lustbefriedigung mit Abhängigen, vor allem Minderjährigen, hatte es bisher immer nur die Vorwürfe einzelner, inzwischen erwachsen gewordener Betroffener gegeben. Ihnen war wenig Gehör geschenkt worden. 1998 hing die kommende Lawine noch als unscheinbare Schneewechte am Bergkamm.
An einem Herbstnachmittag jenen Jahres stiegen die einstigen Schulfreunde Michael Waßmuß und Bruno Gnadl in Düsseldorf in einen Intercity, der den Namen »Ludwig Uhland« trug. Sie waren beide vierundfünfzig und hatten sich im Lauf der Jahrzehnte etwas aus den Augen verloren. Bruno hatte sich als Boxer versucht, war dann Schauspieler geworden und hatte in den Achtzigerjahren ein eigenes Theater eröffnet. Michael war nach einem Studium der Politologie durchs Examen gefallen und darauf in mehreren Jobs erfolglos geblieben, bis er mit einem Erzählungsband Anerkennung fand und sich als Schriftsteller bezeichnen konnte. Viele sahen in ihm damals einen »Meister der kleinen Form«. Er hat dann länger nichts geschrieben, aber im Frühjahr 1998 war ein neues Buch von ihm erschienen – mit zwanzig skurrilen Kurzgeschichten ohne jede politische oder erzieherische Nutzbarkeit, darauf war er stolz. Sein Verlag hatte ihn gedrängt, Romane zu schreiben, aber das lag ihm nicht.
Michael und Bruno waren sich am Abend zuvor in Düsseldorf auf der Geburtstagsfeier eines Unternehmers und Kunstmäzens wieder begegnet und jählings in eine Auseinandersetzung geraten, die sie beide schon bald bedauerten und beilegen wollten. Morgen wollte Bruno nach Zürich reisen, um sich tags darauf eine Inszenierung anzusehen, und Michael sollte dort zur gleichen Zeit eine Lesung halten. So entstand die Idee, denselben Zug zu nehmen und auf der Fahrt mehr über Gemeinsamkeiten zu sprechen als über Trennendes.
Michael war es gewesen, der die gemeinsame Reise vorgeschlagen hatte. Er war gleich frühmorgens zum Bahnhof gegangen und hatte zwei gegenüberliegende Sitzplätze nach Zürich gebucht – die Fahrkarten hatten sie schon. Er wäre gern in einem Abteil gereist, aber im »Ludwig Uhland« waren diese Plätze schon weg, er bekam noch zwei im Großraumwagen an einem Tisch. Immerhin klappte es mit dem Abteil für einen ICE mit Namen »Limmat«, der sie von Mannheim bis Zürich bringen sollte.
Michael liebte es, in einem Abteil zu reisen. Man konnte leichter mit anderen Reisenden ins Gespräch kommen oder sie jedenfalls besser beobachten. Das war freilich nur dann von Vorteil, wenn man allein unterwegs war. Heute hatten Bruno und er ja vor, ausgiebig miteinander zu reden, da konnten Dritte stören. Aber das war ihm zu spät eingefallen.
Der Zug verließ Düsseldorf, und sie saßen allein am Tisch, die beiden anderen Sitze waren ab Köln reserviert. Michael hätte gerne gleich ein Gespräch begonnen, aber Bruno blätterte in einem Manuskript und schrieb Notizen hinein. »Moment«, sagte er, »ich muss noch in dieses Stück schauen und dann in Mannheim jemanden anrufen. Da haben wir ja einen Aufenthalt.«
»Kannst gern mein Handy nehmen, wenn du so weit bist«, antwortete Michael.
Bruno blickte kurz auf: »Danke, aber ich mag die Dinger nicht so. Ich telefoniere lieber in der Zelle.«
Michael nickte, holte ein Buch heraus, las und strich mit gerunzelter Stirn Stellen an. Wenn der andere so Wichtiges zu erledigen hatte, wollte er nicht zögern, ebenfalls diesen Eindruck zu erwecken.
Er hatte Bruno am gestrigen Festabend nicht sofort wiedererkannt. Das war peinlich bei einem ehemals besten Freund, aber Michael war diese Peinlichkeit gewöhnt, denn er vergaß die meisten Gesichter. Der Name dieses Leidens ist Gesichtsblindheit. Bei seinen Entschuldigungen nannte er es »Prosopagnosie«, das klang interessanter und weniger nach Behinderung. Es war aber eine, und sie sorgte für viele unmögliche Situationen. Gestern hatte sie vermutlich sogar den ersten Funken zum Wortgefecht zwischen Bruno und ihm geliefert, der rasch nach weiterem Zunder griff und aufloderte. Worum es ging? Zunächst nur um so etwas wie Eitelkeit. Jeder der beiden fühlte sich vom ehemaligen Banknachbarn nicht in seiner Bedeutung wahrgenommen: Der Schriftsteller hatte dem Schauspieler seine beiden Bücher geschickt und keine Reaktion erhalten, dieser wiederum hatte ihn trotz wiederholter Einladungen nie bei einer seiner Premieren gesehen. Es war trotz aller Entschuldigungen unübersehbar, dass Michael sich nicht für Brunos Art von Theater begeistern konnte und Bruno nicht für Michaels Belletristik. Dann der Versuch eines Themenwechsels. Aber auch die Frage: »Wen wählst du denn nun in den Bundestag?«, hatte sich nicht als glücklich erwiesen.
Michael ließ sein Buch sinken und sah hinaus. Ein Stationsschild zog vorbei: »Düsseldorf-Benrath«.
»Da wohne ich«, sagte er zu Bruno, der kurz hinausblickte und »Aha« sagte.
Es begann heftig zu regnen. Die Tropfen am Fenster flossen wegen des Fahrtwinds in waagerechten Bahnen, merkwürdig ruckartig. Wenn sich zwei, drei oder mehr Tropfen vereinigten, hastete die angewachsene Wassermenge noch schneller über die Scheibe und überholte die Einzeltröpfchen. Die blieben zurück, bis sie sich ebenfalls für eine Fusion entschieden. Michael studierte den Effekt nicht zum ersten Mal, war aber wieder aufs Neue von ihm gebannt.
Nun sah er sich Bruno genauer an, der inzwischen in ein Manuskript blickte, ab und zu den Kopf schüttelte und etwas an den Rand kritzelte, dann wieder herzhaft gähnte. Vielleicht war es ja sogar seine Absicht, sich genauer betrachten zu lassen. Er schien Michael weniger gealtert zu sein als er selbst, war immer noch ein massives Kraftpaket, trainiert und muskulös. Angegraute Schläfen zwar, aber immer noch das volle Haar und die breite Stirn mit den Energiewülsten und Sorgenfalten. Die Nase war vom Boxen in den jungen Jahren ramponiert, aber nicht entstellt. Bruno trug ein knitterfreies blaues Leinenjackett und darunter ein grob kariertes, dickes Holzfällerhemd kanadischer Art, vielleicht befürchtete er einen Temperatursturz. Schwarze Jeans, Budapester Schuhe und am Arm eine schwere Uhr mit zwei Kronen, vermutlich mit einer Weckfunktion.
Jetzt schaute Bruno doch einmal hoch, ihre Augen trafen sich. Beide lächelten kurz. So kannte Michael ihn: Der Mund lächelte, die Augen nicht. Die blieben weit geöffnet – Bruno hatte diesen wachsamen Lino-Ventura-Blick, man hatte den Eindruck, dass ihm nichts entgehen konnte.
Endlich steckte Bruno seine Lektüre weg. »Du nennst dich jetzt Mike – auch privat?«, fragte er.
»Ja, klingt doch besser: Mike Waßmuß.«
»Für mich ungewohnt, aber sprechen lässt es sich.«
»Übrigens«, sagte Michael, »wegen gestern! Es ist keineswegs so, dass mir nicht imponiert, was du geschafft hast: ein unabhängiges, erfolgreiches Theater zu gründen. Ich habe überhaupt Respekt vor Gründern. Und den Namen finde ich gut: ›Iffland-Theater‹. Ich wollte ja immer mal kommen.«
»Für welche Gründer schwärmst du denn noch?«
»Im weitesten Sinne. Vorurteilslos, einfach Gründer, Firmengründer! Max Grundig, Bill Gates …«
»Hab Erbarmen, ich bin Marxist.«
»Ach, doch noch?«
»Allerdings! Und was gründest du selber so?«
Michael lachte: »Gar nichts. Ich bin höchstens Frauengründer. Ich habe drei Frauen durch den zweiten Bildungsweg gelotst bis zum Abitur.«
»Und ich nehme an, die letzte davon ist dir geblieben. Hat noch nicht die Flucht ergriffen.«
»Stimmt, irgendetwas muss sie davon abgehalten haben.«
»Habt ihr Kinder?«
»Einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn hat dieses Jahr Abitur gemacht. Sofort danach ist er in einen Baum geklettert und hat seine lateinische Schulgrammatik ganz oben an den Stamm genagelt. Ansonsten schreibt er Gedichte und hat nicht die leiseste Ahnung, was er mit seinem Leben anfangen soll.«
»Und das Buch hängt noch dort?«
»Natürlich! Niemand klettert mit einer Beißzange auf einen Baum, nur um eine Grammatik zu retten.«
»Dein Sohn scheint mir intelligent zu sein, den würde ich gern mal kennenlernen.«
Michael fiel ein Satz seines Freundes aus der Zeit des Abiturs ein: »Es gibt nicht eine, sondern viele Arten von Intelligenz.« Zweifellos richtig. Es gab die kognitive, die emotionale, die schöpferische – ach, unendlich viele, im Grunde hatte jeder Mensch eine andere. Bruno hatte seine und er eine durchaus andere, und vermutlich war jede Art der anderen in irgendeiner Situation überlegen.
Bruno hatte im Unterricht auch behauptet, es gebe einen Gegensatz zwischen »trockener« und »glitschiger« Intelligenz. Mutwilliger Blödsinn natürlich, aber so ein Satz hakt sich fest. Der Zuhörer fragt sich, welche Intelligenz wohl die seine wäre, sollte an der Unterscheidung etwas dran sein, und beginnt, sie zu deuten. Michael meinte, in der glitschigen eine Intelligenz der Anpassung zu erkennen und in der trockenen den Sinn für (vernünftigen) Widerstand.
Der Zug wurde langsamer. Köln Hauptbahnhof. Michael schaute aus dem Fenster und staunte über die Menge der Wartenden. Das Zugunglück von Eschede war erst wenige Monate her, aber das Vertrauen in die Eisenbahn schien wiederhergestellt. Michael, der Zugreisen liebte, hatte es nie verloren.
»Jetzt schau dir das an!«, sagte Bruno. »So viele Menschen aus Afrika und sonst woher. Fühlst du dich noch wohl, wenn so viele Leute nicht von hier sind und gar nicht verstehen, was du sagst?«
»Ich habe kein Problem damit«, antwortete Michael. »Deutschland wird eben welthaltiger. Irgendwann können die ja Deutsch, und im Übrigen könnten wir ja auch einige ihrer Sprachen lernen. Nur Bairisch muss man schon von Haus aus können, da führt sonst kein Weg hin.«
An den Vierertisch kamen nun Zugestiegene, ein wortkarges altes Ehepaar. Die Frau packte eine Zeitung aus und löste Kreuzworträtsel, der Mann studierte einen kleinen Fahrplan, der »Ihr Zugbegleiter« hieß.
Der Regen ließ nach, Michael blickte in die Landschaft. Bruno konnte ihn in Ruhe ansehen.
»Mike« wollte der jetzt also genannt werden. Aber er würde ihn weiter Michael nennen, bis Protest kam. Immer noch blonde Haare, wenn auch spärlicher geworden, und selbst an den Schläfen war der alte Banknachbar noch nicht grau. Trug eine schimmernde Lederjacke über dem Wohlstandsbäuchlein und eine Brille mit fast runden Gläsern. Optisch war er eine etwas korpulentere Nachbildung von Bert Brecht. Ob er diese Jacke auch am morgigen Tag bei seiner Lesung anhaben würde? Bruno kannte diese Sorte Lederjacken, sie wurden viel von Leuten getragen, die an sich selbst zweifelten.
Er dachte an den gestrigen Wortwechsel über die Bundestagswahl. Da hatte man nun die Chance, endlich eine andere Regierung zu bekommen, und Michael mäkelte am Kanzlerkandidaten herum, und an dessen Partei sowieso. Was lag schon an den einzelnen Figuren? Aber er hatte den Eindruck, als vertrete Michael nur deshalb seine Meinung mit solcher Bestimmtheit, um zu beweisen, dass er überhaupt zu festen Standpunkten fähig war. Schulfreunde haben dafür einen Blick, sie wissen noch, wie unsicher einer als Halbwüchsiger war, und sie erkennen mühelos, dass er es hinter seiner Lederjacke und seinen Büchern immer noch ist. Bruno las und kannte viele Schriftsteller, einige liebte er. Aber die schrieben anders als Michael.
»Dass ich’s nicht vergesse«, sagte Michael, »das ist meine neue Adresse.« Er reichte seine Visitenkarte herüber.
»Schlossufer, klingt teuer. Direkt am Rhein, wie ich annehme.«
»Ja, ich sehe den ganzen Tag Schiffe. Und wie ist jetzt deine Adresse?«
»Ich schreib sie dir gleich auf, Moment noch.«
Plötzlich hielt der Zug nach starkem Bremsen auf freier Strecke, am Tisch versuchte man Bücher und Zeitschriften festzuhalten, irgendwo rollten Flaschen, dann war es still. Die Zugchefin eilte durch die Wagen und rief: »Alles in Ordnung, die Bremsen funktionieren!« Man hörte den Wind da draußen, sah, wie er mit den Schlingpflanzen an der Böschung spielte, hatte Zeit, das Alter einer rostigen Badewanne zu taxieren, die im Gestrüpp gerade noch zu erkennen war. Und man sah auf die Uhr: Die Umsteigezeit in Mannheim war reichlich, aber was, wenn der Zug hier Herbstferien machte?
Es folgte eine Durchsage: »Verehrte Fahrgäste, wir haben aus ungeklärter Ursache ein Haltesignal. Wir bitten um Verständnis.«
Bruno zuckte die Achseln: »›Verständnis‹ kommt von Verstehen. Wie soll ich eine ›ungeklärte Ursache‹ verstehen?«
»Mir fällt ein«, sagte Michael, »dass wir zusammen eine Postkarte an Titus schicken könnten. Dass wir beide gerade in Zürich sind oder so.«
»Hast du Verbindung? Schreibt er an einem neuen Film?«
»Das tut er unentwegt, ein Drehbuch nach dem anderen. Ich sehe seinen Namen immer wieder auf dem Bildschirm.«
Bruno schüttelte den Kopf: »Und damals war er der Faulste in der Klasse.«
Der Zug stand. Nach fünf Minuten fragte Bruno: »Was ist eigentlich los mit diesem Ludwig Uhland? Werden wir da noch was hören?«
»Vermutlich ›Des Sängers Fluch‹.«
»Stimmt, das Gedicht musstest du doch in der vierten Klasse aufsagen und bist stecken geblieben!«
»Ich hatte so oft Lampenfieber. Da gab es dann so ein Schneegestöber im Kopf, alles Gelernte zerbröselte. Heute kenne ich die Ursache: Ich gehöre zu den Hochsensiblen.«
»Ist das eine Krankheit?«, fragte Bruno.
»Eine Besonderheit. Bei solchen Leuten verarbeitet das Gehirn alles, was kommt, mit zu großer Sorgfalt, also zu langsam. Deshalb sind wir schnell überfordert, wir verzagen und bleiben stecken.«
»Dein Gehirn arbeitet sorgfältig?«, kicherte Bruno. »Darauf wäre ich nie gekommen!«
Michael blieb ernst. »Ich habe letztes Jahr das Buch einer amerikanischen Psychologin darüber gelesen. Da war mir alles klar.«
»Hochsensibel – könnte ich das auch sein?«
»Auf keinen Fall! Du bist so mehr eine Kampfsau.«
»Deins scheint aber doch eine Art von Behinderung zu sein.«
»Eindeutig ja«, antwortete Michael, »aber ebenso eine Begabung, jedenfalls für so manches. Hochsensibilität und Intelligenz sind zwar nicht ganz dasselbe, aber treten gern zu zweit auf. Leider sind Hochsensible leicht zu irritieren, und sie sind anfällig für Angststörungen – je nachdem, was ihnen zugestoßen ist.«
»Ich finde, dass da jetzt so eine Mode um sich greift! Jeder spricht von seiner Sensibilität. Und vermisst sie natürlich bei anderen.«
Michael sagte dazu nichts.
Der Zug rollte ohne weitere Durchsage wieder an. Die Verspätung war erheblich, und ob Ludwig Uhland in Mannheim seinen Kollegen Limmat erreichen würde, fraglich.
Beide Männer lasen weiter, machten Notizen und schwiegen bis Mainz. Dann, ohne gleich aufzublicken, fing Bruno wieder an zu reden. »Ich habe dich aber auch manchmal bewundert.«
»Wirklich? Wofür?« Michael war misstrauisch geworden.
»Na ja, du bist ein guter Unterhalter und verstehst dich perfekt auf den Themenwechsel. Mit dir hat es kaum je Streit gegeben, außer halt gestern mal. Ich denke, eine deiner Stärken ist die Konversation, die nicht zu weit führt.«
Michael sagte nichts. Es regnete erneut. Er studierte wieder den Galopp der Tropfen auf der Fensterscheibe.
»Ich meine, sie führt zu keinem Verdruss«, fuhr Bruno fort, »das ist das Gute daran.«
»Und manchmal das Schlechte«, sagte Michael. Jetzt redete er wenigstens wieder, der Hochsensible.
»Frauen mögen gute Unterhalter«, sinnierte Bruno weiter. »In dem Punkt habe ich dich beneidet: Ich war ja oft in Mädchen verliebt, die zuallererst für dich geschwärmt haben. Du konntest mit ihnen aber nicht so viel anfangen, damals.«
»Ich weiß. Du schon.«
Mannheim, endlich. Sie hatten nur sechs Minuten, um zum anderen Zug zu kommen, aber sie erreichten ihn noch. Für Brunos Telefonzelle fehlte die Zeit, aber er sagte: »Das Stück interessiert mich sowieso nicht, da brauche ich nicht so eilig anzurufen.«
Im Abteil waren sie nicht allein: Vier von sechs Plätzen waren besetzt. Am Fenster war von ihren reservierten nur einer frei, auf dem anderen saß eine junge Frau mit kurzen schwarzen Haaren, die in einem Bildband blätterte.
»Entschuldigen Sie, aber die beiden Fensterplätze sind unsere!«
»Klar«, sagte sie, »ich hatte eigentlich den in der Mitte. Ich setze mich um!« Sie erhob sich ohne Eile, ließ Bruno vorbei zu seinem Fensterplatz und setzte sich dann auf den mittleren. Dann vertiefte sie sich weiter in ihr Bilderbuch. Als Michael saß, konnte er sie betrachten. Stockhübsch, dachte er – das war sein Ausdruck für Frauen, die er schön fand. Aber da war noch etwas anderes. Diese Art Gesicht meinte er von einem alten Porträt her zu kennen und suchte im Gedächtnis vergeblich nach dem Maler. Einer der Cranachs vielleicht, aber hatten die jemals eine dunkelhaarige Frau gemalt? Hoffentlich schaute sie jetzt nicht auf und begegnete seinem forschenden Blick.
Bruno fragte herüber: »Jetzt sag mir mal eins: Warum hast du die Plätze eigentlich im Abteil gebucht?«
Michael wandte den Blick nicht von dem jungen Gesicht, das aus einer ganz anderen Zeit zu kommen schien. »Darum!«, antwortete er heiser.
»Wie bitte? Du solltest mal ein Sprechtraining machen. Manchmal bist du kaum zu hören. Wer etwas sagen will, braucht Stimme!«
»Und du wirst schwerhörig«, sagte Michael.
Beide Männer spähten nun aus, ob die Schöne sich über den Wortwechsel amüsierte. Sie blickte auf, schaute Michael in die Augen und lächelte kaum merklich.
Der Zug Limmat fuhr langsamer und glitt durch den Bahnhof Waghäusel, wo an einem anderen Gleis viele junge Leute auf einen Nahverkehrszug warteten, deutlich voller Vorfreude auf großstädtische Vergnügungen.
Was las die junge Frau? Michael konnte es leicht erkennen: Ein Buch über Teppiche, mit vielen Farbtafeln. Jetzt blickte sie auf. Wenn sie etwas ins Auge gefasst hatte, schloss sie jedes Mal die Lider, bevor sie sich einem anderen Detail zuwandte. Und da sie offenkundig großen Appetit auf Details hatte, klappten ihre Wimpern ständig auf und nieder. Michael fühlte sich an die Kamera eines Zeitungsreporters erinnert. Wer war sie? Wohin wollte sie? Auffällig zurechtgemacht war sie nicht – kein Schmuck, kein Make-up. Sie trug eine grobmaschige Strickjacke, fast netzartig, durch die das Weiß ihres Hemds schimmerte. Ihm fiel der Satz von Billy Wilder ein, Audrey Hepburn werde es noch fertigbringen, dass der Busen aus der Mode käme.
Michael war über seine Neugier selbst belustigt, sie erinnerte ihn an Denkrichtungen weit jüngerer Jahre. Aber er stand dennoch auf, ging raus und prüfte im Display an der Tür die Reservierungen. Ja, sie fuhr ebenfalls bis Zürich. Dann lohnte es also, ein Gespräch zu beginnen. Nach einer Fortsetzung des Dialogs mit Bruno war ihm jetzt nicht zumute, jedenfalls nicht hier im Abteil. Er setzte sich wieder und sah zu der Lesenden hinüber. Sie hatte inzwischen eine andere Teppichtafel aufgeschlagen.
»Sie studieren Teppiche?«
»Ja. Ich mag Teppiche.«
»Das ist ein prachtvolles Stück da.«
»Es ist einer der beiden Ardabil-Teppiche aus dem 16. Jahrhundert.«
»Hat etwas von einem Schlossgarten mit vielen Blumen.«
»Ich glaube, man kann ihn mit nichts vergleichen.«
»Sehr teuer, wie ich annehme.«
»Er hängt im Victoria & Albert Museum in London. Wenn er versteigert würde, wäre er wahrscheinlich der teuerste der Welt.«
Karlsruhe. Hier wurden drei von sechs Plätzen frei. Und die junge Dame sprang auf und lief einem der Reisenden hinterher: Seine Zeitschrift war liegen geblieben, vielleicht, weil er sie gar nicht hatte mitnehmen wollen. Er sah in ihr Gesicht, nahm das Heft, dankte und schien hocherfreut. Sie kehrte zurück und wandte sich Michael zu:
»Eine Frage: Wie hat es Ihnen damals in der Werft gefallen?«
»Wie bitte? In welcher Werft?«
»In Flensburg. Da habe ich Sie mal gesehen. Sie kamen aus dem Tor, als wir gerade mit unserem Lehrer reingingen.«
Michael war sprachlos. Vor vierzehn Jahren hatte er dort wirklich für eine Geschichte recherchiert. Keinerlei Erinnerung an eine Schulklasse! Damals sah ich noch ziemlich gut aus, dachte er, das ist dem Mädchen wohl aufgefallen.
»Sind Sie denn aus Flensburg?«, fragte er.
»Ja. Ich wohne aber jetzt in Düsseldorf.«
»Wo Sie Teppiche studieren.«
»Ich studiere Kunst.«
Bruno ließ sich hören: »Sie haben offenbar ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Haben Sie mich auch schon mal gesehen?«
»Ja, als Herzog Alba im ›Don Carlos‹, da durfte ich zum ersten Mal ins Theater. Ihren Namen habe ich aber vergessen, ich vergesse immer die Namen.«
»Bruno Gnadl«, antwortete er gut gelaunt. »In Hamburg war das. Hat es Ihnen denn gefallen?«
Sie lachte verschmitzt. »Sehr. Sie waren so wunderbar unsympathisch!« Zum ersten Mal zeigte sie ihre hübschen Zähne.
»Arrogant und eiskalt! Frieren muss es einen, wenn der Alba redet.«
Sie notierte sich etwas, vielleicht war es der letzte Satz. An dem aber doch gar nicht viel dran war. Michael runzelte die Stirn.
»Mein Name ist Waßmuß, Mike Waßmuß.« Er wollte das Gespräch zurückhaben. Dass sie Brunos Bedeutung kannte, nicht aber seine, ließ ihn unruhig werden.
»Klar, Entschuldigung, Herr Waßmuß! Ich wollte Sie ja gerade etwas fragen: Haben Sie in der Werft Stoff für eine Ihrer Geschichten gefunden?«
»Ja, für die ›Tiefseeyacht‹!«
»Ach, die kenne ich, die ist schön verrückt. Ich habe viel gelacht.«
Ein Glücksgefühl durchrann den Meister der kleinen Form. Sie kannte ihn! Er fasste den Entschluss, der jungen Dame vor dem Aussteigen seinen neuesten Geschichtenband in die Hand zu drücken. Mit Widmung, wenn sie darauf bestand. Hoffentlich tat sie das, denn spätestens dann würde er ihren Vornamen erfahren. Sein Kopf war schon dabei, einen geistreichen Satz für sie zu formulieren.
»Ich habe mal Ihren Lebenslauf gelesen«, sagte die Studentin. Michael registrierte bekümmert, dass sie dabei Bruno ansah. »Sie waren ja vorher mal Boxer.«
»Lange her«, antwortete Bruno, »als Amateur und ziemlich oft nur zweiter Sieger.«
»Mein Idol ist Muhammad Ali, der ist überhaupt der größte Mensch. Neben Jitzchak Rabin.«
Michael war sofort dabei, diese zwei zu vergleichen und einen bedeutenden Satz zu formen, aber Bruno kam ihm zuvor.
»Große Kämpfer! Ich schlage vor, Michael und ich gehen jetzt mal ein gescheites Bier trinken. Michael, was sagst du? Und würden Sie so lange unsere Fensterplätze frei halten?«
Michael runzelte etwas die Stirn, aber er wollte ja eine alte Freundschaft wiederbeleben, und so etwas gelang, wie jeder wusste, am besten im Speisewagen, der neuerdings aber »Bordrestaurant« hieß.
Sie saßen sich an einem Fenster gegenüber, vor dem eine seltsame, halbmondförmige Leuchte die Sicht nach draußen behinderte. Die Sonne sank, die Schatten wurden länger und die Konturen schärfer. Aus dem gescheiten Bier wurden zwei Gläser Riesling, und sie sprachen gar nicht über sich, sondern über die junge Frau. Michael sagte, sie sei ein Typ wie Holly Golightly, die bei Tiffany frühstückt, vor allem aber bildschön.
»›Schön‹?«, fragte Bruno. »Schön kann man viele nennen. Sie ist einzigartig. Aber dünn ist sie, man möchte ihr eine Schweinshaxe spendieren.«
Offenburg, 19:39 Uhr. Es stiegen nicht mehr so viele Leute ein. Um diese Zeit wollte wohl niemand mehr nach Freiburg oder Basel.
Plötzlich erschien die Studentin im Restaurant! Sie habe nach dem Zugtelefon gesucht, sagte sie, aber das sei defekt.
Bruno zog die Augenbrauen hoch: »Schön, Sie zu sehen, aber wer passt jetzt dort auf?«
»Da ist jemand ins Abteil gekommen, den ich kenne. Ich habe ihn gebeten, unsere Plätze frei zu halten.« Das mussten sie wohl hinnehmen, es blieben aber Bedenken, Brunos Brauen blieben oben.
»Ich kenne ihn aus Düsseldorf, von der Kripo«, sagte die junge Dame.
Was hatte sie mit der Polizei zu tun? War sie mal festgenommen worden? Oder hatte sie eine Anzeige erstattet? Die Männer verschoben diese Fragen, denn sie bat Mike um sein Handy, telefonierte erregt und schimpfte einen Bekannten aus, der irgendetwas in Zürich versäumt hatte. Danach wirkte sie sorgenvoll. Sie habe heute Nacht keine Bleibe, ein Gastgeber sei über ihr Kommen nicht informiert worden und daher jetzt gar nicht in der Stadt. Mike bot an, telefonisch für sie ein Hotel in Zürich zu buchen, aber sie wehrte ab: Für ein Hotel habe sie gar nicht das Geld. Sie werde bei Mathilde Wesendonck schlafen. Es sei ganz nah bei dem Museum, wo sie sich morgen Teppiche ansehen wolle.
Die junge Frau hatte sich, um das zu sagen, kurz am Tisch niedergelassen, essen wollte sie aber auf keinen Fall. Als ein Mann durch den Speisewagen ging, sprang sie auf: »Moment, das ist mein – ich kenne den! Mein liebster Lkw-Fahrer. Ich muss ihm was sagen!« Damit lief sie davon.