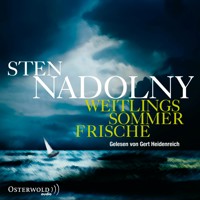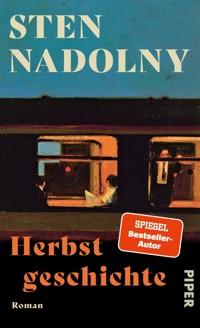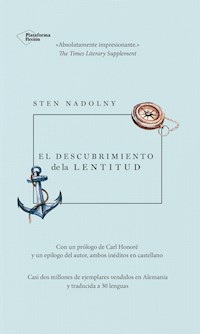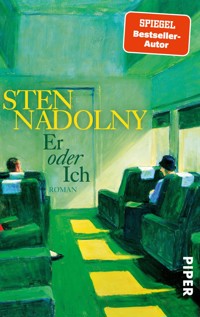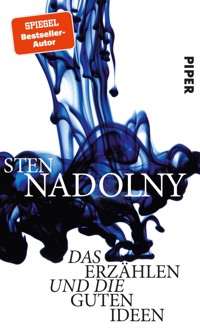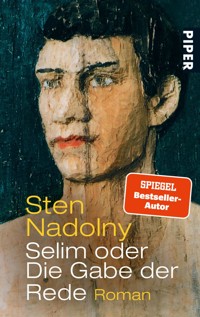9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die »Netzkarte« ist Sten Nadolnys früher, hinreißend leichthändiger Roman um den Taugenichts Ole Reuter, einen jungen Mann, der getrieben von romantischen Sehnsüchten mit der Bahn durch Deutschland reist. Erst als er eine Frau trifft, mit der sich eine mehr als flüchtige Verbindung ergibt, beginnt alles komplizierter zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95788-5 November 2016 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2005 Deutsche Erstausgabe: © Paul List Verlag GmbH & Co. KG, München 1981 Covergestaltung: rumbergdesign Covermotiv: plainpicture/Folio Images/Pontus Charleville Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Vorbemerkung
Ole Reuter, Sohn des 1976 verstorbenen Münchener Unternehmers Friedhelm Reuter, hat mir seine Reisenotizen aus den Jahren 1976 bis 1980 zur Bearbeitung anvertraut. Die Eisenbahn- und Schreibsucht, der wir bei Ole Reuter begegnen, verdient um so größere Beachtung, als es sich offensichtlich trotz aller Tiefpunkte nicht um eine Endstation, sondern eher um den Teil einer allmählichen Gesundung handelt. Die zurückgelegten 30000 Schienenkilometer waren also nicht umsonst. Dennoch kann ich nur davor warnen, es dem Helden der Geschichte nachzutun. Schon angesichts der ersten Eisenbahnfahrt von Nürnberg nach Fürth hat ein bayerisches Obermedizinalkollegium auf die Gefahr des Delirium furiosum hingewiesen. Bei so exzessivem Bahnfahren wie im vorliegenden Fall sind auch Spätfolgen nicht ganz auszuschließen. Halten wir uns immer vor Augen, daß Reuters Reisen aus einem Defekt entstanden sind, der glücklich beseitigt ist.
Der Genesene ist auf Umwegen schließlich doch noch Lehrer geworden und übt diesen Beruf bis auf weiteres in Übersee aus. Das Schreiben hat er dankenswerterweise zugunsten des Lesens aufgegeben, wodurch ich die Chance erhielt, seine Aufzeichnungen zu einem Buch zu vervollständigen.
Der Autor
Frühjahr 1976
1. Vom Bahnhof Zoo bis Sulz am Neckar
»Davor kann ich nur warnen!«
Das waren die Worte des Kollegen N., als ich ihm meinen Plan eröffnete, mit einer Netzkarte einen Monat lang kreuz und quer durch die Bundesrepublik zu fahren. Kollege N. hilft mir unaufgefordert mit so manchem Wink und Kniff. Er erkundigt sich stets nach meinen Fortschritten und sagte des öfteren, ich sei genau der Richtige für die Schule.
»Das bringt nichts«, sagte er jetzt. »Man muß schon wissen, was man will!« – »Und um das zu wissen«, entgegnete ich, »muß ich erst meine Möglichkeiten prüfen.« – »Jetzt, vor dem Examen?« – »Jawohl, jetzt!« Ich hätte, sagte ich, schon lange genug Referendar gespielt und könne von Lernzielen und Urlaubszielen und sonstigem Gezieltem und Geplantem nichts mehr hören. Ich hätte übrigens gar keine Lust, Lehrer zu werden. Ich hielte es für das beste, durch das Examen zu fallen und dann einen Beruf zu ergreifen, in dem ich weder mich noch andere krank machen müsse. Während meiner letzten Worte drehte Kollege N. sich vorsichtig um und sicherte nach allen Seiten. »Herr Reuter!« sagte er beschwörend und machte eine Pause. Dann faßte er mich mit jenem bohrenden Blick ins Auge, mit dem er auch Schüler festzuhalten pflegt, und versuchte leise, aber eindringlich, mich zu retten. Tiefes Verständnis sprach aus seinen Worten, für einen »gewissen Lebenshunger einerseits«, aber auch für meine »nicht auszuschließende Arbeitsscheu«, vor der ich mich lieber hüten solle. Als seine Augen sich zu Schlitzen verengten und sein Mund von einem pädagogischen Lächeln umspielt wurde – wie bei allen Lehrern, wenn sie merken, daß der Schüler sich ihnen zu entziehen beginnt –, versicherte ich ihm, er meine es gut, und wünschte ihm schöne Osterferien.
Da auch alle anderen Versuche, mich vor meinem Unheil zu bewahren, fehlgeschlagen sind, sitze ich jetzt im Zug Berlin-Hannover und studiere das Kursbuch. Helmstedt, Braunschweig, Hannover, Minden, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Hamm – wenn ich in diesem Zug bleibe, bin ich morgen früh um 7 h 46 in Aachen. Zwischen Dortmund und Wanne-Eickel müßte etwa die Sonne aufgehen. Meine Netzkarte gilt einen Monat lang für alle dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Züge der Deutschen Bundesbahn und auf allen Buslinien von Bahn und Post. Nur Ole Reuter, geboren am 10. 8. 1947, darf damit fahren. Gestempeltes Lichtbild, Unterschrift.
Griebnitzsee ist schon lange vorbei. Die Grenzer kamen durch den Zug und ließen mich die Brille abnehmen. Mein Paßbild stammt noch von vor zwölf Jahren. Draußen regnet es. Mir ist kalt. Womöglich werde ich krank und fahre morgen wieder zurück. Aber jetzt fällt mir Kollege N. wieder ein. Ich fahre natürlich nicht zurück! Müde bin ich. Wenn ich ein bestimmtes Reiseziel hätte, könnte ich mich auf das dortige Bett freuen. Ich beginne, in den Argumenten, die ich für diese Reise entwickelt habe, nach etwas zu suchen, was einem Bett ähnlich sieht.
Dem Kollegen K. habe ich erklärt, ich wolle von der Bundesbahn alles fotografieren, was demnächst stillgelegt würde, also vor allem kleine Bahnhöfe. Einem guten Freund sagte ich, ich wolle einfach vor mich hin träumen. Einer ehemaligen Freundin kündigte ich an, ich sei auf sexuelle Abenteuer aus. Meiner Mutter schrieb ich, ich suchte das Deutschland meiner Kindheit. Meinem Seminarleiter lief ich erst gar nicht über den Weg. Vater lebt nicht mehr. Ihm gegenüber hätte ich bestimmt versucht, der Sache einen politischen Zweck zu geben. Was hätte ich einer jetzigen Freundin gesagt, wenn es eine gäbe? Wahrscheinlich hätte ich ihr etwas über meine Vorliebe für kleine ländliche Kinos mit benachbartem Wirtshaus erzählt. Die Wahrheit ist, daß ich gern im Zug sitze und aus dem Fenster sehe, meine Phantasie in Gang kommen lasse und allerlei Pläne mache. Das einzige, was mich bisher daran gestört hat, war die Zumutung, irgendwo aussteigen zu müssen, weil die Fahrt zu Ende war. Aus diesem Grunde kaufte ich mir die Netzkarte. So etwas könnte ich sicherlich gerade einer Freundin nicht ohne weiteres begreiflich machen. Wie gut, daß ich keine habe – schon das Erklärenmüssen behindert eine Reise. Die Freiheit soll es sein und keine Fessel, kein Joch – niemals!
An der Abteilwand lese ich: »Eine saubere Eisenbahn geht uns alle an. Wir greifen zum Besen. Wir sagen es den Mitreisenden. Deutsche Reichsbahn.« Irgend etwas läuft mir kalt den Rücken herunter, ein Gemisch aus Geborgenheit und noch etwas anderem. Auch den Kollegen N. sehe ich wieder vor mir mit seinem Lächeln. Ich sehe zahllose Kollegen vor mir, wie sie in Ost und West ihrer schweren Aufgabe nachgehen. Kollegen und Aberkollegen grüßen mich, nicken, lächeln … Bin eingenickt. Marienborn. Grenzübergang. Regennasser Schotter, Nachtwind. Es nieselt im Schein der starken Lampen, ein Hund bellt. Wenn ich die Richtung meiner Phantasien über einen gewissen, durch Gewohnheit und realistische Einschätzung meiner Möglichkeiten gesetzten Punkt hinaus verlängere, dann ist ein Ziel meiner Reise eine sehr intensive, aber möglichst häufig das Objekt wechselnde Annäherung an das weibliche Geschlecht. Oder, eine Spur kürzer gesagt: ich sinne auf Eroberungen.
Zwei Uhr. Braunschweig ist durch. Vielleicht hätte ich dort schon in irgendeinen anderen Zug umsteigen können. Nein, nur zurück nach Berlin um 2 h 30. Oder nach langem Warten um 5 h 58 nach Jerxheim. Es taucht die Frage auf: was mache ich um 6 h 46 früh in Jerxheim? Aber das ist es gerade, was ich wissen will. Erst wenn man einmal ohne jedes Ziel um 6 h 46 in Jerxheim war, dann weiß man, was daraus werden kann. Vermutlich machen dort um sieben Uhr die Bäcker auf, ebenso in Watenstedt, Schöppenstedt, in Dettum, Wendessen und Mattierzoll. In Jerxheim stelle ich mir das Verzehren eines frischen Brötchens und eine ausführliche Unterhaltung mit der Bäckerstochter als sehr, sehr belebend vor. Ein einzelner Personenname regt die Phantasie nicht an. Hinter einem Namen vermutet man nichts Besonderes: vielleicht mittlere Reife, vielleicht schwarzhaarig, Führerschein, Insasse einer Haftanstalt oder Hausbesitzerin. Anders ist es, wenn man sich die Bäckerstochter in Jerxheim vorstellt. Oder die Müllerstochter in Watenstedt, die Kriminalassistentin in Schöppenstedt, die Lehrerinnen in Dettum oder Wendessen, von Mattlerzoll ganz zu schweigen. Ich lese gern im Kursbuch oder im Verzeichnis der Postleitzahlen. Im Telefonbuch hingegen bin ich nie über die ersten fünf Seiten hinausgekommen.
In Hannover weckte mich der Schaffner, nachdem mein Waggon schon mindestens zehn Minuten einsam auf dem Gleis gestanden hatte. Ich bin abgekoppelt. Dann also kein Frühstück in Aachen. Es ist kurz vor drei, und ich stehe mit zwei Reisetaschen und einer Netzkarte auf dem Bahnsteig im Wind. Ich schließe meine Sachen weg und gehe in die Stadt. Kalt ist es.
Fünf Uhr. Zwei Stunden schlich ich in Hannover herum. Erst schaute ich nach etwaigen Mädchen, dann aß ich nur »Berliner Leber« mit Zwiebeln und Apfelscheiben und studierte dabei zwei örtliche Zeitungen, die bis auf die Titelseite ganz gleich waren. Ich verglich sie, um dies festzustellen, durch Nebeneinanderlegen nach dem Motto: »Erkennen Sie die acht Unterschiede.« Der Ober war ärgerlich, weil er nicht wußte, wo er den Kaffee hinstellen sollte.
In Bahnhofsnähe fragte mich plötzlich ein Mädchen, ob ich Feuer hätte. Ich war so verblüfft, daß ich antwortete. »Nicht direkt, ich rauche nicht!« Ich könnte mich ohrfeigen. Nur ein paar andere Worte mit freundlichem Klang, und ich hätte vielleicht den Rest der Nacht im Warmen verbracht, dort wo es am wärmsten ist.
Jetzt sitze ich im Zug nach Göttingen, Abfahrt 5 h 25 Bis Kreiensen wird der Zug rappelvoll, lauter Arbeiter und Schüler – alle gut ausgeschlafen. In Kreiensen steigen alle aus, dann beginnt sich der Zug von Station zu Station wieder zu füllen für Göttingen.
Ab Northeim sitzt mir eine Schülerin mit ruhigen, schönen Augen gegenüber. Ich versuche gar nicht erst, sie anzulächeln, denn ich sehe wahrscheinlich kalkig und stoppelig aus, ein Schreck nicht nur für Kinder. Wo kann ich jetzt bloß drei Stunden schlafen? In diesem Zustand halte ich die Abenteuer, die ich mir vorgenommen habe, schon physisch nicht durch.
Seit Kreiensen geht es mir seltsam: die Stationsvorsteher sehen hier alle gleich aus. In Salzderhelden, in Northeim, in Nörten-Hardenberg – immer sehe ich einen neuen Doppelgänger des Beamten, der schon in Kreiensen die Kelle schwenkte. Erst ganz spät merke ich, daß es immer derselbe ist, der den Zug abfahren läßt. Er springt dann immer selbst schnell noch auf. Wahrscheinlich sah ihm deshalb auch der Schaffner, der meine Karte kontrollierte, so überaus ähnlich. Ich nehme mein Urteil über das Aussehen niedersächsischer Bahnbeamter zurück und behaupte das Gegenteil.
In Göttingen angekommen, schiebe ich mich durch das Schülergewimmel bis zur Bahnhofsgaststätte und frühstücke. Dort sitze ich aber schon wieder zwischen Schülern – es sind die, die zu spät kommen wollen, man merkt es irgendwie. Ist vielleicht die schöne Schülerin aus dem Zug darunter, schwänzt sie vielleicht meinetwegen, damit ich nun endlich das Wort an sie richte? Nein, sie schwänzt nicht, auch nicht mit mir.
Im großen Zug nach Aachen ließe sich's jetzt gut schlafen. Allerdings werden Nachtzüge stets irgendwann zu Frühzügen, erfüllt von morgenfrischen, emsigen Menschen, die mich unter dem Mantel hervorholen, um auf das himmlische Wetter oder das Autowrack oder den Eichelhäher aufmerksam zu machen. Es ist 8 h 10.
Seit einer halben Stunde wandere ich durchs morgendliche Göttingen. Ich erkenne meine alte Universitätsstadt wieder, aber meine Gedanken sind nicht bei ihr, sie sind vielmehr ausschließlich erotisch, vor allem in der Fußgängerzone. Ich überlege, was da zu tun ist. Ob ich einfach ein Mädchen anspreche: »Guten Tag. Haben Sie vielleicht Lust, mit mir zu schlafen?« Das habe ich bis jetzt erst einmal gefragt, mitten in einem Lesesaal in Tübingen – das Mädchen mußte bei der Antwort immerhin leise bleiben. Das war vielleicht der Grund dafür, daß tatsächlich etwas daraus wurde.
Ich pilgere ins Café »Cron & Lanz«, um dies alles aufzuschreiben. Ein paar Tische weiter mir gegenüber sitzt ein Mädchen mit hellen, etwas eng nebeneinanderstehenden Augen. Dadurch bekommt ihr Blick etwas außergewöhnlich Gezieltes. Sie sieht zu mir her. Ich gucke zurück. Wahrscheinlich ist mein Gucken eher ein Stieren oder Glotzen. Sie biegt den Blick von meinem weg und schreibt etwas. Ich nehme mein Heft und schreibe das auf. Als ich wieder hochblicke, sieht sie her, ziemlich lange sogar. Das Gesicht wird immer hübscher. Ich bin es diesmal, der wegschaut. Ich schreibe und versuche, mir ihren Busen vorzustellen. Sie sieht, daß ich schreibe. Je mehr ich das weiß, desto ausfahrender und theatralischer werden meine Schreibbewegungen. Ich schreibe nicht einfach, ich »schreibe etwas nieder«, wie Dichter es im Film tun, Omar Sharif im ›Doktor Schiwago‹ zum Beispiel. Sie schaut immer noch. Ich schreibe schnell weiter, meine Phantasie gleitet an ihren Beinen entlang – sie trägt in meiner Vorstellung rote Strümpfe. Das irritiert mich, denn woher weiß ich das? Trägt sie wirklich welche?
Als sie aufsteht und an mir vorbeigeht – was für ein schöner Gang! Ihre Augen stehen tatsächlich eng nebeneinander, wodurch sie etwas Religiöses, Madonnenhaftes bekommt. Ich überlege, ob ich Katholikinnen im Prinzip verlockender finde als Evangelisch-Lutherische. Sie trägt keine Strümpfe, aber Socken, und die – immerhin! – sind rot. »Zahlen, bitte!«
Seit »Cron & Lanz« sind fast zwanzig Stunden vergangen. Ich ging eine Weile hinter der Madonna her und überlegte, wie ich es anfangen könnte. Noch in der Weender Straße merkte sie es und guckte in die Schaufenster, um den Kurs und die Absichten des feindlichen Schiffes zu studieren. Dann kehrte sie plötzlich um und ging zurück bis zur Barfüßerstraße, schritt schneller aus, steuerte Kurs Ostnordost die Barfüßer- und Friedrichstraße entlang, hielt sich dann nordwärts Richtung Theater, sah sich zweimal prüfend um. Am Theater kreuzte sie zwischen den Schaukästen hin und her, offenbar in der Annahme, neutrales Gewässer erreicht zu haben. Ich ging aber ganz nah hin, sah sie an und sagte: »Sie gefallen mir sehr gut, ich möchte gerne mit Ihnen sprechen.«
Ich finde, daß es mir sehr gut gelungen ist, diese einfachen Worte zu setzen. Sie sagte ziemlich schnell, sie wisse nicht so recht, was sie damit anfangen solle, und sie habe ja auch einen Freund … Mir fiel darauf nichts ein. Ich stellte fest, daß ich im Grunde sehr müde war. Ich sagte: »Warum auch nicht.« Pause. Dann fragte ich: »Darf ich Sie aber ein Stück begleiten?« Ach, sie führe jetzt sowieso gleich mit dem Bus nach Hause, sie wohne draußen in Treuenhagen. Ich könne sie gern zur Haltestelle begleiten. Ich begleitete sie. Dabei fragte ich, ob wir uns nicht abends treffen könnten. Sie meinte, sie wolle das doch lieber nicht. Jetzt käme Ja auch schon der Bus. Tschüß, und viel Spaß noch.
Das ging mir, obwohl dieses Ende meiner Müdigkeit sehr entgegengekommen wäre, doch etwas zu schnell. Ich stieg daher mit in den Bus, sprach, ich müsse auch nach Treuenhagen, und wußte, daß ich jetzt die Grenze vom rücksichtsvollen, verständnisvollen Menschen zum lästigen Widerling überschritten hatte. In einem Bus ist es nahezu unmöglich, im Stehen jemanden zärtlich zu berühren und sich gleichzeitig bei jähen Bodenwellen und Straßenecken, die man nicht kennt, festzuhalten. Es endet oft damit, daß man sich gerade an der Person festhält, zu der man zärtlich sein wollte, sie gar umreißt und durcheinanderbringt, unverhofft schwängert und ähnliches. Da ich all das vielfach erfahren habe, unterließ ich jeden Versuch, der zu einem bösen Ende hätte führen können, und die Busfahrt verlief ereignislos.
Irgendwo stieg sie aus, und ich mit ihr. Jetzt richtete sie das Wort an mich und fragte: »Ich dachte, Sie wollten nach Treuenhagen?« Sie ging ein paar Schritte, ich folgte ihr und erklärte mich: ich wüßte gar nicht, wo das läge, es ginge mir nur um sie. Sie meinte, ich solle nur einmal sagen, wie ich mir das weiter vorstellte. Ich sagte, ich wolle mit ihr reden. Sie mutmaßte, ich wolle doch bestimmt nur mit ihr schlafen – oder? Ich gab zu, daß ich hin und wieder daran gedacht hätte. Sie antwortete mit einem noch schlimmeren Vorwurf: wenn im Café ein anderes Mädchen näher bei mir gesessen hätte, würde ich jetzt hinter diesem herlaufen und nicht hinter ihr. »Aber das stimmt ja gar nicht!« rief ich und wußte doch, daß es stimmte. Und da mir kein besserer Beweis einfiel, umarmte ich sie, zog sie in den Schatten vor dem Gittertürchen einer alten Villa, vor der wir gerade standen, und küßte sie. Sie nahm meinen Kuß durchaus neugierig und bereitwillig entgegen. Es war ein langer Kuß. Im Garten der Villa erschien ein Gärtner mit Eimer und Rechen. Wir küßten uns immer noch. Der Gärtner blieb stehen. Ein Hund erschien und näherte sich dem Gartentor. Wir küßten uns immer noch. Der Gärtner stellte lärmend den Eimer auf die Fliesen, schaute aber noch her. Der Hund begann mit dem Schwanz zu wedeln. Jetzt machte die Madonna die Augen wieder auf, blickte in den Garten, entzog sich mir blitzschnell, griff durchs Gitter und öffnete das Tor. »Hallo, Papa!« – »Na, mein Schatz?« fragte der vermeintliche Gärtner. Das Tor fiel ins Schloß. Der Hund blieb dahinter stehen und betrachtete mich mit geschärftem Interesse. »Tschüs«, flüsterte das Mädchen und winkte mir mit der Hand so, daß ihr Vater die Bewegung nicht sehen konnte. Dann ging sie zu ihm. Ich sagte nichts. Der Hund bekam einen zunehmend reservierten Gesichtsausdruck. Ich spazierte weiter, als hätte ich mich den ganzen Tag schon auf diese paar Schritte unter den alten Bäumen gefreut. Dann ging ich noch einmal zurück und suchte am Gartentor nach einem Namen. Ich fand keinen und beschloß, am frühen Abend wieder herzukommen. Das tat ich auch, aber ohne irgendeinen Erfolg. Die Villa war völlig dunkel, nicht einmal der Hund gab Laut. Abends fand ich mich in einem Pornofilm wieder, der mich fürs erste von erotischen Vorstellungen kurierte. Ich ging bereits nach der Hälfte. Im Hotel schlief ich zehn Stunden lang.
Heute morgen bekam ich eines jener berüchtigten Frühstücke für sechs Mark: zwei Brötchen, zwei Winzigkeiten mit den Bezeichnungen ›Konfitüre‹ und ›Markenbutter‹ und ein Kännchen mit einer Sorte Kaffee, die ich nie für möglich gehalten hätte. Durch das Danebenlegen einer Illustrierten vermochte ich die karge Mahlzeit ein wenig zu strecken. Die erste Zeile, die mir ins Auge fiel, lautete: Entdecken Sie die Liebe neu! »Abgemacht!« murmelte ich.
Jetzt sitze ich im Intercity »Mercator« nach Freiburg und Basel. Er führt nur die Erste Klasse, daher zahle ich einen Zuschlag bis Freiburg. Außer mir sitzen hier drei jüngere Geschäftsleute mit halbdunklen Anzügen. Jeder hat einen sehr flachen, sehr geraden Diplomatenkoffer bei sich. Einer liest eine französische Zeitung. Vater fuhr nie im Zug, immer nur mit Firmenwagen und einem Chauffeur, den er zur Eile antrieb. »Zeit«, sprach er, »ist das einzige, was wir nie wieder herausbekommen.«
Der Zug fährt an der Leine entlang und dann über Fulda weiter. Mit Kassel ist es also leider nichts. Dort wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen. Im Park des Schlosses Wilhelmstal in Kassels Nähe lag ich vor Jahren und las ›Geschichte und Klassenbewußtsein‹ von Georg Lukács. Ich wohnte in einem Gasthaus, das mir sehr gefiel. Das Haus roch dezent nach feuchten Wänden, die Tapeten deuteten, als ich in der Mitte eines Zimmers stand, eine leichte Verbeugung an. Ich aber las auch dort unbeirrt weiter, im Schein einer immer wieder einnickenden Nachttischlampe, halb versunken in die Bettengruft. Alles schien mir für ein Buch über Revolutionen ganz die richtige Umgebung. Heute ist mir, als ob der Park, das Gasthaus und vor allem dieses Zimmer sich für kühne erotische Experimente mehr geeignet hätten, vom Bett selbst vielleicht abgesehen.
Leider sitze ich nicht in Fahrtrichtung, aber immerhin am Fenster. Viele Einfamilienhäuser haben im Windfang neben der Eingangstür vier bis sieben bunte Glasziegel, unsinnig gruppiert wie verlorene Eier. Allerdings unterscheiden sich die Häuschen oft nur durch die Anordnung dieser Glasziegel. Ich fühle, wie mein Herz für die in diesen Häuschen gefangengehaltenen, tagaus-tagein staubwischenden und WC-reinigenden Hausfrauen zu schlagen beginnt, die Damen mit den engen Röcken und dem Teint, die gepflegte Hand am Staubsaugergriff. Sauberkeit stellt für mich eo ipso eine massive Herausforderung dar. Als ich mich einst während des Studiums als Vertreter für ein rotes Plastiklexikon mit Goldprägung versuchte, gab ich mir einmal die größte Mühe, einer Jungen Ehefrau im Bezirk Steglitz ihre ganz und gar unbegründete Scheu vor Vertretern zu nehmen. Es begann damit, daß ich über ihr Aussehen ein paar wohlüberlegte Worte sagte. Damit meinte ich vor allem ihren hübschen Hals, der den Blick auf die wunderbaren Schlüsselbeine und in einen zartrosa Ausschnitt lenkte. Bevor ich das aber präzise sagen konnte, bezweifelte sie schon die Aufrichtigkeit meines Kompliments. »Schließlich komme ich gerade aus dem Krankenhaus, ich bin an der Galle operiert worden. Stellen Sie sich vor: acht Steine!« – »Toll!« entfuhr es mir, während ich insgeheim rätselte, wieviel Steine man wohl normalerweise hätte. »Wollen Sie mal sehen?« – »Was, die Narbe?« fragte ich, »aber unbedingt!« – »Nein, die Steine. Warten Sie mal!« Sie holte ein Glasdöschen und zeigte mir acht entzückende Gallensteine – es waren die ersten, die ich je gesehen hatte, und ziemlich grün. Später zeigte sie mir dann auch noch das, was ich von Anfang an bei ihr vermutet hatte: das Lexikon. Sie besaß es bereits. Sie verabschiedete mich dann rasch und riet mir, nicht Vertreter zu bleiben. Ich dachte an die Gallensteine und versprach es.
Ich registriere, was draußen alles vorbeikommt: Wohnmaschine, Lagerplatz, Kabeltrommeln, ausgediente Waggons (jemandes Zuhause), eine alte Wassermühle, eine riesige Buche, Heuschober, Isolatoren. Die sexuellen Einfälle, die mit jeder der genannten Einzelheiten sich verknüpfen, lassen mich selber staunen. Signalmaste, Bahnsteige, Gepäckwagen, das Stationsschild »Bebra«, das Schild »Grenzkontrollstelle«. Wieso? Ich sehe in die Karte. Tatsächlich, ich bin hier nahe dran, Gerstungen liegt schon drüben. Ich bin wieder ein wenig verblüfft über die Schmalheit der Bundesrepublik, bin es aber gleichgültigen Herzens. Als Kind sah ich Vorkriegskarten, die prägten sich ein. Das Deutsche Reich war gebaut wie ein Wappenlöwe mit viel Brust und Schultern. Die Beschriftung zog sich im Halbkreis von Südwest nach Nordost. Vom Oberrhein bis Kassel lag »Deut«, die heutige DDR hieß »sches«, dann kamen »Re« und »ich«, durch einen Korridor getrennt. Als Kind hielt ich auf Besitz: das war alles »Mein Land«.
Bad Hersfeld. Beackerte Hügel schwingen sich hin bis zum Horizont.
Das Bahnfahren gibt viel Überblick. Jetzt, im Vorfrühling, erkennt man gut die nackte Form der Landschaft. Von der Straße aus muß man so vieles beobachten, was nur ihretwegen so aussieht – von den Verkehrsschildern ganz abgesehen. Der Bahn zeigen die Städte und Dörfer ihr altes und hübsches Gesicht, der Straße dagegen alles, was neu ist. Und die Reklame. Die Bahn gehört längst zur Landschaft und hat Gewohnheitsrecht. Sie fährt mitten durch die Obstanger alter Bauernhöfe, man sieht die Kinder mit dem Esel spielen, die Hühner scharren, die Katze schleichen. Man sieht die beiden Gänse auf dem Kühler des stillgelegten blindäugigen Mercedes Diesel unterm Birnbaum. Die Leute beachten die Bahn nicht, denn diese wird in keinem Fall ihretwegen anhalten. Sie ahnen nicht, daß ich trotz der hundert Stundenkilometer alles sehe. Sogar, daß es ein Diesel war.
»Burghaun.« Viele kleine Häuser am Berg. Oben ein Antennenmast. Oder ist es eine Fahnenstange? Hochspannungsleitungen. »Hünfeld.« Eine Likörfabrik und eine neue Kirche. Ich finde, Betonkreuze taugen nichts. Jetzt Gewächshäuser, Wege mit Zaunpfählen, die angenehm krumm stehen. Noch fünf Minuten bis Fulda. Wir fahren durch den Wald.
Es ist seltsam, jemanden zu betrachten, der aus einem fahrenden Zug in den Wald schaut. Das Auge nimmt nicht einfach alles auf, was vorüberfegt, sondern muß von Einzelheit zu Einzelheit springen. Die Augen meines Gegenübers sind nach draußen gerichtet und flackern unablässig. Das gibt seinem Blick etwas Aufgescheuchtes, Dramatisches. So ähnlich guckt eine Katze durchs Gartentor, wenn hintereinander fünf Feuerwehrwagen vorbeifahren. »Götzenhof.« Bahnarbeiter werkeln an der Böschung. Jetzt kommen Schrebergärten, ein Hang mit Hochhäusern, darunter Bungalows. Raiffeisen, Fabrikschlot. In einem Auto kann man Beschleunigung nicht genießen. Schaut man zum Seitenfenster hinaus, dann wird man unruhig – die sichere Schiene fehlt.
Gemüsegarten, Autofriedhof, Häuser, Häuser – Fulda! Noch ein Geschäftsmann, jetzt sind wir zu fünft. Auf dem Nebengleis steht ein Kurswagen »Kulmbach-Fulda«.
Die riesigen Gitterarme von Hochspannungsmasten haben einen ähnlichen Reiz wie große, alte Eisenbahnbrücken oder der Eiffelturm. Neuhof. Kabeltrommeln. Wieder ein Hügel mit Sendemast. Ein Güterzug versperrt für endlose Zeit die Sicht, danach – Frieden. Nein: »Flieden«. Eine Straße mit Birken nähert sich erst zaghaft, dann immer schneller, stürzt auf den Bahndamm zu, entledigt sich hastig der Birken und verschwindet unter mir in einer Unterführung. Jetzt ist mein Zug selbst in einem Tunnel. Warum riecht es plötzlich durchdringend nach Mottenpulver?
Hier irgendwo muß in Römerzeiten der Limes gestanden haben, ein Palisadenzaun. Hanau. Ein sonnendurchfluteter, kohlenverstaubter Ziegelbahnhof – oder war das gar nicht Hanau?
Die Reise beginnt jetzt richtig zu laufen, obwohl ich mich durch den Erster-Klasse-Zuschlag bis Freiburg festgelegt habe. Allein der Gedanke, auf irgendeinem Bahnhof schlagartig Freiburg aufzugeben und einen anderen Zug zu besteigen, um heute abend in Donauwörth, Xanten, Miltenberg, Mainz oder Passau zu sein! Schon das Ändern von Plänen ist schön, ich aber brauche gar nicht erst Pläne zu machen. Ich brauche überhaupt nicht nachzudenken, ich habe es nicht nötig. Augen und Ohren genügen. Ich kann mich dem Zufall anvertrauen und in unregelmäßigen Abständen je nach Lust den Zug verlassen, um einen anderen zu nehmen, der als nächster aus dem Bahnhof fährt. Wartezeiten nutze ich, um mich in den Städten und Dörfern umzusehen (und nicht nur das!). Ich werfe einen Blick ins Kursbuch. Mein Auge wandert über Hunderte von morgendlichen, nachmittäglichen und abendlichen Bahnstationen hin, erfüllt vom Ticktack hübscher Stöckelschuhe und dem freundlichen Stimmengewirr abreisender Studentinnen, umsteigender Arzthelferinnen, heimkehrender Kellnerinnen und verirrter Schauspielerinnen, eine zur Oma fahrende Jerxheimer Bäckerstochter nicht zu vergessen.
Ende der Leseprobe