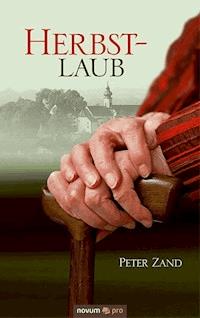Herbstlaub
Peter Zand
Erschienen im novum pro Verlag
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und -auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2010 novum publishing gmbh
ISBN Printausgabe: 978-3-99003-190-2
ISBN e-book: 978-3-99003-724-9
Lektorat: Mag. Dr. Margot Liwa
Gedruckt in der Europäischen Union auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem -Papier.
www.novumpro.com
AUSTRIA · GERMANY · HUNGARY · SPAIN · SWITZERLAND
Langsam hebt sich der Nebel über dem kleinen Ort in der Nähe der Alpen. Aus seinen mystisch anmutenden Schwaden tauchen langsam die Umrisse der Häuser, der Bäume und einiger Menschen auf, die sich scheinbar ziel – und planlos an diesem grauen feuchtkalten Morgen, den Blick nach unten gerichtet, dahin bewegen. Es ist der Beginn eines jener Tage, an denen sich die Sinnfrage des Lebens, die man sonst meist verdrängt, wieder behutsam ins Gedächtnis einschleicht und dieses unangenehme Gefühl der Ohnmacht auslöst. Der Ohnmacht, irgendwas verändern zu können, an der Natur, an der Gesellschaft, am eigenen Leben, das geprägt wird durch Existenzängste, Vorschriften, Hoffnung, Glauben und Zweifel.
Es ist der erste Adventsonntag. Eine alte Frau verlässt ihr Haus, tritt hinaus in diesen unfreundlichen Morgen, steht eine Zeit lang regungslos vor der Tür und ist scheinbar unschlüssig, welchen Weg sie nehmen solle. Der erste Adventsonntag, was war das früher für ein Freudentag. Früher, als ihr Mann noch lebte, als sich die Familie, ihr Mann, ihre Eltern und ihr Kind, ein Junge, um den Adventkranz versammelte, die erste Kerze wurde angezündet, das erste Weihnachtslied gesungen, ein kurzes Dankgebet gesprochen, dann wurde gemeinsam im Kerzenschein in der Vorfreude auf das Weihnachtsfest gefrühstückt.
Die alte Frau, die sich kurz an diese schöne Zeit erinnerte, hat inzwischen ihre Entscheidung gefällt, dreht sich langsam nach rechts und geht in langsamen, gemächlichen Schritten die Straße entlang. Sie meidet den Gehsteig, der recht glatt und rutschig zu sein scheint, während die Fahrbahn mit Salz gestreut, doch besseren Halt bietet. Die Lichtmasten sind weihnachtlich geschmückt, über die Straße wurden Drähte gespannt und mit Plastikzweigen und silbernen Sternen behängt, die um diese Tageszeit noch beleuchtet sind, aber eine Weihnachtsstimmung kann bei der alten Frau nicht aufkommen. Zu trostlos ist die Umgebung. Die Straße, in der einst reges Treiben herrschte, ist heute wie ausgestorben, leer stehende, verwahrloste Geschäfte säumen den Weg, die einst so gepflegten Grünanlagen wurden lange nicht mehr gemäht und sind verwildert. All das trägt zum derzeitigen schlechten seelischen Zustand der alten Frau bei.
Auf ihrem Weg kommt sie an einem größeren Gebäude mit verwitteter gelber Fassade und einem bequemen, breiten Stiegenaufgang zur Eingangstür vorbei. Das war früher das Postamt. Einst waren hier drei Angestellte beschäftigt, der Amtsleiter, eine Schalterbeamtin und der Briefträger. Vor allem die junge, hübsche Beamtin war wegen ihrer freundlichen Art sehr beliebt, und so mancher Bursch begann mit der Sammlung von Briefmarken, obwohl er bis dahin kein Interesse an diesen kleinen Kunstwerken gehabt hatte und sie auch weiterhin wenig beachtete. Aber er hatte dadurch einen Grund, das Postamt und somit auch das hübsche Mädchen öfter zu besuchen, um die neuen Marken abzuholen bzw. nachzufragen, wann denn die neue Serie kommen werde. Auch ältere Männer sollen erstaunlich oft die Dienste des Fräuleins, wie man es nannte, in Anspruch genommen haben, zum Beispiel um Telefongespräche anzumelden, denn dazumal hatte kaum jemand ein eigenes Telefon und auch die Post konnte nicht wie heute üblich den gewünschten Teilnehmer direkt anwählen, sondern musste über das sogenannte Fernamt der nächsten Stadt das Gespräch anfordern. Dort wurde dann über freie Leitungen versucht den gewünschten Teilnehmer zu erreichen und in weiterer Folge das Gespräch an den anfordernden Teilnehmer, in diesem Fall das Postamt im Ort, weitergeleitet. Dieser Vorgang konnte je nach Verfügbarkeit bzw. Überlastung des -Netzes oft sehr lange dauern, eine gute Gelegenheit, sich mit dem Fräulein zu unterhalten, oder ihr bei der Arbeit zuzusehen.
Die alte Frau erinnert sich gerne an das Postamt, für sie war es damals die Verbindung mit der großen Welt da draußen, denn die ganze Kommunikation, sei es schriftlich, sei es telefonisch oder per Telegramm, wurde über diese Einrichtung abgewickelt. Sie selber betrieb damals eine sogenannte Gemischtwarenhandlung, war also eine Greißlerin und bis zur Genehmigung und Installierung eines eigenen Telefonanschlusses ständig in diesem Hause aus- und eingegangen. Inzwischen ist das Postamt längst geschlossen, der Amtsleiter ist in Pension, das „Fräulein“ hat geheiratet, übrigens keinen „Markensammler“, und ist weggezogen, lediglich der Briefträger stellte die Post noch einige Zeit aus der nahen Stadt mit einem Moped zu, bis auch dieses Service eingestellt wurde.
Im selben Haus, dem sogenannten Posthaus, war auch der Polizeiposten untergebracht, allerdings an der Rückseite des Gebäudes. Es waren drei Polizisten, die dort ihren Dienst versahen, wobei zwei davon ständig anwesend sein mussten. Nun war das Aufgabengebiet der drei nicht allzu groß. Es betraf vorwiegend die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung im Dorf, wobei das Einschreiten und teilweise Mitwirken bei Wirtshausraufereien, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Kontrolle der Sperrstunde und deren etwaige Verlängerung aus sozial-humanitären Gründen (z. B. bei Ehekrach eines Bürgers, Freibier oder Glatteis) wohl die Hauptaufgaben waren. Fahrzeugkontrollen gab es damals mangels Autos und Radargeräten nicht. Gibt es auch heute nicht, mangels Polizisten, der Posten wurde aus Sparsamkeitsgründen längst stillgelegt.
Die alte Frau geht am Posthaus vorüber, zieht fröstelnd ihren Mantel enger zu und erreicht nach kurzer Zeit den Kirchplatz. Dieser, zugleich Hauptplatz des Ortes, war einst das Zent-rum des Handels, des Gewerbes und der Gastronomie. Allein in den umliegenden Häusern waren zwei Gasthäuser, zwei -Bäckereien, eine Fleischhauerei, eine Drogerie, die auch die wichtigsten Medikamente führte, und die „Greißlerei“ der alten Frau untergebracht. In der weiteren Umgebung waren noch einige Gewerbebetriebe wie eine Tischlerei, eine Huf- und Wagenschmiede, eine Schneiderei, ein Schuhmacher und noch einige kleine Trödlerläden angesiedelt. Rings um den Ort gab es einige Bauernhöfe, die sich selbst, den Ort und da-rüber hinaus auch angrenzende Regionen mit frischen Lebensmitteln versorgten. Alle Besitzer waren Vollerwerbsbauern. Heute gibt es noch einen davon, der recht und schlecht mit verschiedenen Preisstützungen, mit auferlegten Produktionslimits kämpfend, versucht seine Existenz aufrecht zu erhalten. Ein anderer betreibt seinen Hof noch als Nebenerwerb, während alle anderen aus unterschiedlichen Gründen den Betrieb einstellen mussten, sei es aus Kapitalmangel, sei es, weil sich die Erben diesen zeitaufwendigen Beruf nicht antun wollten.
Die Erinnerungen an diese vergangene Zeit erregen die alte Frau, die plötzlich das Verlangen verspürt, in der angrenzenden Kirche ihre Ruhe und den Frieden wiederzufinden. In der Regel ist diese jedoch versperrt, da schon einige Jahre lang kein hauptamtlicher Pfarrer mehr die Schäfchen dieses Ortes betreut und der ortsansässige Mesner die Kirche lieber verschlossen hält. Aber heute ist sie überraschenderweise offen, vielleicht weil Adventsonntag ist, oder hat auch die Vorsehung den Mesner veranlasst die Kirche aufzusperren, um der alten Frau diese außertourliche Einkehr zu ermöglichen. Überrascht, aber dankbar nimmt sie dieses „Geschenk“ gerne an und betritt die Kirche.
Diese ist menschenleer, da wohl kaum jemand auf den Gedanken kommt, sie um diese Tageszeit und ohne -besonderen Anlass zu besuchen. Außerdem gehen heutzutage immer weniger Menschen zur heiligen Messe, die ja durch den Priestermangel ohnehin nur mehr jeden zweiten Sonntag in dieser Kirche abgehalten wird. So steht sie nun allein inmitten des Gotteshauses und wird von der eigenartigen Atmosphäre, die so eine Kultstätte ausstrahlt, gefangen genommen. Sie spürt einerseits die Geborgenheit, andererseits aber auch das kühle, ja sogar düstere Umfeld, welches eine unbeleuchtete -Kirche vermittelt. Die Skulpturen einiger Heiliger und Engel, die überlebensgroß herab oder betend gen Himmel schauen, wirken irgendwie fremd und Angst einflößend. Die zwölf Bilder, welche das Leiden und Sterben Christi darstellen, angebracht an der kahlen Wand, vertiefen dieses Unbehagen und lassen die alte Frau leicht erschauern. Erst der Blick auf den Hoch-altar, wo Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm, milde lächelnd und unendliche Liebe verheißend, alles überstrahlt, bringt der alten Frau die Ehrfurcht und Ruhe, die diesem -spirituellen Ort geziemt, wieder zurück.
Sie geht den Mittelgang entlang, orientiert sich kurz und setzt sich in eine Bank auf der linken Seite. Es war einmal „ihre“ Bank, denn früher hatte jeder Bürger, vor allem aber die Bauern und Geschäftsleute, ihre reservierten Sitzplätze, streng getrennt nach Geschlecht, die Frauen links, die -Männer rechts vom Eingang. Besonders angesehene und spendenfreudige Bürger hatten ihre Plätze in der Nähe des Hochaltars. Die sogenannten Stammplätze waren durch Messingschilder, welche an der Brüstung der Bänke montiert waren und in die der Name des „Besitzers“ dieses Platzes eingraviert war, markiert. Die alte Frau hatte als ehemalige Geschäftsfrau natürlich auch so einen Stammplatz, ebenso ihr Mann. Heute sind diese Schilder längst entfernt, es gibt auch keine Trennung der Geschlechter mehr und jeder sucht sich den Platz, der ihm gerade zusagt bzw. der noch zur Verfügung steht. So ist es für sie eine große Freude dass sie heute, da allein in der Kirche, ihren einstigen Stammplatz wieder unangefochten einnehmen kann. Heute am Abend wird wieder eine Messe abgehalten werden. Da kommt der Pfarrer aus der Nachbarstadt, ein junger Mann mit starkem fremdländischem Akzent. Er dürfte aus einem der früheren Ostblockstaaten stammen, macht zwar einen sympathischen Eindruck, aber ein einheimischer Priester wäre ihr doch lieber, obwohl die alte Frau als brave Christin natürlich alles andere als fremdenfeindlich ist. Noch lieber wäre ihr, wenn dieser die hl. Messe wie einst in lateinischer Sprache zelebrieren würde, denn diese Gottesdienste waren ihr immer viel feierlicher und erhebender erschienen. Diese lateinischen Messen mit zwar unverständlichen, aber doch vertrauten Worten und Lauten wurden für die damals noch junge Frau immer zu einem besonderen spirituellen Erlebnis. Sie brachten dem Priester auch großes Ansehen und Autorität, da er sich durch diese Sprache doch von den einfachen Menschen abhob. -Lediglich der Apotheker, der hier die Drogerie betrieben hatte, soll bei seinem Studium diese Sprache auch erlernt haben, konnte sie aber im Alltagsleben nicht wirklich anwenden. Anders damals der Priester, wenn er im prunkvollen Messgewand dem Hochaltar zugewandt die lateinische Messe feierte und mit weit ausgebreiteten Armen den Segen des Herrn in sich einzusaugen schien, um ihn durch seinen Rücken an die Gläubigen förmlich zu versprühen. Nach der Lesung aus dem Evangelium bestieg er die Kanzel, um seine Predigt auf die Bürger herabprasseln zu lassen, und so mancher oder manche verließ anschließend die Kirche mit Schuld – oder zumindest gemischten Gefühlen. Da wurde jede kleine oder große Sünde angeprangert und oft genug die Hölle oder zumindest das Fegefeuer strapaziert. Ja, der geistliche Herr war sehr streng und manch reuiger Sünder konnte nur durch eine angemessene Spende sein Seelenheil und die Gunst des Pfarrers einigermaßen wieder erlangen.
Die alte Frau, die nun auf der kalten Kirchenbank Platz genommen hat, beginnt sich zu erinnern, wie das damals in ihrer Kindheit bezüglich der Sünde war bzw. wie die Kinder damit konfrontiert wurden. Als sie vor langer Zeit in dieser Kirche getauft wurde, hatte sie schon den Makel der Erbsünde zu tragen, wie man ihr später in der Schule erklärte. Die Geschichte mit Adam, Eva und dem Teufel in Form einer Schlange und dem berühmten Apfel fand sie zwar interessant, aber so richtig verstand sie nicht, dass dieses Vergehen solche Folgen haben konnte, zumal sie selber gerne Äpfel aß und darin keine Sünde vermutete.
So verlebte sie eine wunderschöne, wertungsfreie Zeit der ersten Kinderjahre. Bis zur Erstkommunion. Zur Erteilung dieses hl. Sakramentes war es nämlich notwendig, die erste Beichte abzulegen. Nun ist es allgemein schon unangenehm, einem eigentlich fremden Mann, auch wenn er Priester ist und das Schweigegelübde abgelegt hat, die eigenen Verfehlungen, sprich Sünden anzuvertrauen. Für unser Mädchen, das noch dazu den Pfarrer ein wenig fürchtete, war es doppelt schlimm, da ihm nicht einfallen wollte, welche Sünden es begangen haben und was es dem Pfarrer eigentlich erzählen sollte? Die Mutter geärgert? Bei der Hilfe der Hausarbeit unwillig gewesen? Den Nachbarbuben gehänselt? Sollten das Sünden sein? Sie hat diese Untaten jedenfalls auf ihren Sündenzettel aufgeschrieben. Selbst die größte Sünde, die ihr in ihrem noch -jungen Leben einfiel, nämlich einmal am Sonntag die hl. Messe nicht besucht zu haben, war keine richtige, da sie damals stark verkühlt war und daher das Bett hüten musste. Sie beschloss aber diese „Verfehlung“ trotzdem zu beichten, um dem Pfarrer die Gelegenheit zu geben, ihr eine Buße auferlegen zu können. So war es dann auch, zwei Vaterunser waren zu beten, und das Seelenheil war wieder hergestellt. Sie konnte nun an Körper und Seele reingewaschen die hl. Kommunion empfangen.
Die jungen Menschen waren an diesem Tag der Mittelpunkt ihrer Familien und die Hauptdarsteller des Ortes. Die Mädchen in weißen Kleidchen, geflochtene Kränze im Haar, die Buben im feschen Trachtenjanker, jeder eine verzierte Kerze in der Hand, zogen begleitet von feierlicher Orgelmusik und den Taufpaten in die Kirche ein. Die Eltern und andere Verwandte saßen bereits in den Kirchenbänken und verfolgten voll Rührung diese Zeremonie. Der Pfarrer, heute leut-selig lächelnd, empfing die kleinen Mini-Heiligen und waltete seines Amtes. Nach der Messe und dem Empfang der Hostie, des Leibes des Herrn, traten die jungen Menschen, gestärkt im Glauben, hinaus ins Leben, bzw. vorerst einmal in den Pfarrhof, wo eine Agape für sie und ihre Begleitung bereitstand. Unser Mädchen, das mit seinen Eltern in einem Haus am Kirchplatz wohnte, dort, wo sie später mit ihrem Mann die Greißlerei führen sollte, ging mit ihrem „Anhang“ nach Hause. Das waren die Mutter, die Taufpatin, damals Godl genannt, die Oma, zwei Tanten und eine Cousine. Der Großvater war bereits verstorben und der Vater aus dem vergangenen Krieg noch nicht zurückgekehrt. Sie wussten nicht, ob er überhaupt noch am Leben war, hofften aber, dass er irgendwo in Russland in Gefangenschaft geraten war und sich dort in einem Lager befinden würde.
Heute lebt die alte Frau in jenem grauen Mietshaus, das sie, wie wir wissen, heute Morgen verlassen, und daraufhin die Straße, vorbei am Posthaus, genommen hat. Das Geschäft am Kirchplatz gibt es nicht mehr, das Haus verkauft, die Mutter längst tot, der Sohn ausgewandert nach Australien und der geliebte Mann vor Kurzem gestorben, so ist aus dem einst so fröhlichen Mädchen eine einsame, alte Frau geworden.
Diese unsere alte Frau sitzt jetzt in der Kirchenbank und lässt die Erinnerungen an sich vorüberziehen. Obwohl jetzt draußen langsam die Sonne den Kampf gegen den Nebel zu gewinnen scheint und durch das Kirchenfenster die ersten Sonnenstrahlen auf den Hauptaltar fallen, ist es drinnen noch ziemlich kalt. Die Kirchenbesucherin scheint das nicht zu spüren, es ist als ob eine spezielle Energie ihren Körper warmhalten würde. Sie überwindet gedanklich die kurze Entfernung und die lange Zeit und befindet sich wieder in der Küche ihres Elternhauses, wo die Mutter gerade ihr zu Ehren aus Anlass der Erstkommunion ein für heutige Begriffe eher bescheidenes Festmahl zubereitet. Es war kurz nach dem Krieg, die Lebensmittel waren rationiert und manchmal trotz gültiger Lebensmittelkarten schwer zu bekommen. Um also dieses, wie erwähnt, bescheidene Festmahl auf den Tisch bringen zu können, musste man versuchen, sich Kostbarkeiten wie Eier, Schmalz, Kartoffeln oder auch Mehl und Brot auf andere, illegale Weise zu verschaffen, Fleisch war sowieso nicht zu bekommen. Diesen ungesetzlichen Beschaffungsvorgang nannte man „Hamstern“. Man ging oder fuhr hinaus zu den Bauern und bot ihnen alles, was man entbehren konnte, oder auch manches, was man eigentlich behalten sollte, an, um es gegen Lebensmittel einzutauschen, und so wechselten Schmuckstücke, Kleidung, technische Geräte etc. in den Besitz der Bauern, die dann nach ihrem Ermessen mit Naturalien, sprich Lebensmitteln bezahlten. Dieses „Hamstern“ war streng verboten, und wenn man Pech hatte und in eine Polizeistreife geriet, konnte es passieren, dass die teuer erkauften Lebensmittel beschlagnahmt wurden. Die drei Dorfpolizisten aber drückten meist ein Auge zu, bekamen dafür auch öfter etwas davon ab, und so war es der Mutter möglich, dieses gute Essen herzustellen.
Die Kleine war das einzige Kind der Familie, der Vater war fast während des ganzen Krieges an der Front gewesen und galt damals noch als vermisst. Das Mädchen kannte ihn kaum, es hatte ihn nur kurz bei einem Heimaturlaub gesehen. Damals hatte er ihr ein Goldketterl mit einem Anhänger aus rotem Stein in Herzform geschenkt. Ob der Stein echt war oder nicht, wusste sie nicht, war ihr auch völlig egal, denn das Geschenk an sich war für sie ein Heiligtum. Sie ließ es auch vom ehrwürdigen Hr. Pfarrer weihen und trug es als Talisman und als Pfand für seine gesunde Heimkehr. Für die Kommunion bekam sie von der Taufpatin die Kerze, ein Gebetbuch und einen Ring aus feinem Silber. Dafür war sie sehr dankbar, besonders der Ring gefiel ihr und sie freute sich schon auf den nächsten Schultag, um dieses schöne Stück herzeigen zu können.
Sie besuchte die zweite Klasse der achtklassigen -Volksschule, die sich am Rande des Ortes befand, und hatte etwa zehn -Minuten dorthin zu gehen. Dabei kam sie jedes Mal an der Viktualienhandlung, so hießen damals auch Lebensmittelgeschäfte, vorbei, und diese zog sie magisch an. Fast täglich machte sie einen Abstecher in diesen Laden, wobei sie besonders der große Glasbehälter, gefüllt mit verschiedenen Sorten von Zuckerln, faszinierte. Die Inhaberin, eine freundliche Frau etwa im Alter ihrer Mutter, freute sich offensichtlich über den regelmäßigen Besuch der Kleinen und ließ sie jedes Mal in den Behälter greifen und sich eines davon herausnehmen. Damals reifte in dem Mädchen sicher schon der Entschluss, später selbst einmal einen solchen Laden zu besitzen. Aber bis dahin war noch ein weiter Weg, zunächst galt es sich in der Schule zu bewähren, um für die kaufmännische Lehre gerüstet zu sein. Das tat sie recht ordentlich, sie war eine gute und vor allem brave Schülerin, die auch schon früh im hiesigen Kirchenchor mitsingen durfte. Das waren immer schöne und aufregende Momente, wenn sie als jüngstes Mitglied des Chores von der Empore herab mit ihrer hellen Stimme zum Gelingen der diversen Feierlichkeiten beitragen durfte. Auch das Verhältnis zum Herrn Pfarrer war dadurch wesentlich entspannter, da der geistliche Herr sehr stolz auf seinen Chor war und dessen Mitgliedern von Haus aus wohlwollend gegenüberstand.
Es ist jetzt ganz still in der Kirche. Die alte Frau scheint zu schlafen, ein leichtes Lächeln erhellt ihre Gesichtszüge, es scheint als würde sie wieder wie damals die Orgelmusik und den Gesang des Chores hören. Ein lautes Geräusch reißt sie plötzlich aus ihren Träumen. Sie bemerkt, dass der Mesner, der inzwischen wohl aus der Sakristei in die Kirche gekommen sein muss, offensichtlich den Hochaltar für die Abendmesse vorbereitet. Dabei ist ihm offenbar etwas um- oder hinuntergefallen. Er hat die Frau wohl nicht bemerkt, sie verhält sich ganz ruhig, will in ihren Erinnerungen nicht gestört werden. Der Mesner, anscheinend fertig mit seiner Arbeit, bekreuzigt sich vor dem Altar und verlässt wieder die Kirche. Die alte Frau, so abrupt aus ihren Träumen gerissen, dreht sich um, schaut hinauf auf die Empore, aber außer der Orgel, die diesen Teil der Kirche beherrscht, ist nichts zu sehen. Der wunderschöne Gesang, den sie eben noch zu hören glaubte, musste wohl von den Engeln gekommen sein.
Es ist noch nicht lange her, dass von dort oben tatsächlich wunderschöne Orgelklänge und feierlicher Gesang die Kirche füllten. Es wurde das Ave Maria gespielt und von einem Mädchen mit ausdrucksvoller, aber eher zarter Stimme gesungen. Dies war der letzte Wunsch des Mannes der alten Frau, dem damit bei der Einsegnung seines Leichnams entsprochen wurde. Ja, ihr geliebter Mann ist nach langer Krankheit in ihren Armen verstorben. Das Ave Maria bei seiner Beisetzung sollte noch einmal an seine Liebe und Zuneigung zur hl. Jungfrau erinnern. Er war ein gläubiger Mensch, durch seine freundliche Art und seine Hilfsbereitschaft überall beliebt und bis zuletzt einer der Himmelträger bei der Fronleichnamsprozession. Jetzt ist er selbst im Himmel, die alte Frau jedenfalls glaubt fest da-ran und vermeint seine Nähe an diesem heiligen Ort zu spüren. Sie hat sehr viel geweint in letzter Zeit, sich aber immer wieder damit getröstet, dass der Herrgott ihn von seinen Leiden erlöst und zu sich geholt hat. Und wohl auch damit, dass sie ihm bald in die Ewigkeit folgen werde. Sie hat im Geheimen eine etwas andere Vorstellung von Gott, als er in der Kirche oft dargestellt wird. Für sie ist Gott gleichzusetzen mit Liebe, wie es sein Sohn Jesus in seiner Inkarnation auf Erden immer wieder verkündet und vorgelebt hat. Ein liebender Gott und nichts anderes. Die offizielle Kirche, die neben dem liebenden gerne auch den strafenden Gott herauskehrt, bringt die gläubigen Menschen oft in Gewissensnot und Abhängigkeit.
Die alte Frau erhebt sich langsam von ihrem Platz, um in Gedenken an ihren geliebten Mann und zum Schutze ihres in Australien lebenden Sohnes Kerzen anzuzünden. In einer Nische im Seitenschiff der Kirche ist ein Platz vorgesehen, wo man um einen kleinen Betrag Kerzen entnehmen und dort auch anzünden darf. Durch das lange Sitzen und die niedrige Temperatur in der Kirche etwas steif geworden und wohl auch dem Alter entsprechend, humpelt sie etwas auf dem Weg dorthin. Der Gedenkplatz, oder wie immer man diese Kerzenecke bezeichnen mag, liegt vom Platz der alten Frau aus gesehen im gegenüberliegenden Seitenschiff und auf dem Weg dorthin stabilisiert sich ihr Kreislauf wieder und die eingeschränkte Gelenkigkeit verbessert sich. Sie entnimmt dem Depot zwei Kerzen, wirft doppelt so viel wie verlangt in das dafür vorgesehene, gut versperrte Gefäß aus Blech und will die Kerzen anzünden. Normalerweise entzündet sie diese an den anderen bereits brennenden, aber diesmal gibt es keine davon, und da sie keine Zünder bei sich hat, muss sie eine andere Möglichkeit finden, um das Licht für ihre Lieben zu entflammen. Sie hat bemerkt, dass der Mesner vorhin die große Kerze am Haupt-altar angezündet hatte, und geht nun dorthin, um sich das Feuer zu holen.
Da steht sie nun vor dem inzwischen vom Sonnenlicht überfluteten Hauptaltar, der ganz der hl. Maria gewidmet ist. Wieder blickt sie in das freundlich lächelnde, fast übersinnlich anmutende Antlitz der Muttergottes und wie unter zwar sanftem, aber doch bestimmtem Zwang fällt sie vor ihr auf die Knie. Es war wie eine stille Meditation, kein Gebet, aber tief im Inneren spürt sie das Gefühl der Einheit mit Gott, mit Maria, mit allen Menschen dieses Planeten, ja, mit dem ganzen Universum.
Tief betroffen erhebt sich die alte Frau, sie kann es kaum begreifen, was ihr da widerfahren ist, auch weiß sie nicht, wie viel Zeit sie hier kniend vor dem Altar verbracht hat, aber dass etwas Besonderes mit ihr geschehen ist, ist ihr bewusst. Sie steigt die drei Stufen bis zum Altar-Tisch hinauf und zündet die eine Kerze an. Sie fühlt sich dabei so leicht und frei und um vieles jünger. Vor diesem Erlebnis hätte sie wohl Hemmungen gehabt, sich diesem heiligen Platz so weit zu nähern, aber jetzt hat sie erkannt, dass man auf Gott und alle Heiligen ganz normal zugehen kann, um seine Bitten und Wünsche vorzubringen und auch seine Sorgen, denn wir leben hier auf Erden nicht im Paradies, haben unsere Aufgaben zu erfüllen und manchmal auch großes Leid zu ertragen. Auch unsere alte Frau hat im Laufe ihres bisherigen Lebens einige Schicksalsschläge erleiden müssen, sie hat aber den Glauben nie verloren, obwohl sie auch manchmal an der Gerechtigkeit des Himmels gezweifelt hat.
Sie geht zur Nische zurück, zündet auch die zweite Kerze an, stellt beide auf die dafür vorgesehene Vorrichtung und bleibt eine Weile andächtig davor stehen. Nach all dem eben Erlebten ist sie unschlüssig, was sie jetzt machen soll. Sie geht zurück in den Kirchenraum, kommt dabei an der rechten Bankreihe, der ehemaligen „Männerreihe“, vorbei und erinnert sich an den Platz, der früher für ihren Mann reserviert war. Sie setzt sich kurz entschlossen auf diesen für sie in diesem Augenblick fast heiligen Sitz und versucht sich ganz zu entspannen. Das Namensschild ihres Mannes wurde längst entfernt, die Bank ist ziemlich „abgewohnt“, aber sie spürt, dass irgendwas von einst, von ihrem Mann auf diesem Platz erhalten geblieben ist.
Sie beginnt leise zu beten: „Gegrüßet seist du, Maria“ – und sieht sich als junges Mädchen vor dem Altar betend knien – „voll der Gnade, der Herr sei mit dir; du bist gebenedeit unter den Frauen“ – einige Tränen perlen über ihr junges Gesicht – „und gebenedeit sei die Frucht deines Leibes, Jesus“. – Das junge Mädchen erlebte gerade seinen ersten Liebeskummer, konnte aber mit niemandem darüber reden, denn es war eine sehr geheime Liebe, von der nicht einmal der Auserwählte eine Ahnung hatte. Es war die kindliche Schwärmerei für ihren Lehrer, wie es bei pubertierenden Mädchen öfter vorkommt. Es handelte sich natürlich nicht um den etwas schrulligen alten Lehrer, der sie lange Zeit durch die Schule begleitet hatte, nein, ein junger und für diesen Ort sicher moderner Pädagoge hatte vor Kurzem ihre Klasse übernommen. Es war natürlich eine reine Mädchenklasse, alles andere war damals verpönt und hätte auch der Herr Pfarrer sicher nicht zugelassen. Der schaute nämlich streng auf Zucht und Ordnung im Ort, wobei die Buben gegenüber den Mädchen schon etwas bevorzugt wurden. Wie oft beneidete das Mädchen früher die Ministranten, die in ihren weißen Kitteln dem Pfarrer bei der Messe assistieren durften, besonders denjenigen, der die große Verantwortung hatte, die Handglocke immer zum richtigen Zeitpunkt zu läuten. Allerdings zweifelte sie daran, ob sie das überhaupt schaffen würde. Diese Bevorzugung der Buben bei den Ministranten konnte man den Pfarrer allerdings nicht alleine anlasten, denn das war vom Bischof so vorgeschrieben, aber dieser Vorschrift hätte es bei diesem Pfarrer sicher nicht bedurft.
So kniete das Mädchen, also vor dem Marienaltar, erfüllt von tiefer Sehnsucht, in Selbstmitleid zerfließend und bat die hl. Jungfrau um Hilfe und Rat.
Ein leises Lächeln umspielt die Lippen der alten Frau, die jetzt an diese Zeit zurückdenkt. Nie mehr in ihrem Leben hat sie dieses schöne, schwärmerische, beglückende und doch so traurige Gefühl erlebt, das man nur in jungen Jahren erfahren kann. Sie erinnert sich, dass sie weniger um die Erfüllung dieser Liebe betete, vielmehr wollte sie mithilfe Mariens diese „sün-digen Gedanken“ loswerden. Bis ihr dies gelang, musste sie wohl noch längere Zeit mit extremen Gefühlsschwankungen leben, aber mithilfe der hl. Jungfrau hat sie diese ach, so schöne, aber auch ach, so schreckliche Zeit gut überstanden. Als dann der Lehrer eine hübsche Frau aus der Stadt mitbrachte und später auch heiratete, berührte sie das nicht mehr besonders.
Aber eine andere entscheidende Veränderung kündigte sich im bisherigen harmonischen Zusammenleben zwischen Mutter und Tochter an. Ihre Mutter hatte die Verständigung erhalten, dass ihr Mann, der Vater des Mädchens, sich in einem russischen Gefangenenlager befinde und seine Heimkehr in Bälde zu erwarten sei, allerdings sei der genaue Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die nunmehrige Gewissheit, dass der so lang Vermisste am Leben sei und sogar bald daheim sein werde, erfüllte beide mit großer Freude. Wie oft hatten sie darüber geredet, dafür gebetet, gehofft und wieder gezweifelt, aber jetzt sollte alles bald ein Ende haben und die Familie würde wieder vereint sein.
Trotz der Freude beschlich das Mädchen manchmal ein Gefühl der Unsicherheit, hatte es seinen Vater doch viele Jahre nicht gesehen und sich in seiner Fantasie ein Bild von ihm zurechtgelegt, das von der Wirklichkeit vielleicht völlig abweichend sein konnte. Aber sie hatte in ihrem jungen Leben schon gelernt, dass solche Gedanken nichts brachten, dass man sich nicht dauernd um die Zukunft sorgen, sondern die Dinge einfach herankommen lassen sollte. Die vorhandene Energie sollte man besser in die Gegenwart, das Jetzt, investieren. Dies gelang unserem Mädchen ganz gut, es hatte Spaß an der Schule, am Chorgesang, half der Mutter oft im Haushalt und fand auch noch Zeit in der Katholischen Jungschar, der es ja seit frühester Kindheit angehörte, eine Gruppe von kleineren Kindern zu führen. Diese ehrenvolle Aufgabe war ihr vom Pfarrer persönlich übertragen worden. Es war für ihn sicher etwas ungewöhnlich, dass er diese Aufgabe einem Mädchen übertragen hatte, auch sie war etwas verwundert darüber, aber ihre Einstellung ihm gegenüber hatte sich dadurch positiv verändert. Sie erkannte, dass hinter der rauen Schale ein zwar nicht weicher, aber ein zumindest zu knackender Kern steckte. Er versuchte die Menschen zu Gott zu führen, und tat dies seiner Herkunft, seiner Ausbildung und Überzeugung nach genauso, wie man es von der klerikalen Obrigkeit verlangte, loyal dem Papst und den Bischöfen gegenüber und streng nach dem Kirchenrecht.
Irgendwie hat die Erinnerung an den Pfarrer von damals die alte Frau aus ihren Träumen wieder in die Gegenwart zurückgebracht. In eine Gegenwart, in der es keinen festen -Pfarrer, keine Jugendgruppen mehr gibt und in der nicht einmal regelmäßig hl. Messen abgehalten werden.
In der Kirche ist es inzwischen recht hell geworden, draußen dürfte sich die Sonne endgültig durchgesetzt haben, und es scheint ein schöner Adventsonntag zu werden. So wie damals als sich im Ort die Nachricht „der Berghofer-Sepp hat sich aufgehängt“ wie ein Lauffeuer verbreitete. Der Berghofer-Sepp war eigentlich ein braver, fleißiger Mann, bei dem es aber im Oberstüberl nicht ganz richtig war. Er wohnte bei seinen Eltern in einer alten Keusche etwas außerhalb des Ortes am Rande des Waldes. Dort hat er sich einen Baum ausgesucht, um mit dessen Hilfe und einem alten Wäschestrick seinen Geist und seine Seele aus dem behinderten Körper zu befreien. Was ihn dazu bewogen hat, war und wird immer ein Rätsel bleiben, zumal er ja immer lustig war, aber viel Unsinn redete, gesprochene Sätze immer wieder wiederholte und dazu herzlich lachen konnte. Nun möchte man meinen, dass man einem Menschen, der seiner Sinne nicht ganz mächtig und der sich seiner Handlung sicher nicht voll bewusst ist, diese „Sünde“ des Selbstmordes verzeihen sollte. Nicht die Kirche, nicht der damalige Pfarrer. Die alte Frau wurde damals, als Mädchen, Zeugin einer Szene die sie tief bewegte. Als Jungscharleiterin hielt sie sich oft im Pfarrhof auf, um sich für kommende Aktivitäten vorzubereiten. So auch zu dem Zeitpunkt als die Eltern des Berghofer-Sepps zum Pfarrer kamen, um über das Begräbnis ihres Sohnes zu reden. Das Mädchen war damals im Nebenraum, die Tür war nur angelehnt und so konnte es, unfreiwillig, die Unterhaltung mit anhören. Die beiden alten Leute, gramgebeugt, baten den Pfarrer inständig, ihrem Sohn ein würdiges christliches Begräbnis zu gewähren. Der Pfarrer, von dem man sich in solch einer Situation eigentlich Trost und Hilfe erwarten könnte, war im Gegenteil sehr erbost über das Ansinnen der beiden, belehrte sie streng über die „Todsünde“, die ihr Sohn begangen hatte, und verweigerte sowohl seine Teilnahme am Begräbnis als auch eine Grabstätte innerhalb der Friedhofmauern in sogenannter geweihter Erde. So wurde der Sepp also in nicht geweihter Erde in der Nähe seines Heimathauses von einigen hilfsbereiten Holzarbeitern, die in der Nähe mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt waren, im Beisein seiner Eltern begraben. Unsere alte Frau, damals ein junges Mädchen, mochte den Berghofer-Sepp gut leiden, war er doch stets lustig und freundlich und aufgrund seiner Unbeholfenheit gab es mit ihm auch viel zu lachen. Er war nie bösartig und hatte Kinder gern. Die Entscheidung und Härte des Pfarrers traf die junge Seele damals schwer und es dauerte lange, bis sie diesen Schock überwunden hatte, verstehen konnte sie es nie.
Trotzdem war die Kirche für sie wichtig, und auch die geweihte Erde und das Weihwasser waren ihrem Verständnis nach notwendig, damit die Verstorbenen die ewige Ruhe erlangen können. Der Umstand, dass ihrer Meinung nach dem Berghofer-Sepp durch die Verweigerung dieser Weihe diese ewige Ruhe vorenthalten wurde und er womöglich ruhelos in aller Ewigkeit umherirren muss, ließ in ihr einen spektakulären Plan heranreifen. Sie besorgte sich in der Kirche ein Fläschchen mit Weihwasser und in vollem Bewusstsein, vielleicht eine große Sünde zu begehen, schlich sie sich abends in der Dämmerung zum Grab des Berghofer-Sepps und spritzte dieses mit einem kleinen Pinsel über seine letzte Ruhestätte, genauso, wie sie es beim Pfarrer schon öfter gesehen hatte. Einer der Holzknechte hatte ein grobes Kreuz zurechtgezimmert, den Namen „Sepp“ eingebrannt und es auf dem Grab-hügel aufgestellt. So kam der arme Sünder doch noch zu einem Grab mit Namen, zu geweihter Erde und zu ewiger Ruhe.
Heute weiß die alte Frau allerdings, dass das Sterben nicht in ewiger Ruhe endet, sondern den Übergang von einer Bewusstseinsebene in die nächste, höhere bedeutet und dass dafür ir-dische Dinge wie geweihte Erde etc. nicht vonnöten sind. Es ist schon anzunehmen, dass einer, der sein irdisches Leben durch Selbstmord beendet, es schwerer haben wird, sich in der „anderen Welt“ zurechtzufinden, aber mit viel Liebe und Gebeten kann diesen Seelen sicher auch geholfen werden, Liebe, wie sie z. B. unser Mädchen trotz persönlicher Angst, etwas Unerlaubtes zu tun, gegenüber dem Berghofer – Sepp be-wiesen hat.
Inzwischen, es war zwei Wochen vor Weihnachten, war auch der Vater des Mädchens aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt. Die Mutter und sie hatten ihn damals in der nächsten Stadt abgeholt, denn dort war er mit mehreren anderen Leidensgenossen mit einem Sonderzug angekommen. Das Wort „Leidensgenossen“ mag in diesem Zusammenhang, da es sich doch um eine erfreuliche Begebenheit handelte, etwas deplatziert klingen, aber wenn man den körperlichen Zustand dieser Männer betrachtete, hatte der Begriff durchaus seine Berechtigung.
Die beiden, Mutter und Tochter, fuhren also mit dem Postbus in besagte Stadt, das Mädchen hatte für diesen Tag von der Schule freibekommen. Da in jener Zeit die Busverbindungen dorthin ziemlich schlecht waren, einer fuhr früh am Morgen, einer erst am späten Nachmittag, der Heimkehrerzug aber gegen Mittag eintreffen sollte, mussten sie natürlich den Frühbus nehmen. Die Fahrt in die Stadt dauerte nicht allzu lange, und so mussten sie mehrere Stunden bis zur Ankunft des Zuges überbrücken. Es war ein kalter Wintertag und daher suchten sie eine Gelegenheit, diese Zeit möglichst in warmer Umgebung zu verbringen. Zuerst gingen sie in denWarteraum des Bahnhofs, doch auch dort war es nicht wirklich warm, abgesehen von der triesten Atmosphäre die dort herrschte. So mussten sie ihr Glück in der Stadt versuchen. Das war auch nicht einfach, denn die wenigen Kaffeehäuser oder Restaurants hatten um diese Zeit noch alle geschlossen. Es war eben eine andere Situation damals, der Brennstoff war knapp und teuer, Lebensmittel kaum zu bekommen und die Menschen hatten nicht das Geld, um solche Lokale häufig zu besuchen. So reduzierten sich die deren Öffnungszeiten auf einige Stunden pro Tag, meist auf den Nachmittag oder Abend. Daher gingen Mutter und Tochter durch die Straßen, vorbei an einigen zerbombten Häusern, auf der Suche nach Wärme.
Diese Stadt war für den vergangenen Krieg strategisch -sicher nicht wichtig gewesen, trotzdem waren einige Bomben dort abgeworfen worden. Möglicherweise wurde eines der Bombenflugzeuge von den in der Nähe befindlichen FLAK-Geschützen getroffen und der Flugzeugführer versuchte durch den Abwurf der Bombenlast zu entkommen, oder es sollte die FLAK-Stellung getroffen werden, aber stattdessen hat es einige Häuser im Stadtzentrum erwischt.
Trotz der äußeren Umstände waren die zwei Frauen guter Dinge, denn in wenigen Stunden würden sie mit dem Mann bzw. Vater wieder vereint sein.
Endlich kamen sie zu einem Lokal, das geöffnet war, es war eine Stehweinhalle, und voller Freude und Erwartung traten sie ein. Die Luft war zwar geschwängert mit Alkoholdunst und Zigarettenrauch, aber es war warm. Die Mutter bestellte sich einen Glühwein, und in Anbetracht der ausgestandenen Kälte durfte das Mädchen auch einen leichten Weintee zu sich nehmen. Sie hielten sich eine Weile dort auf, lernten einige Leute kennen, die ebenfalls auf den Heimkehrerzug warteten, wodurch das Gesprächsthema schon vorgegeben war und man sich rasch näherkam.
Inzwischen hatte sich draußen die Sonne durchgesetzt und es wurde etwas wärmer.
Aufgewärmt an Körper und Seele, dazu hatte einerseits der Alkohol und andererseits die Gespräche mit den anderen wartenden Angehörigen beigetragen, verließen sie das gast-liche Haus, um die Stadt zu erkunden. Nach und nach öffneten auch die Geschäfte ihre Pforten und so verging die Zeit relativ rasch und sie mussten langsam daran denken, zum Bahnhof zurückzukehren.
Dort waren schon sehr viele Menschen versammelt und man spürte die Spannung jener, die einen Angehörigen erwarteten, und die Hoffnung derer, die mit dem Foto ihres vermissten Angehörigen in der Hand versuchen würden von den heimkehrenden Soldaten Auskunft über ihren Lieben zu erhalten. Es war nicht mehr als ein Strohhalm, an den sie sich da klammerten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Ankommenden den Gesuchten gesehen hatte oder sogar wusste, wo sich dieser befand, war sehr gering und doch, bei jedem ankommenden Transport sah man damals meist Frauen mit den Fotos ihrer verschollenen Männer den Bahnsteig säumen.
Die Heimkehrer, die wie angekündigt um die Mittagszeit eintreffen sollten, waren inzwischen schon überfällig. Es war ja auch kein fahrplanmäßiger Zug, der die Erwarteten bringen sollte, sondern ein Sonderzug, der von Stadt zu Stadt fuhr, um die dort im Umkreis Beheimateten „auszuladen“. Sämtliche fahrplanmäßigen Züge hatten natürlich Vorrang und der eingeschobene Sonderzug musste oft lange warten, bis er weiterfahren durfte. Die beiden, Mutter und Tochter, wurden schon langsam nervös, denn der letzte Bus in ihren Ort fuhr am frühen Abend und ein Taxi war damals schwer aufzutreiben, auch kaum leistbar.
Endlich wurde über den Lautsprecher durchgegeben, dass in Kürze ein Schnellzug durchfahren und unmittelbar danach der Sonderzug erwartet werde. Bald darauf fuhr der Schnellzug an den Wartenden vorbei, denn in diesem Ort hielten nur die Regionalzüge. Der Bahnhofsvorstand stand stramm in seiner blauen Uniform, legte die Hand zum Gruß an den Schirm seiner Kappe und signalisierte damit dem Lockführer, dass -alles in Ordnung sei. Das Mädchen sah dem entschwindenden Zug lange nach, verspürte so etwas wie Fernweh und beneidete ein wenig die Fahrgäste, die sie nur kurz und schemenhaft hinter den Fenstern des Zuges wahrgenommen hatte. Es war überzeugt, dass es später einmal in solch einem Schnellzug aus dieser kleinen, vertrauten, aber engen Welt in der es lebte, hinausdampfen würde, um einen Teil der großen Welt kennenzulernen.
Die Mutter unterhielt sich mit anderen Frauen, Reisende gingen vorüber, stiegen in den wartenden Regionalzug ein, der sie nach einem langen Arbeitstag wohl nach Hause bringen würde, einige Fotografen und Reporter liefen herum, bemüht, eine gute Position zu finden für eine Reportage über die Heimkehrer. Das Mädchen, dem diese Hektik und Aufgeregtheit nicht behagte, zog sich in eine stille Ecke des Bahnhofes zurück, um sich auf das kommende Ereignis seelisch vorzubereiten. Es war zwar noch nicht so spät, aber der Jahreszeit entsprechend legte sich schon langsam die Dämmerung über die Szene und verursachte in ihr eine seltsam melancholische Stimmung. Einerseits der Wirbel um sie herum, andererseits die Stille und Ruhe in ihrer Nische, dieser Gegensatz erweckten in ihr das Gefühl, über den Dingen zu stehen, als ob sie mit all dem nichts zu tun hätte, als ob sie alleine da wäre, ihren Vater zu empfangen. Es tat ihr direkt weh, als ein lautes Pfeifen aus der Ferne die Ankunft des Zuges ankündigte und sie wieder in die harte Realität zurückbrachte. Sie sah, dass die Mutter bereits nach ihr suchte, und verließ diesen Platz der Ruhe, um sich wieder unter die Menge zu mischen und gemeinsam mit ihr den großen Augenblick des Wiedersehens zu erleben.