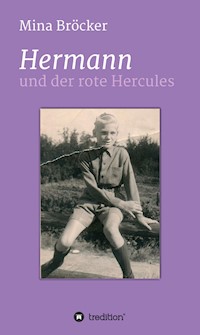
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bremen in den 50er Jahren: Der neunjährige Waise Hermann wächst bei seinen Großeltern in bescheidenen Verhältnissen auf. Der Junge träumt von einem eigenen Fahrrad, einem roten Hercules. Mit dem deutschen Wirtschaftswunder gelingt ihm der soziale Aufstieg. Tagsüber arbeitet er als Schiffbauer auf der Werft, nachts zieht er mit seinen besten Freunden Jürgen und Peter durch die Bars und Rock'n' Roll-Clubs der Stadt. Doch dann trennen sich ihre Wege: Peter geht erst nach Belgien, dann nach Frankreich. Hermann und Jürgen zieht es nach Süditalien, wo das größte Stahlwerk Europas entstehen soll. Eines Tages erfährt Hermann, dass er jahrelang angelogen wurde. Verbittert bricht er auf nach Saint-Nazaire in Frankreich, wo sein Freund Peter arbeitet und wo Hermann ein neues Leben beginnen will. Doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Er trifft auf Pierre, der ihm ein väterlicher Freund wird und ein ähnliches Schicksal teilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mina Bröcker
Hermann
und der rote Hercules
© 2020 Mina Bröcker
Verlag und Druck:tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-20581-9
Hardcover: 978-3-347-20582-6
e-Book: 978-3-347-20583-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Saint-Nazaire, November 1962
Hermann legte den Kopf in den Nacken. Er sah Oskars Hände vor sich. Wie sie den Pinsel führten und wunderschöne riesige Rosenranken auf die Tapete malten. Und wie sein Großvater im Handstand die Treppe zum Hof hoch- und runterstieg, um ihn und seine Freunde zu erheitern. Er dachte an Jürgen und die scheinbar endlosen Sommertage am Lankenauer Höft. All das schien eine Ewigkeit her.
„Hermann? Was ist mit dir?“
„Hmm?“
Hermann öffnete seine Augen. Sein Blick traf auf Jeanne. Sie ordnete ihr dichtes dunkles Haar und beobachtete ihn im Spiegel. Ihr Chignon, der Knoten, hatte sich gelöst. Mit geübtem Griff nahm sie die Klammer aus dem Mund und steckte die Strähnen hinter dem Ohr fest. Ihr Blick blieb dabei auf ihn geheftet. Noch vor ein paar Minuten hätte er sie am liebsten wieder ausgezogen, doch jetzt schien er überrascht, sie zu sehen.
„Was ist denn passiert? Du bist ja ganz blass!“
Hermann schaute auf das Papier in seiner Hand. „Es ist nichts!“, sagte er.
„Cheri!“
Jeanne schüttelte ihren Kopf und drehte sich um. Sie und Hermann waren noch nicht sehr lange ein Paar, aber sie kannte ihn bereits gut genug, um zu wissen, dass das nicht stimmte. Seit dem Sommer trafen sie sich heimlich in seiner Mansarde, in der nichts weiter stand als ein Bett, ein Nachtschrank, eine Kommode und ein Stuhl. Hier liebten sie sich voller Hast, bevor Jeanne wieder zurück in das Kurzwarengeschäft musste, in dem sie arbeitete. Sie nahm ihre Strickjacke vom Stuhl und spielte mit dem Ärmel. Offenbar hatte sie es diesmal nicht eilig, pünktlich ins Geschäft zurückzukehren.
Hermann überlegte, wie er Jeanne versichern konnte, dass alles gut sei. Aber für einen abwiegelnden Satz fehlten ihm die feinen Nuancen der französischen Sprache. So beschloss er zu sagen, was er soeben erfahren hatte.
„Meinem Großvater geht es nicht gut.“
„Was soll das heißen, ihm geht es nicht gut? Ist er krank?“ fragte Jeanne und setzte sich neben ihn aufs Bett.
„Es kann sein, dass er bald stirbt“, antwortete Hermann.
„Mon Dieu!“ Jeanne schlug sich die Hand vor den Mund. Dann besann sie sich und schlug schnell ein Kreuz vor ihrer Brust.
„Das heißt, du fährst nach Deutschland? Wenn du willst, frage ich Papa, ob er dich von der Arbeit abmelden kann. Ich werde ihm alles erklären“, sagte sie.
„Halt Jeanne, warte! Warte! Ich… ich werde nicht nach Hause fahren!“
„Wie? Warum nicht? Willst du deinen Großvater nicht noch einmal sehen?“
Jeanne sah Hermann fragend an. Manchmal verstand sie nicht, was ihm durch den Kopf ging und warum er immer so verschwiegen war. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hatte sie sich in ihn verliebt und zwar just an jenem Abend, an dem ihr Bruder François den fremden blonden Mann mit nach Hause gebracht hatte.
Auch Hermann war vom ersten Augenblick an von Jeanne angetan. Erst wollte er es sich nicht eingestehen und dann ließ er sich nichts anmerken. Das hatte vor allem mit Jeannes Vater zu tun. Hermann hatte großen Respekt vor Pierre. Er liebte ihn und schaute zu ihm auf. Und er hatte eine Heidenangst vor seiner Reaktion, wenn er erführe, dass Hermann und Jeanne ein Paar waren.
Pierre Guimard war freundlich zu Hermann gewesen, hatte sein Haus für ihn geöffnet und ihn in seine Familie, in sein Innerstes, aufgenommen. Das war nicht selbstverständlich für einen Franzosen und schon gar nicht für einen aus Saint-Nazaire. Seit 16 Jahren war der Krieg zu Ende, aber noch immer spaltete der riesige U-Boot-Bunker die Stadt.
Hermann wusste, dass Pierre ihn mochte, aber würde er ihn auch als Schwiegersohn akzeptieren? Wollte er denn überhaupt heiraten, Vater werden, für immer an einem Ort bleiben? Hermann atmete tief durch. Er musste seine Gedanken sortieren.
„Natürlich will ich meinen Großvater sehen. Ich muss nur vorher noch ein paar Dinge klären“, beschwichtigte er Jeannes Unruhe und küsste sie auf die Nase.
Als Jeanne fort war, zog Hermann sich an und ging raus. Er wollte ans Ufer der Loire, den Kopf frei bekommen. Seit jeher hatte Wasser eine beruhigende Wirkung auf ihn. Er verließ das Haus in der Rue de Vieille Église. Draußen war es nasskalt, es nieselte – bretonisches Wetter. „Genauso ein Schietwetter wie in Bremen“, dachte Hermann und schlug den Mantelkragen hoch.
Das Zimmer, das er erst Anfang des Sommers angemietet hatte, lag im Hafenviertel, von hier konnte er zu Fuß zur Werft gehen. Sie arbeiteten im Schichtbetrieb, auch die Monteure, alle zwei bis drei Tage im Wechsel Früh-, Spät- und Nachtschicht und zwischendurch ein paar Tage frei. Hermann verließ das Hafengebiet und ging über die Drehbrücke Richtung Stadt. An der Ecke war ein Kiosk, der Postkarten verkaufte. Auf den meisten war das maritime Saint-Nazaire zu sehen. Sie erinnerten an längst vergangene Zeiten. Wie die mit dem traditionsreichen Ozeandampfer Normandie, der malerisch in Richtung Horizont zieht, während sich an der Promenade gut gekleidete Menschen in ihren weißen Anzügen und Sommerkleidern tummeln.
An diesem Novembermorgen war die Stadt einfach nur trist. Das Zentrum befand sich auf der anderen Seite des Boulevards de la Légion d’Honneur, wohin es nach dem Krieg verlegt worden. Es gab eine langgezogene Einkaufsstraße mit Bekleidungsgeschäften und zweitklassigen Restaurants, in denen man ein Drei-Gänge-Menü schon für wenige Francs bekam. Doch Hermann hatte keinen Hunger und er wollte nicht in die Stadt. Also bog er in die Rue du Port ein und ging zum Strand.
Es war Ebbe. Die Loire hatte sich zurückgezogen und Bänke weißer Muscheln freigelegt, auf deren Schalen die Wellen ihre geriffelten Reliefs hinterlassen hatten. Eine Frau sammelte Austern und Miesmuscheln auf. Möwen kreischten und konkurrierten mit den Enten um die Wattwürmer. Bereit zur Attacke kreisten die Raubvögel im Himmel. Es roch nach Fisch, Tang und Meer. Hermann musste an Jürgen denken. Er wünschte sich, sein bester Freund wäre bei ihm in Frankreich. Noch nie hatte er mit jemanden darüber geredet. Mit Jeanne nicht, mit Jürgen nicht und auch nicht mit Peter. Jeanne hatte er nur erzählt, dass er bei seinen Großeltern aufgewachsen war und dass er keine glückliche Kindheit hatte. Aber das stimmte nicht. Er hatte eine glückliche Kindheit.
Bremen, März 1951
Der Tag war für eine Beerdigung fast beleidigend schön. Es war zwar bitterkalt, doch das erste Mal seit Wochen ließ sich die Sonne blicken. Sie schien durch die bunten Fenster der Kapelle und warf rote, gelbe, blaue und grüne Flecken auf die weiß gekalkte Wand.
Hermann sah das Farbspiel nicht. Er klammerte sich an die weiße Rose in seiner Hand. Vergeblich versuchte er zu weinen, doch keine einzige Träne wollte ihm die Wange herunterlaufen. Damit niemand es bemerkte, hielt er den Blick fest auf die ebenmäßigen Blütenblätter der Rose gerichtet.
Links von ihm saß sein Großvater, Oskar. Rechts von ihm seine Großmutter Henny. Hinter ihnen hatten Hannah, Gerd und Hans Platz genommen, die Geschwister seiner Mutter. In einem Moment der Stille ging ein Husten, Räuspern und Schniefen durch die Trauergemeinde.
Hermann hörte ein schweres Ächzen hinter sich, vorsichtig lugte er über seine Schulter. Zwei Reihen hinter ihm saß eine Frau, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hatte die Schultern hochgezogen. Um die Brust hatte sie ein wollenes Tuch geschlungen. Ihre Augen waren gerötet. Sie presste ein Taschentuch auf ihren aufgerissenen Mund, um nicht laut aufzuschluchzen und nur anhand ihrer zuckenden Schultern erahnte Hermann, dass sie weinte. Geplagt vom schlechten Gewissen, nicht weinen zu können, drehte er sich weg. Es war nicht so, dass er seine Mutter nicht geliebt hätte. Er hatte seine Mutter geliebt, sehr sogar. Aber er konnte einfach nicht glauben, dass sie dort vorne in dem schlichten hölzernen Sarg liegen sollte. Seine Großeltern hatten ihm verboten, den Leichnam zu sehen. Aber vielleicht hätte es ihm geholfen zu realisieren, dass seine Mutter nun tot war.
„Behalt‘ deine Mutter so im Kopf wie sie noch gesund war“, hatte Henny nur gesagt.
Hermann rief sich das Bild seiner Mutter Sophie ins Gedächtnis. Damals, als sie noch ein Backfisch war. Gesund, rosig, mit vollen Wangen und zu Schnecken gedrehten Haaren. Es gelang ihm, das andere Bild von ihr zu verdrängen. Das Bild der letzten Jahre, als sie bereits von der Krankheit gezeichnet war: hager, mit scharfen Gesichtszügen und bleichen Augen.
Da erklang eine Melodie, die ihm bekannt vorkam. Auld Lang Syne. Die Melodie hatte seine Mutter ihm vorgesummt, wenn sie ihn beruhigen wollte. Es war eines ihrer Lieblingslieder gewesen. Den Text kannte Hermann nicht. Doch als die Gesangsstimme erklang, begann seine Brust zu beben. Das Beben rollte nach oben, brach sich Bahn bis zum Hals, wo ein dicker Klumpen saß, der das Grollen aufhielt. Doch es wurde stärker. Hermanns Kinn fing an zu zittern und mit einem sich aufbäumenden Schluchzen ergab sich sein kleiner Körper. Er klappte nach vorn auf seine Knie und schluchzte. Tränen liefen seine Wangen hinunter und wollten nicht enden. Sein Großvater streichelte ihm den Rücken, ließ ihn gewähren und drückte ihn immer wieder an sich. Ganz so als wollte er sagen: „Alles wird gut!
Als das Lied endete, kamen die Sargträger. Der Trauerzug mit Hermann und seinen Großeltern an der Spitze folgte ihnen nach draußen ins Freie. Die Sonne schien so gleißend vom klaren blauen Himmel, dass sie die Augen schließen mussten, um nicht geblendet zu werden.
Die Totengräber hatten ihre Mühe damit gehabt, das Grab auszuheben. Die Erde war steinhart gefroren und mit einem Feuer hatten sie zunächst die obersten Schichten auftauen müssen, um sie beiseite schaufeln zu können. Nun lag die Erde in dicken, dunkelbraunen Brocken neben dem Grab. Der Sarg wurde eingelassen und Hermann trat hervor, um seine Rose hinabzuwerfen.
Die Trauerfeier fand in der Wohnung von Henny und Oskar statt. Die Wohnung befand sich im ersten Stock eines einfachen Mehrfamilienhauses, dessen einziger Zweck es war, den Menschen nach dem Krieg schnell ein Dach über dem Kopf zu bieten. Zu siebt lebten sie auf 60 Quadratmetern Wohnfläche. Es gab zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. Gerd, Lore und ihr Sohn Axel schliefen im Schlafzimmer, das sich Hermann zuvor mit seiner Mutter und seiner Tante Hannah geteilt hatte. Nun saßen alle zusammen in der Küche, die den Mittelpunkt der Wohnung bildete. Henny servierte Bohnenkaffee und stellte ein Blech Butterkuchen, den sie frühmorgens noch gebacken hatte, auf den Tisch. Dass die Gäste eine anständige Bewirtung erhielten, war Hannah zu verdanken, die alles bezahlte. Erst am Vorabend war sie aus Heidelberg angereist.
Neben der Familie waren noch Nachbarn sowie Sophies Arbeitskolleginnen und Freundinnen gekommen. Die Frau mit dem wollenen Tuch war auch dabei. Sie hieß Else und kannte Sophie noch aus Findorff. Mittlerweile lebte sie im Bremer Umland in Twistringen und war mit einem reichen Bauern verheiratet.
Hermann war nach der Beerdigung erschöpft ins Bett gegangen. Als er Stunden später wieder aufwachte, war es draußen schon dunkel. Hermann wusste nicht, wie spät es war, schätzte aber, dass es früher Abend sein musste. Aus der Küche hörte er Stimmen. Die Erwachsenen saßen am Tisch und diskutierten. Einzelne Gesprächsfetzen drangen an sein Ohr. Jemand sagte seinen Namen. Schlaftrunken lauschte Hermann in die Dunkelheit hinein. Er hörte den Bügelverschluss einer Bierflasche ploppen. Hermann streckte sich und beschloss aufzustehen. Er hatte Hunger, seit dem Frühstück hatte er nichts mehr gegessen. Auf nackten Füßen tappte er durch den dunklen schmalen Flur Richtung Küche. Die Holztür war nur angelehnt. Durch einen schmalen Spalt fiel das Licht der Deckenlampe auf die Dielen.
Er hörte Oskars Stimme. „Wir müssen es ihm sagen. Der Junge hat ein Recht darauf.“
„Oskar, lass gut sein. Das sind olle Kamellen“, sagte seine Großmutter. „Viel wichtiger ist die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Hannah, was ist mit Heinrich und dir? Ihr habt ein großes Haus.“
„Mutter, ich habe gesagt, es geht nicht.“
„Aber ihr seid jung und habt keine Kinder. Oskar und ich sind alt und wir wohnen hier zu siebt.“
„Und wie stellst du dir das vor? Heinrich fährt nächsten Monat für einen Vortrag in die Schweiz, von dort wollen wir weiter an den Gardasee. Da kann ich Hermann unmöglich mitnehmen und ich habe nicht vor zuhause bleiben.“
„Was bist du nur für ein egoistischer Satansbraten!“, zischte Henny.
„Satansbraten? Ich gebe dir gleich Satansbraten!“ erregte sich Hannah.
„Menschenskinners! Könnt ihr euch nicht zusammennehmen? Wenigstens an einem Tag wie heute?“ Oskars Gesicht war zornesrot. Nicht einmal einen halben Tag hatte es gedauert, bis Hannah und ihre Mutter aneinandergeraten waren.
„Ist schon gut Vaddern“, sagte Hannah und zündete sich eine Zigarette an. Sie nahm einen tiefen Zug und pustete den Rauch langsam aus. Dann beugte sie sich vor: „Wir machen es so: Der Junge bleibt bei euch und ich schicke euch jeden Monat Geld bis er 14 Jahre alt ist und sein eigenes Geld verdienen kann.“
Oskar sah Henny an. Henny seufzte. Sie wusste, ihre Tochter war durch nichts umzustimmen Sie war genauso dickköpfig und resolut wie sie selbst. Außerdem wagte sie es nicht, ihre älteste Tochter zu bedrängen. Immerhin war es Hannah gewesen, die die Familie durch den Hungerwinter 1946 gebracht und sie auch danach mit dem Nötigsten versorgt hatte. Sie waren eine Familie und die Familie hielt zusammen. Zwar ging sie schon auf die 60 zu, aber hatte sie nicht auch ihre eigenen vier Kinder durch die Depression und durch die Wirren der jungen Republik bekommen? Hermann war ein guter Junge. Ordentlich und fleißig. Und er beklagte sich nie. „Ein besserer Bub als meine Jungs“, wie Henny insgeheim zugeben musste. Also nickte sie.
Die Tür knarrte. Henny erschrak, als sie ihren Enkel im Türrahmen stehen sah. „Hermann, was machst du hier? Ich dachte du schläfst!“ Ihre Stimme klang vorwurfsvoller als beabsichtigt. Henny fühlte sich ertappt, weil sie über ihren Enkel gesprochen hatten. Wie lange mochte er wohl schon dort gestanden haben?
„Ich bin aufgewacht“, sagte Hermann und gähnte. „Ich habe Durst. Und Hunger!“
Hennys Gesichtsausdruck entspannte sich, als sie den zerzausten Jungen ansah. Sein blondes Haar war verstrubbelt, das rechte Bein der langen Unterhose bis zum Knie hochgerutscht - das Kind war ja noch halb am Schlafen! Sie stand von ihrem Stuhl auf und strich ihren Rock glatt. „Na komm man her min Jung! Ich mach‘ dir was zu essen.“
Henny Westen hieß eigentlich Henriette, wurde aber von niemandem so genannt. Sie war klein, rund und runzelig und wirkte wie ein gutmütiges Großmütterchen. Doch das täuschte. Aus ihrem Gesicht blitzten die hellblauen Augen wach und scharfsinnig. Einmal hatte Hermann erlebt, wie Henny eine dahergelaufene Maus mit einem Feudel erschlagen hatte. Ein anderes Mal hatte Henny ihren Mann aus der Kneipe gezerrt nachdem sie spitzbekommen hatte, dass er donnerstags seine Lohntüte als erstes hierhin trug. Seitdem wartete sie Woche für Woche mit ausgestreckter Hand vor dem Werkstor der Werft, wo Oskar als Maler arbeitete. Ohne zu murren, händigte er ihr den Lohn aus. Denn obwohl Henny mindestens zwei Köpfe kleiner war als ihr Mann, gab sie in der Familie den Ton an und Oskar hatte im Laufe der Ehejahre gelernt, seiner Frau nicht zu widersprechen.
Hermann liebte seinen Opa über alles. Sie waren Komplizen im Geiste und Verbündete im Schabernack. Oskar Westen war gutmütig und lustig. Als Hermann noch kleiner war, hatte sein Opa ihm Seemannslieder vorgesungen und Geschichten von früher erzählt. Und wenn Oskar das Lied „Das schmeißt doch einen Seemann nicht gleich um“ anstimmte und bei „so'n lüdden, lüdden, lüdden Buddel Rum“ kräftig das r rollte, klatschte der kleine Hermann vor Vergnügen in seine dicken Händchen.
Mittlerweile war Hermann neun Jahre alt. Er machte es sich auf dem Stuhl vor dem Ofen bequem. Normalerweise war das Hennys Stammplatz. Hier war es schön mollig warm und Henny hatte „Rücken“, wie sie zu sagen pflegte. Hermann stellte seine nackten Füße auf der Stuhlkante auf und schlang seine Arme um die angezogenen Knie. Der Ofen bollerte und verströmte eine angenehme Hitze. Obendrauf knurrte noch die Kanne mit dem Kaffee vom Nachmittag vor sich hin. Sicher war er schon ganz bitter und klebrig. Der Stuhl knarrte, als Hermann sich bewegte. Das Holz war trocken von der Wärme und hatte sich zusammengezogen. Doch noch hielt es. Henny schnitt Hermann eine dicke Scheibe Graubrot vom Laib, bestrich sie mit Butter und Leberwurst und goss ihm Milch in einen Becher. Die Erwachsenen tranken Bier.
„Worüber habt ihr gerade gesprochen?“ fragte Hermann und biss in sein Butterbrot. Es schmeckte herrlich. Die Krume war weich, die Kante knusprig. Henny hatte das Brot auch am Morgen gebacken, genauso wie den Butterkuchen, den er so liebte. Von dem Kuchen jedoch war nichts mehr übrig. Hannah zückte eine neue Zigarette aus ihrer Schatulle. „Nix, was für deine Ohren bestimmt ist“, sagte sie eine Spur zu unwirsch.
Hermann wusste es trotzdem. Sie hatten über ihn gesprochen und wie es mit ihm weitergehen sollte. Er war jetzt nämlich ein Waisenkind. Eine „Vollwaise“ wie er heute gelernt hatte.
Wie fast jeder in seiner Klasse war Hermann ohne Vater aufgewachsen, entweder waren die Väter gefallen, verschollen oder noch in Kriegsgefangenschaft. Und nun war auch seine Mutter tot. Kauend betrachtete Hermann seine Tante. Hannah war 33 und die Älteste von Henny und Oskars Kindern. Seine Mutter Sophie war zwei Jahre jünger gewesen, danach folgten Gerd und mit großem Abstand Hans, der 20 Jahre alt war und von Henny vergöttert wurde. Hannah kam vom Wesen her ganz nach ihrer Mutter, hart im Nehmen und im Geben. Und sie war schön. So schön, dass sie es noch besser getroffen hatte als Else mit ihrem reichen Bauern.
Einige der Trauergäste hatten Hannah seit Jahren nicht gesehen und bemerkten mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung die edle Kleidung und den teuren Schmuck, den sie trug. „Die ischa’n büschen etepete geworden“, raunte Frau Diemers ihrem Mann zu als Hannah in die Kapelle trat.
Hermann fand, dass seine Tante ein bisschen aussah wie Rita Hayworth. Erst neulich hatte er die amerikanische Filmschauspielerin auf einem großen Kinoplakat gesehen. Die beiden Frauen hatten die gleichen Haare, die gleichen verführerisch blickenden Augen. Hannahs Gesichtszüge waren zwar etwas markanter, aber der Mund war weich und hübsch geschwungen, die Lippen dunkelrot geschminkt.
Wie eine echte Dame saß Hannah auf dem Holzstuhl. Den Rücken durchgedrückt, die Beine leicht schräg nebeneinander aufgestellt. Und dann ihre Garderobe: Für die Trauerfeier hatte Hannah ein schwarzes Kostüm gewählt. Dazu trug sie schwarze halblange Handschuhe, Nylons und schwarze Pumps. An ihrem Hut, der mehr Kopfschmuck als Bedeckung war, hing ein kleiner schwarzer Schleier, der, wenn sie ihn herunterzog, ihr halbes Gesicht bedeckte. Zuhause zog sie die Handschuhe aus, weiße langgliedrige Finger kamen zum Vorschein, die Fingernägel dunkelrot lackiert. Kaum zu glauben, dass Hannah aus einer Arbeiterfamilie stammen sollte.
Ihre Schönheit war ein Segen für sie alle gewesen. Als die ersten Gerüchte über das „Fräuleinkarussel“ vor dem Kasino der Amerikaner aufkamen, ließ sie sich schon von ihren Liebhabern im Jeep durch die Stadt kutschieren. Stets kam Hannah mit einer Wurst, Konserven oder Zigaretten nach Hause. Henny rümpfte zwar die Nase über ihre älteste Tochter, nahm die Annehmlichkeiten jedoch gerne an. „Jede Zeit erfordert ihre Opfer“, sagte sie entschuldigend.
Den Volltreffer landete Hannah bei einer Abendveranstaltung der amerikanischen Militärregierung in Bremen. Dort lernte sie Heinrich Hesekamp kennen. Hesekamp war Physiker. Vor dem Krieg war er in die USA emigriert. Sein ehemaliger Doktorvater lehrte am Massachusetts Institute of Technology und hatte ihn als seinen Mitarbeiter nachgeholt. An der MIT promovierte Hesekamp und verfasste seine Habilitationsschrift. Gebürtig stammte er aus Bremen. Daher war er gerne der Einladung gefolgt, an jenem Abend die dinner speech über die neuesten Entwicklungen in der Kernphysik zu halten. Von dort aus sollte es für ihn an die Universität Heidelberg gehen, die ihm eine Professur angeboten hatte.
Wie Hannah den spröden Wissenschaftler im Laufe nur eines Abends von sich überzeugen konnte, war Henny ein Rätsel. Auch wie Hannah es überhaupt geschafft hatte, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Doch einen Monat später packte Hannah ihre Koffer und zog zu Hesekamp nach Heidelberg, wo die beiden heirateten.
Sophie hätte auch gerne einen Mann kennengelernt. Anfangs, als das Fraternisierungsverbot gerade aufgehoben wurde, hatte sie ihre Schwester zu den amerikanischen Tanzveranstaltungen im Rotkreuzclub in der Glocke noch begleitet. Doch dann wurde sie krank geworden. Hermann hätte nichts gegen einen Amerikaner als Stiefvater gehabt. Im Gegenteil. Er mochte die Amerikaner sehr.
Den ersten sah er als er etwa fünf Jahre alt war. Hermann ging gerade mit seiner Mutter die Obernstraße hoch zur Straßenbahnhaltestelle. Auf der anderen Straßenseite umringte eine Gruppe von Kindern vier GIs. Sie bettelten um Zigaretten, die sie auf dem Schwarzmarkt zu tauschen hofften.
„Häff ju ä Zigarett for mein Vadder?“ hörte Hermann ein Mädchen sagen und sah, wie die GIs den Kindern Schokolade gaben. Er wollte auch hingehen, doch Sophie hielt ihren Jungen fest an der Hand.
„Betteln ist nicht erlaubt“, sagte sie streng und wollte weitergehen. Hermann jedoch blieb stehen und warf den Kindern verstohlene Blicke zu, als ihn einer der Männer bemerkte, sich aus der Gruppe löste und auf ihn zukam.
„Hey, Buddy. What’s your name?" fragte der Soldat, hockte sich vor Hermann hin und entblößte eine Reihe schneeweißer Zähne. In seiner Hand hielt er einen Block Schokolade, die in glänzendes Silberpapier eingewickelt war. Die Haut des Mannes war schwarz. Hermann hatte noch nie zuvor einen Schwarzen gesehen und noch nie so weiße Zähne. Er schmiegte sich eng an die Beine seiner Mutter, konnte aber den Blick nicht von dem Stück Silberpapier abwenden. Der GI lachte, brach eine Rippe von der Schokolade ab und gab sie dem Jungen. Dann klopfte er Hermann auf die Schulter, sprang auf und verschwand. Hermann war verwirrt, in seinem Kopf rasten die Gedanken durcheinander. Noch nie hatte ihm jemand Schokolade geschenkt. Dafür gab es nur eine Erklärung.
„Mama?“
„Ja?“
„War das Papa?“
Sophie schnappte hörbar nach Luft. „Wie bitte? Schätzchen, dein Papa ist im Himmel, das weißt du doch.“
„Ja, aber du hast doch gesagt, dass er ein Soldat war.“
Sophie schaute ihren Sohn an. Es brach ihr das Herz, wie er sie mit seiner Schokolade in der Hand erwartungsvoll anblickte. Sie kniete sich hin, nahm ihn in die Arme und drückte ihn fest an sich. Dann legte sie Hermann beide Hände auf die Schultern und blickte ihm fest ins Gesicht. Sie versuchte ihrer Stimme einen unbekümmerten Klang zu geben: „Stimmt mein Schatz, du hast Recht, dein Papa war Soldat. Der Mann eben war aber ein amerikanischer Soldat. Dein Papa ist schon vor langer Zeit gestorben und liegt auf Bornholm begraben.“
„Bornholm? Ich dachte, er ist im Himmel!“
„Ja, seine Seele ist im Himmel. Begraben ist er auf Bornholm. Das ist eine dänische Insel und weit weg.“
„Ach so.“
Hermann vermisste seinen Vater nicht. Er kannte ihn ja nicht. Nur manchmal, wenn er andere Kinder mit ihren Vätern sah, packte ihn die Sehnsucht. Da fragte er nach und wollte wissen, wie sein Vater ausgesehen hatte. Da lachte seine Mutter nur und sagte: „Dein Vater war genauso ein hübscher Bengel wie du!“
Wenige Monate nach der Begegnung mit dem freundlichen GI erkrankte Sophie. Zunächst war sie nur erschöpft und verspürte trotz der harten Arbeit in der Wäscherei keinen Appetit. Zudem plagte sie ein hartnäckiger Husten. Eines Tages entdeckte Sophie blutige Schlieren im Taschentuch. Henny schalt sie: „Sophie, so geht das nicht, du musst zum Arzt. Oder willst du uns etwa alle anstecken?“
Sophie kam direkt auf die Tuberkulose-Station in Friedehorst. Während ihres Reichsarbeitsdienstes hatte sie Tuberkulosepatienten versorgen müssen und sich offenbar selbst angesteckt. Jetzt erst war die Krankheit ausgebrochen. Immer schon schlank gewesen, magerte sie innerhalb kürzester Zeit ab, so dass sich die Rippen unter der dünnen Haut abzeichneten. Mit einem Mal war ihre Nase keine Stupsnase mehr, sondern ragte spitz aus dem eingefallenen Gesicht hervor. Die zwei Grübchen zeichneten sich scharf auf der bleichen Haut ab. An ihrem Körper war nichts mehr rund und weich. „Wer nimmt mich schon mit diesen Beinen?“, fragte sie Hannah bei einem ihrer Besuche, schlug die Decke beiseite und lachte beim Anblick ihrer dürren Waden und Oberschenkel bitter.
Im Dezember 1950 bestand sie nur noch aus pergamentdünner Haut und Knochen. Die nassgeschwitzten Haare klebten an ihrer Kopfhaut. Hannah versuchte vergeblich, für ihre Schwester Penicillin auf dem Schwarzmarkt zu ergattern. Das Medikament galt als das neue Wunderheilmittel. Doch es war knapp und nur für Amerikaner zur Syphilis-Behandlung vorgesehen, da halfen auch Hannahs gute Beziehungen nichts. Wegen der Ansteckungsgefahr durfte Hermann seine Mutter im Krankenhaus nicht besuchen. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als sich unten in den Krankenhauspark zu stellen und ihr von dort zuzuwinken. Seine Mutter winkend auf einem Balkon. Dies sollte das Letzte sein, was Hermann von seiner Mutter zu sehen bekam. Am Ende schaffte sie es nicht mehr von dem Stuhl hoch. Im März 1951 starb Sophie mit 31 Jahren. Und Hermann sollte in jenem Sommer zehn Jahre alt werden.
Das Fahrrad
In den ersten Wochen nach ihrem Tod dachte Hermann noch oft an seine Mutter. Auch als sie bereits im Krankenhaus gelegen hatte, war sie in seinem Alltag präsent. Man unterhielt sich über ihren Gesundheitszustand, sie strickte Strümpfe für alle und ließ ihm Grüße ausrichten. Jetzt sprach kaum noch jemand von ihr und seine Erinnerungen verblassten. Das Schlimmste für ihn war, dass er sich fortan das Zimmer mit Hans teilen musste. Hans war ein unberechenbarer Taugenichts. Ein falsches Wort und Hermann bekam eine Backpfeife. Seine Mutter hatte ihn immer beschützt, wenn Hans ausrastete, nun musste er alleine mit seinem Onkel zurechtkommen. Auf seine Großeltern konnte er in diesem Fall nicht zählen. Hans passte die Augenblicke ab, wo er alleine mit Hermann war. Und wenn Hermann sich an seine Großeltern wandte, so fand Henny immer eine Ausrede für ihren jüngsten Sohn. Henny liebte diesen Nichtsnutz auf sonderbare Weise und Oskar durfte sich nicht einmischen.
So oft es ging, verbrachte Hermann die Zeit draußen. Sein bester Freund war Jürgen Koch. Sie wohnten im gleichen Haus und gingen in die gleiche Klasse. Meist spielten sie Fußball. Ihr Nachbar Herbert Schlehn besaß eine Kirsche, einen echten Lederball. Der Ball war dunkelbraun und hatte eine dicke weiße Naht. Eines Nachmittags spielten sie vier gegen vier. Einer im Tor, drei auf dem Feld. Herbert wählte Jürgen, Hermann und Schorse in seine Mannschaft. Mit ihren Pullovern markierten sie die Tore. Sie waren mitten im Spiel, als Jürgen den Ball nach links verschoss. Sie hörten Glas klirren und eine Frau vor Schreck laut aufschreien.
„Mist!“, fluchte Herbert.
„Au Backe!“ sagte Schorse.
„Ausgerechnet bei der Martens, die meckert eh schon immer rum!“ stöhnte Hermann.
Nur Jürgen sagte nichts. Er blickte ungläubig auf die zerborstene Scheibe.
„Was ist Jürgen? Hol den Ball!“, forderte Herbert ihn auf.
„Mein Vater“, sagte Jürgen. „Wenn mein Vater das mitkriegt.“ Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er schluckte.
„Ich geh‘ schon“, sagte Hermann.
„Was?“ Jürgen schaute Hermann an.
Der nickte und wiederholte: „Ich geh‘ und hole den Ball.“
Hermann verschwand im Hauseingang. Er würde einfach behaupten, er sei es gewesen. Zwar wusste er nicht, wie er es Henny und Oskar beibringen sollte, aber wenigstens drohte ihm kein Unheil. Manchmal war es eben doch besser, wenn man keinen Vater hatte, zumindest keinen, der einen prügelte. Zaghaft drückte er auf die Klingel von Frau Martens. Später wusste er nicht mehr, was sie ihm alles entgegengeschleudert hatte. Er erinnerte sich nur an ihr dickes rotes Gesicht und ihren verzerrten Mund. Er murmelte eine Entschuldigung, doch die Martens weigerte sich, ihm den Ball auszuhändigen. Hermann verstand, dass sie auf eine Entschädigung pochte. Er nickte ungeduldig.
„Ja, machen wir doch, ich sage meinem Opa Bescheid, der repariert das wieder!“
Henny schnaubte, als sie von dem Unglück hörte. „Und warum nimmst du das auf deine Kappe? Das kann doch Jürgens Vater selber reparieren, das müssen wir doch nicht machen!“
„Bitte Oma, du darfst Jürgens Eltern nichts sagen. Jürgen hat versprochen, die Scheibe zu bezahlen. Er wird das Geld schon irgendwie besorgen. Opa muss sie nur einsetzen, sonst fliegt alles auf“, bettelte Hermann.
Henny warf Oskar einen Blick über den Tisch zu. Sie saßen in der Küche. Lore hatte Axel nach seinem Mittagsschlaf geweckt und versuchte ihm beizubringen, mit Messer und Gabel den Kartoffelbrei und die Frikadellen zu essen. Hans war beim Boxtraining. Gerd las die Zeitung.
„Also wenn ihr mich fragt, würde ich es machen“, sagte Lore und sah auf. Axel nutzte den Augenblick, langte mit seiner Hand in den Kartoffelbrei und schmierte ihn in seine Haare. „Oh du Ferkelchen!“ schimpfte Lore.
„Dich hat aber keiner gefragt. Jetzt siehste, was du davon hast!“ sagte Gerd bösartig. Lore warf ihm einen wütenden Blick zu, verkniff sich aber eine Erwiderung.
Da stand Oskar auf.
„Oskar, wo willst du drauf los?“ fragte Henny.
„Ich hol‘ den Hammer und mach der Martens erst einmal ein Brett vors Fenster. Jürgen soll die Scheibe besorgen, dann erledige ich den Rest“, antwortete er und ging Richtung Keller. Hermann rannte ihm hinterher. Von hinten umschlang er Oskars Beine. „Danke Opa!“
„Da nicht für!“ Er streichelte Hermann über den Schopf. „Los, und jetzt sag Jürgen Bescheid!“
Hermann stürmte aus der Wohnung. Erleichtert über den Ausgang und froh, der schlechten Stimmung zwischen Gerd und Lore entkommen zu sein.
Wochen später – die Scheibe war längst repariert – stiegen die Temperaturen bereits in der ersten Juniwoche auf über 25 Grad. Es war heiß und Jürgen holte Hermann zum Schwimmen ab.
„Hermann, nu‘ komm inne Puschen!“ Ungeduldig trat Jürgen von einem Bein aufs andere. Seine Haare waren verschwitzt und die Kniestrümpfe verrutscht. Er, der eh stets gerötete Bäckchen zu haben schien, glühte heute noch mehr, aber nicht, weil ihm so warm war, sondern vor Aufregung.
Hermann schulterte seine Tasche mit den Schwimmsachen und sprang die letzten Stufen runter auf den Bürgersteig. Jürgen wippte auf den Zehen und strahlte.
„Was ist los? Warum hast du es so eilig?“, fragte Hermann.
„Die haben bei Dutschke ein neues Fahrrad! Das musst du dir angucken! Komm mit!“
„Ich dachte, wir wollten schwimmen gehen!“
„Danach! Komm, es dauert nicht lange!“
Jürgen hatte von seinen Eltern zu seinem zehnten Geburtstag ein eigenes Fahrrad versprochen bekommen. Seitdem redete Jürgen von nichts anderem mehr. Sie überquerten die Gröpelinger Heerstraße und bogen in die Lindenhofstraße ein. Vor dem Schaufenster des Fahrradhändlers blieben die beiden Jungs stehen. Hermann sah das Fahrrad sofort. Genauer gesagt, waren es zwei. Zwei Sporträder. Ein weinrotes und ein blaues. Davor ein Reklameschild mit einem Foto von einem Hercules-Fahrrad, das mit einem Seil zwischen zwei Zugwaggons befestigt war.
„Mensch, schau dir das an. Guck mal, was da geschrieben steht: ‚Stark wie der sagenumwobene Held Hercules! Dieses Fahrrad kann acht vollbeladene Waggons hinter sich herziehen und hat die berühmte Zerreißprobe mit Bravour bestanden!“ las Jürgen laut vor. Seine Augen leuchteten und auch Hermann war fasziniert. Er trat näher an die Schaufensterscheibe heran und schirmte seine Augen vor der blendenden Sonne ab. Das rote Fahrrad gefiel ihm besonders. Es hatte einen leicht geschwungenen Lenker mit blanken Handgriffen. Auf dem Boden drapiert lagen die dazugehörigen Lenkerbänder in schwarz und weiß. Daneben noch ein Tachometer und eine Radlaufklingel. In einem Ständer steckte eine Auswahl bunter Wimpel. An ihnen baumelten die Preisschilder. Hermann





























