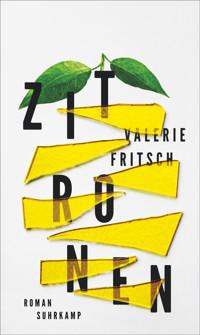10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wird ein Kind zu einem mitfühlenden sozialen Wesen, wenn es die Verwundbarkeit nicht kennt? Wenn es nicht versteht, wie sehr etwas wehtun kann? In eindringlichen Bildern erzählt Valerie Fritsch von einem Trauma, das über die Generationen weiterwirkt.
Alma und Friedrich bekommen ein Kind, das keinen Schmerz empfinden kann. In ständiger Sorge um ihren Jungen kontrolliert Alma unaufhörlich seine körperliche Unversehrtheit. Halt findet Alma bei ihrer hochbetagten Großmutter, die nach lebenslangem Schweigen zu erzählen beginnt: vom Krieg, von Flucht, Hunger und Entbehrungen. Mit dem Kind auf dem Schoß, das keinen Schmerz kennt, sitzt Alma am Bett der alten Frau, die sich nichts mehr wünscht, als ihren Schmerz zu überwinden. Und in den Geschichten der Großmutter findet sie eine Erklärung für jene Gefühle der Schuld, der Ohnmacht und der Verlorenheit, die sie ihr Leben lang begleiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Valerie Fritsch
Herzklappen von Johnson & Johnson
Roman
Suhrkamp
Widmung
Zum Gedenken an Ilse
Motto
Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte des Schmerzes. Vladimir Nabokov
Tomorrow belongs to those who can hear it coming. David Bowie
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
I
Alma war ein ungeduldiges Kind, das nicht verlieren konnte, bei Brettspielen betrog, lieber schrie als schwieg, die Hände oft zu Fäusten ballte, die auch im Schlaf selten aufgingen. Das Elternhaus war immer leer, kathedralisch, zu groß für einen kleinen Menschen. In der Wohnstube hing ein riesenhaftes Gemälde mit Weintrauben, so lebensecht, dass im Sommer die Vögel durch die offenen Fenster in den Raum flogen und versuchten, sie von der Leinwand zu picken. So still war es, dass einen schon das leiseste Geräusch erschreckte, und wenn das Telefon klingelte, dachte man stets, es läutete im eigenen Kopf. An den heißen Tagen beschäftigten Alma die Vogelstimmen im Garten, dann stand sie draußen unter den Bäumen und hörte dem unsichtbaren Orchester mit angehaltenem Atem zu, aber sooft sie es auch probierte, zum Nachsingen waren die Tonfolgen nicht geeignet. Mit jedem Jahr, das sie älter wurde, erschien sie mehr auf der Welt. Mit jedem Jahr wurde sie sichtbarer auf ihr, wuchs in die eigenen Formen, nahm ihren Platz ein, hineingeboren ins Fragen und in die Lücke, die auf der Welt war, bevor ein Mensch sie füllte. Die Wirklichkeit des Hauses, in dem sie wohnte, erschien ihr bald als eine, auf die man sich nicht verlassen konnte. Sie beobachtete, wie die Eltern durch die Räume geisterten, mal Mutter und Vater spielten, dann das liebende Ehepaar gaben und hin und wieder Besuch empfingen, für den sie lachten. Mit dem Großvater aß man sonntags manches Mal gemeinsam im Garten zu Mittag, bei stockenden Gesprächen, mit Spritzwein und kleinen Käfern, die aus den großen Bäumen in die Suppe fielen wie Pfefferkörner. Wann immer Alma ihre Eltern mit dem alten Mann sah, dachte sie, dass man den Menschen anstelle einer Sprache auch ein Schweigen beibringen konnte. Und immer gab es zum Abschluss Kaffee und Torte, so fett, dass die Sahne beinahe schon Butter war, oder so trocken, dass man scherzte, das Gebackene würde einem zu den Ohren herausstauben, je nachdem, ob es aus der Küche der Mutter oder aus der Konditorei kam; und es gab Kinderspiele. Noch viele Jahre später erinnerte sich Alma, wie sie an trägen Sonntagnachmittagen die Finger und nackten Zehen der Anwesenden mit einem Reim abzählte und stets ins Stolpern geriet und verwirrt innehielt, wenn sie beim Großvater angekommen war, weil sie an seinem rechten Fuß bloß drei Zehen fand. Dass womöglich nicht nur an dem alten Mann etwas fehlte, aber es überall mehr gab, als man sie sehen ließ, wurde für Alma ein vager Gedanke, ein unbestimmtes Kindheitsgefühl, dem sie sich nicht entziehen konnte. Stets fühlte sie sich um etwas betrogen, von dem sie nicht recht wusste, was es war – als prallte sie ab an der Wirklichkeit. Selbst die Früchte in den Schalen des großen Zimmers waren aus Kristall, durchsichtig und so hart, dass man sich die Zähne ausbeißen konnte an ihnen. Ihr Zuhause schien ihr mitunter beängstigend kulissenhaft, es war keine Scheinwelt, aber brüchig zusammengezimmert, wackelig und unstimmig in den Einzelheiten, als wären sie nur geborgt. In jeder Ecke stieß sie auf Kleinigkeiten, die nicht zueinanderpassten und dem prüfenden Blick nicht standhielten, leise umfielen, wenn man sie zu lange ansah. Manche verschwanden ganz, andere kamen wieder in veränderter Gestalt oder ungenügend maskiert. Man schwieg mit offenem Mund. Unterhaltungen erstarben, wählte man auch nur ein einziges falsches Wort, das man noch Minuten zuvor für unverdächtig gehalten hatte. Eine Sorge tauchte plötzlich als Ärger auf, eine Geste der Zuneigung lief ins Leere, ein harmloser Satz wurde zum Vorwurf, ein Lachen misslang und verwandelte sich in einen weggedrehten Kopf. Manches verschob sich beinahe unmerklich, blieb sich selbst aber ähnlich genug, so dass man nur kurz stutzte und dann darüber hinwegsah. Die Gefühle schienen künstlich und unbeständig und ärgerten den Kinderblick. Es war, als hätten alle Menschen in Almas Leben etwas zu verbergen, die Eltern und die Großeltern, deren Verhältnis untereinander und zur Welt so gespannt war, dass man es gerade noch ertrug. Alma wurde die Idee nicht los, dass man für sie Theater spielte. In jedem Zimmer war eine Bühne errichtet für die endlosen Vorstellungen, in denen alle ihr Bestes gaben und stets heimlich enttäuscht davon waren, dass der Applaus für ihre Mühen ausblieb. Die Rollen waren von unsichtbaren Kräften zugewiesen worden, und Unsicherheiten kompensierte man mit Vehemenz. Als Alma größer wurde, dachte sie, wie erschöpfend es sein musste, im eigenen Lebenswerk nicht Regie zu führen, sondern darin nur mitzuspielen, in einem Lehrstück ohne Pause, die einen erlöste, ohne Vorhang, der je fiel. Maschinen der eigenen Biographie, die Lebenslügen produzierten, sich mal als diese, mal als jene Version ihrer selbst ausgaben. Müde Marionetten mit einem schwarzen Fleck auf dem Herzen, die um ihr Leben spielten, sich immerzu bückten, aber sich nie verbeugen durften.
Die Eltern stritten nur in der Nacht, im Schutz der Dunkelheit, als würden sie glauben, die späten Stunden verbärgen sie vor der Welt. Oft stand Alma lauschend an der Tür, ein kleines Gespenst mit bloßen Füßen, ein blasses Kind in blassen Kleidern, das erst laute Schritte oder jene Müdigkeit, die einen innen und außen frieren ließ, zurück ins Bett trieb. Sie verstand nichts und riss die Augen auf, so weit sie konnte, um besser zu hören, aber vernahm doch nur das erstickte Auf und Ab der Stimmen und die Atemlosigkeit, wenn man einander das Gesagte nicht glauben wollte. Die Eltern sprachen wie Fremde hinter verschlossenen Türen, und gerne hätte sie die weißen Holzflügel aufgerissen und nachgesehen, ob sie mit den neuen Redeweisen auch ein anderes Gesicht trugen. Denn in der Nacht waren die Regeln des Tages aufgehoben. War Almas Vater tagsüber ein unauffälliger Mann, der sich den Ordnungssystemen der Mutter mit einer irritierenden Dankbarkeit unterwarf, stets lieber Knecht als Herr, so dass es einem leichter fiel, ihn zu vergessen, als an ihn zu denken, so wurde er nachts laut und traurig. Die Mutter schwieg zur Verteidigung, und man hörte ihre Schmallippigkeit durch die Wände. Sie war eine penible Person in einem klinisch sauberen Haus, in dem sie jeden Dienstag die Regale abstaubte, bevor die Putzfrau jeden Mittwoch kam. Eine Frau, stets kontrolliert und immer so freundlich, als müsste sie etwas nicht nur gut, aber wiedergutmachen, ungeeignet für jeden Streit, denn Vorwürfe und andere Meinungen machten sie erst untröstlich, dann krank, und wie zur Strafe hungerte sie und schluckte für Tage nur ihre Seufzer hinunter, ansonsten keinen Bissen. Die Welt um sie herum war so sorgfältig organisiert, dass Unvorhergesehenes darin keinen Platz fand und darum erst gar nicht geschah. So kam es, dass Alma nicht nur die Nächte voll Streit auf merkwürdige Art und Weise mochte, aber auch jene seltenen, in denen die Mutter schlafwandelte. Es waren magische Momente der Unordnung, Verstöße gegen die von ihr selbst aufgestellten Gesetzmäßigkeiten, die Alma mit eigenartiger Befriedigung beobachtete. Die reservierte, stets kontrollierte Mutter wurde zur Irren im Nachthemd, der Alma, aufgeschreckt von einem ungewöhnlichen Geräusch, staunend folgte. Das Weiß des Stoffes leuchtete ihr den Weg. Es war eine hemmungslose Verwandlung. Der Mutter stieg in dunklen Nächten der Mond zu Kopf, durchbrach ihre Gefasstheit und machte sie planetensüchtig, fiebrig und außerirdisch. Er öffnete ihr die Augen und zog ihr die Lider an den Wimpern hoch, bis ein starrer Blick hervorkam, der ins Leere sah. Er ließ sie aufstehen aus dem Ehebett und führte sie wie eine Mondpuppe an unsichtbaren Fäden durch das nächtliche Haus, auf labyrinthischen Bahnen und die Teppichmuster in den Korridoren entlang. Auf sein Geheiß öffnete sie Türen und stand in Schränken, nahm sie die Kuchenteller aus der Vitrine und ließ sie im Kreis um sich herum fallen, als deckte sie einen Tisch. Sie griff nach jedem Lichtschein, wanderte durch den eigenen Garten und jenen des Nachbarn, holte man sie nicht schnell genug zurück. Sie ging mit sicherem Tritt, stieß unbeeindruckt gegen Mauerkanten und Regentonnen, Obstbäume und Zaunpfähle, stürzte manchmal die Treppen und manchmal die Straße hinunter und kehrte erst an der Hand des Vaters ins Bett zurück. Einmal lief sie bis zum Friedhof und stand vor einem fremden Grab, weiß wie eine Kerze, bis ein nächtlicher Spaziergänger sich zu Tode erschrocken an die Polizei wandte, die sie nach Hause begleitete. Stets schlief sie weiter, als wäre nichts geschehen, und kam morgens zu sich, mit winzigen Kratzern und blauen Flecken, aber ohne Erinnerung. Als Kind jubelte Alma über die kleinen nächtlichen Vorstellungen, klatschte in die Hände über die verrückte Mutter, die sich selbst ähnlicher schien unter Mondeinfluss, unverkrampft, beinahe fröhlich und selbstbestimmt. Auch mochte Alma die Schauergeschichten des Vaters, die er ihr ein ums andere Mal erzählte, um sie zu gruseln, und auch seine Enttäuschung, wenn sie sich nicht genug fürchtete. Mit großem Ernst berichtete er von den schlaftrunkenen Nachbarn seines Kindheitsortes, die meinten Gespenster zu sehen, wenn sie nachts, geweckt von den Schritten der Somnambulen, am Fenster standen und in ihrer Angst zum Gewehr griffen und auf die weißen Gestalten im Mondschein schossen, so dass man mit dem ersten Licht des Tages einen Toten im Schlafanzug am Wegesrand fand. Einen Nachtikarus, sagte der Vater am Ende jeder Geschichte missbilligend, einen, der dem Mond zu nahe gekommen war. Aber Alma mochte die Mondsucht der Mutter und auch ihre Vergesslichkeit und war froh, dass sie am Tag nach ihren lunatischen Wanderungen stets lebte, wenn auch zurückverwandelt und beschämt von den Taten, die man ihr berichtete. Nur einmal verschwieg man sie ihr, als Alma mitten in der Nacht aufwachte, weil das dunkle Haus erfüllt war von Musik. Im Wohnzimmer saß die Mutter nackt am Klavier und spielte Der Lindenbaum aus Schuberts Winterreise, mit großen Augen und Gänsehaut auf den Brüsten, die Beine weit gespreizt.
Ansonsten hörte man selten Geschichten im großen Haus, es wurde nicht viel gesprochen und nicht viel gefragt. Wenn doch, gab es in diesen frühen Jahren anstelle von Erklärungen stets Stille als Reflex, als wäre sie eine gültige Antwort auf alle Kinderfragen. Es herrschte ein Schweigen, das man entlarven wollte, eine Stille, die zornig machte. Jedes Kind spürt die Lüge im Ungesagten. Und die Angst. Wenn man klein ist, fürchtet man sich vor der unsichtbaren Welt, dem Verborgenen und Verstellten, vor diesem einen Ort, den man sich ausdenkt und hinter verschlossenen Türen vermutet, voller Geister, Monster, Fremder, die man nicht beweisen kann, und Vertrauter, die man nicht wiedererkennt. In jeden Spalt und in jede Dunkelheit füllt man das Vorgestellte. Die Schlüssellöcher sind die Schatten der weitaufgerissenen Münder der Kinder, die hinter den Türen auf die Geheimnisse der Erwachsenen warten. Man wird mit einer Wirklichkeit ausgestattet als Kind, die man nicht mehr loswird. Alma war ein ungeduldiges Kind, das die angebotenen Erzählungen mit ihren Fehlern und Widersprüchen oft nicht überzeugten. Die Lebensgeschichten ihrer Großeltern und Eltern verwirrten sie vor allem anderen, es waren undeutliche, unverständliche Biographien voller Lücken, ein inkohärenter Zeitstrahl, auf dem sie sich nicht zurechtfand. Sie fühlte eine innere Erfahrung, die nicht mit der äußeren Wirklichkeit übereinstimmte, ein fremdes, unleugbares Wissen von Dingen, die ihr selbst nicht widerfahren waren. Zu schüchtern, um Fragen zu stellen, hielt sie in jedem Gespräch Ausschau nach einem Baustein, einer Einzelheit, einem Stück Welt, mit dem sie die Zwischenräume füllen und die Brüche erklären könnte. Der Ehe der Eltern misstraute sie mit den Jahren mehr und mehr, beargwöhnte deren schonenden, aber gleichgültigen Umgang miteinander, und immer war sie sich unsicher, ob die Mutter und der Vater zu viel oder zu wenig voneinander wussten. Nur in den nächtlichen Auseinandersetzungen erahnte sie eine Art Liebe – das, was sie gewesen, und das, was sie geworden war. Der Großvater kam sonntags zu Besuch, wie es sich gehörte, ließ die Nähe mit aufeinandergepressten Lippen über sich ergehen und bekam zu jedem Abschied für die zu Hause gebliebene Großmutter ein Stück Kuchen eingepackt. Der Grat zwischen einem Schweigen und dem, was man noch sagen durfte, war schmal. Seine Geschichte war der Krieg, und sie wurde nur erzählt, wenn es sich nicht vermeiden ließ, hinter vorgehaltener Hand, in ritualisierter Form, einer verdrehten Chronik folgend, die es mit dem Anfang und dem Ende nicht so genau nahm. Sie klang immer falsch und war so verwirrend, dass man die Opfer und die Täter verwechseln konnte und die Tage- mit den Geschichtsbüchern, wenn man nicht scharf mitdachte. Seine Geschichte begann mal hier und mal dort und klang, als wäre der Großvater kein aktiver Teil davon gewesen, als hätte er die beschwerlichen Zeiten nicht selbst gelebt und als wäre ihm der Krieg, der immer noch nicht richtig zu Ende schien, bloß zugestoßen. Wie ihm die Zehen fehlten am Körper, fehlten dem Bericht die Einzelheiten und die Jahreszahlen. Nichts wünschte sich Alma mehr in diesen Gesprächen als einen Augenblick der Klarheit und hoffte ein ums andere Mal, dass jemand aus der Rolle fiele und brüllend aufspringen würde, um in höchster Erregung zu fragen, wie es denn nun wirklich gewesen war, und ahnte schon, dass dieser Wunsch wohl nicht in Erfüllung gehen würde. Am besten merkte sich Alma die großen, gleichgültigen Wörter des Krieges, sie waren im Übermaß vorhanden, wurden wie Versatzstücke herumgeschoben, waren schwer wie Steine, wenn man sie im Kopf abwog. Als Kind saß sie unter dem Tisch und hörte zu, später saß sie so still dabei, dass sie die Erwachsenen nicht bemerkten, sammelte Begriffe ein, Gewehr und Bombe und Soldat und Frieden, und führte in Gedanken ein kleines Wörterbuch der entrückten Vergangenheit, in dem sie manchmal nachschlug, wenn sie die Gegenwart nicht gut genug verstand. Es dauerte viele Jahre, bis das Gehörte Sinn ergab, und während Alma während des Tages über Zusammenhänge nachdachte oder sie vergaß, träumte sie nachts von diesem Krieg in klaren und klirrenden Bildern. Es war, als hätten ihr die Großeltern ihr eigenes Schicksal in den Doppelhelixsträngen der DNA weitergegeben, als hätten sie ihr das Dunkel der Luftschutzkeller und die Kälte der Front in den Leib gepflanzt, als hätten sie im Körper der Enkelin die komatöse Stille der Kriegstage zwischen den Bombenangriffen haltbar gemacht, einen unbestimmten Hunger, eine unbestimmte Last. Als hätte ihr die Großmutter ein eingestürztes Haus vermacht und der Großvater die Erinnerungen seiner Soldatenjahre und seiner Gefangenenjahre vererbt. Und auch tagsüber kam es vor, dass sie vor einem grauen Himmel meinte die Bomben von damals fallen zu sehen, für eine Sekunde nur, als wären sie ihr auf die Netzhaut tätowiert. Manchmal schien ihr, sie habe unfreiwillig ein Erbe angetreten, von dem sie nicht genau wusste, worin es bestand.
Jahre später, als sie lange erwachsen war, las sie beim Zahnarzt in einem Magazin von einem Experiment, in dem man Mäusen beibrachte, sich vor dem Geruch von Kirschblüten zu fürchten; die wiederum gaben ihre Angst vor dem Blütenduft an ihre Jungen weiter. Sie kamen mit erfahrungsbasiertem Wissen ohne Erfahrung zur Welt. Nicht nur die Erbsubstanz, aber die Erinnerungen ihrer Eltern steckten ihnen in den Knochen, einem genetischen Gedächtnis gleich. Alma stellte sich vor, wie die neugeborenen Mäuschen in einem Labor vor den prächtigen Blüten saßen und bangten, ohne zu wissen, warum, als bereite ihnen nur deren Schönheit Entsetzen.
Auch von der Kindheit und Jugend der Eltern hörte Alma nur in Nebensätzen, auf den Topos der müden Mütter und cholerischen Väter stieß sie erst später in den Geschichtsbüchern. Sie waren aufgewachsen in einem Krieg, den es nicht mehr gab, der auf der Welt, aber nicht in den Menschen zu Ende gegangen war, in einem Schattenkrieg, einer verrutschten Wirklichkeit, die man nicht loswurde. Sie waren groß geworden in Haushalten der Unverfügbarkeit, in denen jedes Kinderleid zu klein war, um ernst genommen zu werden, weil es nicht heranreichte an die schmerzhaften Erfahrungen der Kriegsgeneration. Ein verbrannter Finger, ein aufgeschlagenes Knie, ein Alptraum waren nicht der Rede wert gewesen, für dergleichen hatte es nur zerstreutes Unverständnis und im besten Fall halbherzigen Trost gegeben, wurde die Mutter nicht müde zu erklären, wann immer sie sich pflichtbewusst über die geschundenen Finger, Knie und Träume ihres Kindes beugte. Als Alma größer wurde, erkannte sie, dass in der Kindheit der Eltern die Erwachsenen immer fern gewesen waren. Der Vater war früh Waise geworden, ohne Erinnerungen an die leiblichen Eltern, aber mit vielen Verwandten, durch deren Hände er gegangen war. Den Ort des Heranwachsens der Mutter stellte sich Alma vor wie ein Puppenhaus, ein Wimmelbild der Sorge. Sie schaute von oben herab in die kleinen Zimmer mit den großen Menschen, die selbst auf engstem Raum weit weg voneinander schienen, mit nach innen gerichtetem Blick, sah es hell und dunkel werden um sie herum, sah den Großvater ohne Zehen, wie ihm die Kinder eine Flasche Wein brachten, die Großmutter, wie sie in einer Ecke saß und unter Kopfschmerzen litt, die nie vergingen. Sie sah, wie sie die Kinder zu vorsichtigen, stillen Wesen heranzog, die nicht stören sollten in dieser Welt, kleinen Menschen, die mit großer Ernsthaftigkeit vermieden, eine Last zu sein, aber versuchten, jene diffuse Traurigkeit auszugleichen, die stets in der Luft lag. Sie sah, wie die Mutter als kleines Kind sich für ein fremdes Lächeln die abenteuerlichsten Geschichten ausdachte. Wie sie rot wurde vor Anstrengung, das Richtige zu tun. Wie sie sich fürchtete, dass es das Falsche war. Wie sie so viele Blumen für die Eltern pflückte, dass die Sträuße keinen Platz fanden in den Vasen. Wie sie die Erwachsenen scheu berührte, wenn sie schliefen, weil sie es sich sonst nicht traute. Wie sie spürte, dass das Wichtigste in ihrem Leben sich zugetragen hatte, bevor sie auf die Welt gekommen war.
Wann immer Alma als Kind an den Krieg dachte, stellte sie ihn sich als eine magische Maschine vor, in die auf der einen Seite die Menschen hineingingen und auf der anderen Seite verwandelt, fremd und falsch wieder herauskamen. Alles konnte passieren, die Rollen wurden getauscht, die Identitäten verwirrt, bloß derselbe durfte man nicht bleiben. Wer sich als Held meldete, kam vielleicht als Verbrecher wieder, als Verräter, als Opfer; wer gedemütigt auf dem Boden gelegen hatte, stand unversehens aufrechter da als jeder andere und wurde mutig oder grausam, und nur die Toten waren alle gleich stumm.
Wie alle Mitglieder ihrer Familie waren auch Almas Eltern anfällig für die elementarste aller Kränkungen, die durch Andersartigkeit. Sie waren genau, bieder, nett, legten Wert auf moralische Überlegenheit und waren auf unangenehm leise Art enttäuscht, wie unähnlich ihnen das eigene Kind erschien. Wie alle wollten sie anders sein als die eigenen Eltern, aber später Kinder haben, die waren wie sie. Alma wich ab von diesem Selbst- und Fremdbild, je älter sie wurde. Während die Mutter und der Vater das eigene Ich so klein hielten, dass man es mitunter übersah, war Alma fasziniert vom großen Exzess, der nackten, nervösen Existenz, unterschied nicht zwischen dem Furchtbaren und dem Schönen und fand, dass alles, was geschah, eine berechtigte Funktion habe in der Welt. Sie ließ alles an sich heran, war melancholisch, pathetisch, betört von radikalen Ideen und erfüllt von einer Bereitschaft für alle kommenden Wunden, die andere vor den Kopf stieß. Sie war fähig zu ungerührtem Hass und ungerührtem Selbsthass. Eine große junge Frau mit hoher Stirn und Händen so breit wie jene, die Dürer betend gemalt hatte. Jeden Tag fielen ihr neue Wünsche ein, und sie bestand auf jedem einzelnen. Sie lebte behütet, war Einzelkind, einsam, eine durchschnittliche Schülerin, machte keine Probleme und gab niemandem Grund zur Klage. Die Welt jener Jugendjahre war still und mondän. Stunden verbrachte sie allein im großen Haus, wenn die Eltern ausgegangen waren, zwischen den schweren Holzmöbeln in schwarzem Klavierlack und den kargen Landschaftsbildern in goldenem Rahmen. Lange vor den fremden Körpern sind es Dinge, die den Menschen erregen. Leere Räume, kühle Gegenstände, ein Kind, das an ihnen riecht, ein Kind, das mit kalten Fingern nach ihnen greift. An Sonntagnachmittagen saß sie in der leeren Badewanne, bleichte sich das Schamhaar mit Wattestäbchen und Wasserstoff weißblond und wanderte dann nackt durch die leeren Räume, von Zimmer zu Zimmer, hörte Space Oddity in Orchesterlautstärke und las das Glaubensbekenntnis im Flüsterton. Schaute die eigene Nacktheit in den türgroßen Spiegeln in der Diele an, den Geruch des Wasserstoffs scharf in der Nase. Lackierte sich den Mund mit dem Lippenstift der Mutter, nahm auch ihre Wäsche und machte ihr Gesicht, sah in den Spiegel mit dem ausgeborgten Blick, das schwarze Spitzenhöschen groß und unförmig um die Hüften. Dachte an die Welt. Dachte an die Liebe. Träumte davon, nachts durchs Fenster zu steigen zu einem Unbekannten, heimlich in seinen Armen zu schlafen und wieder fortzugehen, ehe er erwachte. Ohne Kleider kniete sie auf dem Fensterbrett, sommers auf dem kalten Stein, winters über der Hitze des Heizkörpers, eingehüllt in die Vorhänge, und sah hinaus in die graue, kleine Welt und wartete, dass die Zukunft die Gegenwart einholen, es endlich Jetzt werden würde, Jetzt Jetzt Jetzt. Und die Welt bereit wäre für ihr Bereitsein. Nichts schien ihr notwendiger in diesen Jahren des Heranwachsens, als über alle Maßen zu leben.
So leer das Haus war, so voll war ihr Kopf. Wie allen Menschen mit großen Erwartungen kam ihr der Schlaf ungelegen. Sie schlief wenig, saß nachts in T-Shirt und Unterhose auf dem Teppichboden ihres Zimmers und las in Schulbüchern und Romanen, die sie nicht verstand. Sie hörte so laut Musik, dass die Eltern abends nur mit Wattebäuschen in den Ohren zu Bett gingen, sie morgens vergaßen und halb taub am Frühstückstisch saßen, bis sie ihnen bei einem Nicken oder einem Kopfschütteln neben Brot und Butter auf den Teller fielen. Im Schein der Schreibtischlampe zeichnete sie mit blauem Kugelschreiber an die Ränder ihrer Hefte, Kritzeleien vom immer gleichen Blick aus dem Fenster oder dem immer neuen Gesicht im Spiegel, Bilder, die ihr aus dem letzten Traum im Gedächtnis geblieben waren, und Bilder, die sie nicht vergessen konnte. Sie malte auf die Innenseite von Schubladen und auf die Außenseite von Schranktüren, phantastische Wesen, Schlachten, wucherndes Grün, ausgezehrte Gesichter, kleine Regenschirme und große Tiere. Zeichnend hatte sie das Gefühl, als experimentierte sie mit den Elementen, als testete sie ihre Kombinierbarkeit, ihre Reaktionen, ihre Wandelbarkeit. Sie baute aus den Bestandteilen der einen Welt, die sie kannte, viele andere Welten, von denen sie noch nichts wusste, die sie nur erahnte. Bilder gab es im Übermaß, jedes neu genug, dass einem der Hunger nach dem nächsten nicht verging. Jedes alt genug, dass man an ein Wiedererkennen glauben konnte. Es waren Jugendjahre mit langen Nächten und langen Tagen und wirren Träumen. Wenn sie die Augen schloss, sah sie die Menschen auf Berggipfeln stehen, mit ausgebreiteten Armen und rotem Kopf, wie sie versuchten, die Körper zu wechseln, ein anderer zu werden, und am Ende müde und als sie selbst nach Hause gingen. Sie träumte von weißgesichtigen Männern mit Quecksilberaugen vor grünen Wänden, leuchtenden Arsentapeten, giftig und feucht, Aquarien voller Meerjungfrauen, Soldaten, die ihre Gliedmaßen mit hölzernen Klammern auf Wäscheleinen hängten, und von Kindern, die diese Arme und Beine wieder abnahmen und in Körben über die Felder davontrugen, von durchsichtigen Sanduhrfrauen mit schmalen Taillen, denen auf den Kopf gestellt die Zeit durch die Mitte rann, von Rube-Goldberg-Maschinen, die über die Welt hinauswuchsen und noch die kleinsten Abläufe ins Unendliche dehnten. Von Städten, in die man ein Streichholz warf und die in Flammen aufgingen. Von Mädchen mit Geschlechtern wie brennende Häuser. Arsenträume, Brandstifterträume, Kriegsträume. Himmel dunkel von Fliegerbomben und dunkel von Vögeln. Weite Ebenen voller Menschen im einen Augenblick und leer im anderen. Von baumlosen Landschaften, deren Weite und Hoffnungslosigkeit einem ins Herz schnitt. Von Steppen und Wüsten, unwirtlichen Landschaften mit stummen Salz- und Schwefelmenschen in der Ferne und Männern schwarz von Kohle, die bei jedem Schritt Spuren hinterließen. Einem Winter, der nicht verging, und einer Dunkelheit, so eisig, dass sie an ihren Träumen fror und mit kalten Händen erwachte. Schnee, der fiel und fiel, über Kinder, Häuser und Gärten, bis man selbst die hohen Bäume nicht mehr sah, der über ganze Städte fiel, bis sie unter ihm verschwanden und kein Schornstein und kein Wolkenkratzer mehr herausragte. Im Schlaf spielte sie Schach gegen sich selbst, träumte, sie säße inmitten einer dürren Wiese allein vor einem Brett, dachte lange nach über die Züge, erkannte in den Figuren das Gesicht des Vaters, die Züge der Großmutter, manchmal die eigenen, schlug die einen, beschützte die anderen und erwachte stets mit dem Gefühl der Niederlage.