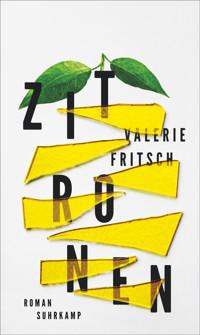
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sprachgewaltig, in packenden Bildern und Episoden erzählt Valerie Fritsch von der Ungeheuerlichkeit einer Liebe und über die Abgründe der menschlichen Seele.
August Drach wächst in einem Haus am Dorfrand auf, das Hölle und Paradies zugleich ist. Der Vater misshandelt seinen Sohn, Zärtlichkeit hat er nur für die Hunde übrig. Trost findet August bei seiner liebevollen Mutter. Doch als der Vater die Familie verlässt, verwandelt sich ihre Zuwendung: Sie mischt August heimlich Medikamente ins Essen, die ihn schwach und krank machen; von seiner Pflege erhofft sie sich Aufmerksamkeit und Bewunderung. Es sind quälende Jahre, bevor es August gelingt, sich von der Mutter zu befreien und ein selbständiges Leben zu führen. Die erste Liebe zu erfahren. Kann er das Trauma seiner Kindheit überwinden, in der Grausamkeit und Liebe untrennbar zusammengehörten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Valerie Fritsch
Zitronen
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Arbeit am vorliegenden Roman wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. und vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) gefördert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der Originalausgabe, 2024.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Nurten Zeren, Berlin
eISBN 978-3-518-77863-0
www.suhrkamp.de
Motto
Jedes Leben richtet sich an jemanden, und insofern – und nur insofern – ist es ein sinnvolles Leben, wenn auch den Sinn des Lebens selbst völlige Finsternis umgibt.
Imre Kertész
Freedom, I am told, is nothing but the distance between the hunter and its prey.
Ocean Vuong
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
TEIL1
I
II
III
TEIL2
IV
V
VI
VII
Informationen zum Buch
Zitronen
TEIL1
I
Es war eine kühle, grüne Gegend. Immer roch es nach Regen, auch wenn er selten fiel. Kam in den Tälern der Frühling, wurde die ausgezehrte, magere Welt des Winters wieder groß und bewohnbar, aber wer hinauf zu den Bergspitzen sah, konnte noch im Sommer frieren. Die Katzen jagten auf den Wiesen, saßen im wachsenden Gras und warteten auf die Mäuse wie ein schöner Tod im Sonnenschein. Das Dorf war so klein, dass man sich, wenn man sich umschaute, nie sicher war, ob jeder jeden kannte oder niemand niemanden, nicht einmal den unter seinem eigenen Dach. Den Kindern erzählten die Alten, auf der Straße müsse man alle Männer grüßen, weil man nie wissen könne, wer der Vater sei. Überall gab es Geschichten, hinter denen man rasch die Tür zuzog. Hinter der einen Tür wartete eine Familie seit Jahren auf ein Mädchen, das verschwunden war, und zuckte Mal um Mal zusammen, wenn auf der Straße ein fremdes Kind im blauen Kleid vorüberging, hinter der anderen lebte ein Mann im Werkzeugkeller, nachdem seine Frau einen Liebhaber ins Haus geholt hatte. Es gab Häuser mit immer geschlossenen Fenstern, die man nur öffnete, wenn jemand starb, damit die Seele entweichen konnte, und so reichte den Bewohnern des Dorfes ein Blick von der Straße, um zu wissen, wann der Tod Ein- und Auszug in diesen Zimmern hielt. Das aufgerissene Fenster war sein letztes Zeichen, bei dem die Frauen schon nach Salz und Zucker griffen und zu backen begannen, um bald einen warmen Kuchen als Zeugnis ihres Beileids auf den Treppenabsatz zu stellen.
Die Drachs lebten am Rande des Ortes, gerade so abgelegen, dass man keinen Menschen sah, aber ging man nur um die richtige Ecke, schon mit einem Bein im Vorraum eines Nachbarn stand. Das Haus, das Lilly Drach nach dem frühen Tod ihrer Eltern geerbt hatte, war auf eigenwillige Art und Weise schön, aber unfertig und schmutzig. Zu Reparaturen und Neuerungen fehlten die Mittel, das Geld war so knapp, dass man darüber gar nicht erst sprach, aber gleich losschrie, konnte man eine Unterhaltung darüber nicht vermeiden. Sah man genau hin, war es schief, verzogen vom Wind, als hätte es sich in einem großen Sturm baumgleich ein paar Zentimeter gebeugt und nie wieder in seinen aufrechten Stand zurückgefunden. Wie ein Puppenhaus schien es mit seiner hölzernen Veranda und dem filigranen Treppenaufgang, die Formen zu feingliedrig für die raue Gegend und das Dorf. Ein großer Sonnenschirm blühte im Sommer neben dem Eingang und schlief im Winter dünn um sich selbst gewickelt wie ein Wächter an den Stufen.
Kaum trat man durch die Tür, roch es nach altem Stoff, Parfum und Staub. Der Schiffsplankenboden knarrte nur unter manchen Schritten, und es war wie ein Lauf über ein rätselhaftes Klavier, dessen Bretter wie hölzerne Tasten mal anschlugen und mal schwiegen, wenn August mit bloßen Füßen durch die Räume rannte, so wild, dass hin und wieder Speile in seinen Sohlen zurückblieben, die die Mutter mit einer Nähnadel und einer Brille auf der Nase herausoperierte. Das Haus war eine billige Wunderkammer voll Ramsch, aber ohne Schätze, mit dem der Vater mehr schlecht als recht handelte. Wochenends fuhr er auf Flohmärkte, lud den Kastenwagen voll und kam mit fast ebenso vielen Dingen wieder, mitunter waren es mehr, wenn er etwas entdeckt hatte, von dem er glaubte, es woanders teurer verkaufen zu können.
So vollgestopft war das Haus, dass seine Bewohner kaum Platz hatten in ihm, bis in die letzte Ecke ausgefüllt mit Flohmarktware, Kuriositäten, die man gefunden, und Erbstücken, denen man nicht geschafft hatte zu entkommen. Manche Möbel waren wie Gespenster, die einen Blick in die vergangene Welt freigaben: der dicke Polsterstuhl, auf dessen abgeriebenen Lehnen man unwillkürlich die schweren Unterarme der Vorbesitzerin sah, die geblümte Plastiktischdecke am Küchentisch, durch deren Brandloch man den kleinen Finger steckte und meinte noch die Glut der Zigarette zu fühlen. Um den langen Tisch standen sieben unterschiedliche Stühle, als brauchte jeder Mensch einen eigenen, nur ihm angemessenen Platz, und Schallplattencover in Neonfarben hingen auf feinen Nägeln an den Wänden. In einem Käfig am Fenster saßen Kanarienvögel bunt wie Bonbons und sahen sich in ihren kleinen, hängenden Spiegeln mit geneigtem Kopf an, und auch die Mutter prüfte ihren Lippenstift in der winzigen Reflexion, wenn sie die Tiere fütterte. Die mächtigen Fensterkreuze dahinter erinnerten August an die ausladende Geste des Priesters bei der Sonntagspredigt, das Kreuzzeichen im Namen des Vaters, von oben nach unten und von links nach rechts, eine ewige Segnung der Landschaft. Sie teilten die Aussicht, den Himmel, den Apfelgarten in Rechtecke, auf denen sich das Drinnen und das Draußen überlagerten, und wer hinaussah, sah die Wiese durch die Fingerabdrücke auf den Glasscheiben.
Überall gab es kleine Besonderheiten zu entdecken, über denen man große Augen bekam, in jeder Ecke verbarg sich etwas, das man in anderen Häusern nicht fand. Gerne studierte August die Bilder, die an der Küchenwand hingen. Da gab es steife Familienporträts mit der Größe nach geordneten Kindern, in denen durchsichtige Frauen mit in den Hintergrund verdämmernden Gesichtern von der Decke schwebten. Ein Büblein, das auf einem Tisch stand wie ein Kerzenleuchter, umringt von seinen schemenhaften Brüdern und Schwestern aus dem Totenreich. Eine Uniform, die hinter einem ernsten Ehepaar aus dem Jenseits erschien. Es waren Geisterphotographien aus dem letzten Jahrhundert, Flohmarktfunde, die mit den Jahrzehnten über den Atlantik gereist waren, auf dem einen Kontinent verschwunden und auf dem anderen in Wühlkisten und vollgestopften Emailletöpfen wieder aufgetaucht waren. Sie stammten aus einer Zeit, in der man glaubte, dass Photoapparate auch jene Dinge aufnehmen konnten, die dem menschlichen Auge verborgen blieben. Zwar galt die Gespensterphotographie als unsichere Wissenschaft, und selbst die spiritistische Fachpresse war sich nicht einig, ob sich Geister ablichten ließen, die Entdeckung der Röntgenstrahlung aber, die den Menschen bis auf die Knochen entblößte, verstärkte die Idee, dass die neueste Technik unsichtbare Welten sichtbar machen könne. So entstand eine eigenartige Bilderindustrie für gutgläubige Menschen, auf deren sündhaft teuren Studioporträts fortan schwebende Figuren, bewegte Bettlaken, unscharfe Schneiderpuppen und flüchtige Gesichter neben dem eigenen Antlitz erschienen, mit einer Verlässlichkeit, die man Gespenstern kaum zutraute. Es waren kleine Auferstehungen, graphische Totenbeschwörungen, die die Verstorbenen noch einmal zurück in den Kreis der Familie holten, dirigiert von Photographen, die sie als Medium in die Wirklichkeit führten. Die große Trauer des Krieges, in dem jeder um jemanden zu weinen hatte, befeuerte das Geschäft, denn die Angehörigen der gefallenen Soldaten wollten nur allzu oft ein letztes Mal mit ihnen in Kontakt treten, einen Abschied haben und ein Bild, dem sie eine schwarze Binde anlegen konnten. Die Gespensterphotographen erfüllten ihnen den Wunsch mit Doppelbelichtungen und mit Gesichtern, die sie bereits zuvor auf Glasplatten gebannt hatten, manches Mal lief auch ein Assistent kurz in den Bildraum hinein, während sich die Porträtierten mit angehaltenem Atem nicht bewegen durften, und blieb als rätselhafter Schatten einer anderen Welt auf dem fertigen Produkt zurück. Nicht wenigen der Professionisten, die mit der Sehnsucht nach dem Verlorenen Geschäfte machten, wurde später der Prozess wegen Betrugs gemacht, und doch wohnte der Gespensterinszenierung, dem Handwerk mit dem Unsichtbaren etwas Zartes inne.
Lange dachte August Drach, bei den Bildern in der Küche handele es sich um eine Ahnengalerie, und nahm wie selbstverständlich an, sie wären mit all den Gespenstern verwandt. Als Lilly Drach ihm erklärte, dass die Gestalten auf den Photographien keine an den Fäden der Familie hängenden Vorfahren, aber Generationen fremder Geister waren, fühlte er sich betrogen, denn er hatte sie liebgewonnen, sich Geschichten für sie ausgedacht und sich selbst als Folge dieser Geschichten betrachtet. Für ihn gehörten sie zur Familie. Umso mehr hing er an ihnen, da es keine lebenden Verwandten gab, die er kannte, und bloß der Bruder der Mutter einmal im Jahr zu Besuch in den Garten kam. So hatte er sich unter falschen Annahmen eine Identität an der Küchenwand gebaut, sich selbst als Nachfahre des Mannes mit Schnurrbart und Enkelsohn der Frau ohne Schwerkraft gesehen, als Abkömmling der Vergilbten, der Schwebenden, der Durchsichtigen. Aber es waren nur Fremde ohne Namen, denen er sich verbunden geglaubt hatte.
Wenn es Herbst wurde und die Äpfel rot und gelb an den Bäumen hingen im Garten, rannten August und seine Freunde Jahr für Jahr durch die Wiesen, rutschten, stolperten und fielen ins Gras. Sie rappelten sich wieder auf und hielten still unter den schweren, brüchigen Zweigen, um einander abwechselnd einen Kronprinz Rudolf oder einen Geflammten Kardinal vom Kopf zu schießen, auf den sie sich zum Schutz einen alten Motorradhelm gesetzt hatten. Als Kinder standen sie sich mit Pfeil und Bogen gegenüber, bald mit dem ersten Luftdruckgewehr und später mit einer Pistole, die die Dunkelheit eines Dachbodens freigegeben hatte. Es gab unterschiedliche Arten der Aufregung und der Ehrfurcht, wenn sie einander in die Augen sahen: Während die einen mehr die Schmach fürchteten, den Apfel zu verfehlen, zitterten die anderen davor, den Freund darunter zu treffen, und nur die ins Visier Genommenen hielten stets den Atem an. Fand sich kein Freiwilliger an einem Tag, schossen sie auf die noch am Baum hängenden Früchte, suchten in dem Wimmelbild des Gartens ein besonders schönes Exemplar, feuerten mit in den Nacken gelegtem Kopf, kletterten hoch und saßen auf den unter ihrem Gewicht nachgebenden Ästen, um das Durchschussloch zu betrachten oder mit den Fingern eine Kugel aus dem weichen Fleisch zu schälen.
August Drach schoss stets als Letzter, schnell und ohne mit der Wimper zu zucken, als wüsste er schon, dass einem das Leben das Abwarten verzieh, aber nie das Zögern. Auch wenn er alle Sorten beim Namen kannte, machte er sich nichts aus Äpfeln, aß sie nie, pflückte sie nur fürs Wilhelm-Tell-Spiel oder wenn seine Mutter es ihm befahl.
Der Apfelgarten war Liebe und Hass der Mutter, in manchem Jahr hatte sie nicht einen Blick für ihn übrig und bemühte sich im darauffolgenden umso mehr, die Verheerungen und Verwüstungen ihrer Nachlässigkeit wiedergutzumachen. Einmal pflegte sie ihn, stand schon morgens im Nachthemd zwischen den Bäumen und hob selbst die Arme wie Äste, arbeitete sich die schmalen Finger rau, schnitt im Frühling und rechte im Herbst, dann saß sie zwölf Monate am Fenster und sah der Verkümmerung zu, hob die Augen für keinen brechenden Zweig, stürzte der Baum auch hinterher. Die Nachbarn sahen über den Zaun auf das unbeeindruckt aufblühende und vergehende Paradies, zogen ihre Schlüsse und flüsterten hinter vorgehaltener Hand, dass die Mutter ein Apfeljahr habe, wenn es ihr und dem Garten gutging. In den Apfeljahren stellte Lilly Drach das Radio ins offene Fenster, spielte laut Musik, während sie und die Buben die Früchte ernteten, sich zu Dolly Partons Golden Streets of Glory in die Höhe streckten oder zu Boden beugten. War sie zufrieden mit der Ernte, verkaufte sie die schönsten Exemplare als Tafelobst an den Feinkostladen der Stadt, wo die Äpfel nebeneinander in mit Seidenpapier ausgeschlagenen Holzkisten lagen und die Mutter vor Stolz errötete, als wäre sie einer von ihnen. Die übrigen trugen die Kinder in den Keller, wo sie in der Kälte auf Holzbrettern und Zeitungspapier durch den Winter dämmerten, von einem seltsam organischen Glimmen erfüllt, das man schon von der Tür aus sah in den dunklen Monaten, bevor man noch das Licht einschaltete im Raum.
Wenn der Schnee fiel, kochte Lilli Drach Apfelkompott so blass wie sie selbst, schnitt das helle Fleisch der hochroten, spätreifen Früchte, aß manchmal für Tage nichts anderes und setzte es auch ihrem Sohn vor, wenn dieser sich schlecht fühlte. Nur die Hunde und der Vater weigerten sich, vom Kompott auch nur zu kosten, wenn sie ihnen abends eine Schale hinstellte: Es war eine Kränkung, auf die sie sich verlassen konnte, und eine, auf die sie nicht verzichten wollte.
Was sie sonst den ganzen Tag über tat, seit sie nicht mehr als Krankenpflegerin arbeitete, wusste niemand genau. Sie lebte ein anstrengendes Leben unter dem löchrigen Deckmantel eines unangestrengten Tagesablaufs. Oft saß sie am Fenster zwischen den Gardinen, wickelte sich in die Stoffbahnen ein, wenn sie fröstelte, und sah hinaus, während der Fernseher in ihrem Rücken lief. Spielte mit ihrem Haar, ließ die ausgegangenen Strähnen aus dem Fenster fallen, und obwohl sie wie ein Kind hoffte, dass die Vögel sich daraus ein Nest bauen würden, verfingen sie sich stets bloß an den abstehenden Holzspänen der Kellertür. Sie schlief, wenn sie sich zu sehr langweilte. Fragte sich, wer die Menschen in ihren Träumen wohl waren, Fremde, die ihr vertraut schienen, ohne dass sie sich erinnerte, sie je gesehen zu haben. Trank warmen Zwetschgenschnaps am Nachmittag, sonntags mit Obershaube, die auf dem Gebrannten schwamm.
Auf den braunen Fliesen des alten Couchtisches legte sie große, uralte Puzzle mit Tausenden von Teilen, die sich so ähnlich sahen, dass es manches Mal Stunden dauerte, bis sie den richtigen Ausschnitt gefunden hatte. Riesenhafte Bilder von Pferden und Schwänen, Panoramen staubiger Märchenwelten, entsättigte Königsreiche vergangener Tage wuchsen so Stück für Stück zusammen. Jedes vollendete rührte Lilly Drach, und sie brachte es kaum übers Herz, es wieder auseinanderzunehmen und wegzuräumen, als hätte sie Scheu, eine so intakte, mühsam zusammengefügte Welt in Stücke zu zerbrechen. Wenn sie nicht puzzelte, fertigte sie hin und wieder Collagen an mit allem, was sie fand, klebte Zeitschriftenausschnitte, die herabgefallenen Blätter der Zimmerpflanzen und Grashalme, die in den Ritzen der Fensterbank sprossen, auf Papier und schnitt einmal sogar dem schlafenden August nachts ein bisschen braunes Haar ab, das sie in ihr Werk einfügte.
Sie liebte alles, was schön war, und fand manches schön, was anderen bloß wirr vorkam, weil es über das Paradies keine Einigkeit gab. Du bist nichts als das, was du träumst, sagte sie August nach den Gutenachtgeschichten und Märchen, die sie ihm in Kindertagen und noch später erzählte und deren erfundene Welten sie hellwach machten, während ihr Sohn dabei einschlief. Ich will zu den Blumen, den Männern, zum Meer, rief sie manchmal wie zu sich selbst.
Die Leute, die das gute Geschirr sparten in den Vitrinen, es jahrein, jahraus hinter den Glasscheiben anstarrten wie etwas Fernes, Exotisches, auf das man achtgeben und vor dem man sich schützen musste gleichermaßen, als wären die Porzellantassen und Kristallgläser Tiere im Zoo, blieben ihr fremd. Wenn sie zu einer Einladung der Nachbarn ging, sah sie verwundert, wie sich die Gastgeber scheuten, die schönsten Teller aus dem Schrank zu nehmen, und schweren Herzens zu den zweitbesten Stücken griffen, während sie selbst, auch wenn sie allein zu Hause war, am liebsten mit dem angelaufenen Silberlöffel aß, den sie am Totenbett ihrer eigenen Mutter unter dem Kopfpolster der Sterbenden hervorgezogen hatte. Auch ein Kind zu haben schien ihr schön, entband sie aber nicht vom Wunsch nach anderen, fremden Schönheiten, die größer waren, nach einer Überwältigung, einer Überraschung, nach etwas, das nicht in den Vorgarten, nicht in den Apfelgarten und das Dorf passte, aber es zu sprengen drohte, träte es ein. Abends las sie gerade noch rechtzeitig die Tageshoroskope für alle, die sie kannte, glaubte an die guten Vorhersagen und fürchtete sich vor den schlechten, griff manchmal noch nachts zum Telefon, um besorgt in Erfahrung zu bringen, ob es um die Liebe der Nachbarin tatsächlich so schlecht bestellt sei oder ob die Gesundheit ihres Bruders wirklich so sehr unter den Sternen leide, wie es in der Zeitung stand.
Augusts Mutter war eine seltsame Person, der man ihre Schrulligkeit nicht übelnehmen konnte, weil sie so gern besonders sein wollte, dass sie gar nicht bemerkte, dass die Leute sie bloß eigenartig fanden. Sie war gläubig, aber ging zum Beten lieber in den Wald als in die Kirche oder kniete am Küchenboden vor einem bauchigen Krug voll Wasser, durch den das Licht fiel, statt vor einem Kreuz nieder. Sie lebte versteckt im Faltenwurf einer unauffälligen Biographie. Als Mädchen machte sie Bekanntschaft mit dem Schicksal, verlor die Mutter schon als Kind und einen über alles geliebten Hund, nicht aber die Lebensfreude, und die frühen Verluste ließen ihre späteren Wünsche nur umso größer und vehementer werden. Später kamen die unvermeidlichen Enttäuschungen des Lebens, eine Liebe endete und eine andere begann nicht, Hoffnungen erfüllten sich und brachten doch nicht das Glück, auf das man dachte so gut vorbereitet zu sein, eine Idee war richtig, aber die Zeit falsch. Sie trug eine blonde Dauerwelle, die sich auf ihrem Kopf türmte, war sehnsüchtig und verloren, müde geworden vor der Zeit, mit schmalen Lippen, die sie stets im falschen Moment aufeinanderpresste. Vieles war ihr passiert, ihr Leben hatte sie sich nicht recht ausgesucht, aber in den entscheidenden Augenblicken auch nicht Nein gesagt, und auch wenn es nicht so war, wie sie es wollte, weil es falsch war in so vielen Einzelheiten, reichte es doch nicht für ein richtiges Unglück. Manchmal aber dachte sie daran, wie ihr, als sie als junges Mädchen vor einem Eisgeschäft wartete, ein Mann die langen Zöpfe abgeschnitten hatte und mit ihrem wehenden Haar in der Hand davongerannt war.
Sie himmelte berühmte Frauen an, wollte sein wie Dolly Parton, wie Lady Di, wie die Nachrichtensprecherin, blickte in die Ferne und manchmal in die Zukunft, nie aber schien sie zu sehen, wer oder was in der Gegenwart anwesend war, um sie herum. Nichts konnte sie mehr enttäuschen als die karge Realität, auch wenn sie wusste, dass man nichts erwarten sollte, dessen Ausbleiben einen doch nicht zu überraschen vermochte. Das Wissen beschützte sie nicht. Sie besaß die Traurigkeit jener Menschen, die Großes vorhaben, aber kaum hoben sie die Hand, schrumpften ihnen die Dinge unter den Fingern, verzwergten sich, scheiterten an der Wirklichkeit. Sie war eine von der Welt Überrumpelte, eine wirre Prinzessin, ewig ungekrönt, eine vom Leben zu Fall Gebrachte, die, wenn sie sich aufmühte, stets überrascht auf einer Stufe unter jener stehen blieb, von der der Wind sie herabgeweht hatte. Je höher sie hinaufwollte, desto tiefer schien sie zu fallen, manchmal sah man sie förmlich in Zeitlupe durch den Küchenboden in die Erde sinken, wenn sie das Geschirr abwusch, während sie sich auf dem Fernsehapparat die Videokassettenaufnahmen von Lady Dianas Begräbnis anschaute und sich an einem Lächeln versuchte, das ihr misslang. Sie bekam nicht genug von diesem großen Tod, der sich auf dem Bildschirm wiederholte und für den die Menschen so schöne Kleider und Hüte trugen, und auch wenn das Unglück schon Jahre zurücklag, so war sie doch jedes Mal aufs Neue so begeistert wie untröstlich. Fragte August seine Mutter, warum sie sich etwas so Tragisches ansah, von dem man überdies wusste, wie es ausging, strich sie ihm bloß seufzend über den Kopf, und stets dachte er, wie gut ihr Blick zu den Millionen traurigen Gesichtern im Fernseher passte.
Sie sah fern, als ginge es um ihr Leben. Ohne den laufenden Apparat tat sie nichts im Haus, machte ohnehin bloß das Notwendigste, und auch das nicht immer, denn allzu ordentliche Häuser hielt sie für einen Beweis der Langweiligkeit ihrer Besitzerinnen, und legte nur auf ihre eigene Sauberkeit wert, roch Tag und Nacht nach Parfum und einer Handcreme, die sie stets bei sich trug. So kam es vor, dass Lilli Drach in einer Wolke aus Pflaume und Orangenblüte inmitten ihrer Versäumnisse lebte, zwischen Geschirrtürmen saß, auf denen die Essensreste trockneten, bis sie von den Tellern pellten, der Müll auf dem Boden zwischen den nackten Zehen raschelte und der Staub in den selten betretenen Zimmern lag wie ein leiser Schnee, in dem man bei einem Blick über die Schulter die eigenen Fußspuren sah. Die Hunde streiften durch die Räume wie durch eine verlassene Stadt. Der Vater rührte keinen Finger, aber erhob oft die Hand. Er starrte erst in das verschlossene Gesicht seiner Frau und öffnete dann Augusts Zimmertür mit einer Geste, die immer die Gewohnheit und manchmal eine Zögerlichkeit verriet, als hätte er einen letzten Zweifel, ob er wirklich über diese Schwelle treten wollte.
Das Betteln, das Schreien und Weinen, das Sich-Winden, das Entkommen-Wollen gewöhnte sich das Kind bald ab, wurde ein stummes Gefäß für die Wut, das nicht wusste, ob seine Aufgabe darin bestand, an der Luft auszuhärten oder zu zerbrechen. Nie lief er schnell genug davon, nie versteckte er sich so gut, dass er nicht gefunden wurde. Nichts half. August wurde bewegungslos unter dem Geruch der Nähe des Vaters, seines Atems nach Zahnstein und Vergorenem. Mehr als August ihn fürchtete, schämte er sich für ihn und auch für sich selbst. Er fand den Vater schwach, seine ungeschickte, unsichere Brutalität, war beschämt, dass er war, wie er war, beschämt, dass er den unscheinbaren Mann dazu brachte, so zu sein, beschämt, dass es ihn, August, traf und keinen anderen. Auch die Hände des Vaters schienen ihm die falschen zu sein, fremd, als gehörten sie gar nicht zu dem Menschen, der sie trug, unpassende, unproportionierte Prothesen der Gewalt, so klein, dass man kaum glauben mochte, dass eine so große Wut in ihnen verborgen war. Im Alltag schaute August ihm oft prüfend auf die Finger, beobachtete, wozu sie sonst noch fähig waren, achtete genau darauf, wie der Vater in einem Buch vorsichtig die Seiten umblätterte oder sich vor dem Badezimmerspiegel die Augenbrauen glattstrich. Eitel war er, das sah August, und dass er gern ein Künstler, ein Schauspieler, jeder andere als er selbst gewesen wäre, das wusste er von den zahllosen Vorträgen, die ihm darüber gehalten worden waren – welches Spiegelbild dem Vater über dem Waschbecken aber entgegenstarrte, blieb ihm verborgen. Die Rolle seines Lebens war bloß die eines Betrunkenen, der versuchte, einen Nüchternen zu spielen. Lange war August zu jung, um ihm ähnlich zu sehen, auch wenn die Mutter oft sagte, sie hoffe, er würde einmal so ein schöner Mann werden wie der Vater, und stets hinzufügte, bis es so weit sei, trage er ja schon seinen Namen. Wie eine Prophezeiung klang das in den Ohren des Kindes, wie eine Anordnung, brav in seine schon fertigentworfene Identität, seine festgelegte Zukunft hineinzuwachsen, der nur noch das richtige Gesicht fehlte. Dann fühlte er sich ein wenig wie ein Doppelgänger wider Willen, und wann immer im Haus nach dem einen oder nach dem anderen gerufen wurde, hoben in ihrem jeweiligen Zimmer beide gleichzeitig den Kopf.
Dieser Vater war ein Mann mit großen Gesten, die ins Leere gingen, Gedanken, die zu kurz griffen, einem Jähzorn, der sich an jedem Missgeschick und an jedem Missverständnis entzünden konnte. Er war widerwillig alt, aber nie erwachsen geworden. Ihm fehlte die Distanz, er kam allem und jedem zu nah, bedrängte die Menschen, ob er sie kannte oder nicht, redete auf sie ein und beugte sich stets eine Spur zu weit vor, so dass sie seinen bitteren Atem rochen. Im Gespräch packte er Fremde an der Schulter und Kellnerinnen am Handgelenk und lachte noch, wenn das Gegenüber schon erstarrte. Oft standen die Menschen wie Säulen vor ihm, Statuen aus Salz, deren Gesten in der Luft stecken blieben. Weil er aber hübsch war und immer rechtzeitig ein Kompliment, eine Anekdote auf den Lippen hatte, verzieh man ihm und schloss den kleinen Mann, sobald man das unangenehme Gefühl, das man nicht recht benennen konnte, abgeschüttelt hatte, ins Herz. Die Frauen liefen ihm hinterher, verwechselten seine Aufgebrachtheit mit Leidenschaft und versprachen sich ein Abenteuer, wenn er ihnen nur zuzwinkerte. Obwohl er stürmisch war, an die Liebe glaubte er nicht. Schon legte er einem den Arm um die Schultern, während man die Hand noch abwehrend hob, schon erzählte er einem im Vertrauen etwas, das sonst keiner wusste, schon war man sein Komplize geworden, ohne es zu merken. Er fasste alle an, war aber selbst ein Unberührbarer, einer, den schon ein unabsichtlicher Stoß auf der Straße in Zorn versetzte, und selbst eine zärtliche Geste seiner Frau, auf die er nicht vorbereitet war, ließ ihn zurückzucken. Nur im Schlaf war er angreifbar, und mehr als einmal stand sein Sohn stumm an seinem Bett in der Nacht, beugte sich über seine Abwesenheit, seinen vom Dämmer umfangenen Körper, das träumende Fleisch, sah ihm in die geschlossenen Augen und legte ihm einen Finger auf das im Atmen auf und ab schwingende Schlüsselbein, auf den unter der Decke hervorstehenden Fuß, auf den Arm, der herabhing, bevor er ihn – erschrocken vom eigenen Mut, der Umkehrung der Berührung – rasch zurückzog und wieder aus dem Zimmer schlich.
Jenen, die ihn umgaben, diktierte der Vater abwechselnd eine verletzende Nähe und eine ebensolche Distanz, zog sie an sich und stieß sie wieder fort. Er konnte nicht bei sich bleiben, ragte zu weit in die Welt hinein, dehnte sein Inneres über den eigenen Körper hinaus aus. In seiner Gegenwart fühlte man sich im Guten wie im Schlechten porös, ungenügend geschützt von der eigenen Haut, und es kam vor, dass August auch an warmen Tagen einen Pullover mit langen Ärmeln trug, damit er nicht mehr, als er musste, von sich preisgab, weniger Angriffsfläche für die Worte oder die Schläge bot. Und doch gewöhnte er sich an nichts. Wie ihn der Vater immer kleinmachte und daran groß wurde. Wie er die Kälte zelebrierte, nicht ablassen konnte von einem vermeintlichen Fehler. Wie er kein Herz hatte, aber eine Hand. Wie die Festlichkeit der Strafe, das Feierliche daran ihn ganz erfüllte. Wie das hysterische Glück, den Sohn dumm zu heißen, ihn für Stunden in Beschlag nahm. Wie er ihm schreiend durch die Räume folgte, um mit seinen Beschimpfungen immer wieder von vorne zu beginnen. Wie er, wenn er wieder guter Laune war, zu August an der Tür sagte: Sei bloß vorsichtig, die Welt da draußen ist schlecht.





























