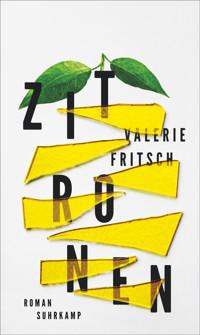9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winters Garten, so heißt die idyllische Kolonie jenseits der Stadt, in der alles üppig wächst und gedeiht, in der die Alten abends geigend auf der Veranda sitzen, die Eltern ihre Säuglinge wiegen und die Hofhunde den Kindern das Blut von den aufgeschlagenen Knien lecken.
Winters Garten, das ist der Sehnsuchtsort, an den der Vogelzüchter Anton mit seiner Frau Frederike nach Jahren in der Stadt zurückkehrt, als alles in Bewegung gerät und sich wandelt: die Häuser und Straßenzüge verfallen, die wilden Tiere in die Vorgärten und Hinterhöfe eindringen und der Schlaf der Menschen schwer ist von Träumen, in denen das Leben, wie sie es bisher kannten, aufhört zu existieren.
In ihrem preisgekrönten Roman erzählt Valerie Fritsch sprachmächtig und in sinnlichen Bildern von einer Welt aus den Fugen. Und von zwei Menschen, die sich unsterblich ineinander verlieben, als die Gegenwart nichts mehr verspricht und die Zukunft womöglich ein Traum bleiben muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Winters Garten, so heißt die idyllische Kolonie jenseits der Stadt, in der alles üppig wächst und gedeiht, die Pflanzen wie die Tiere, in der die Alten abends Geige spielend auf der Veranda sitzen, die Eltern ihre Säuglinge wiegen und die Hofhunde den Kindern das Blut von den aufgeschlagenen Knien lecken.
Winters Garten, das ist der Sehnsuchtsort, an den der Vogelzüchter Anton mit seiner Frau Frederike nach Jahren in der Stadt zurückkehrt, als alles in Bewegung gerät und sich wandelt: die Häuser und Straßenzüge verfallen, die wilden Tiere in die Vorgärten und Hinterhöfe eindringen und der Schlaf der Menschen schwer ist von Träumen, in denen das Leben, wie sie es bisher kannten, aufhört zu existieren.
Sprachmächtig und in sinnlichen Bildern erzählt die junge österreichische Autorin Valerie Fritsch von einer Welt aus den Fugen. Und von zwei Menschen, die sich unsterblich ineinander verlieben, als die Gegenwart nichts mehr verspricht und die Zukunft womöglich ein Traum bleiben muss.
Valerie Fritsch, geboren1989, studierte an der Akademie für angewandte Photographie in Graz und bereist als Photographin vor allem den afrikanischen Kontinent. Sie lebt in Graz und Wien. Winters Garten ist ihr erster Roman im Suhrkamp Verlag.
Valerie Fritsch
Winters Garten
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Ausgabe:
Erste Auflage 2015
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und
Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie,
Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des
Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978–3-518-74033-0
www.suhrkamp.de
für Martin
Wenn ich mich heute meiner frühen Jugend erinnere, so müsste ich den Knaben (einzelne wenige Punkte abgerechnet) für einen anderen halten, wenn nicht die Kette der Erinnerungen vorläge.
Ernst Mach
Every night and every morn
Some to misery are born ;
Every morn and every night
Some are born to sweet delight ;
Some are born to sweet delight ;
Some are born to endless night ;
William Blake
1 | Die Gartenkolonie
Anton Winter wuchs als Sohn eines Geigenbauers auf in einem riesigen Garten zu einer Zeit, als man noch in ein Schicksal hineingeboren werden konnte. Die Gartenkolonie war einst von Fabrikantensöhnen und Naturärzten, von schmallippigen Asketen und ein paar Gelehrten, von Bauern und hochgewachsenen Frauen mit Strohhüten gegründet worden, als der Staat sich auflöste und die Stadt trost- und der Mensch so ratlos geworden war, dass er in die Natur gehen musste, um sich zu erneuern. Die Damen saßen zwischen Rhabarber und Erdbeeren, und die Herren lehnten sich aus den Fenstern des Hauses, um den Bäumen das Obst herunterzupflücken. Die Kinder liefen nackt über Grund und Boden, der allen gehörte, und abends aß man mit bloßen Füßen im Gras. War es anfangs eine Ansammlung von Leuten so unterschiedlich wie Tag und Nacht, die eine Idee verband, so waren es später die vielen Ideen, die zu jener ersten hinzustießen, die die Schar wieder trennten : Während die einen den Fortschritt verdammten, schmähten die anderen den Stillstand.
Als Anton Winter zur Welt kam, war jene Gemeinschaft des Anbeginns längst aufgedröselt und zu einer kaum überschaubaren Großfamilie geschrumpft, die aus den Liebschaften der Vergangenheit hervorgegangen und dem Garten treu geblieben war. Noch immer bestellte man ein, zwei Felder und kümmerte sich um den Kräuter- und den Obstgarten, aber viele arbeiteten in der für die Kinder so weit entfernten Stadt am Meer. Jene, die am Hof kein Auskommen fanden, fuhren Tag für Tag eine Stunde dorthin, bis die Berge hinter ihnen schrumpften, die Wiesen sich in Straßengeflecht verwandelten und der unebene Boden im unruhigen Wasser verschwand. Diese einstündige Fahrt verband zwei so gegensätzliche Welten, dass man im Garten nicht über die Stadt und in der Stadt nicht über den Garten sprach, als gehörte es sich nicht. Die beiden Orte existierten wie parallele Universen, eines, in dem es nichts als Erde und Berge gab, die man in den kantigen Gesichtern seiner Einwohner wiederfand, und eines, in dem die Gezeiten eben diese Kanten und Falten davonwuschen. Anton und die anderen Kinder hielt man fern vom Meer und der Stadt, als fürchtete man, dass ihr Anblick sie verderben könnte. So blieben sie und die Alten allein zurück im Garten und hatten alle Zeit der Welt.
Zwanzig bis dreißig Menschen lebten je nach Tageszeit in dem gewaltigen Haus und den zwei angrenzenden Nebengebäuden. Inmitten von Wiesen, Feldern und Wäldern, fern von den Straßen, fremd den Nachbarn, so entlegen, dass man nicht zu ihnen sah, eingefasst von einem verrückten Garten, dessen Ränder in die Landschaft schmolzen. Schon alt, als Anton Kind war, halb Bauerngehöft, halb Gutshof, mit wildem Wein an der gelb bröckelnden Fassade und der hölzernen Veranda, dem großen Tor, den Tonnengewölben und dem Walmdach, mutete das Haupthaus eigenartig aus der Zeit gefallen an, und die Lebensgeschichten seiner Bewohner waren in Schichten auf seine Mauern und das Grundstück aufgetragen. Alles lebte und wandelte stetig seine Form, kam, ging, schlug Wurzeln und verschwand in diesem Bienenstock. Es war eine unermüdliche Bewegung, die sich im Takt des Kommens und Gehens der Bewohner dem Chaos des Hauses einschrieb. Der Garten schien ein Gleichnis aus Gedeih und Verderb und allerlei Geheimnissen ; die Alten saßen unter den Magnolien, und die Kinder hielten sich die Kelche der Lilien an die Ohren und hörten hinein, als wären sie ein Grammophon, das zu großen Abenteuern riefe. Alles wuchs und starb nebeneinander in diesem Garten, in dem die Menschen den Pflanzen gleich ihre Stühle dem Sonnenstand hinterherrückten und erst ihre Gesichter dem Licht zuwendeten und später die Köpfe müde hängen ließen, wenn es dunkel wurde.
Für Anton Winter war die Kindheit vollgestopft mit hohen Gräsern und Teerosen und grünen Äpfeln in den Bäumen, die man den ganzen Sommer über so begehrlich ansah, dass sie irgendwann schüchtern erröteten. Die Alten und Kranken waren zu Hause, und durch die dünne Haut fiel ihnen das Sonnenlicht bis aufs Skelett, wenn sie zwischen den Glockenblumen saßen, so zart, als wären sie eine von ihnen. Die Geburt steckte noch in allen Knochen, so dass man den Tod nicht fürchten musste. Die Welt prahlte mit ihrer Größe, und die Himmel jagten über die kleinen Köpfe so lange, bis man sich an sie gewöhnt hatte. Zu Tausenden brachen die Blüten der Fliederbüsche auf über Nacht, dass man meinte, es ginge ein Rauschen durch den Garten. Die Kinder hockten in den Magnolien und dachten an nichts, und so gehörte ihnen alles. Sie sangen wie Vögel in den Ästen für ihre Urgroßtanten und -onkel und für die Säuglinge und Kleinkinder, die man neben den Alten in die vom Waldrand verschattete Wiese legte. An den Friseurtagen knieten sie weinend auf einem Stuhl und blickten den Haaren, die die Mutter mit blitzender Schere abschnitt, nach, wie sie an ihnen herab zu Boden fielen, während die anderen sie umstanden und lachten. Alles hatte Platz in diesem Garten. Nichts war unmöglich damals. Der Himmel war so weit entfernt wie der Mond. Neben der Bienenhütte saßen die Tanten mit Hüten groß wie ein Wagenrad und tranken heißen Tee in der Sonne. Die Backen der Frauen waren weich wie Kirchenbrot, und wenn sie lachten, wuchsen darin kleine Seen. Die weißen Nacht- und Totenhemden wehten an den Wäscheleinen, und die Kinder schlüpften von unten in den vom Wind geblähten Stoff und taten, als wären sie Gespenster. Starb jemand, standen sie nachts gemeinsam im Garten und sahen himmelwärts zu den Sternen, und es war, als ob durch den Riss des Todes die Zurückgebliebenen dem Toten ins Universum hinterherschauten. Man legte das Ohr auf den Boden, um die Verstorbenen zu hören, und schauderte dann ein bisschen. Nichts roch je lebendiger als die lockere Erde der frischen Grabhügel am Rande des Gartens, über die sie sommers mit bloßen Füßen rannten.
Auf den Grabhügeln standen Himbeeren, die sie einander so gierig in die Münder stopften, als wollten sie sehr groß werden, und die, die es bereits geworden waren, trugen abends mühelos die Urgroßmutter auf den Armen ins Haus, als wäre sie bloß ein Holzscheit. Wenn man es mit den Kinderspielen übertrieb, bekam man glasige Augen und ein Fieber, das einen ins Bett drückte, während die anderen draußen vor den Fenstern weiter herumtobten. Ganze Tage zogen die Kinder umher, und niemanden kümmerte es. Was konnte einem draußen in der Welt schon zustoßen? Es war eine Übereinkunft, über die man nicht sprach. Hinter den Fenstern begann die Welt, und hinter den Zäunen wartete ein Schicksal. Die Jungen suchten mit der Dringlichkeit des Anbeginns die Wege, die sie gehen wollten, und die Alten gingen in Demut die Wege zu Ende, die sie einst gewählt hatten. Die Kinder waren Kinder aus Stroh, wenn sie über die Sommerwiesen liefen, und Föten, die in den Bäumen schliefen mit hölzernen Kronen, als zöge der Wald sie auf, wenn sie sich ausruhten, nachdem sie tief in ihn hineingewandert waren. Wenn es spät wurde, gab es zu Hause heißen Gugelhupf, an dem man sich die vom Tag kühlen Hände wärmen konnte, und leise Musik aus den Ecken. Die Alten hielten die Geigen im Schoß, als wären sie Kinder, und spielten auf ihnen von Zeit zu Zeit auf der Veranda, eingemummt in Decken, mit den Bechern voll Apfelsaft und den Tellern voll Butterbrot neben ihren Bänken. Alle strömten herbei des Abends. Die Mütter wiegten die Säuglinge im Takt, und die Väter warfen sie lachend in die Luft. Die Erwachsenen fuhren mit den Wagen aus der Stadt vor, und die Kinder kamen aus allen Richtungen gelaufen. Die Hofhunde umringten die Heimkehrer und leckten ihnen das Blut von ihren aufgeschlagenen Knien. Im Garten dann erzählten sie alle einander von ihren Wanderschaften und Wandlungen und wurden sanft unter der Gelassenheit der Großeltern, die indessen gierig waren nach ihrem Überschwang, bis alle ihre Ruhe fanden. Dann verstummten auch die schimpfenden Vögel in den Bäumen und schliefen stumm wie Früchte mit den Köpfen in ihrem Gefieder, während sich die Blumen langsam schlossen und der Garten feucht und schwarz wurde von der Nacht.
Das Haus war stets erfüllt von Gute-Nacht-Geschichten für die Kleinen, von tausend Schritten und dem sauren Geruch, der aus den Essigleintüchern stieg, die man den Kranken um ihre schmerzenden Beine wickelte. Die Schaukelpferde jagten aufgezäumt durch die Nacht und waren ebenso gute Freunde wie die Hunde, die den Kindern um die Beine liefen. Man hielt das Ohr an den Brustkorb der schlafenden Haustiere und hörte die Herzschläge der Katzen wie Drums. Die Frauen nahmen ihre Ringe und Ohrringe ab und legten sie auf den Nachttisch mit weißen Händen. Ein letztes Mal drehte man den Kindern die Wundertrommel an, dass sie den Bildchen der springenden Pferde hinterherträumen konnten. Den Alten strich man, über die Betten gebeugt, die Falten glatt, und den Brüdern Anton und Leander schlug man lächelnd die Bücher unter den rauen Decken zu. Anton glaubte sich noch viele Jahre später zu erinnern, dass die Mutter roch wie ein Engel, wenn sie sich nachts zu ihm setzte, um ihn zu küssen. Und er erinnerte sich an den Schatten, der ihm ins Gesicht fiel, bevor ihn ihre Lippen berührten. Dann gab es nur noch das Kinderlicht, das die Eltern der verwandelten Landschaft der Nacht entgegenstellten, jene winzige Lampe im Bubenzimmer, die Schatten der flackernden Kerzen und die Stimmen der Erwachsenen, die von der Veranda heraufdrangen. Sie lagen mit den Köpfen in ihren großen weichen Locken, hörten den merkwürdigen Geräuschen zu und hefteten die Augen an den kargen Lichtkegel, bis sie ihnen zufielen. Immer war es warm im Bett. Man schlief wie tot, und die Nächte waren so lang. Man liebte sie so sehr, wie man die Dunkelheit fürchtete. Morgens war das Aufwachen ein Wachsen. Den Kindern schien es, als wären sie in den Brutkästen der Nacht ein Stückchen größer geworden und müssten nun hineinwachsen in die Welt und die Glieder strecken, als gingen die Körper auf wie verklebte Blüten mit dem ersten Licht.
In den Kindern wiederholte sich das ewige Wachstum, über das alle Bescheid wussten. Die Bewohner des Gartens erzogen die Kinder zu einer Zukunft, für die man erst genau Maß nahm und die dann akkurat mit dem Leben mitwuchs, die in den kleinen Schritten von gestern und den großen Wünschen von morgen wurzelte. Sie sperrten Schutzengel in Medaillons und verhängten mit den Goldkettchen einen Segen wie ein Urteil über das Leben der Kinder. Sie forderten einander zu Großem auf : groß und größer zu werden. Die Großmutter predigte, dass die Zukunft jene Reihe an stets wachsenden Vorzeichen wäre, die man rückblickend betrachtet richtig gedeutet hätte. Und der Großvater fügte hinzu, dass die Zukunft auch der Eintritt all der schlechten Vorahnungen sei, von denen man gar nichts gewusst habe, und zündete sich dann auf der Veranda eine Pfeife an, als wolle er sich zum Schutz in Rauch einhüllen.
Anton war ein Kind, das sich sowohl von der Begeisterung für das Leben als auch von jener für den Tod anstecken ließ. Die Bewohner sprachen viel über den Tod in ihrem Garten, denn wie sollte man irgendwann in Ruhe sterben, wenn man darüber schwieg. Es galt ihnen : Was man nicht über die Lippen bringt, bringt man auch nicht übers Herz. Und Anton gewöhnte sich schnell an die Veränderungen, die das Leben mit sich brachte. Dass die Natur alles auflöste, was sie gebar, in einem Wasserglas, in einem Sturm, in einem Winter, fand er aufregend. Dass die Menschen um ihn herum starben, machte ihn nie unsicher. Die Familie war groß genug, um all das Sterben zu tilgen und jeden Tod mit einer Geburt, einer Hochzeit oder bloß einem unerwarteten Besuch auszusöhnen. Alles, was war, teilte sich die Welt mit all jenem, was sein würde. Eine chronische Ruhe breitete sich in dem Buben aus, als er das verstand, und er wurde ein eigenbrötlerisches Kind ohne Vorsicht, was die anderen dächten, ein unerbittlicher Einzelgänger, der ein genaues Auge auf die Welt, die ihn umgab, hatte. Er liebte ausdrücklich all jenes, was greis war, und all das, was alt wurde. Er war fasziniert von den Toten, die alle paar Jahre feucht auf dem Sterbebett lagen und denen seine Mutter mit den Fingerspitzen über die Augen strich, bevor man sie im Garten begrub. Und er saß gerne bei den Kranken, die den Garten nicht mehr verlassen konnten, und sah sie so genau an, wie man einen Sternenhimmel beobachtet. Ehrfürchtig stand er vor den Frauen, die eine Leibesfrucht in sich trugen, wie er die Großmutter sagen hörte, und dachte ganze Sommer lang beunruhigt, dass in ihren Bäuchen ein großer Apfel wüchse. Oft fand er auf seinen Streifzügen durch den Wald aus dem Nest gefallene Vögel und beschädigte Tierchen, die er, die hohlen Hände zum Käfig gekrümmt, mit nach Hause nahm und seinem Bruder überließ, dessen Ehrgeiz es war, sie wieder gesund zu pflegen. Leander wollte irgendwann dem Großvater nachfolgen und die Apotheke übernehmen, wenn sein Onkel, der sie nun führte, zu alt und er selbst alt genug sein würde. Anton begnügte sich damit, sich Tag für Tag auf den Boden neben die Schachteln und selbst gebauten Nester zu hocken und einen Blick auf die dank Leander zusammenwachsenden Beinchen und Flügel zu werfen, während die Tiere mit stummen Augen erschreckt zu ihm hinaufstarrten. Er sah das Beschädigte als das Besondere. Er lobte sich das Einmalige und seine Zerstörbarkeit. Er mochte das Schadhafte, jene Stelle, an der die Heilung aus- und eine ewige Gegenwärtigkeit einsetzte. Sein Bruder rieb, wie er es von dem Großvater gelernt hatte, die kranken Vögel mit Rosenessig und Kamillensalbe ein, die er aus dem Apothekerschrank des Arbeitszimmers stahl, wenn niemand hinsah.
Während der Bruder mit sauren Händen durchs Leben ging und das Schadhafte wieder ganz machte, streunte Anton durch die Welt und sammelte die Irrtümer und Schönheiten der Schöpfung auf. Er war in den Bann gezogen von der Harmonie der Mineralien und der Geometrie des Wachstums, deren Ordnung nur hin und wieder gestört war. In den Kinderzimmerregalen lagen abgestreifte Schlangenhäute, erbärmlich wie zurückgelassene Häuser, und schämten sich, weil sie ihren Bewohnern zu klein geworden waren. Der Raum roch holzig und tierisch und süß nach dem noch milchweißen Kinderhaar der Brüder. Am Boden fiepten die kranken Küken. In der Nacht irrlichterten die Augen der Schützlinge durch die Dunkelheit. Die ausgekochten Schädel winziger Wildtiere beschwerten die Zeichenpapierbögen und Schulhefte. Große fremdartige Muscheln, die der Großvater von einem Besuch aus der Stadt mitgebracht hatte, lagen auf der Fensterbank. In den Hosentaschen trug Anton gehärtetes Harz glatt wie Glas, auf dem man, hielt man es gegen das Licht, die Fingerabdrücke sah. Um den Hals die Kette aus Milchzähnen von der Großmutter, die Zahn für Zahn, den man ihr brachte, nachdem man ihn verloren hatte, auffädelte auf spinnwebendünnes Garn und den Kindern um den Hals hängte, bis alle ausgefallen waren.
Gerne stand Anton im Sommer, wenn die Tomaten auf den Fensterbänken in der Hitze dörrten, in der Kühle der Speisekammer, wo neben den Käselaiben und Holundersäften im obersten Fach auch die Gläser standen, in denen die Großmutter alle Fehlgeburten aufbewahrte, die ihr im Laufe ihres Lebens zu früh aus dem Bauch abgegangen waren und von denen sie sich nicht trennen mochte. Die Enkel sahen sie sich nur selten an, um einander ihren Mut zu beweisen, aber Anton trieb sich oft alleine in der Speisekammer herum. Stunde um Stunde bat das Kind alle, die vorbeikamen, es hochzuheben, damit es sie betrachten konnte, und waren die Erwachsenen zu beschäftigt, kletterte es heimlich und ohne fremde Hilfe die Schränke empor. Um sie gegen das Licht zu schützen, waren die sechs Gefäße, als wären sie Teil eines Zaubertricks, mit dunklen Tüchern bedeckt. Anton Winter kniff die Augen zusammen und hob die Tücher Mal für Mal : atemlos wie ein Magier. Unter den Stoffen schlummerten phantastische Welten aus Gewebe und Nervenzellen, Geschöpfe eingehüllt in eine weiche nasse Haut, durch die man hindurchsah, als wäre sie eine Fensterscheibe. Es war ein stilles Glimmen in der Speisekammer. Die winzig kleinen Körper schienen weiß wie der Mond. Sie schwammen in Formalin und stiegen schwerelos bis an die Deckel der Gläser. Auf den Marmeladeetiketten standen in der Handschrift der Großmutter die Jahreszahl ihrer Entstehung und das Datum ihres Verlustes. Mit großen Augen stand Anton auf Zehenspitzen in dem Regal wie auf einer Leitersprosse und verglich das, was er sah, mit dem, was er aus den Anatomieatlanten des Großvaters kannte. Da gab es kaum einen Finger breite Gebilde, groß wie ein Seepferdchen, und ein Menschlein hinter Glas, das sich schläfrig mit geballter Faust an den Brustkorb griff, als müsse sein Herz doch weiterschlagen. Ihre Augen waren schwarz oder leuchteten hinter den niedergeschlagenen Lidern, als wären sie nicht Tote, aber nur Träumende. Adern rot wie ein Baum wuchsen ihnen im durchsichtigen Schädel. Sie waren fossile Ureinwohner, die die Zeit nicht wandelte. Sie waren schlafende Uhren. Sie waren die ungeborenen Pilger der Welt, die starben, lange bevor Geburt und Schicksal sie heimsuchen konnten, und lächelten versteinert mit jenem Lächeln, das einem nur dann im Gesicht steht, ehe man aufwacht.
Anton Winter erschienen diese kleinen Tode als angenehmer Ruhepol in diesem Haus und Garten, in dem Tag für Tag so vieles lebte, und so verbrachte er zahllose Stunden mit den Wesen hinter Glas. Er sah sie sich gut an.
Man wartet viel, wenn man Kind ist, und : man erwartet viel. Als Kind besitzt man diese unsagbare Zeit, sich die Welt anzusehen. Man geht tastend durch die Welt und weckt die Gegenstände. Nie wieder weiß man so viel, und nie wieder verspricht man sich so viel von ihr. Nie wieder schaut man so uneitel auf all das, was anwesend ist um einen. Die Augäpfel sind Erdkugeln, auf denen eine Schwerkraft wirkt, die alle Bilder aus dem Äther zu ihnen herabzieht. Nie wieder sieht man in den Kleinigkeiten so sehr Grund zu großen Hoffnungen. Später schienen Anton die Jahre des Heranwachsens ein großes Warten gewesen zu sein und ein lautloses Wachsen, ein paar heiße Sommer und ein paar kalte Himmel im Winter und stets jene weit aufgerissenen Augen, die die Welt nicht entkommen ließen.
Die Apotheke der Großeltern hatte ihr mittlerer Sohn, Antons Onkel, übernommen, als ihnen der tägliche Weg in die Hafenstadt zu weit geworden war. Manches Mal machten die beiden noch Ausflüge dorthin, setzten sich Hüte auf mit Krempen flach und schneidend wie Rasiermesser, besuchten ihren Sohn in der Apotheke und standen verblüfft am fischigen Meer, als hätten sie im Garten und in den ihn umschließenden Landschaften vergessen, dass es dieses gab. Die Stadt schien ihnen nunmehr kalt und dunkel, zu wenig grün, voller Anker und Trompetenspieler, endloser Häuserreihen und Speichergebäude, das Meer bedrohlich. Seit sie alt waren, wuchs sie ihnen über den Kopf. Dass sie einst, wie so viele andere es heute taten, in ihr gearbeitet hatten, schienen die Großeltern vergessen zu haben. Längst war sie ihnen ein Abenteuer geworden, zu dem sie aufbrachen und von dem sie abends heimkamen mit vom Wind zerzaustem und vom Meersalz verklebtem Haar, dessen Geruch die Kinder bei jeder Umarmung sehnsüchtig einatmeten.