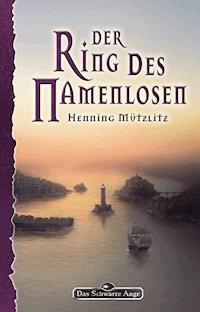Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Feder & Schwert
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine dämonische Verschwörung bedroht Frankreich Frankreich, 1642: Dämonenjünger schüren Angst und Verzweiflung in den Herzen der Menschen. Gegen sie stellen sich die Musketiere des Schwarzen Banners, arkane Kämpfer, die weder Tod noch Teufel fürchten. Allerdings vermögen auch sie nicht den Mord am Gouverneur der Provinz Poitou zu verhindern. Als die magiebegabte Kammerdienerin Cécile die Flucht vor den Mördern ergreift, gewinnt sie in dem Musketier Armand einen unerwarteten Verbündeten. Doch schon bald müssen sie sich entsetzlichen Feinden und ihren persönlichen Abgründen stellen. Währenddessen kommt der Befehlshaber des Schwarzen Banners, César de Rochefort, auf Geheiß Kardinal Richelieus Verrätern an Krone und Dreifaltigkeit auf die Spur. Dabei stößt er auf eine Verschwörung, die sich von den höchsten Kreisen des Königreichs bis in die Domänen der Hölle erstreckt. Fern von Paris obliegt es allein Cécile, Armand, Rochefort und ihren Verbündeten, den dunklen Pakt der Dämonendiener zu zerschlagen und Frankreichs Sturz in die Finsternis abzuwenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Autor: Henning Mützlitz
Lektorat: Judith C. Vogt
Korrektorat: Frank Roßnagel
Covergestaltung: Tobias Rafael Junge
Coverillustration: Mia Steingräber
ISBN Taschenbuch: 978-3-86762-360-5
ISBN E-Book: 978-3-86762-361-2
© Feder & Schwert 2019
Hexagon: Der Pakt der Sechs ist ein Produkt der Feder & Schwert GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur zu Rezensionszwecken und mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Inhaltsverzeichnis
Für Bernd
Kapitel 1
Frankreich, Juli 1642.
Cécile lief vorsichtig den Gang hinunter. Dunkelheit umfing sie. Lediglich durch einen Schlitz am Ende des Korridors fiel ein wenig Licht, kaum ausreichend, um die eigenen Füße zu erkennen. Von dort hinten hörte sie die Stimmen der Herrschaften, denen sie heute ein letztes Mal aufwartete. Obwohl sie den schmalen Korridor während des Abends bereits oft durchquert hatte, kannte sie im Gegensatz zu den anderen Bediensteten noch immer nicht alle Stufen, Absätze oder versteckten Stolperfallen. Nach wie vor war also höchste Vorsicht geboten, denn schließlich sollte der gelungene Abend nicht in einer Katastrophe enden.
Die junge Kammerdienerin war emsig darauf bedacht, nichts auf dem Silbertablett verrutschen zu lassen, das sie trug. Umständlich streckte sie die Arme nach vorne, um nicht an die Wände zu stoßen. Dennoch musste sie sich beeilen, durfte doch der Nachtisch keinesfalls kalt sein, wenn sie ihn servierte. Es handelte sich dabei um die neueste Sensation des Küchenchefs: ein bislang in Frankreich unbekanntes Rezept, das er von einem Freund aus Spanien erhalten hatte und nun unter dem Namen »Crème fermé« als eigene Kreation ausgeben wollte. Cécile hatte in der Küche beobachtet, wie er dessen Oberfläche umständlich erhitzt hatte, bis sie zu einer kristallinen Kruste verschmolzen war. Das war offenbar das Besondere an diesem Dessert. Sie kannte sich nicht mit derlei Süßspeisen aus, denn es war ihr zum ersten Mal vergönnt, ihrem Herrn und seinem Gast die verschiedenen Gänge zu servieren.
Immerhin konnte man nichts von der Crème verschütten, wenn man sich schon so beeilen musste. Chefkoch Antoni hatte ihr mit Schlägen gedroht, wäre sie zu langsam und die Crème bereits erkaltet. Cécile zweifelte nicht daran, dass er die angekündigte Strafe durchsetzen würde, sollte sie zu lange benötigen. Der Umstand, dass der Kammerherr ihr noch eine Karaffe Cognac sowie dazugehörige Kristallgläser auf das Tablett gestellt hatte, erschwerte die Aufgabe zusätzlich.
Ihre Arme brannten, als sie die leichte Tür, die aus dem Botengang in den Großen Salon des Hauses führte, mit dem Fuß aufstieß. Die anderen Domestiken hatten das schmutzige Geschirr der Hauptgänge entfernt, sodass sie das vorläufig letzte Mal ins Speisezimmer trat. Wieder erfasste sie diese Aufregung, die sie seit dem Moment ergriffen hatte, da der Kammerherr ihr mitgeteilt hatte, dass sie erstmals helfen würde, dem Herrn Vicomte Charles de Châtellerault am Abend die Speisen zu servieren.
Konzentriert brachte sie die letzten Schritte bis zum Esstisch hinter sich. Sie hoffte, dass der Seigneur und sein Gast das Zittern in ihren Armen nicht bemerkten, als sie das Tablett vorsichtig abstellte. Es klapperte beim Aufsetzen etwas, aber die Herrschaften schienen keinerlei Notiz davon zu nehmen, und zu ihrer Erleichterung war auch nichts umgefallen.
Zuerst servierte sie das Dessert des Gastes. Sie beeilte sich, ihm die Keramikschale, die auf einem silbernen Unterteller drapiert war, zu reichen, ohne dabei in unhöfliche Hast zu verfallen. Erleichtert spürte sie, dass von dem Gefäß noch Wärme ausging. Sie verbeugte sich kurz vor dem Mann, der lediglich als Marquis de Cinqmars vorgestellt worden war. Der junge Adlige, wahrscheinlich nur wenige Jahre älter als sie, ignorierte sie schon den ganzen Abend und beachtete sie auch dieses Mal nicht. Cécile war zwar von den älteren Bediensteten berichtet worden, dass solch ein Verhalten schlichtweg normal für die hohen Herrschaften sei, dennoch ärgerte sie sich ein wenig, dass er sie nicht einmal mit einem dankbaren Lächeln, vielleicht einem Nicken oder wenigstens einem Blick bedachte, nachdem sie ihn und seinen Gastgeber stundenlang bedient und ihnen jeglichen Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Es wäre ihr Dank und Lohn genug gewesen.
Andererseits war sie froh darum, dachte sie, während sie das Dessert auch dem Vicomte servierte. In unmittelbarer Gegenwart des Marquis fühlte sie sich nicht wohl. Als sie dicht neben dem langhaarigen Aristokraten stand und die bauchigen Gläser mit einem Schluck Cognac füllte, verspürte sie erneut Unbehagen, sogar stärker als zuvor. Der Marquis hatte sie weder beachtet noch berührt. Dennoch erschien es ihr, als habe er seine Präsenz in diesem Moment auf sie gerichtet, obwohl er gerade mit dem Vicomte plauderte. Cécile fühlte sich vollkommen von ihm durchdrungen, beinahe, als stünde sie entblößt vor ihm und offenbarte ihm gleichzeitig ihre schlimmsten Ängste und geheimsten Wünsche. Kaum dass sie es wahrnahm und ihre Hände zu zittern begannen, verschwand das Gefühl wieder – ebenso schnell, wie es sie überkommen hatte.
Die junge Frau wusste nicht, ob sie diese nie zuvor verspürte Empfindung erschrecken müsste. Stattdessen ertappte sie sich dabei, es als durchaus angenehm empfunden zu haben. Für wenige Augenblicke war sie dem fremden Adligen schutzlos ausgeliefert gewesen. Was es auch gewesen wäre, sie hätte alles für ihn getan.
Was war nur mit ihr los? Ihre Sinne mussten ihr einen Streich spielen! Wahrscheinlich lag es an der Müdigkeit, an der Erschöpfung nach einem Arbeitstag mit mehr als sechzehn Stunden.
Cécile kniff kurz die Augen zusammen, um einen klaren Blick zu bekommen. Sie schenkte den Cognac ein und überzeugte sich davon, dass es den Herrschaften an nichts mehr fehlte. Dann trat sie zwei Schritte zurück und deutete eine Verbeugung gegenüber dem Vicomte an.
»Dank ihr, sie darf sich zurückziehen«, sagte er, und sie meinte, den Anflug eines Lächelns zu erkennen.
»Sehr wohl, Seigneur«, nickte sie und knickste artig.
»Wir möchten nicht mehr gestört werden. Sollten wir noch etwas benötigen, werde ich es den Camérier wissen lassen.« Er bedeutete ihr mit einer Handbewegung, dass sie sich zu entfernen hatte.
Langsam zog sie sich in den Botengang zurück und schloss so leise wie möglich die Tapetentür, damit sie die Männer nicht unnötig durch ein Geräusch belästigte.
Endlich! Cécile seufzte und nahm zum ersten Mal seit Stunden die Spannung aus dem Körper. Harte Arbeit mit tadellosem Auftreten zu verbinden, war weitaus anstrengender, als sie vermutet hatte. Ihr Rücken schmerzte höllisch, die Beine fühlten sich weicher an als die von ihr servierte Crème, und darüber, ob sie den Kopf jemals wieder geschmeidig drehen konnte, wollte sie lieber nicht nachdenken.
Sie versuchte, den verspannten Nacken zu lösen, indem sie ihn mit den Fingerkuppen massierte. Es verschaffte nur wenig Linderung, sodass sie beschloss, lieber in die Küche zu eilen, um Antoni Bericht zu erstatten und dann endlich ins Bett zu kommen. Nur ausreichend Schlaf würde Müdigkeit und Schmerzen aus den Gliedern vertreiben. Erneut sandte sie ein Dankgebet zum Himmel, dafür, dass sie am nächsten Tag nicht zu arbeiten hatte.
Nach zwei Schritten bemerkte sie, dass etwas sie zurückhielt. Erschrocken wirbelte sie herum, doch da war niemand.
Jetzt fange ich wirklich an, zu träumen!
Und doch schien es ihr, als habe sie jemand an der Schulter berührt, fast gezogen, so, als solle sie diesen Ort nicht verlassen.
Alles Einbildung! Wer sollte sie hier im Gang aufhalten wollen? Der Kammerherr? Antoni? Alle anderen Bediensteten waren längst zu Bett gegangen. Und genau das musste sie ebenfalls schleunigst tun, wenn ihr müder Geist sie nicht endgültig durcheinander bringen sollte.
Erneut wollte sie sich zum Gehen wenden, doch anstatt sich vom Salon zu entfernen, schlich sie die wenigen Schritte zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war.
Nun musste sie nicht mehr darüber nachdenken, warum sie es tat, oder was sie dazu zwang. Wer wusste schon, wann sie den Seigneur und seine Gäste erneut betreuen durfte? Und wer konnte sagen, wann sie jemanden wie den Marquis, immerhin ein Günstling des Königs und eigens aus dem fernen Paris angereist, wie sie sich hatte sagen lassen, jemals wiedersah?
Schon war sie an der Tapetentür angelangt und spähte vorsichtig durch den Schlitz, der gewöhnlich dazu diente, unauffällig zu beobachten, ob der Vicomte oder seine Gäste etwas benötigten. Der Camérier hatte sie und die anderen Mädchen zwar darauf aufmerksam gemacht, doch bislang war sie nicht dazu gekommen, diese Funktion des Dienstbotengangs zu nutzen – sie war ja den ganzen Abend hin- und hergelaufen, um rechtzeitig alle Speisen und Getränke zu servieren.
Es schadete allerdings niemandem, wenn sie noch eine Weile hierblieb und den einen oder anderen Blick riskierte. Vielleicht benötigte der Vicomte tatsächlich noch etwas, und dann war sie zur Stelle. Solch eine Aufmerksamkeit wurde sicher honoriert und brachte ihr gegenüber den anderen Mädchen einen Vorteil ein.
Als sie aber den Marquis erblickte, der gerade einen Schluck Cognac zu sich nahm, und ihr ein kalter, und doch wohliger Schauer über den Rücken lief, ihr Herz wild zu klopfen begann und ihr Bilder in den Kopf schossen, die sie normalerweise erröten ließen, wusste sie, dass der Grund ihres Verweilens ein gänzlich anderer war.
»Ausgezeichnet!« Cinqmars stellte das leere Weinbrandglas auf dem Tisch ab.
»Das freut mich«, erwiderte sein Gastgeber mit einem Lächeln und schenkte nach. »Seit fünf Jahren lasse ich mir ausschließlich die Erzeugnisse des Hauses Frapin aus der Grand Champagne kommen. Er produziert nur wenige Dutzend Fässer im Jahr, und ich bin einer der Glücklichen, denen es vergönnt ist, einige davon exklusiv zu beziehen.«
»Schätzt Euch glücklich, Monsieur. Nicht einmal am königlichen Hof habe ich solch einen edlen Tropfen zu mir genommen.«
»Dann sollten wir dem König nichts von Frapin und seinem Cognac berichten, sonst wird außer Louis und seinem Hofstaat künftig niemand mehr in dessen Genuss kommen«, schmunzelte der Vicomte und schenkte dem Gast nach. »Aber berichtet, Marquis, was treibt Euch zu mir? Ich unterhalte mich gerne mit Euch über den Tratsch in Paris, den besten Baugrund in der Bretagne oder die Qualität von Cognac, aber dies wird kaum der Grund sein, weshalb Ihr den Weg bis in das Poitou auf Euch genommen habt.«
Nun war es an Cinqmars, zu lächeln. »Eben diese Scharfsinnigkeit ist es, die mich veranlasste, Euch aufzusuchen, Monsieur.«
»Die nicht zu überhörende Ironie in dieser Aussage könnte man als beleidigend auffassen, Marquis. Kein geeignetes Mittel, um ein Gespräch zu eröffnen, scheint mir. Oder war das lediglich der plumpe Versuch, mir zu schmeicheln? Auch dies, so versichere ich Euch, wird nicht vonnöten sein.«
»Natürlich nicht, Monsieur. Seid versichert, beides lag nicht in meiner Absicht. Tatsächlich habt Ihr richtig erkannt, dass nicht das Parlieren über die Genüsse des Lebens meine Schritte in Euer Domizil lenkte – so angenehm mir das Gespräch über derlei Vergnügungen auch ist.« Er nahm einen Schluck Cognac und räusperte sich. »Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Während das Heilige Römische Reich zerfällt, schreitet die Integration Frankreichs unaufhaltsam voran, angetrieben von der Zentralverwaltung und immerzu im eisernen Griff des Ersten Ministers.«
»Monsieur, verzeiht, aber das ist hinlänglich bekannt. Eine Lektion in Politik und Verwaltungsdingen benötige ich zu dieser fortgeschrittenen Stunde nicht mehr. Ich bitte Euch höflich, zum Punkt zu kommen.«
»Selbstredend, Monsieur. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ihr verbringt Eure Tage nunmehr im lieblichen Poitou, als Verwalter eben jener neuen Ordnung, die Richelieu etabliert hat, und doch wissen wir beide, dass Euch mehr bestimmt sein müsste, als lediglich die Hoheit über eine Krondomäne auszuüben.«
»Wenn Ihr auf die Güter meines Hauses etwas weiter nördlich anspielt, werdet Ihr ebenso gut wie ich wissen, dass auch diese der Verwaltung der Krone unterliegen. Der Ort, an welchem ich meiner Aufgabe nachgehe, ist also gleichgültig. Alles andere ist Gefühlsduselei, die sich den Realitäten der heutigen Zeit verschließt.«
»Genau dort liegt das Problem, auf das ich Euch nicht eigens aufmerksam machen muss: Seit fünfhundert Jahren wird die Aristokratie kontinuierlich ihrer ureigenen Rechte beraubt. Und seit dem Guten König Henri wird eine offene Politik der Enteignung durch die königliche Zentralverwaltung betrieben.«
»Monsieur, natürlich gebe ich Euch recht, und ich könnte in Eure Klagen über diesen fortschreitenden Prozess mit einstimmen, aber was würde es mir nützen? Châtellerault befindet sich seit 1482 in königlicher Hand. Den Kampf darum haben meine Vorfahren bereits vor über einem Jahrhundert geführt und verloren.«
»Mir ist sehr wohl bekannt, dass diese Entwicklung nicht erst seit Richelieu im Gange ist. Ich muss Euch nicht erklären, wie es die Krone über all die Zeit geschafft hat, den Feudaladel zu entrechten, seiner angestammten Domänen zu berauben und zum Schein mit pompösen Titeln auszustatten.«
»Wurden Euch selbst nicht letzthin derartige Titel zuerkannt, Marquis?«, fragte der Vicomte spöttisch. »Lasst mich überlegen … Was war es doch gleich? Großmeister der Königlichen Garderobe und Oberstallmeister? Sagt mir nicht, dass Ihr damit bei Hofe nicht über einen erheblichen Einfluss verfügt, ungeachtet profaner Ländereien? Habt Ihr nicht gar das Ohr des Königs?«
»Wenn Ihr damit den Einfluss auf die Spitzfindigkeiten des höfischen Protokolls und die Spielereien der dortigen Gesellschaft meint, mögt Ihr recht haben, Vicomte, doch meine Einflussmöglichkeiten auf tatsächlich relevante Bereiche sind äußerst begrenzt. Mein Vater war Marschall der Dragoner, meine Verlobte ist Louise Marie aus dem ehrenwerten Haus der Gonzaga, und ich soll mich mit einem Titel zufriedengeben, der nahezu ausschließlich auf die königlichen Paläste beschränkt ist?«
Châtellerault lächelte. »Daher weht also der Wind, mein werter Marquis de Cinqmars. Ihr fühlt Euch ungerecht behandelt, herabgestuft, und es verlangt Euch, schlicht gesprochen, nach mehr Einfluss.«
»Ja und nein. Natürlich würde ich lügen, behauptete ich, es ginge mir in dieser ganzen Sache nicht auch um mich persönlich. Aber ich möchte zum Kern des Ganzen vordringen, von dem ich weiß, dass Ihr diesen ebenso erkennt wie ich. Wo früher einmal der Grundherr über seine Güter herrschte, niemandem verpflichtet als dem Lehnsherrn, existiert jetzt eine Klasse an Verwaltern. Die Bürokratie hat die Aristokratie ersetzt, flankiert vom allumfassenden Einfluss der Geheimpolizei und der Roten Garde. Glaubt Ihr, nur weil der Erste Minister zufällig einen purpurnen Mantel trägt, legitimiert ihn das zu uneingeschränkter Machtausübung? Nein, ich sage Euch, der Kardinal besitzt in Frankreich mehr Macht als alle Heiligen zusammen!«
Der Vicomte schwieg einen Moment und dachte über die Worte des Marquis nach. »Monsieur, ein Wort der Warnung: Ihr wandelt hier auf einem schmalen Grat. Andere würden Euch für diese Wortwahl wegen Hochverrats anklagen. Seid dankbar, dass Ihr in einem Haus zu Gast seid, das dem Ersten Minister mitunter … distanziert gegenübersteht.«
Cinqmars vollführte eine entwaffnende Geste, und ein Schmunzeln umspielte seine Lippen. »Verzeiht, aber bei anderen würde ich nicht diese Worte wählen, Vicomte.«
»Das mag sein, und im Kern der Sache stimme ich Euch zu. Ihr versteht es, einen auf breiter Ebene gehegten Unmut zu artikulieren. Bedenkt aber, dass ich in erster Linie eine Kreatur eben jenes Systems bin, dem Ihr soeben die Legitimation abgesprochen habt, wenngleich ich vom Blute her dem Uradel angehöre. Zudem scheint Ihr misszuverstehen, dass alle Veränderungen der vergangenen Dekaden, seien es nun die Ausweitung der Krondomänen, die Errichtung der Provinzen oder das Intendantentum nicht durch die Minister, sondern vor allem durch den jeweiligen König erlassen wurden – ob es nun Charles, Henri oder Louis gewesen sind.« Er seufzte. »Mir schwant, Ihr wollt einen Kampf aufflammen lassen, der längst ausgefochten und von unsereins verloren wurde, Monsieur.«
»Dann habt Ihr mich nur zum Teil verstanden, Vicomte. Mir geht es nicht um die Wiedererrichtung eines feudalen Ständestaats, dessen Aufrechterhaltung nur zu innerer Schwäche führen kann – man sieht es ja am Heiligen Römischen Reich. Nein, was ich anstrebe, ist eine Beschränkung der Macht des Ersten Ministers. Nicht vor ihm soll Frankreich niederknien, sondern vor seinem tatsächlichen König. Nicht vor einer Politik, die die Staatsräson und die Dogmen der Kirche immer so miteinander verwebt, dass für ihn der größte Gewinn dabei herausspringt. Was wir benötigen, ist innere Stabilität, die nicht bloß vom Speichelleckertum abhängig ist.«
Der Vicomte zog die Augenbrauen zusammen. »Und Ihr glaubt, Ihr seid der Mann, um diese Verhältnisse zu ändern? Was ist mit Louis, wenn der Kardinal nicht mehr da ist? Wie lange glaubt Ihr, werden wir unsere Stellung gegenüber anderen Reichen bewahren können? Ihr kennt den König besser als ich. Wie lange wird er sich allein auf dem Thron halten? Euer Gedanke ist zu kurz gegriffen. Ihr treibt die Schwächung, nicht die Stärkung Frankreichs voran.«
»Glaubt mir, darüber habe ich nachgedacht. Ich käme kaum mit so etwas zu Euch, verfügte ich nicht über Verbündete, die der gleichen Ansicht sind. Der Kardinal hat sich viele Feinde gemacht, das ist nichts Neues. Aber dieses Mal liegen die Dinge anders, Monsieur. Das Pendel wird nicht mehr zu seinen Gunsten zurückschwingen wie so oft zuvor. Condé war erst der Anfang!«
»Ich ermahne Euch erneut: Bedenkt Eure Worte und nehmt nicht die Namen von Hochverrätern in den Mund! Auch meiner Toleranz sind Grenzen gesetzt«, entgegnete Châtellerault ungehalten.
Cinqmars war davon unbeeindruckt. »Monsieur, es liegt nicht an mir, über meine Worte nachzudenken. Soeben habt Ihr bestätigt, dass ich mit meiner Beschreibung der Missstände im Recht bin, nun wiegelt Ihr das Gesagte unter dem Vorwurf des Verrats ab. Niemand beabsichtigt, den König zu stürzen, Frankreich zu verraten oder die Siegel zu den Domänen der Hölle zu zerstören. Es geht einzig um Richelieu! Es geht um den alten, übel gelaunten Despoten, der die Fäden in der Hand hält und jeden Untertan wie eine Puppe in seinem grausamen Spiel tanzen lässt.«
»Wenn ich Euch richtig verstanden habe, Marquis, haltet Ihr Euch wohl für denjenigen, der stattdessen der Puppenspieler sein soll?«
»Ich? Beileibe nicht!«, antwortete Cinqmars lachend. »Das würde ich mir nicht anmaßen. Nein, dafür steht jemand bereit, der vom rechten Blut und den besten Fähigkeiten ist. Wie gesagt, bin ich nicht alleine. Zwei Dekaden schwelte der Unmut, nun bahnt er sich seinen Weg. Was verlören wir, gäbe es den Kardinal nicht mehr? Überlegt doch, was die Alternative sein könnte: Der Erzherzog von Orléans wäre derjenige, der Frankreich an der Seite seines Bruders am besten dienen könnte.«
Châtellerault stieg unvermittelt die Zornesröte ins Gesicht. »Gaston? Ich hätte es mir denken können. Beinahe hattet Ihr meinen Verdacht zerstreut, doch nun seid Ihr zu weit gegangen, Cinqmars. Wiegelt es nicht erneut ab, denn Ihr verlangt nichts weiter als den Hochverrat! Ihr habt mich endgültig davon überzeugt, dass Ihr mit Kräften im Bunde steht, für die ich nichts als Abscheu empfinde.«
Der Marquis seufzte und blickte betreten zu Boden. Einige Augenblicke verharrte er in dieser Pose, bevor er fast schon provozierend langsam einen Löffel der erkalteten Crème zu sich nahm. Dann richtete er den Blick auf sein Gegenüber, und aus seinem Antlitz war jegliche Emotion gewichen. »Vicomte, Ihr macht Euch keine Vorstellung davon, mit welchen Kräften ich im Bunde stehe.«
Als sei ein unhörbarer Befehl erklungen, öffneten sich die Flügeltüren des Salons. Mit wehendem Umhang stürmte ein großgewachsener, bärtiger Mann herein. Durch seinen schwarzen Mantel, der das Licht regelrecht aufzusaugen schien, wirkte er wie ein erwachter Schatten der Nacht, der gekommen war, um rechtschaffene Seelen in die Finsternis zu reißen. Die blankrasierte Kopfhaut schimmerte im Kontrast dazu im Licht der Kerzen, und seine Augen wurden von schwarzen Onyxgläsern verdeckt. Sein blankgezogener Krummdolch wirkte wie ein stählerner Auswuchs des Körpers.
Keine zwei Wimpernschläge später war er bei dem vor Angst starren Vicomte. In einer blitzschnellen Drehung schnitt die Klinge über dessen Hals.
Einen Blutfaden hinter sich herziehend, führte er den Dolch vor den Körper und deutete eine Verbeugung in Richtung des Marquis an. Dann verschwand er in den Schatten, aus denen er gekommen war.
»All das Geschwafel – völlig umsonst«, seufzte der Marquis. »Ganz umsonst war es dennoch nicht. Das Dessert war köstlich!«
Während er den Rest der Creme auslöffelte, lag der Vicomte ihm gegenüber mit dem Kopf in einer Lache aus Blut auf dem Silbertablett.
Cécile kam wieder zu sich. Die Schwärze, die sie umfing, als sie die Augen öffnete, unterschied sich kaum vom Dunkel der Ohnmacht. Sie lag noch immer im Gang, aus dem sie das Gespräch der beiden Adligen belauscht hatte. Sie hatte fast alles gehört.
Gehört und gesehen.
Sofort bemerkte sie, wie ihr die Flüssigkeit im Mund zusammenlief. Sie versuchte, sich zu beherrschen, die Übelkeit hinunterzuschlucken, an etwas anderes zu denken, sie einfach zu vergessen. Doch es gelang ihr nicht. Sie erbrach sich hustend in den Korridor. Krämpfe schüttelten sie, und obwohl ihr Magen geleert war, wollte ihr Körper noch mehr aus ihr herauspressen.
Dazu gesellten sich Tränen. Krämpfe des Entsetzens lösten die Übelkeit ab. Schluchzend und verkrümmt lag sie im Dienstbotengang. Es war kein Traum gewesen, keine Einbildung ihres übermüdeten Geistes. Nein, sie hatte tatsächlich mit ansehen müssen, wie ihr Herr kaltblütig ermordet worden war! Ohne Vorwarnung und ohne Zögern. Sie hatte einen Moment benötigt, um zu realisieren, was sich vor ihren Augen abspielte. Der Mann mit der dunklen Brille war in den Salon gefegt wie eine Sturmböe, die ein Gewitter ankündigt. Und wie ein Blitz vom Himmel Feuer und Verderben bringt, war dem Vicomte diese schreckliche Klinge durch den Hals gefahren, gefolgt vom Prasseln des Bluts auf Tisch und Boden.
Dieses Bild hatte sich in ihren Kopf gebrannt, und sie war unfähig, es durch etwas anderes zu ersetzen.
Cécile richtete sich auf, glitt dabei auf dem schmierigen Untergrund aus und hielt sich schwer atmend an der Wand fest. Sie musste aus diesem Gang hinaus, fort von der Dunkelheit, die ihr keine Chance ließ, den Schreckensbildern ihrer Gedanken zu entkommen! Sie stolperte in Richtung Küche. Keine fünf Schritte weiter übersah sie eine Stufe und verlor das Gleichgewicht. Sie stürzte nach vorne und schlug auf den Boden, konnte sich aber noch abrollen, sodass der Sturz gelindert wurde. Stattdessen prallte sie mit dem Hinterkopf gegen die Wand.
Cécile stöhnte auf. Wenigstens vertrieben die Pfeile aus Schmerz, die sich in ihren Kopf bohrten, die quälenden Bilder.
Am Ende des Gangs erkannte sie Licht. Nicht weit von ihr entfernt befand sich die schmale Wendeltreppe, die sich vom Küchentrakt im Untergeschoss bis hinauf in die Etage der Gemächer des Vicomtes wand. Dort waren in regelmäßigen Abständen Öllampen installiert, um den Dienern sicheren Tritt zu gewährleisten.
Erneut rappelte sie sich auf. Sie lief bis zu dem Durchgang ins Treppenhaus, vorbei an der Luke des Küchenaufzugs. So schnell, dass sich ihre Füße fast überschlugen, stürmte sie die Stufen hinunter. Sie wusste nicht, was sie mehr antrieb: die Flucht vor der grauenvollen Szenerie im Salon oder die Hoffnung, dort unten bei Antoni und den anderen in Sicherheit zu sein. Hoffentlich war noch jemand von ihnen wach, schließlich hatte sie keine Ahnung, wie lange sie ohnmächtig gewesen war.
Zu hören war zumindest nichts.
Cécile rannte durch den kurzen Flur bis in die Garküche, in der sich der Herd befand, an dem Antoni die meiste Zeit zugange war. Doch er war nicht zu sehen, seine massige Gestalt im Halbdunkel nirgends zu entdecken. Sie blickte nach links hinunter zu dem großen Steinofen, den der Koch meist als letztes sauberzumachen pflegte, bevor er sein Tagwerk beschloss.
Was sie dort sah, ließ ihr Herz für einen Moment lang aussetzen: Von der Glut aus dem Inneren des Ofens durch das Gitter schwach beleuchtet, konnte sie seinen Leib ausmachen, auf dem Boden liegend, regungslos. Sie musste nicht länger hinschauen, um zu wissen, dass Antoni tot war. Die Blutlache, die sich fast bis vor ihre Füße ausbreitete, ließ keinen Zweifel daran, dass er ebenso ruchlos und brutal umgebracht worden war wie der Vicomte.
Cécile taumelte zurück und stieß mit der Schulter gegen einige Pfannen, die neben dem Herd an einer Stange hingen. Vor Schreck schrie sie auf und sprang zur Seite, als ob ihr das Geschirr etwas antun könnte. Sie geriet ins Stolpern und sackte auf die Knie.
Antoni ist tot! Sie sind alle tot! Er hat sie alle umgebracht!
Verzweifelt versuchte sie, das Schluchzen zu unterdrücken und sich zu beruhigen. Wie lange war sie bloß ohnmächtig gewesen? Sie hätte die anderen warnen können! Vielleicht konnte sie noch hinauf in die Schlafkammern laufen, um die übrige Dienerschaft zu retten, wenigstens Tatimo und Gabrielle. Aber war das nicht viel zu gefährlich? Wenn sie sie erwischten, würden sie sie ebenfalls umbringen. Cécile war unfähig, sich zu bewegen, und je länger sie in der dunklen Küche hockte, desto größer wurde ihre Gewissheit, dass außer ihr niemand im Château mehr am Leben war. Das bedeutete, dass sie sich in höchster Gefahr befand, führte sie den Gedanken zu Ende. Sie war in den letzten Minuten alles andere als leise oder vorsichtig gewesen. Wenn der Marquis und seine Schergen noch im Haus waren, würden sie ihr ein ebenso blutiges Ende bereiten wie den anderen Bewohnern.
Genau in diesem Moment hörte sie das Geräusch zum ersten Mal.
Es war wie ein Scharren, als ob jemand mit einer längst durchgetretenen, rauen Ledersohle über einen schmutzigen Boden ging.
Doch beim zweiten Mal klang es eher so, als wurde ein Blasebalg betätigt, um ein erloschenes Feuer wieder anzufachen.
Ein eisiges Gefühl kroch Cécile den Rücken hinauf.
Ich bin nicht allein!
Sie sprang auf und presste sich mit dem Rücken gegen die Flurwand, suchte die im diffusen Halblicht daliegende Küche panisch mit den Augen ab, als das Schnaufen erneut ertönte.
Zwischen Herd und Schältischen war eine Bewegung auszumachen. Von dort kam eine Gestalt auf sie zu. Ihre Bewegung war nicht die eines Menschen, fast schien es, als würde sie knapp über dem Boden schweben. Ein Kältehauch wie in einem Schneesturm schlug ihr entgegen.
Wieder ertönte ein Röcheln.
Cécile begann, von einem auf den anderen Moment mit den Zähnen zu klappern, als habe sie jemand in einen Eiskübel gesteckt. Sie war unfähig, sich zu rühren.
Als das Wesen vollends hinter dem Herd hervorkam, konnte sie sehen, dass es mitnichten schwebte, sondern eher über den Boden schlurfte, als sei es Zeit und Raum entrückt. Seine Gestalt war zwar grob menschenähnlich, Arme und Beine jedoch viel länger und mit Klauen bewehrt. Im Halbdunkel erkannte sie nicht viel mehr, aber der Anblick des Kopfs mit der, ähnlich einer Echse, vorstehenden Schnauze und langen, blutbesudelten Reißzähnen löste ihre Schockstarre.
Wenige Fuß, bevor das Wesen ihr den Weg abschneiden konnte, rannte sie quer durch die Küche zur Hintertür. Ein hektischer Seitenblick verriet ihr, dass die Kreatur ebenfalls die Richtung geändert hatte und sie verfolgte, nun wesentlich schneller als zuvor. Der kleine Vorsprung, den sie sich erarbeitet hatte, war schon wieder verspielt.
Doch sie gelangte rechtzeitig zur Tür. Zu ihrer Erleichterung war sie nicht abgeschlossen, das erledigte Antoni gewöhnlich als Letztes, wenn er die Abfälle hinausgebracht hatte. Sie warf sich in die verstärkte Tür, hetzte hindurch und schlug sie sofort wieder zu. Das Krachen, das sie vernahm, als sie den Weg hinunter in den Garten rannte, verriet, dass sie ihren Verfolger mit der schweren Holztür, wie erhofft, voll erwischt hatte.
Ein Bersten kündete jedoch davon, dass es die Kreatur kaum mehr als ein paar Wimpernschläge aufgehalten hatte. Wieder spürte sie die Kälte in ihrem Rücken. Das Wesen holte mit jedem Schritt auf.
Cécile bog in den erstbesten Kiesweg zwischen den Büschen ein. Sie wusste, dass sich an seinem Ende ein Gartentürchen befand. Von dort gelangte man auf die Straße, die hinunter ins Dorf führte. Bis dort musste sie es schaffen, wenn sie Hilfe erlangen wollte.
Doch das scharrende Atmen des Wesen kam näher, schon fröstelte sie erneut am ganzen Körper. Sie versuchte, schneller zu rennen, aber bekam kaum noch Luft.
Keinen Steinwurf entfernt entdeckte sie den Zaun, der das Château von den umliegenden Weinstöcken trennte. Wenn die Tür verschlossen war, war sie verloren.
Nur noch ein paar Schritte!
Dann war die Kreatur heran. Eine klauenbewehrter Arm packte sie an der Schulter. Cécile wurde herumgewirbelt und stürzte rücklings auf den Kiesweg. Sie schrie vor Schmerzen, denn die Krallen hatten ihren Arm aufgerissen. Das Wesen stand über ihr, und sie erkannte, dass seine schwarze Haut über und über mit Blut besprenkelt war: dem Blut ihrer Freunde!
Es gab keine Möglichkeit, zu fliehen. Hinter ihr befand sich der Zaun, und das Wesen wartete nicht darauf, bis ihr etwas anderes einfiel. Fast meinte sie, ein triumphierendes Grinsen in der dämonischen Fratze zu erkennen, als es sie erneut packte. Sein Maul öffnete sich, Blut und Geifer tropften von den Reißzähnen. Schwarzrot loderndes Feuer schlug ihr aus dem Schlund entgegen, und Cécile glaubte, die Pforte zur ewigen Verdammnis öffne sich direkt vor ihren Augen.
Todesangst überkam sie.
»Nein!«, schrie sie und versuchte, die Bestie mit Tritten abzuwehren. Doch deren eiserner Griff bohrte sich tief in ihr Fleisch. Blut quoll in Strömen aus ihren Armen hervor.
Dennoch gab sie nicht auf, wollte sich nicht einfach in ihr Schicksal fügen. Unbändiger Überlebenswille erfüllte sie und schien ihre Kräfte zu vervielfachen. Verzweifelt versuchte sie, die Klauen von sich fernzuhalten. Die Kraft ihres Gegners aber war zu groß. Seine Fänge näherten sich unerbittlich, um ihr die Kehle zu zerfetzen.
»Lass mich nicht sterben!«, schrie sie und schlug panisch um sich.
Unvermittelt verwandelte sich die Kälte in ihr und um sie herum ins Gegenteil. Ein warmes Gefühl ergriff von ihr Besitz und nahm sie im Bruchteil eines Augenblicks vollkommen ein.
Die Schreckenskreatur hielt inne, das Maul nur wenige Fingerbreit von ihrem Hals entfernt. Es schien dagegen anzukämpfen. Das kalte Feuer in seinem Rachen brannte heller, doch wie von einer unsichtbaren Hand wurde es von ihr fortgeschoben.
Cécile benötigte einen Moment, um die Verwirrung abzuschütteln, noch am Leben zu sein, obwohl sie dem Tod schon ins Auge geblickt hatte. Die Kraft schien von ihr selbst auszugehen, ihrem eigenen Körper zu entstammen. Obwohl sie ihren Gegner nicht berührte, konnte sie sich so bewegen, dass sie ihn von sich wegstieß. Das Wesen ließ von ihr ab und wich zurück.
Cécile streckte die Hände vor, um die Kreatur auf Abstand zu halten. Die Schmerzen an den Armen nahm sie kaum noch wahr, nur so etwas wie ein wohliges Prickeln, das den Körper erfüllte. Ein kaum zu erahnendes Licht ging von ihr aus, hüllte sie ein und schlug der Kreatur entgegen. Obwohl diese dagegen ankämpfte, vermochte sie nicht erneut auf das Mädchen einzudringen.
Cécile suchte mit einer Hand hinter dem Rücken nach dem Griff der Gartentür, ohne die Bestie dabei aus den Augen zu lassen. Ihr Herz vollführte einen Sprung vor Erleichterung, als sich die Tür quietschend öffnete. Sie wich langsam einen Schritt zurück, dann noch einen, bis sie durch die Öffnung im Zaun getreten war. Weiterhin strömte Wärme aus ihren Händen, wie Wellen, die sanft an einen Strand rollten. Die Kreatur war unfähig, sich zu widersetzen und ihr zu folgen. Stattdessen fixierte sie die junge Frau mit hasserfüllten Augen.
Cécile atmete zwei, drei Mal heftig durch und warf die Tür in die Angeln. Dann rannte den Hügel hinunter ins Dorf, so schnell sie die Füße trugen.
Hinter ihr schlugen Kälte und Dunkelheit über dem Garten zusammen.
Kapitel 2
Oktav, Riposte, Coupé.
Armand setzte seinen Gegner lehrbuchmäßig unter Druck.
Der Skandinavier wich vor der hervorschnellenden Klinge zurück, stolperte und setzte sich beinahe auf den Hosenboden.
Armand widerstand dem Drang, sofort nachzusetzen, um das ungleiche Duell zu beenden, führte den Degen elegant in eine aufrechte Position und deutete eine Verbeugung an. Dabei wich er einen Schritt zurück, um dem Gestrauchelten Gelegenheit zu geben, das Gleichgewicht wiederzufinden. Der brachte sich in die Ausgangsstellung und funkelte ihn gereizt an.
Ohne abzuwarten, drang Armand wieder auf ihn ein. Er wollte nicht den ganzen Abend mit dieser unnötigen Konfrontation verschwenden.
Ausfall, Finte, Filo.
Wieder war sein Gegenüber nicht imstande, der Geschwindigkeit des Angriffs zu folgen. Mit mehr Glück als Verstand vermochte er es dennoch, Armands Klinge im letzten Moment zur Seite abzulenken.
Weitere Gelegenheiten dazu sollte er nicht bekommen.
Cavation, Rimesse.
Die Degenspitze traf auf Widerstand. Ein schmerzerfülltes Stöhnen folgte keinen Wimpernschlag später.
»Touché!«, riefen die Sekundanten fast einstimmig. Das erste Blut war vergossen, der Zweikampf somit beendet.
Armand zog sich von dem Getroffenen zurück, jedoch ohne die Waffe sinken zu lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Unterlegener nach einem Treffer seine guten Manieren vergaß und wutentbrannt auf seinen Peiniger einzuschlagen begann.
Doch zu seiner Erleichterung hatte er es mit einem Ehrenmann zu tun. Der Skandinavier führte die Klinge zitternd vor das schmerzverzerrte Gesicht und verbeugte sich. Armand tat es ihm gleich.
Er hatte ihn am Handrücken getroffen. Aus dem zerfetzten Wildleder des Handschuhs sickerte Blut hervor.
»Damit sehe ich diese Unstimmigkeit als ausgeräumt an«, stellte Armand fest.
»Ich hoffe … Euch nicht allzu große Unannehmlichkeiten bereitet zu haben«, presste der Mann hervor, während er die Wunde betrachtete.
»Belastet Euch nicht damit, Monsieur. Der Abend ist noch jung. Kann ich Euch hingegen zu Diensten sein? Diese Wunde sollte versorgt werden, bevor Ihr dauerhaften Schaden davontragt.« Armand hatte die gute Hand des Fechters getroffen. Wenn er Pech hatte, waren Sehnen und Muskeln zerfetzt worden, und er konnte nie wieder eine Waffe führen.
Ein hoher Preis für eine Lappalie wie diese.
»Tatsächlich wäre ich Euch dankbar«, sagte der Verletzte.
Armand bedeutete seiner Schwester Julaine, die als Sekundantin fungiert hatte, die Wunde anzuschauen. Sie zog ihm vorsichtig den Handschuh aus. Wenig später gab sie Entwarnung. »Da habt Ihr Glück gehabt, Monsieur. Es ist nur ein oberflächlicher Schnitt. Alkohol zur Reinigung und ein fester Verband, dann wird es gut verheilen.«
Dem Mann war die Erleichterung anzusehen.
»Dann wollen wir hineingehen, damit wir die Wunde desinfizieren können. Und lasst mich Euch etwas Gebranntes für den Durst bereitstellen. Ich denke, Ihr könnt es brauchen.« Früher hätte Armand das Wohlbefinden eines Duellgegners einen feuchten Dreck geschert, aber nach einigen Disputen mit seiner Schwester bezüglich seiner Umgangsformen und seines Auftretens in der Öffentlichkeit bemühte er sich neuerdings, wie ein Ehrenmann aufzutreten. Zumindest gelegentlich.
»Vielleicht sparen wir Politik als Thema für den restlichen Abend aus, um weiteren Streitigkeiten vorzubeugen«, fügte Julaine hinzu und funkelte Armand mit warnend zusammengezogenen Augenbrauen an.
»Das ist wohl eine gute Idee«, nickte der Skandinavier.
Armand konnte sich nicht an den genauen Wortlaut erinnern, mit dem er den verblichenen Schwedenkönig Gustav Adolf betitelt hatte. Es hatte jedoch ausgereicht, um von dem Nordländer als Beleidigung aufgefasst zu werden. Kurz darauf hatten sie sich im Hinterhof wiedergefunden.
Er war erleichtert, dass die Sache schnell und nahezu unblutig aus dem Weg geräumt worden war, denn die vergangenen Wochen hatten genug Ärger für ihn bereitgehalten. Ruhigere Tage waren dringend nötig. Deshalb waren sie schließlich ins Poitou gekommen, in dem es außer den vergleichsweise harmlosen Problemen der Landbevölkerung für sie kaum etwas zu tun gab. Blutend im Hof einer Dorfkneipe zu liegen, war das Letzte, worauf Armand Lust hatte.
»Dann kommt!«, forderte er die anderen mit einem Wink auf. »Es ist fast dunkel, und ich bekomme allmählich Durst.«
Duellanten und Sekundanten kehrten in den Schankraum zurück.
Der fragende Gesichtsausdruck des Wirts verwandelte sich in Erleichterung, als er erkannte, dass alle Beteiligten aufrecht gingen und es keinen Schwerverletzten oder gar Toten zu beklagen gab. Armand konnte es ihm nicht verdenken. Duelle waren von Kardinal Richelieu schon vor etwa fünfzehn Jahren verboten worden. Wenn die örtliche Polizei Wind davon bekam, gab es auch für den Wirt Probleme. Allerdings bezweifelte Armand, dass das Dorf Darneville über mehr als einen altersschwachen Gendarmen verfügte. Aufsehen hätte das Ganze aber in jedem Fall erregt.
»Wir nehmen einen Krug von Eurem Roten«, rief er dem Wirt zu. »Etwas zu essen wäre auch nicht schlecht.«
Die Aussicht auf Umsatz machte dem bärtigen Mann Beine und ließ ihn vergessen, was alles hätte passieren können.
Während Julaine etwas reinen Alkohol aus ihrer Kammer besorgte, um damit die Wunde des Verletzten zu reinigen, ließen sich die vorherigen Kontrahenten an einem Tisch nieder.
»Ihr könnt froh sein, dass Ihr an einen höflichen Menschen wie mich geraten seid, Monsieur«, bemerkte Armand und strich sich gespielt weltmännisch durch den Kinnbart. Ganz ohne Belehrung wollte er den Schweden nicht davonkommen lassen. »Wenn Ihr Euch wegen jeder Kleinigkeit echauffiert, werdet Ihr in Frankreich viel Zeit mit Duellen verbringen. Irgendwann enden die im Gefängnis oder in einer Holzkiste.«
»Mein Herr, ich danke Euch für den guten Rat«, entgegnete der Angesprochene mit sarkastischem Unterton. »Bis jetzt konnte ich ganz gut für mich sorgen. Ich bin quer durch das Königreich gereist, und tatsächlich seid Ihr der Erste, mit dem ich … erheblich anderer Meinung war. Außerdem habe ich bald mein Ziel erreicht.« Er stöhnte auf, als Julaine seine Hand nahm und die Wunde mit einem getränkten Tuch abtupfte. »Ich komme zurecht, glaubt mir.«
»Natürlich.« Armand füllte die Becher mit Rotwein.
Einen Moment später erschien der Wirt und servierte ihnen eine Platte mit Fladenbrot, Weichkäse, Schinken und Weintrauben.
Armand wollte schon zugreifen, als ihm etwas in den Sinn kam. »Wo bleiben eigentlich meine Manieren? Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ein unverzeihlicher Fauxpas! Warum eigentlich?«
»Es gab da diesen kleinen Zwischenfall. Ein hitziger Austausch von Höflichkeiten wurde im Hof zur Vollendung gebracht«, merkte Julaine an.
Armand deutete mit dem Finger an die Stirn, so als erinnere er sich wieder. »Jetzt dämmert es mir. Doch da wir nun zur Höflichkeit zurückgefunden haben, lasst uns das Wesentliche nicht vergessen: Mein Name ist Armand de Guerét, dies ist meine Schwester Julaine.« Beide deuteten eine Verbeugung an.
Der Schwede runzelte über das Schauspiel verwundert die Stirn, antwortete dann aber. »Jarl Olsson, sehr erfreut.«
»Es ist uns eine Ehre, Monsieur Olsson.« Armand überspielte mit einem Lächeln seine Belustigung über den merkwürdig klingenden Namen.
Julaine hatte die Hand zwischenzeitlich verbunden, sodass sie sich dem Essen zuwenden konnten. »Ihr seid weit weg von Schweden, Monsieur. Sagt an, was führt Euch in diese Gegend? Verzeiht meine Neugier, aber Landsmänner wie Ihr sind hier doch eher selten anzutreffen.«
»Gerade komme ich aus Greifswald, einer Stadt im Nordosten des Heiligen Römischen Reiches, die wir aus den Fängen des Kaisers befreit haben. Ich befinde mich auf dem Weg nach Poitiers. Entschuldigt, aber mehr müsst Ihr nicht wissen.«
»Mehr müssen wir nicht wissen …«, murmelte Armand. Dieser Schnösel sollte ein wenig mehr Dankbarkeit dafür zeigen, dass er so billig davongekommen war und jetzt auch noch versorgt wurde, anstatt draußen im Dreck zu liegen.
Vielleicht hätte ich ihn lieber abstechen sollen.
Er verdrängte den Gedanken und überspielte ihn mit einem gequälten Lächeln.
»Dann habt Ihr es nicht mehr weit. Ihr solltet übermorgen Mittag die Stadt erreichen«, sagte Julaine, um das unbehagliche Schweigen zu durchbrechen. »Poitiers ist eigentlich viel zu groß für das ruhige Poitou drumherum. In der Händlergasse unterhalb des Rathauses wohnt eine Bekannte von mir. Mareille. Ihr Mann ist Hutmacher. Wenn Ihr also einen Hut braucht – bei ihm seid Ihr an der richtigen Adresse.«
»Ich werde daran denken«, antwortete Olsson zwischen zwei Bissen. »Und Ihr? Ihr stammt doch ebenfalls nicht von hier.«
»Wir sind auf der Durchreise, mehr braucht Euch nicht zu interessieren«, entgegnete Armand.
»Dachte ich es mir. Ihr seid hier ebenso fremd wie ich. Ihr tragt keine Farben, und doch scheint Ihr einer kriegerischen Profession anzugehören.«
»Chapeau! Sehr scharf beobachtet.« Offenbar hatten sie es mit einem Schlauberger zu tun. Armand bereute erneut, dem Mann nicht wenigstens die Zunge herausgeschnitten zu haben, allein schon, um sich das altkluge Geschwätz nicht anhören zu müssen.
Olsson musterte ihn. »Die Lederkleidung – maßgefertigt, nehme ich an? Und sehe ich da eine schwarze Fleur-de-Lis auf Euren Schulterstücken? Dann Euer Degen – selten habe ich ein Stück derartiger Qualität erblickt. Ist das etwa eine Scaligerklinge? Also ein Diener des Königs. Habt Ihr der Armee angehört? Seid Ihr gar desertiert und versteckt Euch in der Provinz?«
Meinte der Kerl das ernst? Offenbar legte es der Trottel darauf an, baldmöglichst über die Klinge zu springen. Ein warnender Seitenblick seiner Schwester verhinderte eine scharfe Entgegnung Armands.
Stattdessen ergriff Julaine das Wort. »Ich rate zur Vorsicht, Monsieur. Haben wir Euch nicht darauf hingewiesen, Euch im Zaum zu halten? Wenn Ihr den falschen Leuten unter die Nase reibt, was Ihr in ihnen seht, werdet Ihr kaum in Euer … Greifswald zurückkehren.«
»Nichts für ungut, werte Dame. Meine Neugier erweist mir gerne einen Bärendienst.« Er hob beschwichtigend die Hände. »Aber sagt ehrlich: Was treibt Euch in diese Gegend?«
»Wir lösen Probleme«, antwortete Armand. »Darauf verstehen wir uns ganz hervorragend.«
Im gleichen Moment schlug die Tür auf. Eine blutüberströmte junge Frau stürzte herein. Ihre Kleidung war zerfetzt und die Arme übel zugerichtet.
»Bitte helft mir!«, stöhnte sie. Sie schleppte sich einige Schritte bis in die Mitte des Schankraums und brach dann auf den Holzbohlen zusammen.
»Probleme wie diese«, fügte Armand hinzu.
Julaine betrachtete die Verletzungen. Tiefe Kratzer zogen sich über die Oberarme bis hinunter zu den Ellenbogen. Dazwischen befanden sich immer wieder ovale Löcher in der Haut, die stark bluteten.
»Bei der Dreifaltigkeit!«, entfuhr es dem Wirt, als er sah, wie schlimm die junge Frau zugerichtet war. »Seht nur ihre Arme! Sie muss von einem wilden Tier angefallen worden sein!«
»Das war kein Tier«, erwiderte Julaine kopfschüttelnd. »Armand, sieh dir die Wundränder an. Sie beginnen, zu schwären.«
Armand betrachtete die Arme. Nahezu überall hatten sich die Wundränder verdunkelt, und das Fleisch rundherum verfärbte sich ebenfalls. Er blickte seine Schwester an. »Schattenklauen.« Julaine nickte ernst. »Der Dämonenodem wird sie von innen heraus auffressen, wenn wir ihr nicht sofort helfen. Mit ein bisschen Alkohol und einem Verband ist es hier nicht getan. Wir müssen sie hinaufbringen, wo ich meine Sachen habe. Wenn es im Willen der Dreifaltigkeit liegt, kann ich ihre Arme vielleicht noch retten.« Sie blickte sich um. »Helft mir, sie hochzuschaffen. Dann brauche ich frisches Wasser, Tücher, und so viel Aderminze, wie ihr auftreiben könnt.«
»Aber …«
»Macht schnell, jede Sekunde zählt!«, trieb sie den Wirt an, der mit der Situation überfordert war. »Armand!«, bedachte sie ihren Bruder mit einem Blick, der ebenfalls deutlich machte, dass er die Hufe schwingen sollte. Dann hievte sie die junge Frau hoch und schleppte sie gemeinsam mit dem Wirt die Treppe hinauf.
»Was ist ihr zugestoßen?«, fragte Olsson, der sichtlich schockiert war.
»Sie ist von einem Wesen der Zwischenwelt angegriffen worden. Unheiliges Gift greift ihren Körper an, sodass sie sich auch in eine solche Kreatur verwandeln wird, wenn wir nichts tun. Die Wunden scheinen kaum mehr als eine Viertelstunde alt zu sein.« Armand betrachtete Olssons Hand. »Wie sieht es mit Eurer Linken aus, Monsieur? Könnt Ihr damit eine Waffe führen?«
»Na ja, so einigermaßen.«
»Dann nehmt das!« Armand warf ihm eine krumme Klinge in einer Scheide zu. Ungeschickt fing Olsson die Waffe auf. »Was soll ich damit?«
»Mir helfen«, erwiderte Armand und zog seinen Degen blank. »Was immer das Mädchen angefallen hat, ist noch da draußen, und ich werde nicht warten, bis es an die Tür klopft.«
Olsson starrte ihn unschlüssig an.
»Mit Eurem Rapier könnt Ihr nichts gegen eine solche Kreatur ausrichten. Meine Waffen sind … nun ja, speziell, wie Ihr bereits bemerkt habt. Also, worauf wartet Ihr?«
Olsson zog vorsichtig den geflammten Scimitar aus der Scheide und hielt die schwere Klinge unbeholfen in der linken Hand.
Armand seufzte, reichte ihm seinen Degen. »Dann nehmt den. Gnade Euch Gott, wenn ein Kratzer drankommt!«
Er warf einen Blick durch die Fenster und öffnete die Tür. »Bleibt dicht hinter mir!«, wies er den Schweden an, als sie sich vorsichtig aus dem Gasthaus hinausbewegten.
Das Dorf lag still da, nur in wenigen Häusern war das Flackern von Öllampen und Kerzen zu erkennen. Es musste nach Mitternacht sein, genau konnte Armand das nicht sagen, da die Glocken der kleinen Dorfkirche bereits seit Stunden schwiegen. Er schlich im Schatten der Mauer einige Schritte bis an die Gebäudeecke und lugte herum. Nichts war zu sehen oder zu hören. Auch auf der anderen Seite führte seine Überprüfung zu keinem Ergebnis.
Dann winkte er Olsson nach vorne auf die Straße. Auch hier war es still. Lediglich das Rauschen der Bäume und das Zirpen von Grillen drang an sein Ohr.
Armand fluchte innerlich. Er wusste einfach zu wenig: weder, woher das Mädchen gekommen war, noch, was es verfolgt hatte. Die Verderbtheit, die so rasch in den Wunden sichtbar geworden war, wies auf ein höheres Wesen der Zwischenwelt hin. Gewöhnliche Untote, geringere Geister oder beseelte Tiere waren nicht dazu in der Lage, Wunden mit dem schwärenden Odem der Dunklen Domänen zu verpesten. Nur Kreaturen, die einem der Dämonenfürsten direkt unterstanden, waren dazu imstande. Die Frage war, ob es tatsächlich der Zwischenwelt entstammte oder gar aus einer der Dunklen Domänen selbst beschworen worden war. Wie auch immer, das würde er herausfinden, wenn er es aufgespürt hatte.
Dann wirft der Aufenthalt in diesem Kaff mehr ab als gedacht.
Die wenigen Livre, die ihnen der Dorfschulze gestern für die Beseitigung einiger unheilig beseelter Leiber ausgehändigt hatte, waren für das Abendessen und den Wein beinahe draufgegangen. Ein Daimonid hingegen sollte den Bewohnern von Darneville schon einen Louisdor wert sein, rechnete Armand hoch.
Zwischenzeitlich hatte er die umliegenden Sträßchen abgesucht, weit und breit war nichts Unnatürliches festzustellen.
»Habt Ihr etwas entdeckt?«, fragte Olsson, als sein Begleiter innehielt.
»Nein, aber ich muss sichergehen, dass sich hier tatsächlich nichts herumtreibt«, murmelte Armand und begann, sich zu konzentrieren. Es war zu gefährlich, etwas dem Zufall zu überlassen. Das Dorf schien im Tiefschlaf zu liegen, da sollte er es riskieren können, das Schattenwesen auf eine andere Weise als mit den beschränkten Möglichkeiten seiner bloßen Augen aufzuspüren.
Er fokussierte seine Sinne auf einen bestimmten Punkt in seinem Inneren, steigerte die Spannung in Geist und Körper über ein natürlich erträgliches Maß hinaus und entließ diese zusammengeballte Form äußerster Aufmerksamkeit mittels der Kraft nach außen. Er nahm kurz ein bläuliches Glimmen in seinen Augenwinkeln wahr, als er seine arkane Kraft fokussierte und sie in konzentrischen Kreisen in die Umgebung ausdehnte. Wie Ringe auf einer Wasseroberfläche, in die man einen Stein geworfen hatte, breiteten sich seine Sinne in alle Richtungen aus. Er schloss die Augen und suchte den gesamten Bereich, den er auf diese Weise wahrnahm, nach einer Aura ab, die nicht dorthin gehörte. Doch außer den Dorfbewohnern, ihren Kindern und dem Vieh in den Ställen konnte er nichts Ungewöhnliches feststellen.
Er löste die Konzentration und atmete heftig aus. Dann schüttelte er den Kopf, um seine Sinneswahrnehmungen wieder über die Organe zu steuern, die eigentlich dafür vorgesehen waren.
Olsson starrte ihn mit offenem Mund an. »Ihr … Ihr seid ein geweihter Priester!«
»So ähnlich«, antwortete Armand, der keine Lust auf Erklärungen hatte. »Lasst uns wieder hineingehen. Ich habe nichts entdeckt, aber dennoch kein gutes Gefühl bei der Sache. Es kommt mir so vor, als hätte ich etwas übersehen.« Mit seiner magischen Fokussierung hatte er zwar einen großen Bereich des Dorfes abdecken können, aber eben nicht alles. Wer wusste schon, was sich in den Schatten der umliegenden Wiesen und Weiher verbarg?
Die beiden Männer kehrten in die Gaststube zurück, wo der Wirt damit beschäftigt war, die Blutspuren des Mädchens vom Boden zu wischen. Seine Frau half ihm und wirkte dabei äußerst mitgenommen.
»Wie geht es ihr?«, fragte Armand.
»Die Mademoiselle sagt, sie wird es schaffen. Sie hat ihr ein Mittel gegeben, um das Gift zu beseitigen«, erwiderte der Wirt. Auch seine Stimme zitterte.
»Gut. Es wird sich alles wieder fügen, seid unbesorgt. Erweist uns doch einen Liebesdienst und schenkt uns zwei Cognac ein – das Glas gut gefüllt«, wies Armand den Mann an. »Und gönnt Euch und Eurer Gattin ebenfalls einen auf meine Kosten.«
»Sehr wohl, Monsieur.«
Armand setzte sich an einen Tisch und legte die Füße auf die Platte, um sich zu beruhigen. Langsam fiel die Anspannung von ihm ab. Er musste lächeln, als er sah, wie Olsson erneut von seiner Neugier geplagt wurde, sich aber zurückhielt, mit allzu unvorsichtigen Fragen herauszuplatzen. Armand wartete, bis der Wirt den Weinbrand servierte und prostete dem Schweden zu.
»Nun fragt schon! Ich sehe doch, dass Euch etwas quält.«
Olsson wurde rot, lächelte dann aber ebenfalls. »Ich werde nicht schlau aus Euch, mein Herr. Zuerst hielt ich Euch für einen Flegel, dann für einen respektablen Ehrenmann, der sich der Profession des Söldners verschrieben hat, und letztlich geht Ihr mit der Kraft um, als sei es ein Kinderspiel, behauptet aber, kein Priester zu sein.«
»Das macht einen guten Schauspieler aus«, sagte Armand. »Schlüpfe in alle Rollen, ohne dass das Publikum bemerkt, wen du tatsächlich darstellst.« Er wiegelte Olssons Einwand mit der Hand ab. »Bevor Ihr Euch die Zunge mit der nächsten Vermutung oder gar einem besudelten Namen verbrennt: Nein, ich diene nicht dem Herrn der Lügen oder einem der anderen Fünf.« Er runzelte die Stirn. »Oder vielleicht war gerade das eine Lüge, und es verhält sich doch so?!«
Olssons Gesicht verdunkelte sich. »Damit solltet Ihr nicht spaßen. Mitnichten hätte ich Euch so etwas unterstellt.«
Armand verlor die Lust daran, das Spiel weiter zu spielen. Dazu war er zu müde und die Ereignisse zu ernst. »Sagt an, Monsieur, kanntet Ihr das Mädchen?«, fragte er den Wirt, der ihnen bereits nachschenkte.
»Ja, Monsieur. Das ist Cécile Ledoux. Sie lebte bis zum vergangenen Jahr am Ende der Straße. Nach dem Tod ihrer Großmutter nahm der Vicomte sie in seine Dienste. Seitdem wohnt sie oben im Château. Ich habe sie seitdem nur selten gesehen. Manchmal erledigte sie Besorgungen im Dorf.«
»Wie weit ist das Château entfernt?«
»Keine zwei Meilen. Sie muss von dort gekommen sein«, antwortete der Wirt und nahm einen kräftigen Schluck Cognac zu sich. »Was glaubt Ihr, was dort vorgefallen ist, Monsieur?«
»Sie wurde von einem Nephazalar angegriffen«, antwortete Julaine für ihn, als sie im Hintergrund die Treppe herunterkam.
Armand konnte an ihrem Gesicht erkennen, dass sie die Heilung des Mädchens viel Kraft gekostet hatte. Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen, schloss die Augen, unter denen sich Ringe gebildet hatten, als habe sie eine Woche lang nicht geschlafen, und schnaufte durch. Armand schob ihr sein Glas hin, und sie nahm dankbar einen Schluck der brennenden braunen Flüssigkeit zu sich.
»Bist du dir sicher?«, fragte Armand vorsichtig, obwohl er wusste, dass seine Schwester keine derartigen Feststellungen traf, wenn sie nicht zweifelsfrei davon überzeugt war.
»Du hast die Wunden gesehen, Armand. Während ich sie versorgte, schien es regelrecht, als werde das Mädchen von den Malen aufgefressen. Als ich ihr die Finger in die Wunden gelegt habe und die Essenz fließen ließ, standen die Wundränder keine zwei Sekunden später in schwarzen Flammen. Beinahe hätten sie auch mich verzehrt! Ich verstärkte die Kraft, und es dauerte einige Minuten, bis ich den Odem des Daimoniden eindämmen und schließlich aus ihrem Körper tilgen konnte.« Sie schüttelte den Kopf. »Kein beseeltes Tier oder toter Leib ist imstande, solche Macht auszuüben. Ich habe diePräsenz des Bannerträgers gespürt, deshalb denke ich, dass das arme Ding einem Nephazalar zum Opfer gefallen ist – beinahe zumindest.«
Armand legte den Kopf in die Hände und rieb sich die Stirn. »Das habe ich befürchtet, Jula. Unsere Aufgabe hier ist noch nicht beendet. Neben den Untoten von gestern treibt sich in Darneville eine weit größere Bedrohung herum. Das Mädchen ist wohl eine Dienerin des Vicomte. Oben im Château muss also etwas vorgefallen sein. Das erklärt, warum ich keine Präsenz im Dorf wahrgenommen habe.« Armand dachte nach und wandte sich an den Wirt. »Was wisst Ihr über den Vicomte? Ist er ein gottesfürchtiger Mann?«
Der Angesprochene nickte. »Ja … zumindest denke ich das. Ich kann nichts Schlechtes über ihn berichten, und mir ist auch kein übles Gerücht bekannt«, erwiderte er und bekreuzigte sich dreifach. »Bei der Dreifaltigkeit, meint Ihr, er könnte …«
»Wir können nichts ausschließen, sondern nur vermuten, dass auf dem Château blasphemische Dinge vor sich gehen, die dieses Mädchen fast umgebracht haben.«
Armand blickte Julaine fragend an.
»Nein, nicht heute Nacht. Ich kann kaum noch stehen. Die Heilung hat mich die letzte Kraft gekostet. Und bevor du fragst: Ich werde kein Arcanum nehmen, denn dann sind wir mindestens für zehn weitere Tage an diesen Ort gebunden.«
Armand ballte die Faust. Seine Schwester hatte recht. Ihre Tätigkeit am Nachmittag sowie die Heilung des Mädchens und die Suche nach dem Daimoniden hatten viel Kraft gefordert. Außerdem waren ihre Sinne zu sehr von Müdigkeit und Alkohol benebelt, als dass sie heute Nacht noch den Weg ins Château auf sich nehmen und den Kampf gegen eine unbekannte Anzahl von Anhängern eines Dämonenfürsten aufnehmen konnten.
»Ein Nephazalar lässt sein Opfer nicht entkommen«, stellte Julaine nach einer Weile in die unbehagliche Stille hinein fest. »Entweder tötet er es, oder er stellt sicher, einen weiteren Diener unter das Banner seines Herrn gezogen zu haben. Beides ist nicht geschehen.«
Julaine verschwieg dennoch das Offensichtliche. Als Armand in die fragenden Gesichter Olssons und des Wirts blickte, sprach er es für sie aus.
»Wir bekommen heute Nacht Besuch.«
Erschrocken riss Cécile die Augen auf. Sie saß aufrecht in einem Bett, um sie herum ein nur spärlich durch ein flackerndes Öllämpchen beleuchtetes Zimmer. Kalter Schweiß bedeckte ihre Stirn, und ihr Leib zitterte, als sei sämtliche Wärme aus ihm gewichen.
Wo bin ich?
Sie versuchte, ihre Umgebung einzuordnen, sich daran zu erinnern, was passiert war. Doch die Gedanken rasten unkontrollierbar dahin wie eine Droschke, der die Pferde durchgegangen waren. Verschwommene Bilder des Châteaus, der herrschaftlichen Gärten mit ihren verschlungenen Kieswegen und nächtlichen Schatten zuckten durch ihren Kopf und verschwommen mehr und mehr zu einem einzigen chaotischen Gemälde. Krampfhaft presste sie die Augenlider zusammen, als könne sie die quälenden Trugbilder damit vertreiben. Stattdessen wurde es noch schlimmer, und aus dem diffusen Wabern übereinanderstürzender Bildfetzen entstanden Kaskaden aus Blut, die sich wild schäumend aufbäumten und sie zu ersticken drohten.
Cécile schrie auf und warf sich zurück. Sie prallte gegen die Wand, und der Schmerz brachte sie mit einem donnernden Schlag in die Wirklichkeit zurück. Sie schüttelte den Kopf, um ihren Geist zu beruhigen.
Langsam gestattete sie ihrem Bewusstsein, Ordnung in das Chaos zu bringen. Vorsichtig setzte sie die Erinnerungen wieder so zusammen, dass die zuvor ungezügelten Eindrücke, Wahrnehmungen und Emotionen wieder ein Ganzes ergaben. Am Ende dieser neu entstandenen Reihenfolge sich immer schärfer abzeichnender Bilder befand sich eine Flucht, die sie an das Ende ihrer Kräfte geführt hatte. Getrieben von Todesangst und blind vor Erschöpfung, war sie in das Gasthaus im Dorf gestürzt, in der Hoffnung, dass dort noch jemand war, der ihr beistehen konnte.
Beistehen gegen … gegen dieses Ding, das nur die Hölle selbst hatte ausspeien können.
Vorsichtig betastete sie ihre Oberarme und stellte überrascht fest, dass sie dick verbunden waren. Ein unangenehmer und doch irgendwie vertrauter Geruch ging davon aus. Wer auch immer ihre Wunden behandelt hatte, musste Ahnung davon gehabt haben, darauf ließ auch die Tasche auf dem Tisch schließen. Darin konnte Cécile allerlei Gerätschaften erkennen, die sie schon bei den Medici gesehen hatte, die regelmäßig vom Vicomte wegen seiner Leiden bestellt worden waren. Scheren und Klemmen, Fläschchen und Phiolen sowie einige obskure Metallwerkzeuge, die eher aussahen, als könne man damit die Innereien eines Tiers ausnehmen, anstatt einem Menschen zu helfen, waren zu erkennen.
Sie dankte der Dreifaltigkeit, dass sie an den richtigen Ort geführt worden war, anstatt auf der Straße zu verbluten. Ihr Atem beruhigte sich, und sie schloss die Augen. Während sie lauschte, wie ihr hämmerndes Herz nach und nach wieder in einen normalen Rhythmus zurückkehrte, fiel auch die allumfassende Angst etwas von ihr ab, die sie gefangen hielt, seit sie hatte mitansehen müssen, wie der Vicomte grausam aus dem Leben gerissen worden war.
Kaum hatte sie sich dieser Erleichterung hingegeben, spürte sie, dass sie nicht alleine im Zimmer war. Sie riss die Augen auf und starrte zur Tür. Im letzten Moment konnte sie einen Schrei unterdrücken, als sie erkannte, dass dort nicht Qual und Tod auf sie lauerten, sondern eine Frau stand, die sie überrascht anblickte.
»Du bist also wach«, stellte diese lapidar fest und betrat den Raum. Dunkle, bis auf die Schultern reichende Locken, rahmten ein Gesicht von hellem Teint ein, in dem die Anstrengungen eines langen Tages erkennbar waren. Sie setzte sich an den Bettrand und betrachtete Céciles rechten Arm. »Hast du Schmerzen? Ich kann dir noch etwas Anodyna geben, damit du schlafen kannst.«
»Nein«, Cécile schüttelte den Kopf. »Keine Schmerzen.«
Die Frau runzelte die Stirn. »Das wundert mich. Lass mich nachsehen, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist.« Ohne zu fragen, begann sie, den Verband um Céciles Oberarm zu lösen. »Du wurdest sehr schwer verletzt. Verderbtes Sekret der Dunklen Domänen hätte deinen Körper verzehren können.«
»Ver… verzehren? Wie kann das sein?«
»Ein Daimonid hat seine Schattenklauen tief in dein Fleisch gegraben. Dabei hat er etwas in deinen Körper injiziert, deinen Adern einen Odem eingeflößt, der zwangsläufig ganz von dir Besitz ergriffen hätte«, erklärte sie in ernstem Ton. »Du musst dir das so ähnlich vorstellen, als hätte man dich vergiftet«, fügte sie hinzu, als sie Céciles fragenden Blick bemerkte.
Die Frau löste die letzten Streifen des Verbands und entfernte dann ein dickes Tuch, das von dem Stoff auf die Wunden gepresst worden war und von dem der beißende Geruch ausging. »Das hat die Wunde gereinigt und dafür gesorgt, den dunklen Odem zu vertreiben«, erklärte sie. »Halt still!«, forderte sie Cécile auf, als diese den Arm wegziehen wollte. Dann betrachtete sie die Wunde.
Cécile bemühte sich währenddessen, möglichst nicht auf ihren Arm zu schauen. Ihr wurde ja von dem Geruch schon beinahe übel, und sie wollte sich nicht die Blöße geben, sich beim Anblick ihrer Verletzung zu übergeben. Angestrengt starrte sie auf die Wand und wartete die Begutachtung der unbekannten Heilerin ab.
»Das ist erstaunlich«, murmelte diese nach einem Augenblick. »Sehr erstaunlich.« Dann schwieg sie.
»Was ist erstaunlich?«, fragte Cécile nach einer Weile und drehte den Kopf zu ihr. Ihre Ungeduld hatte die Angst vor der Übelkeit besiegt, und sie betrachtete nun selbst die Verletzung. Wo nach der Ankündigung Blut, Eiter und entzündete Wundränder zu erwarten gewesen wären, erkannte sie feste Verkrustungen und ein zartes Rosa, das sich um die Wunden erstreckte, die ihr der Daimonid zugefügt hatte.
»Was meint Ihr mit erstaunlich?«, fragte sie noch einmal, als sie keine Antwort erhielt.
»Wie kann das derartig schnell verheilen? Vor ein paar Stunden habe ich noch um dein Leben gekämpft. Selbst wenn es eine normale Verwundung gewesen wäre und ich noch mehr der Essenz in die Heilung hätte hineinfließen lassen, dürfte sie frühestens in einer Woche so aussehen.«
»Was ist daran ungewöhnlich?«, wunderte sich Cécile.
»Hast du mir nicht zugehört? Ich habe es dir doch gerade erklärt.«
»Ja, Madame, das habt Ihr, aber warum sollte es eine Woche dauern? Wunden heilen schnell. Ihr als Heilerin müsstet das doch besser wissen als ich.«
Die Frau starrte sie an, als habe sie den Verstand verloren.
»Oder etwa nicht?«, fügte sie kleinlaut hinzu.
»Nein, eigentlich nicht … Zumindest habe ich so etwas noch nie erlebt«, antwortete sie leise und blickte sie mit einem unergründlichen Blick an. Kurz bevor Cécile die Augen abwenden wollte, weil es ihr immer unangenehmer wurde, wandte sich die Frau ab. Sie stand auf und setzte sich auf den Stuhl neben das Bett. Aus einer Karaffe goss sie Wasser in einen Tonkrug und reichte ihn ihr. »Trink!«
Cécile trank das Gefäß mit einem Zug leer und forderte mehr. Erst jetzt merkte sie, wie durstig sie war. Während sie auch den zweiten Becher gierig hinunterstürzte, wurde ihr bewusst, dass sie erneut beobachtet wurde.
»Ist etwas, Madame?« Die Dame mochte ihr geholfen haben, aber allmählich ging sie ihr mit ihren nichtssagenden Andeutungen und dem Gestarre auf die Nerven. Obgleich sie offenkundig eine bewanderte Heilerin war, die die Güte besessen hatte, ihr in der Not beizustehen, wirkte sie nicht besonders vertrauenerweckend auf Cécile, ging man nach ihren Umgangsformen. Sie war zwar daran gewöhnt, herumgescheucht zu werden, aber was gab dieser Frau das Recht, sich aufzuführen, als sei sie der Kammerherr oder die Garderobenmeisterin? Und hatte sie da hinten in der Ecke nicht eine Schwertscheide entdeckt? Warum trieb sich so jemand in der Dorfkneipe von Darneville herum? Cécile kamen auf einmal die Geschichten von spanischen Menschenjägern in den Sinn, die sie bisher für dummes Dorfgeschwätz gehalten hatte. Lag in der Stimme der Frau nicht ein südländischer Akzent? War sie etwa vom Regen in die Traufe geraten?
»Keine Wunde heilt so schnell, und der Odem eines Nephazalar hätte den stärksten Mann dahinraffen können. Doch dich nicht, Cécile Ledoux. Du trägst etwas in dir, das es verhindert hat. Etwas wie die Kraft, doch ich kann es nicht ergründen. Ich bin zu erschöpft.«
»Die … Kraft? Was soll das sein? Und woher kennt Ihr meinen Namen?«
»Vom Wirt. Er hat uns geholfen, dich hier heraufzuschaffen.«
»Uns?«
»Mir und meinem Bruder Armand. Mein Name ist Julaine. Wie du vielleicht vermutet hast, stammen wir nicht aus dieser Gegend. Wir sind auf der Durchreise und saßen zufällig im Schankraum, als du uns vor die Füße gefallen bist.«
Eine Spanierin, hab ich es doch gewusst! »Und wie kommt es, dass Ihr Euch so gut mit diesen … Dämonenkreaturen auskennt?«
»Eine berechtigte Frage. Ganz einfach gesprochen, gehen wir derartigen Phänomenen auf den Grund und treiben sie dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Von Berufs wegen.«