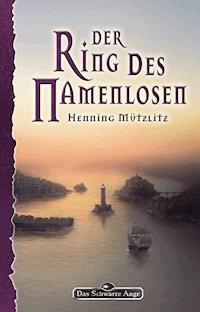Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Knappe Liocas und die Kriegerin Moriana erwachen am Schauplatz einer Katastrophe. Eine unbekannte Macht hat die verfeindeten Heere der Allianz von Valdora und der barbarischen Tequari gleichermaßen vernichtet. Wider Willen versuchen die überlebenden Todfeinde herauszufinden, was geschehen ist. Verfolgt von den Häschern des valdorischen Königs und den Inquisitoren der Hohen Priesterschaft stoßen sie auf eine mörderische Verschwörung. Die Spur führt nach Amhas, ins Reich der Oligarchen und Söldnergilden. Dort treffen Moriana und Liocas auf neue Verbündete und unbekannte Feinde, die mit Kräften im Bunde stehen, von denen sie nichts geahnt haben. Im Schatten der amhasischen Handelstürme und Luftschiffe offenbart sich Moriana und Liocas das Ausmaß einer Bedrohung, die abseits von Politik und Krieg ein ganzes Zeitalter neu zu schmieden vermag. Der Kontinent Camotea steht am Abgrund, und nur wenige Eingeweihte kennen die tatsächliche Macht, die hinter den Schleiern der Wirklichkeit lauert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wächter der letzten Pforte
WeltkartePrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25EpilogGlossarÜber die AutorenDie Wächter-Chroniken - Schatten über CamoteaDie Wächter-Chroniken - Die Königin von MesothImpressumWeltkarte
Prolog
Das Luftschiff erschien mit der aufgehenden Sonne.
Trotz seiner Größe kam es elegant wie ein Adler aus der Wolkenbank hervor, die sich an die Flanken der Berge schmiegte. Unter dem dreigliedrigen Gebilde aus Holz und Metall breitete sich eine bewaldete Hügellandschaft aus, die nach und nach in eine Ebene überging. Zwei sich vereinende Ströme beherrschten die Szenerie.
Matrosen liefen auf dem Deck umher und betätigten Kurbeln, Gestänge und Seilzüge für den Landeanflug des Arcanaeros. Die Luft unter dem Rumpf flimmerte, als die mit dem Leitwerk verbundenen Auslassöffnungen heiße Luft verströmten.
Vor dem Bug erschien eine Stadt, die am Zusammenfluss der Ströme lag und wie ein steinernes Geschwür wirkte, das in die Landschaft hinein wucherte. Das Luftschiff steuerte auf einen der vielen Türme zu, die das Zentrum der Metropole bildeten. Sie waren von ihren Erbauern in maßloser Vermessenheit hunderte von Fuß in die Höhe getrieben worden, als ob sie darum wetteiferten, welcher von ihnen die Sonne zuerst erreichte.
Das ankommende Arcanaero war nicht das einzige Luftgefährt seiner Art, das zu dieser frühen Stunde über den Dächern der Stadt schwebte. Es kreuzte den Kurs weiterer Fluggeräte, die flügellos über den Himmel glitten. Manche kleiner, manche größer.
Die Besatzung rief sich Befehle zu, während die Geschwindigkeit verringert wurde. Mit Flaggensignalen teilte der Posten im vorderen Ausguck der Mannschaft des Turms mit, dass man anlegen wollte. In der Vorwärtsbewegung drehte sich der Rumpf, bis die Steuerbordseite korrekt ausgerichtet war. Das Schiff trieb gegen einen Ausleger, der von einer Plattform im oberen Drittel des Turms hinausragte. Kurz bevor der Rumpf mit dem Steg kollidierte, wurde er von einer Kraft gestoppt, die so stark war, dass funkensprühende Entladungen über die Bordwand tanzten. Aus den wie Tierköpfe modellierten Ventilen an den Flanken entwich Gas. Der Abstand zwischen Schiff und Anleger betrug kaum einen Fuß, als es vollends zum Stillstand kam.
In der Bordwand öffnete sich eine Luke, und ein Fallreep wurde von einem Schwenkarm auf den Ausleger gesenkt. Während die Besatzungsmitglieder das Schiff mit Hilfe der Turmmannschaft vertäuten, erschienen vier Personen in der Öffnung und schritten die Stiege hinunter.
Vorneweg ging ein hochgewachsener Mann mit alterslosem Gesicht. Sein schwarzes Haar hatte er mit Hilfe goldener Ringe zu Zöpfen gebunden, die über die Schultern fielen. Ein Silberreif zierte seine Stirn. Ihm folgten ein jüngerer Mann und eine Frau, deren Haar im Kontrast zu dem ihrer Begleiter kupferbraun, aber ebenfalls in mehrere Stränge geteilt war.
Ihre Gewänder hoben sich von der einfachen Kleidung der Arbeiter und Schiffsleute ab. Windböen warfen die für die Jahreszeit unpassenden Mäntel zurück und entblößten Westen und Hosen mit kostbaren Stickereien, die auf eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung deuteten.
Den Abschluss bildete ein Mann von vielleicht vierzig Sommern, der im Gegensatz zu den anderen in dicht anliegende Lederkleidung gehüllt war. Auch sein heller Teint unterschied ihn von den Mitreisenden. Scimitar und Dolch an der Seite zeugten von seiner kriegerischen Profession.
Zielstrebig bewegte sich die Gruppe auf ein Portal am Ende des Anlegers zu. Diener kamen ihnen entgegen, verneigten sich und eilten zum Schiff. Schließlich trat eine Frau mittleren Alters aus der Gruppe heraus. Ihre Haare waren kunstvoll mit Bändern drapiert, und sie trug den förmlichen roten Kaftan der hohen Beamten. Auch sie verneigte sich mit einem Lächeln und sprach die Besucher an. »Seid willkommen in Amhas, im Haus von Dakris Olgasi, edle Gathori! Ich bin Pyâdah, die Prokuratorin dieses Rukh. Mögen Euch die Götter segnen! Mein Herr erwartet Euch bereits, Meister Ikastra.«
Mit diesen Worten drehte sie sich um und ging den Ankömmlingen voran. Schweigend folgten sie ihr in den Turm.
Wenig später traten die Reisenden aus einem technomantischen Aufzug. Zwei Diener öffneten ihnen die Türen, durch die sie in einen Saal unterhalb der Turmspitze traten. Morgenlicht fiel durch die Fenster. Die Ausstattung des Raums machte deutlich, dass der Besitzer nicht nur Steine in den Himmel türmen konnte, denn gleichermaßen besaß er einen erlesenen Geschmack. Keramikplatten und aufwendige Mosaike bedeckten den Boden.
Von der gegenüberliegenden Seite betrat ein Mann in festlich wirkender Robe den Raum. Sein Gesicht war nach Art der amhasischen Optimaten geschminkt, besonders die Augen wurden übermäßig betont. Die goldblonden, formvollendet frisierten Haare waren gewachst und offenkundig nicht seine eigenen. Schillernde Fischschuppen auf Wangenknochen und Handrücken rundeten das farbenfrohe Bild ab.
Mit erhobenen Händen schritt er auf die Gruppe zu und wandte sich an den Mann mit dem Stirnreif. »Ich freue mich, Euch wiederzusehen, Shaat. Euer Besuch ist stets eine Ehre.«
Shaat Ikastra erwiderte den Gruß, blieb aber förmlich. »Sei gegrüßt, Dakris.« Seine erhobene Linke offenbarte einen Siarra, einen blauen Kristall, der mit der Hand verwachsen zu sein schien. »Dies sind Saresh Arkusa und Miriya Ralan, Adepten meines Ordens. Von Saresh habe ich dir bereits berichtet.«
Olgasi deutete eine Verbeugung an, die die Magier erwiderten. Auch sie entblößten Kristalle in ihren Handflächen.
»Seid auch Ihr willkommen, edle Gathori«, sagte Olgasi mit routinierter Herzlichkeit. »Setzt Euch, die Reise mit dem Arcanaero war sicher anstrengend.« Sein Blick fiel auf den Bewaffneten. »Ihr könnt Euren Leibwächter fortschicken. Ihr seid sicher in meinem Haus.«
Shaat, Saresh und Miriya tauschten kurze Blicke. »Der Ghulam bleibt«, stellte Shaat klar. »Nalyd ist eingeweiht.«
»Wie Ihr wünscht. Setzen wir uns.« Olgasi wies auf eine Gruppe von Diwanen, die um einen flachen Esstisch gruppiert waren. Diener richteten dort Glasschalen mit leichten Speisen sowie Weinkaraffen mitsamt Kelchen an.
»Ich wundere mich, dass Ihr bereits so früh eintrefft«, sagte der Amhasi, während er sich niederließ. »Ich hatte kaum Zeit, Euren Empfang angemessen vorzubereiten.«
»Wir sind nicht für eine Festivität in dein Haus gekommen«, entgegnete Shaat, während er sich mit seinen Begleitern dem Gastgeber gegenübersetzte und ihn erwartungsvoll anblickte.
Olgasi schien irritiert über die abweisende Haltung zu sein, setzte jedoch rasch eine geschäftsmäßige Miene auf. »Ehrenwerter Achar, es wurde alles vorbereitet. Söldner stehen bereit, Euch zu führen und zu schützen.«
»Gut, damit hast du einen Teil unserer Abmachung erfüllt. Wie steht es mit dem anderen?«
»Ich habe das beschaffen können, nach dem Ihr verlangt habt, Shaat.«
Auf einen Fingerzeig des Optimaten verließ die Rotgewandete den Raum. Kurz darauf kehrte sie mit zwei Lakaien zurück, die ein konisches Objekt auf einem Tablett hereintrugen und neben Olgasi auf dem Tisch abstellten. Es bestand aus glänzendem Metall von einem halben Fuß Länge. Eine weitere Handbewegung ihres Herrn bedeutete den Dienern, den Raum zu verlassen. Die Prokuratorin Pyâdah hingegen postierte sich neben den Gästen.
»Es befindet sich in diesem Calyx aus gehärtetem Silan. Ein Gefäß, das kaum durch Gewalt zu zerstören ist«, erklärte Olgasi und blickte gönnerhaft in die Runde. »Aber das ist nicht das eigentlich Besondere daran, wie Ihr gleich merken werdet. Ich versichere Euch, niemand hat den Inhalt dieses Behälters gesehen, solange er sich in meiner Obhut befindet. Den Schlüssel trage ich stets bei mir.« Olgasi zog einen Ring von einem Finger. »Nur der Träger eines Siarra kann damit das Schloss öffnen.« Stolz präsentierte er den vermeintlichen Schlüssel und drehte ihn zwischen den Fingern.
»Ich bin zufrieden«, sagte Shaat. »Du sollst erhalten, was ich dir versprochen habe, und noch mehr, wenn der Fund dieses Kleinods weiterhin ein Geheimnis bleibt, bis erfolgreich beendet ist, was begonnen wurde. Wir sind unserem Ziel näher gekommen. Unsere Gegner dürfen unter keinen Umständen erfahren, wie nahe.«
»Natürlich, Achar. Ich trage dafür Sorge«, betätigte Olgasi und legte den Ring auf das Tablett.
»Wir haben wenig Zeit, daher werden wir deine Gastfreundschaft nicht länger strapazieren.« Shaat nickte Saresh zu. Der junge Mann erhob sich und ging zu dem Tisch hinüber, auf dem sich Ring und Kapsel befanden.
In dem Augenblick, als Saresh den Ring in die Hand nahm, stellten sich seine Nackenhaare auf.
Der Angriff kam überraschend.
Er wirbelte herum und erkannte aus den Augenwinkeln, wie Olgasis Dienerin ein blitzendes Stilett aus ihrem Kaftan zog und einen schnellen Schritt auf Shaat zuging. Dieser verstand den Blick seines Schülers sofort, sprang von der Liege auf, drehte sich und fixierte die Angreiferin.
Pyâdah sprang auf ihn zu und stieß die Klinge nach oben, direkt auf seinen Kehlkopf gerichtet. Der Magier schien in der Bewegung zu erstarren, als er das tödliche Instrument auf sich zufliegen sah. Doch kurz bevor sich der Stahl in sein Fleisch bohrte, war Nalyd bei ihm.
Das nächste, was Saresh wahrnahm, war der Scimitar des Ghulam, der weniger als einen Spann über fünf abgetrennten Fingern verharrte.
Die Frau ging schreiend zu Boden und umfasste ihre verwundete rechte Hand. Ein Tritt des Leibwächters warf sie auf den Rücken.
Verzweiflung und Zorn zeichneten sich auf ihrem Gesicht ab. Doch anstatt ihre Niederlage einzusehen, griff sie erneut in ihr Gewand. Ein gläsernes Röhrchen kam zum Vorschein, das sie an einem Band um den Hals trug. Sie zog fest daran und riss dabei den Haken ab.
Als Nalyd erkannte, dass die Attentäterin im Begriff war, eine neue Waffe zu ziehen, wollte er sie niederstrecken, doch Shaat kam ihm zuvor. In dem Augenblick, in dem sie das offene Behältnis in seine Richtung warf, wurde sie von einer unsichtbaren Faust brutal gegen die Wand geworfen. Pulver rieselte aus dem Wurfgeschoss, das beim Kontakt mit der Luft sofort zu glimmen begann.
Miriya sprang an Shaats Seite und vollführte eine Handbewegung, als wollte sie etwas Schweres von sich wegschieben. Das Rohr und das entweichende Pulver wurden zu einem der Fenster geschleudert. Im Augenblick des Aufpralls entzündete sich das Pulver. Mit einem Knall explodierte das Fenster mitsamt Rahmen und dem umliegenden Mauerwerk. Die Druckwelle räumte den Tisch ab, ließ die übrigen Scheiben bersten und schleuderte eine Wolke von Splittern aus Holz, Stein und Glas in den Raum. Die Erschütterung warf alle bis auf Shaat von den Beinen. Olgasi duckte sich schreiend hinter die Rückenlehne seiner Liege.
Ein Schleier aus Staub legte sich über das teure Mobiliar. Wo sich eben noch ein kostbar ausgestaltetes Fenster befunden hatte, klaffte nun ein rußgeschwärztes Loch in der Wand.
Shaat blickte an sich herab und stellte fest, dass er unverletzt war. Er sammelte sich, klopfte den Mantel ab und wischte mit dem Saum den Dreck aus dem Gesicht. Der hustenden Miriya reichte er die Hand und half ihr, sich aufzurichten.
Dann galt seine Aufmerksamkeit wieder der Attentäterin, die vor Schmerzen aufheulte, als sie versuchte, sich zu bewegen. Der Stoß gegen die Wand musste ihr einige Rippen gebrochen haben. Vor sich erspähte er ihr Stilett zwischen abgetrennten Fingergliedern liegen. Der Magier fixierte es mit der Linken, als wolle er zum Tanz auffordern, und die Waffe schwebte durch einen stillen Befehl in seine Hand.
Shaat betrachtete die dreikantige Klinge einen Augenblick, dann ließ er sie los. Doch anstatt zu fallen, schwebte sie vor seiner Brust in der Luft. Er drehte sich zu der Frau, und das Stilett folgte seiner Bewegung wie ein abgerichteter Hund. Auf einen Fingerzeig des Magiers hin bewegte sich die Klinge langsam auf die Attentäterin zu. Diese drückte sich ohne eine Möglichkeit zum Ausweichen gegen die Wand. Das Stilett wanderte über ihre Beine hinweg, zum Gesicht und kam direkt vor ihrem linken Auge zum Stehen.
»Antworte mir, und ich lasse dich mit einem Auge davon kommen«, sagte Shaat regungslos und trat einen Schritt an sie heran. »Wer schickt dich?«
Die schwer atmende Frau versuchte, sich nicht zu bewegen, während sie die Klinge fixierte. Ein feiner Blutfaden, der aus ihrem Mund rann, unterstrich ihre Worte, als sie antwortete. »Das wisst Ihr doch genau.«
Shaat legte den Kopf schief und drehte sich um.
Noch bevor die Attentäterin schreien konnte, hatte sich das Stilett tief in ihren Kopf gebohrt. Ihre Glieder erschlafften.
Für einen Augenblick herrschte Schweigen. Der Wind wirbelte durch das zerstörte Fenster noch mehr Staub und Rauch auf und erfüllte ihn mit einem beißenden Geruch.
Shaat vergewisserte sich, dass seine Begleiter unverletzt waren und blickte zu Olgasi, der bleich in seiner Liege zusammengesunken war. Die Augen des Magiers brannten vor Zorn. »Und du? Hast du mir irgendwas mitzuteilen?«
Als Olgasi zu antworten versuchte, brachte er nicht mehr als ein Stammeln hervor, da sein Unterkiefer vor Angst zitterte. Er sah aus, als hätte er überhaupt nicht verstanden, was zuvor geschehen war.
Shaat beschloss seiner Frage mehr Nachdruck zu verleihen. Die unsichtbare Kraft, die der Magier beherrschte, riss das Stilett aus dem Kopf der toten Attentäterin und schleuderte es auf Olgasi. Schreiend versuchte er von seiner Liege zu springen, stürzte dabei aber rücklings auf den Boden. Als er sich wieder aufrappeln wollte, verharrte er vor Schreck mitten in der Bewegung. Die schwebende, rot glänzende Klinge zielte auf seinen Hals.
Ihr Gebieter stellte sich über Olgasi und sah auf ihn herab. Es benötigte nur eine Handbewegung des Magiers, da legte sich das Stilett an die Kehle des Händlers und schmiegte sich an dessen wild pochende Schlagader. Der verlängerte Arm Shaats hob die Klinge an und zwang Olgasi, den Kopf zu recken. So musste er sich dem unbarmherzigen Blick seines Peinigers stellen. Schweißperlen rannen die Klinge hinab und vermischten sich mit Pyâdahs Blut.
Von jenseits der Tür hörte man Lärm.
»Meister!«, rief Saresh, doch Shaat schien sich nicht daran zu stören. Der Ghulam und die beiden Magier machten sich bereit. Nur wenige Herzschläge später wurde die Tür aufgestoßen, und eine Gruppe Wachen stürmte in den Saal. Der Angriff kam jedoch zum Stehen, als sie drei kampfbereite Magier, die bereits blutige Klinge des Leibwächters und ihren Herrn mit einem Messer an der Kehle am Boden liegen sahen. Diener blickten erschrocken durch die Tür. Einer begann zu schreien, als er die tote Prokuratorin sah.
»Sie sollen verschwinden«, sagte Shaat, unbeeindruckt von dem Spektakel. »Du hast schon genug Schaden angerichtet. Lass nicht auch noch deine Diener dafür mit ihrem Leben zahlen.«
Der Blick des Anführers wanderte erst zu Pyâdahs Leiche und dann zu seinem Herrn.
»Schert … schert euch raus!«, stieß Olgasi hervor. »Alle raus!«
Der Anführer fixierte noch einmal Saresh, dessen linke Hand mit dem magischen Kristall in seine Richtung zielte. Dann hob er die Hand und zog sich mit seinen Männern zurück. Kaum waren sie verschwunden, konzentrierte sich Saresh auf die Türflügel und ließ sie krachend zufallen. Dann richtete er seine Kraft gegen das Schloss der Tür, das zuschnappte und durch seine Magie unter einem metallischen Quietschen so verbogen wurde, dass man es nicht mehr mit einem Schlüssel öffnen konnte.
Shaat kniete sich indessen zu dem schockierten Olgasi herab. »Nun erklärst du mir bitte, wie es einer Attentäterin gelingen konnte, so nah an uns und den Elyr heranzukommen.«
Olgasi blickte den Magier panisch an und schluckte. »Glaubt mir, Shaat, ich habe von nichts gewusst!«
»Das nehme ich dir vielleicht sogar ab. Bleibt dennoch die Frage, wie es so weit kommen konnte. Wenn du nicht die Sicherheit gewährleisten kannst, die du versprichst, bist du nutzlos für uns.«
»Pyâdah … sie arbeitete seit Jahren für mich, ich hätte nie vermutet, dass sie …«
»Seit Jahren?« Shaat fletschte die Zähne und drückte das Stilett fester an Olgasis Hals, woraufhin ein dünner roter Faden auf seiner Haut entstand. Der Händler gluckste, während Shaats Blick ihn förmlich durchbohrte. »Also, wie konnte dir entgehen, was ihre wahren Absichten waren?«
»Ich, ich … ich habe sie …«, war alles, was Olgasi einfiel.
Verstehen zeichnete sich daraufhin im Gesicht des Magiers ab, als hätte er einen flüchtenden Gedanken in seinen Augen gelesen.
»Natürlich, Dakris«, sagte er schließlich beinahe sanftmütig. »Es ist doch immer dasselbe, nicht wahr?«
Olgasi starrte ihn ungläubig an.
»Sie hat es in dein Bett geschafft und von dort schließlich bis hierhin.« Im gleichen Moment war das Stilett vom Hals verschwunden, flog mit einer rotierenden Bewegung zwischen seine Beine und schlitzte dort die Hose auf.
Olgasi schrie auf.
»Vielleicht wirst du vorsichtiger, wenn ich dich vom Ursprung deiner Unachtsamkeit befreie?«
»Nein, bitte! Ich flehe Euch an!«
»Das hängt jetzt ganz davon ab, was wir in der Kapsel finden werden, mein Freund. Saresh, öffne den Calyx! Wir müssen Gewissheit haben«, befahl er seinem Schüler, während er Olgasi weiter beäugte.
Saresh ging auf den Tisch zu und betrachtete argwöhnisch die Metallkapsel. Die polierte Oberfläche glänzte und hatte die Farbe des Morgens angenommen. Sie war tatsächlich aus Silan gegossen und schien aus einem Stück zu bestehen. Seine geschärften Sinne spürten deutlich, dass die Hülle eine große magische Kraft von der Außenwelt abschottete.
Bis auf eine Vertiefung am abgeflachten Kopfende des kegelförmigen Behälters gab es nichts, das auf einen Öffnungsmechanismus hinwies oder einem Schloss glich. Aber er wusste genau, was zu tun war, und nahm den vermeintlichen Schlüssel. Der Ring lag kühl in seinen Fingern. Er legte den hellblauen Siarra vorsichtig darauf. Kaum hatten sich beide berührt, ging ein Vibrieren durch den Ring und er begann seine Form zu verändern. Nach wenigen Augenblicken hatte sich der Gegenstand vollkommen verformt, und anstelle eines Rings hielt Saresh nun einen kleinen Kegel in der Hand, der genau in die Vertiefung der Kapsel passte. Behutsam setzte er ihn ein und beobachtete halb staunend, halb ängstlich den Effekt, den der Schlüssel auf das Behältnis hatte. Ohne das Zutun der Magier im Raum wurden Fugen in dem eben noch makellosen Körper sichtbar, und er veränderte seine Form. Die Hülle des Calyx klappte langsam wie ein Blütenkelch in der Morgensonne auseinander. Hellweiße Strahlen erfüllten den Raum, als sich das Gefäß öffnete. Das Licht erstrahlte heller als die Sonne, die über der Stadt aufstieg.
Keiner der Anwesenden konnte sich dem Anblick entziehen. Alle vermeinten eine Quelle dieser reinen Kraft hinter dem Leuchten zu erkennen. Saresh spürte, dass es mehr war als ein Licht. Er spürte einen Willen. Es war die Inkarnation einer Macht, welche die Welt mit erschaffen hatte. Vor ihm lag tatsächlich der Elyr, nach dem sie gesucht hatten. Und obwohl es heller erstrahlte als alles, was Saresh kannte, erblickte er einen dunklen Fleck in dem Licht. Zunächst nur ein schwarzes Flackern, einen finsteren Schemen, der zusehends Form annahm. Ein lodernder Schatten im Zentrum des Gleißens. Seine Umrisse wurden schärfer und schärfer, je fester Saresh den Blick darauf richtete. Vor seinen Augen gefror er zu einem kreisrunden Gebilde – schwarz und doch leuchtend. Ein bodenloser Schacht, aus dem Licht wie goldene Speere in die Welt geschleudert wurde. Eine schwarze Sonne, heller als alle Lichter Camoteas zusammen.
Saresh spürte den Drang, sich nie wieder davon abzuwenden.
»Das ist genug. Verschließ es wieder.«
Saresh hörte seinen Meister, doch schien ihm dieser Befehl nicht richtig. Erst, als seine Augen zu schmerzen begannen, zog er den Schlüssel aus dem Schloss und trat einen Schritt zurück.
Das Gleisen erstarb, als sich die Hülle des Calyx vollständig schloss. Die Kapsel wirkte so makellos wie zuvor, und der Kegel in Sareshs Hand nahm wieder die Form eines Rings an.
Shaat beugte sich über Olgasi, der für einen Augenblick vergessen zu haben schien, in welch prekärer Lage er sich befand. Er starrte immer noch gebannt in Richtung des Tischs. Seine Pupillen waren fast vollständig in der Iris verschwunden. Links und rechts der spitzen Nase liefen blutige Tränen die Wangen hinab.
»Ich denke, du verstehst nun, warum wir uns keine Schwächen leisten können«, flüsterte Shaat.
Der Mann nickte, unfähig etwas zu sagen.
»Vergiss es nicht.«
Bevor Olgasi reagieren konnte, war die Spitze des Stiletts quer durch sein Gesicht gefahren. Dann fiel die Waffe neben seinem Kopf zu Boden. Einen Wimpernschlag später traf ihn der Schmerz, und er griff sich aufheulend ins Gesicht.
Unbeeindruckt vom Geschrei des Händlers zog Shaat eine Kassette aus dem Gewand und legte sie neben den Calyx auf das Tablett. »Gedenke meiner Dankbarkeit und schick die Söldner in zwei Tagen zu mir.« Er beugte sich noch einmal zu Olgasi herab. »Und hoffe darauf, dass wir keine weiteren Überraschungen auf unserem Schiff vorfinden.«
Auf eine Geste Shaats hin nahm Miriya die Silan-Kapsel an sich. Er trat vor Saresh, der immer noch geblendet war und blinzelte. Shaat legte seinem Schüler den Siarra auf die Stirn und flüsterte.
»Besser?«, fragte er, als er die Hand wieder wegnahm.
»Ja, es geht«, antwortete Saresh leicht benommen.
»Gib mir den Ring.«
Saresh legte seinem Lehrer den Schlüssel in die Hand.
»Nalyd, hilf ihm«, befahl Shaat und ging in Richtung der unbeschädigten Tür. Der Ghulam steckte die Waffe ins Heft und griff Saresh unter die Schulter. Die vier verließen den Saal und ließen Olgasi winselnd am Boden zurück.
Kapitel 1
Liocas kam zu Bewusstsein. Die Schwärze, die ihn umfangen hatte, wich einem warmen Licht, das durch die Augenlider schien. Er zwang sich, die Augen zu öffnen und blickte in Richtung der tiefstehenden Sonne. Die Dämmerung tauchte das Tal in einen rötlichen Schimmer, und die langen Schatten der Viliastannen kündigten den Abend an.
Der Knappe richtete sich auf, doch als er sich einige Handbreit bewegt hatte, sank er stöhnend zurück auf den Boden. Er fühlte sich, als hätte ihn ein Schlachtross niedergetrampelt, jeder Knochen im Körper schien ihn peinigen zu wollen.
Benommen blieb er auf der Seite liegen. Er starrte in die rauschenden Kronen der Bäume und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Was ist nur geschehen? Seine Finger krallten sich im Erdreich fest. Der Boden war noch warm vom Tag, doch der Wind strich über seinen Körper und ließ ihn frösteln. Er trug einen scharfen Geruch mit sich.
Ein heiserer, unmenschlicher Schrei drang an Liocas’ Ohr, und Schatten stiegen vor ihm auf. Sein Verstand riet ihm, sich trotz der Qualen zu erheben. Er kämpfte gegen den übermächtigen Wunsch an, einfach liegenzubleiben, und bemerkte, dass er trotz der Schmerzen kaum verletzt war. Kein Knochen war gebrochen, und die dunklen Flecken auf seiner Kleidung stammten nicht von seinem eigenen Blut.
Endlich kam er auf die Knie.
Rundherum bot sich ein Bild, das die schlimmsten Prophezeiungen der Hohen Priesterschaft des Urias wie eine harmlose Gutenachtgeschichte wirken ließ: So weit Liocas sehen konnte, war die Landschaft von verkrümmten, verstümmelten und zerrissenen Leibern bedeckt. Inmitten dieses Todesfelds schien er das einzige menschliche Wesen zu sein, das sich noch bewegte. Schwärme von Krähen saßen auf den Toten und hockten auf den umliegenden Felsen und Bäumen. Die gierigen Schreie der Aasfresser vermischten sich zu einem grausamen Kanon.
Unzählige Leichen von barbarischen Kriegern, valdorischen Rittern und deren Pferden türmten sich bis zu den Rändern des Tals auf. In jede Himmelsrichtung erstreckten sich die blutgetränkten Körper wie ein Teppich aus Fleisch und Stahl, der sich über das fruchtbare Grün der sommerlichen Vegetation gelegt hatte. Aufgeschlitzte Körper, abgerissene Extremitäten und bis zur Unkenntlichkeit zugerichtete Gesichter tränkten das Tal des Flusses Asakon in Blut.
Neben-, über- und aufeinander lagen die Überreste der streitenden Heere, ihre Leiber teilweise derart ineinander verkeilt, dass sie wie ein Berg aus Innereien wirkten, die ein Fleischer zum Einkochen beiseitegelegt hatte. In groteske Verrenkungen verzerrt, ragten hier und da Hände oder Füße in den Himmel, anscheinend in einem letzten verzweifelten Versuch, den göttlichen Einen um Hilfe anzuflehen.
Doch er hatte sie nicht erhört.
Natürlich hat er sie nicht erhört, dachte Liocas. Ihm begannen Tränen über das Gesicht zu laufen. Warum sollte er auch? Warum jemanden retten, der sich schon vor Jahrhunderten von ihm abgewandt hatte? Dem Knappen stockte der Atem. Er riss sich den visierlosen Helm vom Kopf und begann angesichts des Massakers, das um ihn herum stattgefunden hatte, hemmungslos zu weinen.
Ein furchtbarer Gestank lag über dem Kampfplatz. Liocas krümmte sich, denn ihn überkam eine fürchterliche Übelkeit. Er übergab sich neben einem Pferdekadaver, der noch an einen eisenbeschlagenen tequarischen Kriegswagen gespannt war. Nachdem sich sein Magen in unendlichen Krämpfen entleert hatte, übermannte ihn die Verzweiflung vollends. Lange Zeit blieb er schluchzend am Boden liegen, umgeben von den zerrissenen Leibern einstmals stolzer Krieger.
Doch irgendwann wich das Entsetzen einer inneren Leere, so als weigere sich sein Bewusstsein, von dem Schrecken um ihn herum weiterhin Kenntnis zu nehmen. Zögerlich richtete er sich auf und versuchte, einige Schritte zu gehen. Bereits nach wenigen Fuß glitt er in einer Blutlache aus und schlug auf den Boden. Die leeren Augen eines rumpflosen Barbarenkopfs starrten ihn anklagend an. Liocas erschauderte, versuchte die erneut aufwallende Übelkeit zu unterdrücken, quälte sich auf und taumelte weiter.
Wie konnte das alles nur geschehen? War er tatsächlich der einzige, der dieses Inferno überlebt hatte? Oder hatte ihn sein Orden zurückgelassen, weil sie ihn für tot hielten? War er vielleicht tatsächlich gefallen und in die Tosenden Abgründe gefahren, in denen die Verfluchten ihre irdischen Schulden abbüßen mussten? War seine Seele dazu verdammt, hier zu verweilen, weil er versagt hatte?
Hastig versuchte er bekannte Gesichter unter den valdorischen Rittern zu erkennen. Doch das war ein aussichtsloses Unterfangen. Die Ordenskrieger waren meist so fürchterlich entstellt, dass Liocas sich immer wieder mit Grausen abwenden musste.
Schwarze Vögel aufscheuchend, stolperte er weiter und fand nach einer Weile die Farben seines Ordens. Zumindest konnte er hier und da die blutgetränkten Überreste der Wappenröcke mit dem Zeichen des doppelköpfigen Löwen erkennen. Von den imponierenden Schlachtreitern war wenig mehr geblieben als eine diffuse Masse aus Fleisch und Metall, zwischen denen Kleidungsfetzen oder eine zerborstene Lanze hervorragten.
So sehr er es auch wollte, es gelang Liocas einfach nicht, den Blick von den Überresten der Kämpfer zu nehmen. Diese Hölle auf Erden konnte nicht das Ergebnis der Grausamkeit der gegnerischen Armee sein. So fanatisch und ungestüm die Reihen der Tequari-Barbaren auch auf die Ritter losgestürmt waren, das konnte einfach nicht das Werk von Menschen sein. Nein, hier hatte eine andere Macht ihren Zorn entladen.
Liocas sank auf die Knie und betete im Stillen zum Wächter aller Kraft für die Seelen seiner gefallenen Ordensbrüder. Während er zu seinem Gott sprach, spürte er, wie die Verzweiflung wich und Stärke in seine Glieder zurückkehrte. Er erhob sich und schaute sich um, um den schnellsten Ausweg aus dem Tal zu finden, das einem Massengrab glich, solange das letzte Licht des Tages noch die Möglichkeit dazu bot. Egal, in welche Richtung er sich wenden würde, wahrscheinlich konnte er diesem Alptraum nicht vor Einbruch der Dunkelheit entfliehen.
In nördlicher Richtung, aus der die Horden der Barbaren herangestürmt waren, schien sich der Totenteppich am weitesten zu erstrecken. Offenbar hatte sich irgendetwas mit unbändiger Gewalt von Süden her über den friedlich dahinströmenden Asakon hinweg durch das Tal bewegt, dabei die Schlachtreihen der Ordenskrieger und danach die gesamte Kriegshorde der Barbaren vernichtet.
War dieses Inferno von seinen eigenen Leuten ausgelöst worden? Waren vielleicht weitere Kameraden dem Tode entronnen?
Liocas versuchte sich zu erinnern, was geschehen war, als die Schlacht losbrach: Die Panzerreiter der Allianz waren in breiter Formation auf die von den nördlichen Hügelkuppen angreifenden Barbaren zugeritten. Er war zusammen mit den Fußsoldaten seines Herrn Lord Volkos hinter ihnen marschiert. Nachdem die Ritter durch die ersten Reihen der Wilden hindurchgestürmt waren, und sich weitere Ströme schreiender Tequari in das Tal ergossen, war er in ein rücksichtsloses Hauen und Stechen in der Mitte der Senke verwickelt worden. Kaum jedoch, dass der Kampf begonnen hatte, war er nach einem Schlag gegen seinen Körper zu Boden gegangen und kurz darauf bewusstlos geworden. Wahrscheinlich hat mich ein Schild oder ein Wurfgeschoss getroffen. Er betastete seinen Kopf, fand aber weder eine Wunde noch eine Beule, die von einem Schlag herrühren konnte. Ihm tat zwar nach wie vor jede einzelne Faser des Körpers weh, eine Verwundung konnte er aber nicht entdecken.
Mein Helm!Der Helm hat mir das Leben gerettet, dachte er und dankte seinem Herrn mit einem weiteren kurzen Gebet.
Jetzt wird es Zeit, dass ich hier wegkomme. Vielleicht treffe ich im Süden auf andere Überlebende, die wissen, was passiert ist.
Er lief ein paar Schritte, doch sein Blick fiel unvermittelt auf einen ausgestreckten Arm, der unter einem Berg Tequari-Leichen hervorlugte. Die Innenseite des muskulösen, aber schlanken Arms war mit den fremdartigen Zeichen versehen, die sich viele Barbaren in die Haut zu stechen pflegten.
Liocas wusste nicht warum, aber er kniete nieder, betrachtete die verschnörkelten und dennoch so archaisch anmutenden Hautbilder, die vom Handgelenk bis zur Ellenbeuge reichten. Behutsam strich er mit der Hand darüber. Vor Schreck zuckte er zurück, als er merkte, dass sich der Arm warm anfühlte.
Urias! Das hier ist keine Leiche!
Vorsichtig tastete er nach einem Puls, und nach einigen Augenblicken spürte er ein schwaches Pochen an den Fingerkuppen. Er schob den Torso eines Barbarenkriegers zur Seite, wodurch seine Kleidung mit Blut getränkt wurde, und wühlte sich keuchend durch weitere Tote und deren Einzelteile. Dann war er endlich bis zu dem Körper vorgedrungen, zu dem der Arm gehörte.
Zum Vorschein kam eine junge Kriegerin. Liocas fühlte ein weiteres Mal nach ihrem Puls und fand ihn an der Halsschlagader, dort etwas kräftiger. Er packte sie erst an den Armen, dann an der lädierten Lederrüstung und zog sie vorsichtig aus dem Haufen heraus. Die Barbarin schien etwa in seinem Alter zu sein und verfügte über die drahtig-muskulöse Statur der Tequari-Frauen, von denen er viele auf dem Schlachtfeld gesehen hatte. Am halben Körper war sie mit Narben und Hautzeichen bedeckt, die ihre Stellung innerhalb ihres Clans verdeutlichten, so viel wusste Liocas von den Gebräuchen der Barbaren. Die junge Frau schien allerdings etwas kleiner zu sein als die anderen Kriegerinnen, wahrscheinlich stammte sie von einem der Clans des Nordens, vermutete der Knappe.
Als er sie bis zu einem freien Stück Wiese gezogen hatte, fiel ihm auf, dass ihr linkes Bein derartig verrenkt war, dass es gebrochen sein musste. Sonst schien die Frau aber bis auf Schürfwunden und Prellungen unverletzt zu sein. Dennoch war sie in tiefer Bewusstlosigkeit gefangen.
»Und was mache ich jetzt mit dir?«, murmelte Liocas in sich hinein und betrachtete den reglosen Körper. Wenn er sie schon unter den Leichen hervorzog, musste er ihr auch weiter helfen, so viel war klar. Aber warum hatte er sie überhaupt hierher geschleift? Sie war eine Feindin! Die Barbaren hassten alles und jeden, der der valdorischen Allianz der Orden angehörte, und umgekehrt war es nicht anders. Wer wusste schon, wie viele unschuldige Mütter und Kinder dieses Tier auf dem Gewissen hatte? Wie viele Höfe und Dörfer hatte sie schon gebrandschatzt? Wie viel Leid hatte sie über sein Volk gebracht?
Doch war es nicht eines der grundlegenden Gebote des Einen, jedem seiner Geschöpfe Barmherzigkeit entgegenzubringen, und wenn es auch der schlimmste Feind sein sollte? Wo die Menschen nicht weiterwussten, ergaben erst seine Gebote Sinn in einer Welt, die sich gegenseitig im Wahn zerfleischte. Und ob Feindin oder nicht, Liocas gestand sich ein, dass er Erleichterung darüber verspürte, dass außer ihm noch jemand überlebt hatte.
Er betrachtete das Gesicht der jungen Frau. Unter Dreck und Blut erkannte er scharf gezeichnete Konturen mit hohen Wangenknochen und schmalem Kinn. Ihr Antlitz besaß eine Anmut, wie er sie nicht erwartet hatte, nicht unter den Barbarenfrauen. Ja, sie war eine Kriegerin des Feindes, aber sie wirkte in diesem Augenblick so zerbrechlich auf ihn wie yamarisches Porzellan. Und wer war der Feind wirklich? Liocas war sich nicht sicher. Immerhin waren sie beide vielleicht die einzigen, die überlebt hatten. Er durfte diesen Fingerzeig des Einen nicht einfach so abtun.
»Jetzt kommt’s drauf an, Liocas von Marmadon! Hier kannst du zeigen, was du von Zatos’ Predigten gelernt hast«, ermutigte er sich und atmete tief durch.
Aber wie sollte er es bewerkstelligen, die Tequa vom Schlachtfeld zu schaffen? Er war ja selbst gerade dazu imstande, sich auf den Beinen zu halten. Und wohin konnte er schon mit ihr gehen? Seine Leute würden die junge Frau sofort hinrichten und ihn als Verräter anschließend ebenso.
»Treibst du nur ein grausames Spiel mit mir, Herr?«, fragte Liocas in das flammende Abendrot hinein. Er atmete ein paar Mal kräftig durch, umfasste die Kriegerin an der Hüfte und schwang sie sich auf die Schulter. Dann begann er langsam das Schlachtfeld in Richtung Westen zu überqueren, direkt auf die untergehende Sonne zu.
»Urias, ich folge deinem Weg. Führe und lenke meine Schritte!«, betete er, in der Hoffnung, dass es ihm Kraft geben würde.
Langsam, vorsichtig einen Schritt vor den anderen setzend, näherte er sich dem Rand des Tals. Bei dem Anblick wurde Liocas bewusst, wie gewaltig die beiden Heere gewesen sein mussten, die hier aufeinandergeprallt waren, bevor sie dem Sturm der Vernichtung zum Opfer fielen. Auf beiden Seiten waren sicherlich Tausende von Kämpfern gefallen. Ein Aufeinandertreffen der beiden verfeindeten Völker in dieser Dimension hatte es wohl seit hunderten von Jahren nicht mehr gegeben. Die Grenzregionen waren zwar auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt, aber angesichts der Masse an Bewaffneten, die beide Seiten dieses Mal aufgeboten hatten, verkamen diese Kämpfe zu bedeutungslosen Scharmützeln.
Soweit Liocas wusste, war die letzte große Schlacht jene gewesen, als das Haus Iramon unter Hochmeister Kopios vor etwa zweieinhalb Jahrzehnten die Grenzgebiete zurückeroberte, die sich über dreihundert Jahre im eisernen Griff der brutalen Tequari-Clansherren befunden hatten. Nach einer Zeit des Friedens waren die Barbaren zurückgekehrt und verheerten die nördlichen Regionen erneut – bis heute. Um genau diesen Terror zu beenden, hatte Großkönig Ghalsar Ennius ein mächtiges Heer der Allianz entsandt, den Feind an der Reichsgrenze zu stellen und in die Weiten des Nordens zurückzutreiben. Die Schlacht am Asakon sollte die Entscheidung über die Herrschaft in den umstrittenen Grenzgebieten herbeiführen.
Stattdessen hatte sie für Tausende den Tod gebracht.
Vorsichtig, um ihr verletztes Bein zu schonen, ließ Liocas die Kriegerin zu Boden sinken und setzte sich neben sie, um zu verschnaufen. Nicht weit entfernt konnte er die Umrisse des Walds ausmachen, der sich über die sanft ansteigenden Hänge im Osten erstreckte. Bis es vollends dunkel war, wollte er dort sein, um im Schutz der Bäume die Nacht zu verbringen – und vor allem wollte er dieses Leichenfeld hinter sich lassen. Jedes Mal, wenn er den Gedanken an das, was ihn hier umgab, zu nah an sein Bewusstsein heranließ, spürte er, wie das Entsetzen wieder in ihm aufstieg und ihn zu übermannen drohte.
Als sein Verstand erneut damit begann, eine Erklärung für das Unfassbare zu suchen, gab er sich einen Ruck, lud den Körper der Barbarin auf die Schultern und erhob sich. Ich muss weiter, ich muss weg von hier!, war das einzige, was er zu denken imstande war, als er sich und die Kriegerin den Hang zum Wald hinaufschleppte. Der Weg und die Schatten zogen sich dahin, und die Strecke, die er normalerweise in kurzer Zeit zurückgelegt hätte, schien kein Ende zu nehmen.
Letztlich vermochte er es dennoch, die Bäume zu erreichen, und humpelte mit letzter Anstrengung einige Schritte in den Wald hinein. Geschützt hinter Buschwerk legte er die Frau ab und ließ sich entkräftet ins Laub fallen.
Obwohl sich seine Beine schwer wie Mühlsteine anfühlten, besann er sich, nicht die Müdigkeit die Oberhand gewinnen zu lassen, sondern stattdessen Holz für ein Feuer zu sammeln. Es dauerte zum Glück nicht lange, bis er aus einigem Astwerk und einem Tropfen Pyromel aus seiner Gürteltasche eine flackernde Flamme geschürt hatte.
An dem auflodernden Feuer wärmte er sich auf. Obwohl es zu dieser Jahreszeit tagsüber angenehm warm war, sank die Temperatur nachts oft rapide ab. Außerdem würde das Feuer die Bewohner des Walds fernhalten, die sich ganz unzweifelhaft in der Nacht auf den Weg zum Schlachtfeld machten, um sich an dem reichen Festmahl zu laben, das sich ihnen dort bot. Wölfe und Bären gab es in den nördlichen Wäldern zuhauf, doch das waren die harmloseren Gefahren, denen sich ein einzelner Mensch hier aussetzte. Liocas wusste aus den Berichten seiner Ordensbrüder, dass sich hier auch Bergpanther, riesige Waldspinnen und sogar Oger herumtrieben. An all die anderen menschenfressenden Ungetüme, von denen ihm die Ammen in der Kindheit in Sagen und Märchengeschichten berichtet hatten, wollte er lieber gar nicht erst denken. Sein Herz begann schneller zu schlagen, als er an den riesigen Schädel des Harpax-Drachen deachte, der in der Agora von Marmadon ausgestellt war. Er betete zu Urias, dass keines dieser Ungetüme mehr in den Grenzlanden lebte, und hoffte, dass ihn die Waldbewohner aufgrund des üppig gedeckten Tischs im Tal einfach ignorierten.
Nicht lange, nachdem er die Barbarin mit einem vom Schlachtfeld entwendeten Umhang zugedeckt hatte, schlief er ein.
Als Liocas erwachte, stand Urias’ gleißende Sphäre hoch über den Baumkronen. Offenbar hatte er die Ruhe bitter nötig gehabt, sein Körper hatte schließlich den Geist und die Angst bezwungen. Immer noch saß ihm allerdings ein heftiger Schmerz in den Gliedern, der sich schon bei der kleinsten Bewegung bemerkbar machte.
Unbeholfen rappelte er sich auf. Er streckte sich und blickte sich um. Für einen Moment ertappte er sich bei dem Gedanken, dass er all die Schrecken nur im Traum erlebt haben könnte, doch seine Hoffnungen wurden im gleichen Moment enttäuscht. Die junge Tequa lag noch immer neben der Feuerstelle und rührte sich genauso wenig wie am Vorabend. Immerhin atmete sie ruhig und gleichmäßig. Anscheinend erholte sich auch ihr Körper allmählich von dem, was ihr auf dem Schlachtfeld widerfahren war.
Liocas lief einige unschlüssige Schritte hin und her, bevor er beschloss, etwas Essbares zu suchen. Sich vom Schlachtfeld zu retten und dann zu verhungern, schien ihm kein erstrebenswertes Ziel zu sein. Mit bloßen Händen würde er hier zwar nichts erlegen können, aber er kannte die ein oder andere Wurzel und Frucht, die genießbar war. Er untersuchte Boden und Sträucher und arbeitete sich in den Wald hinein.
Nach einiger Zeit hatte er Wurzeln, Knollen und sogar Pilze gefunden, von denen er wusste, dass man sie ohne Bedenken verzehren konnte. Da haben die langweiligen Lehrstunden bei Bruder Adamos doch noch etwas genutzt, dachte er zufrieden, als er zum Lagerplatz zurückkehrte.
Überrascht blieb er am Rand der Lichtung stehen. Neben der Asche des Feuers hatte sich die Barbarenkriegerin aufgerichtet und betastete mit schmerzverzerrtem Gesicht ihr gebrochenes Bein. Kurz darauf merkte sie, dass sie beobachtet wurde und blickte auf.
Liocas zuckte zusammen, als ihn der Blick zweier eisblauer Augen traf und so durchdringend musterte, dass es ihm kalt den Rücken herunterlief. Er war so verblüfft darüber, dass er einfach nur dastand und sie mit offenem Mund anstarrte.
»Was glotzt du so?«, fragte sie ihn in seiner Sprache. »Überrascht, dass dein Opfer wach ist? Denk ja nicht, dass ich es dir einfach mache, Valdorer!« Sie stieß sich auf ihrem unversehrten Gliedmaß ab und setzte das Knie des gebrochenen Beins auf den Waldboden. Nur ein Zucken um ihre Mundwinkel verriet, dass sie dabei Schmerzen peinigten. Sie warf die verfilzten Zöpfe in den Nacken und blickte ihn herausfordernd an. »Komm schon her, Bastard, und versuch dir zu holen, was du haben willst!«
Liocas schüttelte die Verblüffung ab. Sofort fiel ihm wieder auf, was er schon am Vortag bemerkt hatte. Die junge Frau wirkte nicht wie andere Tequari-Kriegerinnen. Sie war wesentlich schlanker - und dann diese unheimlichen blauen Augen! Sie musste tatsächlich von einem der Clans aus dem Eis des Nordens stammen, dessen war er sich nun sicher. Sie flucht aber genauso wie alle von ihnen. Er machte eine beschwichtigende Geste. »Nein, du verstehst nicht. Ich will dir nichts antun.«
»Natürlich nicht! Erzähl mir doch einfach, dass es mir gefallen wird, und ich es schnell über mich ergehen lassen soll. Wie vielen Männern und Frauen hast du das schon erzählt, ker'kach?«
Liocas seufzte und machte einen Schritt auf sie zu. »Es tut mir leid, wenn ich dir Angst eingejagt habe, aber …«
»Angst? Angst hat eine valdorische Hure, wenn sie darauf wartet, von euch geilen Böcken bestiegen zu werden.« Sie spuckte verächtlich aus. »Eine Tequa kennt keine Angst, schon gar nicht vor ihren Feinden!«
»Ich möchte dir nichts dergleichen antun, noch hab ich sowas jemals getan, weder mit …«
Wieder wurde er unterbrochen. »Du bist ein Lügner wie alle Feiglinge der Orden. Schau dich doch an! Von wem stammt denn das Blut an deiner Kleidung? Ergoss es sich aus dem Schoß einer bewusstlosen Kriegerin, oder hast du sie wenigstens im Kampf getötet?«
Liocas blickte an sich herab. An seinem Waffenrock klebte tatsächlich eine ganze Menge Blut. »Nein, das war ganz anders. Ich …«
»Wenn ich mit dir fertig bin, wird dein Blut den Waldboden tränken!« Sie riss einen Dolch unter ihrer Rüstung hervor.
Ich hätte sie nach Waffen durchsuchen sollen!, schoss es Liocas durch den Kopf. Er verlor allmählich die Geduld. »Hör mir jetzt zu!«, rief er zornig. »Ich habe niemanden getötet. Im Gegenteil … ich habe dir sogar das Leben gerettet. Einer Tequa! Einer Feindin der Allianz! Ich wusste gleich, dass das keine gute Idee ist.«
»Das soll ich dir glauben? Rimmon wird dir die Lügen in die ehrlose Fratze stopfen und dich und dein Volk auslöschen!« Die Barbarin sprang vor und stach mit dem Dolch nach dem Knappen. Durch ihre Verletzung war sie jedoch viel zu langsam, so dass Liocas ohne Mühe ausweichen konnte.
Doch sie ließ sich nicht davon beirren, drehte noch in der Bewegung um und schwang die Klinge in einem Rückhandschlag aufwärts.
Wäre sie im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten gewesen, hätte dieser überraschende Hieb Liocas wohl die Seite aufgeschlitzt, doch so konnte er zurückspringen und aus ihrer Reichweite gelangen. Er griff nach einem dicken Ast aus seinem Feuerholzstapel und hob ihn zur Gegenwehr.
»Das hat doch keinen Sinn! Leg den Dolch weg, und ich erkläre dir alles«, beschwor er sie, obwohl er nicht damit rechnete, dass sie darauf einging.
Schon sprang die Barbarin wieder vor, um mit der Dolchspitze seinen Unterleib zu treffen. Sie setzte das verletzte Bein auf und knickte ein, bevor sie ihn erreichte. Mit einem Schlag zwischen die Schulterblätter streckte Liocas sie nieder. Benommen und unfähig zu weiteren Bewegungen blieb sie vor ihm liegen.
Der Knappe unterdrückte den kurz aufwallenden Drang, ihr noch einen Tritt zu versetzen, als Vergeltung für die Beleidigungen, die sie ihm an den Kopf geworfen hatte. Er beherrschte sich allerdings, als er erkannte, dass sie wehrlos war. Also trat er ihr mit dem Fuß lediglich den Dolch aus den kraftlosen Fingern. Dann suchte er die Kräuter und Wurzeln wieder zusammen, die er zwischenzeitlich verloren hatte, und setzte sich an die kalte Feuerstelle.
»Wenn du dich beruhigt hast, kannst du gern was zu essen haben«, sagte er beiläufig zu ihr, während er damit begann, auf einer zähen Knolle herumzukauen. Sie schmeckte scheußlich, doch Liocas wusste von den zatosianischen Mönchen, bei denen er einst gelebt hatte, dass sie äußerst nahrhaft waren. Sie nannten die festen Knollen Lafken. Angeblich waren sie mit den Wildkartoffeln verwandt, die man in den südlichen Wäldern finden konnte.
Der Knappe kaute eine Weile vor sich hin und sah dann zu der Tequa hinüber, die sich kaum gerührt hatte. Trotzdem schien sie zu merken, dass er in ihre Richtung blickte.
Wieder trafen ihn die Augen wie ein Speer aus Eis, der sich in seinen Kopf bohren wollte.
»Überlegst du, ob du mich nach dem Essen von vorn oder hinten nehmen willst, du widerliche Ratte?«, presste sie keuchend hervor.
Liocas schüttelte den Kopf. Sie schien nicht von dem Gedanken abzubringen zu sein, dass er sie hierher geschafft hatte, um sie zu schänden. »Glaubst du mir immer noch nicht, dass ich dir nichts tun will? Denkst du wirklich, ich habe dich den ganzen Weg in den Wald geschleppt, bloß um mich mit deinem hilflosen Körper zu vergnügen? Dann musst du tatsächlich noch dümmer sein, als ich es von euch verdammten Barbaren gedacht habe.«
Die Kriegerin stemmte sich langsam hoch, bis es ihr gelang, sich hinzusetzen. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Ihr Gesicht war immer noch von unverhohlenem Hass erfüllt, als sie sprach. »Arroganter Hurensohn! Du nennst uns Barbaren, aber sitzt mir mit dem Blut wehrloser Frauen besudelt gegenüber und machst Witze.«
Liocas blickte seufzend in die Baumwipfel. »Urias, deine Prüfung für mich ist größer, als ich vermutet habe!«
»Weil sich dein Opfer wehrt? Weil sich der Krüppel nicht einfach ficken lässt?«
»Nein, weil das Barbarenweib nicht erkennen will, dass es kein Opfer ist«, erwiderte Liocas und schaute die Tequa ernst an. »Wenn du Opfer sehen willst, wirf einen Blick auf das Schlachtfeld, da gibt es genug davon«, fügte er mit Bitterkeit in der Stimme hinzu. Sein Finger stach wie eine Lanzenspitze in Richtung des Tals. Bei dem Gedanken an das Massaker verspannte sich sein Körper.
»Um mir die geschändeten Leichen meiner Clansbrüder und -schwestern anzuschauen? Nein, den Gefallen tu ich dir nicht, Valdorer. Wahrscheinlich laufe ich direkt deinen feigen Freunden in die Arme, die gerade dabei sind, die Leichen zu plündern … oder sich an ihnen zu vergehen.« Sie machte eine obszöne Geste. »Sie tun besser daran, sich mit totem Fleisch zu vergnügen, denn eine lebende Tequa würde ihnen die Schwänze abreißen.«
Die Barbarin sah sich um und griff nach dem Ast, mit dem Liocas sie niedergeschlagen hatte. Er erschien ihr stabil genug, um sich damit abzustützen. Der Knappe sah ihr wachsam zu, denn er rechnete mit einem weiteren Angriff. Doch sie griff lediglich den Ast, stemmte sich daran hoch und humpelte einige Schritte von ihm fort.
»Was hast du vor? Mit dem Bein kommst du nicht weit«, rief er ihr nach.
Sie hielt inne und sah ihn scharf an. »Das ist nicht dein Problem, Valdorer. Ich kehre zu meinen Brüdern und Schwestern zurück. Aber schon bald komme ich wieder, das schwör ich dir! Und nur weil du zu feige warst, eine wehrlose Tequa zu besteigen und zu töten, bezahlst du es eines Tages mit dem Leben – genau dann, wenn ich dir meine Klinge in den Bauch ramme!« Sie bleckte angriffslustig die Zähne, warf den Kopf herum und humpelte weiter.
Liocas war verblüfft von so viel engstirnigem Hass. »Du wirst keine zwei Meilen weit kommen, bevor dich die Wölfe entdecken und zerreißen.«
Ein letztes Mal blickte sie zornig zurück. »Wag es ja nicht, mir zu folgen, sonst nimmt es schon heute ein blutiges Ende mit dir!«
Dann verschwand sie am Waldrand.
Kapitel 2
Schritt für Schritt kämpfte sie sich voran, immer dem Bach folgend, dessen schnell fließende Wasser zum Tal des Asakon hinabplätscherten. Mit der Linken stützte sie sich auf den Ast, der dem gebrochenen Bein wenigstens so viel Halt gab, dass sie sich überhaupt bewegen konnte. Die Schmerzen waren kaum zu ertragen, und die junge Kriegerin ertappte sich immer wieder dabei, wie sie Tränen aus dem Gesicht wischte, die ihr Körper in einem hilflosen Aufschrei aus ihr herauspresste.
Wenigstens bekommt niemand diese Schande mit! Sie konnte das hämische Lachen ihrer Rivalen regelrecht in ihrem Kopf hören. Ihre Schadenfreude würden sie ihr ins Gesicht spucken, wenn sie die verletzte Tequa den Berg hinunterhumpeln sehen könnten, auf der Flucht vor einem lächerlichen Knappen der Allianz.
Die Kriegerin hatte nicht erwartet, dass das valdorische Muttersöhnchen so schnell aufgab. Deshalb war sie noch eine ganze Weile darauf gefasst gewesen, dass er sie von hinten anfiel und ihr die Kleidung vom Leib riss. Wieder und wieder hatte sie vor ihrem geistigen Auge durchgespielt, wie sie ihn tötete, wenn es dazu gekommen wäre. Sie war sich sicher, dass ihr in dem geschwächten Zustand nur eine einzige Gelegenheit dazu blieb, bevor er sie überwältigt hätte.
Doch wider Erwarten war er nicht plötzlich mit erhobenem Schwert oder entblößtem Gemächt hinter ihr aufgetaucht, und so hatte sie sich immer weiter von ihm entfernt, bis sie ihn schließlich zwischen den Bäumen zurückgelassen hatte.
Hast dich wahrscheinlich eingeschissen vor Angst. Umso besser, dann kann ich es wenigstens genießen, wenn ich dir einst die Klinge in die Eingeweide ramme, dachte die Tequa und rang sich ein gequältes Lächeln ab.
Langsam kam sie bis zum Rand des Nadelwaldes. Unten im Tal hoffte sie, sich orientieren zu können, um dann den Weg gen Norden einzuschlagen. Dort würde sie früher oder später auf Späher ihres Volks treffen. Das hoffte sie jedenfalls.
Zwischen den letzten Bäumen schlug ihr der Geruch verwesenden Fleisches entgegen. Ein leichter Wind trug den Gestank des Schlachtfelds empor, so als wolle er die Bewohner der Wälder ringsherum darauf aufmerksam machen, was unten am Asakon passiert war. Der entkräfteten Kriegerin wurde speiübel. Sie zwang sich dazu, dem nicht nachzugeben und kämpfte den Würgereflex nieder.
Nicht auch noch das! Du hast in deinem Leben schon unzählige Leichen gesehen und wirst dich nicht vom Gestank verfaulender Valdorer beeindrucken lassen.
Unbeirrt humpelte sie weiter auf die Baumgrenze zu.
Und wenn es auch tausend Leichen sind, auch das wird mich nicht brechen. Ich bin Moriana von den Tequari, Führerin des stärksten Katu von Clansherr Kal Athrod. In mir brennt das Feuer der Ahnen. Ich werde sie nicht durch Schwäche entehren!
Sie stolperte aus dem Wald heraus in die offene Landschaft des Tals. Keine zwei Dutzend Fuß weiter begann das Grauen, aus dem der valdorische Knappe sie am Vortag gerettet haben musste. Berge toter Leiber erstreckten sich, so weit sie sehen konnte.
Die Kriegerin hatte mit vielem gerechnet, aber das war schlimmer als alles, was sie jemals erblickt hatte, ja sogar schrecklicher als all jenes, was ihr in den grässlichsten Alpträumen begegnet war oder was sie sich hätte vorstellen können.
Die Körper der getöteten Krieger und Ritter waren auf das Widerwärtigste entstellt und verstümmelt worden. Manche schienen regelrecht von innen nach außen umgedreht worden zu sein. Feucht-glänzende Haufen aus Innereien wechselten sich mit Tümpeln aus Blut ab, über denen Fliegenschwärme zwischen abgerissenen Metallteilen von Waffen und Rüstungsüberresten kreisten. Mitten in der infernalischen Szenerie hüpften massenweise Aasfresser umher. Krähen, die sich die Filetstücke menschlicher Körper herauspickten und hie und da um Leberbrocken oder Augäpfel stritten. Wölfe, deren Rivalitäten vor dem reich gedeckten Tisch vergessen schienen, eine Unzahl an anderen kleinen Tieren, die aus den umliegenden Wäldern herbeigeeilt waren, um an dem Festmahl teilzuhaben. Der Aasgeruch war stark genug, dass sogar einige Möwen, die von den Seen im Norden kommen mussten, lauthals ihre Ansprüche geltend machten.
Wie angewurzelt blieb die Kriegerin am Waldrand stehen und starrte auf das Leichenfeld, unfähig zu irgendeiner Reaktion. Minutenlang verharrte sie so, dann verließ sie die Kraft, die sie vorher noch vorangetrieben hatte.
Der Ast, den sie als Krücke umklammert hielt, entglitt ihrer Hand und fiel zur Seite. Sie ging in die Knie und brach dann ganz zusammen. Alles in ihr verkrampfte, und sie übergab sich. Als sie wieder durchatmen konnte, begann sie zu schreien, voller Verzweiflung und Entsetzen, sich immer stärker in einer ausweglosen Agonie windend. Nach einer gefühlten Ewigkeit ergab sich ihr Körper und erlöste sie mit einer wohligen Ohnmacht von den Qualen.
Die beiden Kämpfer umkreisten sich und ließen sich nicht aus den Augen.
Auf der einen Seite stand ein fast sechs Fuß großer Krieger mit beeindruckenden Muskelpaketen. Er war am ganzen Körper mit Hautbildern versehen, dazwischen verliefen hässliche Narben. Schmutzige Haare hingen ihm ins Gesicht und verdeckten die aufgeplatzte Augenbraue, die er sich vor wenigen Augenblicken zugezogen hatte. Hasserfüllt taxierte er seine Gegnerin.
Von der anderen Seite des Kreises belauerte ihn eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, deren Füße ständig in Bewegung waren, um ihrem Gegner keinen Hinweis auf den nächsten Angriff zu geben. Ihre Augen suchten nach der Lücke in seiner Deckung. Die Kriegerin war gut zwei Köpfe kleiner als der Mann, aber für alle Zuschauer, die sich um den Kampfkreis eingefunden hatten, war zu erkennen, dass sie die fehlende Größe mit ihrer Schnelligkeit mehr als wettmachen konnte.
Lauernd verhielt sie in ihrer Bewegung, fixierte den Gegner kurz mit eisblauen Augen und sprang dann wie ein Bergpanther vor.
Sein Konter kam viel zu spät und ging ins Leere. Augenblicklich durchbrach sie seine Deckung. Mit einer Kraft, die man ihr kaum zugetraut hätte, rammte sie ihm die Faust ins Gesicht. Krachend splitterten Knochen und blutspritzend verformte sich seine Nase unter dem Schlag.
Der Krieger schrie auf und versuchte seine Peinigerin zu packen, doch die war schon wieder auf die andere Seite des Kreises zurückgewichen.
»Denkst du, das reicht?«, rief er wütend. »Da muss schon mehr kommen, um mich fertigzumachen, Moriana.« Er versuchte, das unablässig aus seiner zerstörten Nase strömende Blut aus dem Gesicht zu wischen. »Da muss schon mehr kommen, um dein dreckiges kleines Leben zu retten!«
»Für dich wird es reichen, alter Mann«, flüsterte die Angesprochene und spuckte aus. Eine Geste, die gegenüber dem Führer eines Katu einem Todesurteil gleichkam, besonders, wenn es gegenüber dem grausamen Madrak geschah.
Schnaubend warf sich der Herausgeforderte auf sie, um sie mit seiner Masse zu Boden zu werfen. Doch wieder war sie schneller und wich ihm aus. Nach einem Tritt in die Rippen verabschiedete sie sich auf die andere Seite des Kreises.
»Ich reiß dich in Stücke, Frischling!«, tobte Madrak.
Moriana konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ihre Taktik ging auf. Sie wollte Madrak mit Beleidigungen und Nadelstichen so lange provozieren, bis er unkontrolliert um sich schlug. Erst dann war sie in der Lage, den Kampf endgültig zu ihren Gunsten zu entscheiden, denn an reiner Kraft konnte sie es nicht mit dem Krieger aufnehmen. Sie wusste, dass durch blinde Wut selten ein Sieg errungen werden konnte.
Mit der Hand vollführte sie eine Geste vor ihrer Hüfte, mit der sie sein Geschlechtsteil verhöhnte.
Schreiend rannte Madrak auf sie zu, in seinen Augen stand pure Mordlust geschrieben.
Nun hatte sie ihn soweit! Wieder tauchte sie unter ihm weg, doch diesmal ging ihr Plan nicht auf. Mit dem linken Fuß rutschte sie auf dem sandigen Boden aus und gelangte nicht schnell genug aus seiner Reichweite.
Sie fing sich einen Schwinger mit dem Unterarm ein, der sie umwarf. Sofort war Madrak über ihr und riss sie wieder hoch. Mit einer Hand hielt er sie in eisernem Griff gefangen, während er ihr die Faust der anderen in die Seite rammte. Moriana ächzte vor Schmerzen. Wieder schlug er zu, wieder und wieder. Ihr blieb die Luft weg, und ihre Versuche, den riesigen Krieger mit eigenen Schlägen zu treffen, wurden zunehmend kraftloser.
Dann warf er sie in die Mitte des Kreises, wo sie keuchend auf dem Bauch liegen blieb, unfähig, sich zu rühren. Ihr Körper verkrampfte, sie erbrach sich, und ein Schwall Blut schoss aus ihrem Mund. Hustend wand sie sich vor ihrem Gegner.
»Dreckiger kleiner Frischling! Jetzt wirst du sterben!« Madraks Stimme näherte sich ihr langsam von hinten. Offensichtlich genoss er es, sie so hilflos daliegen zu sehen.
Aufstehen, Moriana, du musst aufstehen!
Wenn sie nicht rechtzeitig auf den Beinen war, würde Madrak ihr einfach mit einem gewaltigen Tritt das Rückgrat brechen.
Verzweifelt versuchte sie sich hochzustemmen, doch ihr gesamter Brustkorb schrie vor Schmerzen. Er musste ihr ein Dutzend Rippen zertrümmert haben, ein Wunder, dass sie überhaupt noch atmete. Beim Versuch sich aufzurichten, knickten ihr die Beine weg.
Sie stürzte nach vorne und schlug mit dem Kopf auf den Boden.
Madraks brummendes Lachen hinter ihr verriet, dass er fast heran war.
»Aufstehen, Moriana!«, keuchte sie.
Irgendwann kehrte sie in die Wirklichkeit zurück. Mit einem Ruck stemmte sie den Oberkörper hoch. Krähen sprangen erschrocken von ihr zurück und beäugten sie misstrauisch aus einigen Schritten Entfernung.
Es war höchste Zeit, dass Moriana wieder zu Bewusstsein kam. Einer der Vögel hatte sie doch tatsächlich angepickt und ihr eine kleine Wunde an der Wade zugefügt.
Die Hände Bor-Taks!, schoss es ihr durch den Kopf, als sie die Aasfresser erblickte. Er ruft mich zu sich, um an seine Seite zu treten! Nein, es ist noch nicht an der Zeit! Diesen Gefallen würde sie dem Herrn der Schlachtfelder nicht tun – noch nicht.
»Verdammtes Pack!«, schimpfte sie und drohte den Vögeln mit ihrer Krücke, nach der sie eilig gegriffen hatte.
Die Krähen beschlossen, sich nicht weiter mit dem doch nicht toten Körper der Tequa zu beschäftigen und flatterten hinüber zu den Fleischbergen der Schlachtfeldopfer.
Moriana richtete sich auf und humpelte weiter. Sie versuchte das Grauen, das sich nur wenige Fuß neben ihr quer über das Tal erstreckte, zu ignorieren. Die Sonne stand hoch am Himmel. Sie konnte also nicht allzu lange bewusstlos gewesen sein, vielleicht zwei Stunden.
Im Traum hatte sie den Kampf gegen Madrak, den einstigen Anführer ihres Katu, ihrer Kriegerschar, noch einmal erlebt, genauso wie damals, als sie tatsächlich im Kreis der Drei gestanden hatte. Sie wusste nicht, wie oft sie sich ihm bereits in ihren Träumen gestellt hatte, aber nach jedem Mal fühlte sie sich, als wäre es gerade eben gewesen. Im Kreis der Drei gab es nur zwei Kontrahenten sowie Bor-Tak, der allein über Sieg und Niederlage entschied. Letztlich hatte sie den älteren Krieger zwar töten können, aber zuvor hatte sie die schlimmsten Prügel ihres Lebens bezogen. Schon die Erinnerung daran bereitete ihr Schmerzen. Prüfend befühlte sie ihre Rippen, doch es war alles in Ordnung.
Natürlich ist alles in Ordnung, du hast geträumt.
Madrak hatte ihr damals fast den Brustkorb zertrümmert, und nur die magischen Kräfte eines Druiden hatten die Knochen wieder zusammenfügen können und ihr Leben gerettet. So war sie zur jüngsten Führerin eines Katu seit vielen Generationen geworden und hatte ihre Kämpfer mit den anderen Clans in die Schlacht gegen die Valdorer geführt – in die größte Katastrophe, die die Tequari jemals erlebt hatten. Zumindest wusste sie von keinem vergleichbaren Desaster.
Ihr Volk lebte für den Kampf, führte Kriege, vernichtete Feinde, aber hatte auch herbe Niederlagen und Demütigungen einstecken müssen. Über allem hatte immer der Kampf gegen die verhassten Ritter der valdorischen Allianz im Süden gestanden. Kaum ein Jahr verging, in dem es zu keiner Schlacht oder zumindest einem größeren Scharmützel kam. Vernichteten die Orden ein Katu, brannten daraufhin drei valdorische Dörfer. Nahmen die Feinde einen Clansherrn gefangen, töteten die Tequari ein Dutzend ihrer korrupten Priester. Es war ein Spiel, dessen Regeln aus unnachgiebiger Rache und fortdauernder Vergeltung bestand. Niemand innerhalb der Clans vermochte mehr zu sagen, wie all das einst seinen Anfang genommen hatte.
Moriana hinkte am Waldrand entlang, dachte nach und versuchte den pochenden Schmerz in ihrem Bein so gut es ging als vorübergehende Bürde zu akzeptieren. In mehreren Meilen Entfernung konnte sie den nördlichen Ausgang des Tals erkennen, von wo aus man zurück zu Kandarus’ Kuppen gelangen konnte. Spätestens dort würde sie auf Kundschafter ihres Volks treffen, die ihr helfen und sie versorgen konnten. Vielleicht hatten es weitere Überlebende geschafft, auf sicheres Gebiet zurückzukehren, im besten Fall der Clansherr selbst. Kal Athrod war der größte Krieger, den die Clans der südlichen Ebenen seit Hunderten von Zyklen gesehen hatten. Zum ersten Mal seit den Zeiten des legendären Herrschers Argan war es einem Anführer gelungen, alle Katui des Südens zu vereinen und gemeinsam gegen die Orden vorzugehen. Mehr als fünftausend Männer und Frauen waren seinem Ruf gefolgt, darunter die berühmten Reiter von Makeera, die seit Generationen nicht mehr gegen die Valdorer in den Kampf gezogen waren. Mit ihnen an der Seite bestand zum ersten Mal die Möglichkeit, die anscheinend unüberwindbaren Panzerreiter der Allianz zurückzuschlagen.
Und nun war dieses stolze Heer vernichtet. Hingemetzelt von einer Armee der Valdorer, die in ihrem Kampfrausch nicht einmal Halt davor gemacht hatte, die bereits toten Körper der Tequari in Stücke zu hacken. Und die lebenden Überreste hatten sie ihrem Nachwuchs überlassen, um ihren Spaß mit ihnen zu haben, anstatt ihnen den Weg in die Hallen Bor-Taks zu ermöglichen, wie es Kriegern der Tequari zustand.
Die Tequa wusste nicht, ob sie entsetzt oder wütend sein sollte angesichts der furchtbarsten Grausamkeit, der sie jemals begegnet war. All das, was ihre Lehrmeister jemals von den Valdorern berichtet hatten, entsprach der Wahrheit. Sie waren die Ausgeburt der Schattenhallen, Dämonen in Menschengestalt, die einzig zum Zweck auf der Welt wandelten, um das Leben anderer auszulöschen. Was blieb einem Tequari anderes übrig, als gegen solche Bosheit mit allem zu kämpfen, was ihm zur Verfügung stand? Würde er es unterlassen, bestünde das Land der Clans bald nur noch aus Leichenhaufen wie diesem.
»So weit wird es niemals kommen«, murmelte Moriana grimmig. Sie ballte die Faust. Was auch immer sie getan haben, sie sind nicht stark genug, dich zu brechen! Immerhin hatte eine Tequa das Massaker überlebt und würde das Wissen um das Erlebte zu ihrem Volk tragen, um dessen Willen zu stärken, dem Bösen im Süden immer wieder die Stirn zu bieten.
Der oberste Clansherr selbst musste sie anhören. Er würde alles erfahren und ihr die Unterstützung geben, um neue Kämpfer zu sammeln und blutige Rache an den Orden zu nehmen.
Die Lande der Valdorer sollen brennen!
Möglicherweise war dieses Desaster ja zu ihrer persönlichen Bewährungsprobe geworden. Bor-Tak, der göttliche Kriegsherr, hatte sie auserwählt, Rache an ihren Feinden zu nehmen, vielleicht sogar als Anführerin dieses Feldzugs. Sie musste es nur schaffen, dieses verfluchte Tal lebend zu verlassen.
Trotz ihrer nicht gerade angenehmen Situation überkam Moriana ein berauschendes Gefühl, je länger sie darüber nachdachte. Es verwandelte sich allerdings mit zunehmender Dauer, die sie neben dem Leichenfeld daherhinkte, in Resignation. Statt sie zur Heerführerin zu machen, könnte der oberste Clansherr Argan sie auch hinrichten lassen, stellvertretend für das Versagen der Katui im Kampf gegen die Valdorer. Dem alten Tyrann, der bereits mehr als dreißig Zyklen in der tequarischen Hauptstadt Oròm herrschte, würde kaum etwas gelegener kommen, als eine junge Kriegerin, die er für die Katastrophe verantwortlich machen konnte. Er wartete doch nur auf den richtigen Augenblick, in dem er seinen Widersachern deren Versagen vorhalten konnte. Der fehlgeschlagene Angriff auf die valdorischen Orden war genau der richtige Anlass dazu.
Moriana hielt inne und verschnaufte. Kaum, dass ihre Euphorie geschwunden war, machte sich ihr Bein wieder bemerkbar. Sie hatte sich mittlerweile wohl eine Meile durch das Tal geschleppt und die Schmerzen während des Nachdenkens kaum mehr wahrgenommen. Dafür kehrten sie jetzt mit beißender Kraft in ihr Bewusstsein zurück. Sie lehnte sich an einen Felsen und nahm die Belastung von der gebrochenen Gliedmaße.
Plötzlich bewegte sich etwas im Unterholz nicht weit von ihr entfernt. Ein Wolf brach aus dem Dickicht hervor und rannte auf das freie Stück zwischen Wald und Schlachtfeld, wo er innehielt. Er wandte den Kopf in Morianas Richtung und legte ihn schräg. Kurz darauf sprangen weitere Graupelze aus dem Wald und gruppierten sich um den Anführer. Sieben gelbe Augenpaare musterten die Tequa, als wollten sie herausfinden, was für ein Häufchen Elend sich am Rand der Wüste aus Tod und Verderben entlangschleppte.
Moriana fuhr es eiskalt den Rücken herunter. Sie bemerkte, wie die Leitwölfin sie von oben bis unten musterte. Prüfte sie, ob sie eine lohnende Beute darstellte? Es war ein großes schönes Tier mit schwarz-weißem Fell, das viel dicker war als bei den hiesigen Wölfen. Das Rudel musste aus dem Norden stammen und den Geruch von Blut und Verwesung über viele Meilen wahrgenommen haben. Die Leitwölfin hatte es zielstrebig zu dem Ort geführt, der es wochenlang ernähren konnte.
Nervös fixierte Moriana das Tier. Nein, schwarze Schwester! Führ dein Rudel zu dem Festmahl, das vor dir liegt, und lass mich meiner Wege ziehen. Sie hoffte, ihre Gedanken könnten zu der Wölfin durchdringen und richtete sich auf, um ihr zu zeigen, dass sie sich ihrer Haut erwehren konnte.
Die Wölfin beäugte sie weiter, und Moriana fühlte fast so etwas wie Verstehen. Nach einem Moment wandte sie den Blick ab und bedeutete dem Rudel, ihr auf die Walstatt zu folgen. Die restlichen Tiere umrundeten die Kriegerin mit misstrauischen Blicken und liefen ins Tal, so dass Moriana sie bald nicht mehr sehen konnte.
Sie seufzte und machte sich erleichtert wieder auf den Weg. Nachdem sie das Massaker überlebt hatte, hätte sie sich kaum etwas Unehrenhafteres vorstellen können, als von einem Rudel Wölfe zerrissen zu werden. Mit einem Stoßgebet dankte sie M'Shká, der Lebensspenderin.
Doch sie war erst wenige Fuß weit gekommen, da raschelte es erneut im Gezweig, diesmal noch näher. Zweige brachen, stoben durch die Gegend, dann brach ein fleckig bepelztes Tier durch das Gehölz. Es hatte sie anscheinend schon aus dem Wald heraus beobachtet und stürmte mit großen Sätzen auf sie zu.
Bor-Tak steh mir bei! Ein Téragk!, schoss es Moriana durch den Kopf, als sie den massigen Körper auf sich zukommen sah. Diese ungestümen Räuber waren in den Wäldern häufig anzutreffen und stellten für jedes Lebewesen eine Bedrohung dar, da sie alles und jeden als Beute betrachteten. Speichel tropfte dem Tier aus dem Maul, als es die Zähne fletschte und Moriana anbrüllte.
Schnell zog sie ihren Dolch hervor und versuchte eine Abwehrhaltung einzunehmen.
Das fast bärengroße Raubtier scherte sich nicht darum und schien sie einfach umrennen zu wollen. Mit voller Wucht prallte es auf sie. Die Kriegerin versuchte auszuweichen, vermochte mit dem verletzten Bein aber nicht einmal, sich überhaupt vom Fleck zu bewegen. Sie wurde herumgeschleudert und landete unsanft auf dem Boden.
Verzweifelt versuchte sie wieder aufzustehen, denn war das schwere Vieh erst einmal über ihr, war es zu spät für jede Gegenwehr.
»Nein! Nein, nicht so!«
Mit einem Schrei stemmte sie sich in die Höhe und vollführte mit einer akrobatischen Bewegung einen Satz auf das gesunde Bein, das jetzt alleine ihren Körper zu tragen hatte.
Der Téragk war weitergestürmt, hatte sich aber mittlerweile umgedreht. Falls er überrascht war, dass seine Beute nicht auf dem Boden lag, ließ er es sich nicht anmerken. Unbeirrt rannte er erneut auf sie zu, um das Gleiche noch einmal zu versuchen.
Moriana wusste zwar, was er vorhatte, doch erneut schaffte sie es nicht, dem Angriff auszuweichen. Das Pelztier rammte ihr Standbein, so dass sie einfach umgeworfen wurde und mit der Schulter aufschlug. Immerhin gelang es ihr, den Dolch in der Hand zu behalten.
Dieses Mal war das Raubtier schneller. Sofort setzte es nach und gab der Tequa keine weitere Gelegenheit aufzustehen. Mit einem Sprung versuchte es auf ihren Körper zu gelangen. Moriana rollte sich geistesgegenwärtig zur Seite, so dass es im Leeren landete.
Der Téragk riss den Kopf herum und schnappte wütend nach ihrem verletzten Bein. Die Kriegerin entging dem Angriff mit einer reflexartigen Drehung, doch das reichte nicht aus. Die Kiefer des Tiers schlugen krachend aufeinander und zerrissen Haut und Fleisch knapp oberhalb des Knies. Sie schrie auf, ein Blitz aus Schmerzen durchzuckte ihren Körper. Gequält schlug sie um sich, um die Pein ertragen zu können.
Da spürte sie, dass ihre Hand etwas Festes zu fassen bekam. Verzweifelt zog sie daran. Halb verwundert, halb glücklich, dass es nachgab, schwang sie den Gegenstand mit der verbliebenen Kraft gegen den Angreifer. Der schwere Ast, der ihr bis hierhin als Krücke gedient hatte, traf den Téragk am Kopf. Das Tier jaulte schmerzerfüllt auf.
Morianas kampfgestählte Reflexe und ihr Überlebenswille reagierten prompt. Mit dem gesunden Bein versetzte sie dem Téragk einen Tritt, der genau die Nase traf.