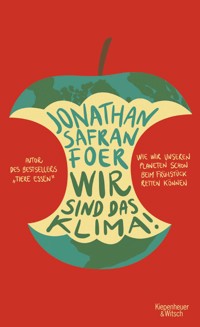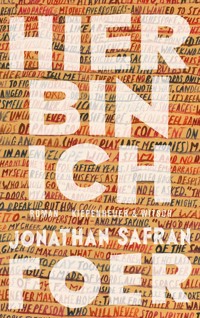
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein aufrüttelndes Meisterwerk über Identität, Familie und den Wunsch nach Zugehörigkeit in einer zunehmend komplexen Welt. In Hier bin ich enthüllt Jonathan Safran Foer die essenzielle Suche nach dem eigenen Platz. Wie können wir gleichzeitig Sohn, Vater, Ehemann, Mutter, Ehefrau, Geliebte, Erwachsener und Kind sein? Oder gar Amerikaner und Jude? Wie können wir wir selbst sein, wenn unser Leben so eng mit allen anderen verbunden ist? Der Roman erzählt von vier turbulenten Wochen im Leben einer Familie in tiefer Krise. Julia und Jacob haben sich auseinandergelebt, doch eine Trennung scheint unmöglich, ohne dass ihre drei Söhne darunter leiden. Gerade als die israelische Verwandtschaft zur Bar Mitzwa des ältesten Sohns eintrifft, ereignet sich ein katastrophales Erdbeben im Nahen Osten, das die Invasion Israels zur Folge hat. Die Fragen »Was ist Heimat?« und »Was bedeutet Zuhause?« stellen sich noch einmal ganz neu. Ein sprachgewaltiges Familiendrama und ein literarisches Meisterwerk über Verlust, Identität und die Suche nach dem eigenen Platz in einer immer komplexeren Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jonathan Safran Foer
Hier bin ich
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jonathan Safran Foer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jonathan Safran Foer
Jonathan Safran Foer, geboren 1977, studierte in Princeton Philosophie. Er gehört zu den profiliertesten amerikanischen Autoren der Gegenwart. Seine beiden Romane »Alles ist erleuchtet« und »Extrem laut und unglaublich nah« wurden mehrfach ausgezeichnet und in 36 Sprachen übersetzt. Er lebt in Brooklyn, New York.
Henning Ahrens, geb. 1964 in Peine, studierte Anglistik, mittlere und neuere Geschichte sowie Kunstgeschichte in Göttingen, London und Kiel. Er veröffentlichte zuletzt den Roman 'Glantz und Gloria' und den Lyrikband 'Kein Schlaf in Sicht'. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Saul Bellow, Richard Powers, Hanif Kureishi und Khaled Hosseini.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wie können wir all die Rollen, die wir zu spielen haben, glaubhaft unter einen Hut bekommen? Wie gleichzeitig Sohn, Vater und Ehemann sein? Oder Mutter, Ehefrau und Geliebte? Oder gar Amerikaner und Jude? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Jonathan Safran Foer in seinem ersten Roman seit elf Jahren.
»Hier bin ich« erzählt drei turbulente Wochen im Leben einer Familie in tiefer Krise. Julia und Jacob haben sich auseinandergelebt, doch wie könnten sie sich einfach trennen, ohne dass ihre drei Söhne darunter leiden, oder gar sie selbst? Lieber diskutieren sie alle Szenarien tagelang durch und kümmern sich aufopferungsvoll um den inkontinenten Hund und die bevorstehende Bar Mitzwa des Ältesten. Als die israelische Verwandtschaft in Washington D. C. eintrifft, ereignet sich plötzlich ein katastrophales Erdbeben im Nahen Osten und die Ereignisse überschlagen sich.
Safran Foer schreibt sich mit seinem dritten Roman endgültig in den Olymp der amerikanischen Literatur.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Here I am bei Farrar, Straus and Giroux New York
© 2016 by Jonathan Safran Foer
All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Henning Ahrens
© 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln nach dem Originalumschlag von Farrar, Straus and Giroux
Covermotiv: © gray318
ISBN978-3-462-31585-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Widmung
I Vor dem Krieg
Zurück zum Glück
Hier bin’icht ich
Glück
Eine Hand so groß wie Deine, Ein Haus so groß wie dieses
Hier bin’icht ich!
Epitom
W-Ä-R-E-D-O-C-H-N-I-C-H-T-G-E-L-8
Epitom
Hier bin’icht ich
Irgendjemand! Irgendjemand!
Das N-Wort
II Erfahrung der Endlichkeit
Antietam
Damaskus
Die verborgene Seite
Noch nicht
Das andere Leben eines anderen
Der fiktive Notfall
Der andere Tod eines anderen
Eine komplette Wiedergeburt
III Vom Nutzen einer jüdischen Faust
Einen Stift halten, zuschlagen, Eigenliebe
Das L-Wort
Vielleicht war es die Entfernung
Zu guter Letzt ist das eigene Zuhause perfekt
Die Israelis sind da!
Wirklich echt
Wey iz mir
Die zweite Synagoge
Das Erdbeben
IV Fünfzehn Tage von fünftausend Jahren
V Keine Wahl ist auch eine Wahl
Nichts ist nicht politisch
Wolle oder Wolke
Was wissen die Kinder?
Die ehrlich gemeinte Version
Manches lässt sich heute nicht so leicht sagen
Die Namen waren großartig
Wiedergeburt
Nur noch die Klage
Schaut! Ein weinendes hebräisches Baby
Das Löwengehege
Im Türschlitz
Wer ist im menschenleeren Zimmer?
De zelbe Prayz
VI Die Zerstörung Israels
Kehrt heim
Heute bin ich kein Mann
O Juden, euer Stündlein hat geschlagen!
Kehrt heim
Heute bin ich kein Mann
O Juden, euer Stündlein hat geschlagen!
Kehrt heim
Heute bin ich kein Mann
O Juden, euer Stündlein hat geschlagen!
Kehrt heim
Heute bin ich kein Mann
O Juden, euer Stündlein hat geschlagen!
Kehrt heim
VII Die Bibel
VIII Zuhause
Die Rede des Präsidenten im Kapitel »Nichts ist nicht politisch« ist eine Abwandlung der Rede, die Präsident Obama 2010 nach dem Erdbeben auf Haiti hielt.
Bei den in Teil VII zitierten Gedichten handelt es sich um Franz Wrights »Year One« und »Progress«.
Radiolab, Invisibilia, 99 % Invisible und Dan Carlins Hardcore History haben mich zu den Podcasts inspiriert, die Jacob hört.
Für Eric Chinski,
der mich durchschaut,
und für Nicole Aragi,
die mich durchschaut
IVor dem Krieg
Zurück zum Glück
Zu Beginn der Zerstörung Israels überlegte Isaac Bloch, ob er sich umbringen oder ins jüdische Seniorenheim gehen sollte. Er hatte in einer Wohnung gelebt, in der die Bücher bis zur Decke reichten und die Teppiche so dick waren, dass Würfel darin verschwanden; danach in einer Anderthalb-Zimmer-Wohnung mit Lehmboden; im Wald unter gleichgültigen Sternen; unter den Fußbodendielen eines Christen, dessen Rechtschaffenheit eine halbe Welt und ein Dreivierteljahrhundert später durch das Setzen eines Baumes gewürdigt wurde; in einem Loch, und das so viele Tage, dass er die Knie nie wieder ganz durchdrücken konnte; unter Roma und Partisanen und halbwegs anständigen Polen; in Übergangs-, Flüchtlings- und Vertriebenenlagern; auf einem Schiff mit einer Flasche, in die ein schlafloser Agnostiker ein Schiffchen gezaubert hatte; auf der anderen Seite eines Ozeans, den er nie ganz überqueren sollte; über einem halben Dutzend Lebensmittelläden, die er im Schweiße seines Angesichts aus dem Boden gestampft hatte, um sie dann mit geringem Gewinn zu verkaufen; mit einer Frau, die die Schlösser so oft überprüfte, bis diese kaputtgingen, und die mit zweiundvierzig an Altersschwäche starb, ohne ein Wort des Lobes, dafür aber mit den sich unaufhörlich teilenden Zellen ihrer ermordeten Mutter im Gehirn; und schließlich, während des letzten Vierteljahrhunderts, in einer schneekugelstillen Hochparterrewohnung in Silver Spring: Auf dem Kaffeetisch vergilbten zehn Pfund Roman Vishniac; im letzten noch funktionierenden Videorekorder der Welt entmagnetisierte sich Feinde – Die Geschichte einer Liebe; in einem Kühlschrank, mumifiziert durch die Fotos großartiger, genialer, tumorfreier Urenkel, mutierte Eiersalat zu Vogelgrippe.
Deutsche Fachgärtner hatten Isaacs Stammbaum bis auf den Boden Galiziens gekappt. Doch mit Glück und Intuition und ohne Hilfe von oben hatte er die Wurzeln auf die Bürgersteige von Washington D.C. verpflanzt und durfte miterleben, wie der Baum wieder ausschlug. Und solange Amerika sich nicht gegen die Juden wandte – bis, berichtigte Irv, sein Sohn –, würde er weiter blühen und gedeihen. Dann wäre Isaac natürlich längst wieder in einem Loch. Es würde ihm nicht mehr gelingen, seine Knie ganz durchzudrücken, doch in Anbetracht seines unbestimmbaren Alters und unbestimmbarer Erniedrigungen, die ihm irgendwann bevorstanden, musste er die jüdischen Fäuste öffnen und sich den Anfang des Endes eingestehen. Die Diskrepanz zwischen Eingeständnis und Akzeptanz nennt man Depression.
Das Timing war selbst dann unglücklich, wenn man von der Zerstörung Israels absah: In wenigen Wochen feierte sein ältester Urenkel Bar Mizwa, eine Zeremonie, die Isaac als Ziellinie seines Lebens galt, nachdem er die früher gezogene Linie, die Geburt seines jüngsten Urenkels, überschritten hatte. Aber niemand kann bestimmen, wann die Seele eines alten Juden den Körper und dieser Körper die geliebte kleine Wohnung für den nächsten Körper auf der Warteliste räumt. Die Mannwerdung lässt sich ja auch nicht beschleunigen oder stoppen. Andererseits sind der Kauf eines Dutzends Flugzeugtickets ohne Rücktrittsrecht, die Reservierung eines Trakts im Washingtoner Hilton und die Entrichtung einer Kaution von $ 23000 für eine Bar Mizwa, die seit den letzten Olympischen Winterspielen im Kalender steht, keine Garantie dafür, dass die Sache tatsächlich wahr wird.
Eine Gruppe von Jungen trabte durch die Flure von Adass Jisroel, lachend und knuffend, während ihr Blut, dem Nullsummenspiel der Pubertät gehorchend, aus den sich entwickelnden Gehirnen in die sich entwickelnden Genitalien schoss und wieder zurück.
»Jetzt mal im Ernst«, sagte einer, wobei sich das ›tz‹ in seiner Gaumen-Dehnplatte verfing, »das einzige Gute an Blowjobs sind die feuchten Handjobs, die dazugehören.«
»Darauf ein Amen.«
»Sonst bumst man ja ein Glas Wasser mit Zähnen.«
»Und das ist sinnlos«, meinte ein rothaariger Junge, der bei dem Gedanken an den Epilog von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes immer noch eine Gänsehaut bekam.
»Nihilistisch.«
Wenn Gott tatsächlich existierte und richtete, dann hätte Er diesen Jungen in Bausch und Bogen vergeben, weil er gewusst hätte, dass ihr Inneres unter dem Druck äußerer Kräfte stand und dass auch sie nach Seinem Bilde erschaffen worden waren.
Schweigen, als sie langsamer wurden, um Margot Wassermann beim Wasserschlabbern zuzuschauen. Angeblich parkten ihre Eltern zwei Autos vor der Dreifachgarage, weil sie fünf Autos besaßen. Angeblich hatte ihr Spitz noch seine Eier, und diese waren Honigtau.
»Scheiße noch mal, ich wäre jetzt gern der Wasserspender«, sagte ein Junge mit dem hebräischen Namen Peretz-Yizchak.
»Ich würde gern die Lücke in dem offenen Slip füllen.«
»Ich würde meinen Schwanz gern mit Quecksilber laden.«
Kurzes Schweigen.
»Was zum Teufel soll das heißen?«
»Na ja«, erwiderte Marty Cohen-Rosenbaum, geborener Chaim ben Kalman, »so als … wäre mein Schwanz ein Thermometer.«
»Indem du ihn mit Sushi fütterst?«
»Man könnte das Zeug injizieren. Oder wie auch immer. Du weißt doch, was ich meine, Mann.«
Vierfaches, unbeabsichtigt synchrones Hin und Her des Kopfes, wie man es von Tischtenniszuschauern kennt.
Im Flüsterton: »Damit ich sie in den Arsch ficken kann.«
Die anderen hatten das Glück, Mütter des 21. Jahrhunderts zu haben, die wussten, dass man die Temperatur digital im Ohr maß. Und Chaim hatte das Glück, dass die anderen abgelenkt waren, bevor sie ihm einen Spitznamen verpassen konnten, den er nie wieder losgeworden wäre.
Sam saß mit hängendem Kopf auf einer Bank vor dem Büro Rabbi Singers, den Blick auf seine geöffneten Hände gesenkt wie ein Mönch, der darauf wartet, in Flammen aufzugehen. Die Jungen blieben stehen und richteten ihren Selbsthass gegen ihn.
»Wir haben gehört, was du geschrieben hast«, sagte einer und bohrte einen Finger in Sams Brust. »Du hast eine rote Linie überschritten.«
»Echt übler Scheiß, Kumpel.«
Sonderbar, denn Sams extreme Schweißproduktion begann normalerweise erst, wenn die Bedrohung nicht mehr akut war.
»Ich habe das nicht geschrieben, und ich bin nicht dein …« – er deutete Anführungsstriche an – »… Kumpel.«
Das hätte er erwidern können, tat es aber nicht. Er hätte auch erklären können, warum der Anschein auf ganzer Länge trog. Tat es aber nicht. Stattdessen verbuchte er wie üblich alles auf der Sollseite des Lebens.
Hinter der Tür des Rabbis und vor dem Schreibtisch des Rabbis saßen Sams Eltern, Jacob und Julia. Sie wollten nicht dort sein. Niemand wollte dort sein. Der Rabbi musste sich ein paar hübsche, gehaltvoll klingende Worte über jemanden namens Ralph Kremberg ausdenken, der um vierzehn Uhr in die Erde gesenkt werden sollte. Jacob hätte lieber an seiner Bibel für Immerfort sterbende Menschen gearbeitet, das Haus nach seinem verschwundenen Handy abgesucht oder wenigstens geschaut, was das Internet zum Thema Dopamin zu bieten hatte. Und Julia sollte heute eigentlich freihaben – dies hier war das Gegenteil von frei.
»Warum ist Sam nicht dabei?«, fragte Jacob.
»Ich halte ein Gespräch unter Erwachsenen für das Beste«, sagte Rabbi Singer.
»Sam ist erwachsen.«
»Sam ist nicht erwachsen«, sagte Julia.
»Weil ihm noch drei Verse fehlen, bis er die Segenssprüche nach der Haftarot beherrscht?«
Julia ignorierte Jacob, legte eine Hand auf den Schreibtisch des Rabbis und sagte: »Einem Lehrer Widerworte zu geben, ist natürlich ein Unding, und wir möchten den Vorfall irgendwie gutmachen.«
»Ja, klar«, sagte Jacob, »aber finden Sie eine Schulsperre nicht etwas zu drakonisch für einen Vorfall, der nüchtern betrachtet eine Lappalie ist?«
»Jacob …«
»Was?«
In dem Bemühen, mit ihrem Mann, nicht aber mit dem Rabbi zu kommunizieren, drückte Julia zwei Finger an die Stirn, schüttelte den Kopf und blähte die Nase auf. Sie wirkte weniger wie ein Mitglied der Gemeinde, eine Ehefrau und Mutter, die den Ozean von der Sandburg ihres Sohnes fernhalten wollte, sondern eher wie der Coach eines dritten Baseman.
»Adass Jisroel ist eine fortschrittliche Shul«, sagte der Rabbi, woraufhin Jacob die Augen verdrehte, ein würgereizartiger Reflex. »Wir können auf eine lange und stolze Geschichte zurückblicken, in der wir stets über den jeweiligen kulturellen Normen gestanden und das göttliche Licht, das Ohr Ein Sof, in jedem Menschen gesucht haben. Rassistische Beschimpfungen wiegen hier außerordentlich schwer.«
»Was?«, fragte Julia und setzte sich in Positur.
»Das kann nicht sein«, sagte Jacob.
Der Rabbi entließ den Seufzer eines Rabbis und schob Julia einen Zettel hin.
»Das hat er gesagt?«, fragte Julia.
»Geschrieben.«
»Was denn?«, fragte Jacob.
Julia las die Liste mit ungläubigem Kopfschütteln vor: »Dreckiger Araber, gelber Affe, Fotze, Japse, Schwuchtel, Tortillafresser, Itzig, N-Wort …«
»Hat er ›N-Wort‹ geschrieben?«, fragte Jacob. »Oder das tatsächliche N-Wort?«
»Das Wort selbst«, sagte der Rabbi.
Obwohl die Klemme, in der sein Sohn steckte, seine größere Sorge hätte sein müssen, wurde Jacob durch die Tatsache irritiert, dass es sich um das einzige Wort handelte, das auf gar keinen Fall laut ausgesprochen werden durfte.
»Da muss ein Missverständnis vorliegen«, sagte Julia, die den Zettel endlich an Jacob weiterreichte. »Sam pflegt mit Hingabe Tiere, die …«
»Cincinnati Bow Tie? Das ist keine rassistische Beschimpfung, sondern eine Praktik beim Sex. Glaube ich. Vielleicht.«
»Sind nicht nur Beschimpfungen«, sagte der Rabbi.
»Wissen Sie was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ›Dreckiger Araber‹ auch eine Sexpraktik ist.«
»Wenn Sie das beschwören können.«
»Ich will damit nur sagen, dass wir die Liste vielleicht falsch verstehen.«
Wieder ihren Mann ignorierend, fragte Julia: »Was sagt Sam dazu?«
Der Rabbi zupfte an seinem Bart, suchte nach Worten wie ein Makak nach Läusen.
»Er hat alles geleugnet. Lautstark. Aber diese Liste war vor dem Unterricht noch nicht da, und er sitzt allein an dem Tisch.«
»Das war er nicht«, sagte Jacob.
»Es ist seine Handschrift«, sagte Julia.
»Dreizehnjährige schreiben alle gleich.«
Der Rabbi sagte: »Er konnte nicht erklären, wie der Zettel dort hingelangt ist.«
»Ist ja auch nicht sein Job«, sagte Jacob. »Und nebenbei: Wenn Sam diese Worte tatsächlich geschrieben hat, warum zum Teufel hätte er den Zettel dann auf dem Tisch liegen lassen sollen? Die Unverfrorenheit beweist seine Unschuld. Wie in Basic Instinct.«
»In Basic Instinct hat sie es aber getan«, erwiderte Julia.
»Ja?«
»Der Eispickel.«
»Kann sein. Aber das ist ein Film. Dieser Zettel muss Sam von einem kleinen Hardcore-Rassisten untergejubelt worden sein, der ihm schaden will.«
Julia wandte sich direkt an den Rabbi: »Wir sorgen dafür, dass Sam begreift, warum die Bezeichnungen so verletzend sind.«
»Julia«, sagte Jacob.
»Genügt eine Entschuldigung beim Lehrer, damit die Bar Mizwa wie geplant stattfindet?«
»Das wollte ich auch vorschlagen. Nur hat unsere Gemeinde leider Wind von den Worten bekommen. Also …«
Jacob schnaufte frustriert – eine Eigenart, die er Sam entweder beigebracht oder von diesem übernommen hatte. »Verletzend für wen, wenn ich fragen darf? Zwischen Schattenboxen und einem Nasenbeinbruch besteht ein himmelweiter Unterschied.«
Der Rabbi ließ den Blick lange auf Jacob verweilen. »Wäre es möglich, dass Sam zu Hause Probleme hat?«
»Die Hausaufgaben erdrücken ihn«, setzte Julia an.
»Er war das nicht.«
»Außerdem lernt er für seine Bar Mizwa, was ihn jeden Abend eine weitere Stunde kostet, jedenfalls theoretisch. Dazu Cello und Fußball. Sein jüngerer Bruder Max schlägt sich gerade mit existenziellen Problemen herum, was alle stark belastet. Und Benjy, der Kleinste …«
»Hört sich an, als hätte er daheim viel um die Ohren«, sagte der Rabbi. »Dafür habe ich natürlich Verständnis. Wir fordern viel von unseren Kindern. Mehr, als jemals von uns gefordert wurde. Trotzdem dulden wir hier keinen Rassismus.«
»Selbstverständlich nicht«, sagte Julia.
»Moment mal. Sie nennen Sam einen Rassisten?«
»Das habe ich nicht gesagt, Mr Bloch.«
»Doch, haben Sie. Haben Sie sehr wohl. Julia …«
»Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat.«
»Ich sagte: ›Wir dulden hier keinen Rassismus‹.«
»Rassismus ist, was Rassisten sagen.«
»Schon mal gelogen, Mr Bloch?« Jacob suchte seine Jackentasche zum wiederholten Mal reflexartig nach seinem Handy ab. »Ich gehe davon aus, dass Sie, wie jeder Mensch auf Erden, schon mal gelogen haben. Aber deshalb sind Sie noch lange kein Lügner.«
»Sie nennen mich einen Lügner?«, fragte Jacob, die Finger um nichts gekrallt.
»Sie betreiben Spiegelfechterei, Mr Bloch.«
Jacob wandte sich an Julia. »Ja, das N-Wort ist eindeutig schlimm. Schlimm, schlimm, richtig schlimm. Aber es ist nur eines von vielen Wörtern.«
»Meinst du, die Einordnung in größere Zusammenhänge wie Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Perversion würde die Sache besser machen?«
»Aber er war es nicht.«
Der Rabbi rutschte auf seinem Stuhl herum. »Darf ich offen sprechen?« Er schob den Daumen in die Nase, als wollte er andeuten, dass er sich auch irren konnte. »Sam hat es sicher nicht leicht – als Irving Blochs Enkel.«
Julia lehnte sich zurück und dachte an Sandburgen und die Pforte des Shinto-Schreins, die zwei Jahre nach dem Tsunami in Oregon angespült worden war.
»Wie bitte?« Jacob fuhr zum Rabbi herum. »Was?«
»Als Vorbild für ein Kind …«
»Das ist ein starkes Stück.«
Der Rabbi wandte sich an Julia. »Sie wissen sicher, was ich meine.«
»Ich weiß, was Sie meinen.«
»Wir wissen nicht, was Sie meinen.«
»Vielleicht war Sam nicht bewusst, dass gewisse Äußerungen, ganz gleich …«
»Kennen Sie den zweiten Band von Robert Caros Biografie Lyndon Johnsons?«
»Nein.«
»Tja, wären Sie ein weltlicher Rabbi und würden diesen Biografie-Klassiker kennen, dann hätten Sie auf den Seiten 432 bis 435 lesen können, dass sich niemand so engagiert für die Verabschiedung des Voting Rights Act eingesetzt hat, und zwar weder in Washington noch anderswo. Ein Kind könnte kein besseres Vorbild finden.«
»Ein Kind sollte gar nicht erst danach suchen müssen«, sagte Julia, den Blick nach vorn gerichtet.
»Gut … Hat mein Vater etwas Bedauerliches gebloggt? Ja. Hat er. Es war bedauerlich. Und er bedauert es. Ein Pauschalpreis-Schlemmerbuffet des Bedauerns. Aber wenn Sie hier andeuten wollen, dass er seinen Enkeln durch seine Rechtschaffenheit irgendetwas anderes als ein Vorbild sei …«
»Bei allem Respekt, Mr Bloch …«
Jacob wandte sich an Julia. »Wir sollten gehen.«
»Wir sollten Sam helfen.«
»An diesem Ort kann Sam nicht geholfen werden. Es war ein Fehler, ihn zur Bar Mizwa zu zwingen.«
»Was? Wir haben ihn nicht gezwungen, Jacob. Wir haben ihn vielleicht sanft gedrängt, aber …«
»Wir haben ihn sanft gedrängt, sich beschneiden zu lassen. Im Falle der Bar Mizwa war es pure Gewalt.«
»Dein Großvater sagt seit zwei Jahren ständig, dass nur Sams Bar Mizwa ihn noch am Leben erhält.«
»Dann sollten wir sie erst recht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufschieben.«
»Außerdem wollten wir Sam vor Augen führen, dass er jüdisch ist.«
»Glaubst du, das hätte er nicht auch so kapiert?«
»Dass er ein Jude ist?«
»Ja, ein Jude. Aber religiös?«
Was die Frage »Sind Sie religiös?« betraf, so stand Jacob stets auf dem Schlauch. Er hatte nie nicht einer Synagoge angehört, nie nicht den Kaschrut entsprochen, nie nicht geplant – nicht einmal in Augenblicken tiefster Frustration über Israel oder seinen Vater oder das amerikanische Judentum oder Gott oder Gottes Abwesenheit –, seine Kinder bis zu einem gewissen Grad mit jüdischer Bildung und jüdischen Riten vertraut zu machen. Aber Doppelverneinungen haben noch keine Religion am Leben erhalten. Oder wie Sams Bruder Max es drei Jahre später in seiner Bar-Mizwa-Rede ausdrücken sollte: »Man kann nur bewahren, was man um keinen Preis aufgeben will.« Und sosehr Jacob sich nach Kontinuität sehnte (der Geschichte und Kultur, der Gedanken und Werte), so gern er geglaubt hätte, dass es nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Kinder und Enkelkinder einen tieferen Sinn gab – Licht frei zwischen seinen Fingern hindurch.
Zu Beginn ihrer Beziehung hatten Jacob und Julia oft über eine »Religion für zwei« gesprochen. Diese wäre peinlich gewesen, wenn sie nicht so erhebend gewesen wäre. Ihr Sabbat: Jeden Freitagabend las Jacob einen Brief vor, den er im Laufe der Woche für Julia geschrieben hatte, und sie deklamierte aus dem Gedächtnis ein Gedicht; bei Dämmerlicht, das Telefon war ausgestöpselt, die Uhren lagen unter den Kissen des roten Cordsessels, aßen sie in aller Ruhe, was sie in aller Ruhe zubereitet hatten; sie ließen ein Bad einlaufen und hatten Sex, während sich die Wanne füllte. Mittwochsspaziergänge bei Sonnenaufgang: Der Weg wurde unabsichtlich zu einem Ritual, sie schritten ihn Woche für Woche in beiden Richtungen ab, bis er sogar auf dem Bürgersteig Spuren hinterließ – unmerklich, aber dennoch. An Rosh Hashanah gingen sie nicht zum Gottesdienst, sondern vollzogen das Ritual des Tashlich: warfen Brotkrümel, die die Sünden des vergangenen Jahres symbolisierten, in den Potomac. Manche gingen unter, manche wurden von der Strömung ans andere Ufer getrieben, manche von Möwen erbeutet, die ihre noch blinde Brut damit fütterten. Jacob küsste Julia jeden Morgen vor dem Aufstehen zwischen die Beine – nicht als sexuelle Geste (laut des Rituals durfte der Kuss zu nichts führen), sondern als religiöse. Sie begannen auf Reisen Dinge zu sammeln, deren Inneres größer schien als das Äußere: eine Muschel, die den Ozean enthielt, das abgenutzte Farbband einer Schreibmaschine, die Welt in einem Spiegel. Alles begann sich zu ritualisieren – Jacob holte Julia donnerstags von der Arbeit ab, sie tranken stumm den Morgenkaffee, Julia ersetzte Jacobs Lesezeichen durch Zettel mit kurzen Botschaften, bis sich – wie ein Universum, das die äußerste Ausdehnung erreicht hat und wieder auf die anfängliche Größe zusammenschrumpft – alles auflöste.
Am Freitagabend wurde es manchmal zu spät, am Mittwochmorgen war es manchmal zu früh. Nach einer schwierigen Diskussion wurde der Kuss zwischen die Beine abgeschafft, und das Innere wie vieler Dinge ist tatsächlich größer als ihr Äußeres, wenn man sich selbst nicht besonders großmütig fühlt? (Groll kann man nicht ins Regal stellen.) Sie versuchten, so viel wie möglich zu bewahren, und verdrängten, wie säkular sie geworden waren. Manchmal, meist, wenn sich einer verteidigen musste, was trotz des Flehens aller guten Geister fast zwangsläufig in Schuldzuweisungen mündete, sagte einer der beiden stets: »Ich vermisse unseren Sabbat.«
Sie empfanden Sams Geburt als neue Chance, wie auch die von Max und Benjy. Eine Religion für drei, für vier, für fünf. An jedem Neujahrstag markierten sie die Größe der Kinder auf dem Türrahmen – ein sowohl säkulares als auch jüdisches Ritual –, und zwar gleich morgens, bevor die Schwerkraft den Körper stauchte. Am 31. Dezember warfen sie ihre guten Vorsätze ins Feuer. Dienstags drehte die ganze Familie nach dem Abendessen eine Runde mit Argus und las sich auf dem Weg zum Vace, wo sie die eigentlich verbotenen Arancitas und Limonatas kauften, Zwischenzeugnisse vor. Die Kinder wurden nach einem ausgefeilten Protokoll und in einer bestimmten Reihenfolge zu Bett gebracht, und wenn jemand Geburtstag hatte, schliefen alle in einem Bett. Sie begingen oft den Sabbat – ihren Glauben sowohl praktizierend als auch von außen beäugend – mit Challah aus Bio-Mehl, Kedem-Grapefruitsaft und Spitzkerzen aus dem Wachs vom Aussterben bedrohter Bienen, die in den Silberleuchtern verstorbener Vorfahren steckten. Nach dem Segen und vor dem Essen flüsterten Jacob und Julia ihren Kindern der Reihe nach ins Ohr, worauf sie letzte Woche stolz gewesen waren. Die große Intimität der Finger im Haar, die Liebe, eigentlich kein Geheimnis, aber im Flüsterton bekundet, all das ließ die Glühfäden der gedimmten Lampen erbeben.
Nach dem Abendessen begingen sie ein Ritual, dessen Ursprung keiner mehr kannte und dessen Sinn niemand hinterfragte. Sie liefen mit geschlossenen Augen durch das Haus. Man durfte sprechen, herumalbern, lachen, aber die Blindheit ließ jedes Mal alle verstummen. Sie lernten allmählich, die dunkle Stille zu ertragen, und hielten es zehn, später auch zwanzig Minuten aus. Am Ende versammelten sich alle am Küchentisch und schlugen zugleich die Augen auf. Zwei Offenbarungen: die Fremdheit eines Zuhauses, in dem die Kinder ihr ganzes Leben verbracht hatten, und die Fremdheit des Sehens.
An einem Sabbat, sie fuhren zu ihrem Urgroßvater Isaac, sagte Jacob: »Ein Mensch betrinkt sich auf einer Party und fährt auf der Heimfahrt ein Kind tot. Ein anderer Mensch betrinkt sich genauso, erreicht aber sein Haus ohne Unfall. Warum muss der Erste lebenslänglich ins Gefängnis, während der Zweite am nächsten Morgen erwacht, als wäre nichts passiert?«
»Weil er ein Kind getötet hat.«
»Bedenkt man das Fehlverhalten, dann sind beide gleichermaßen schuldig.«
»Der Zweite hat aber kein Kind getötet.«
»Weil er Glück hatte. Unschuldig war er nicht.«
»Trotzdem hat der Erste ein Kind getötet.«
»Sollten wir, wenn wir über Schuld nachdenken, neben den Folgen nicht auch Absichten und Verhalten berücksichtigen?«
»Was für eine Party war das?«
»Wie?«
»Ja, und was hatte das Kind zu so später Stunde draußen zu suchen?«
»Entscheidend ist doch wohl …«
»Seine Eltern hätten dafür sorgen müssen, dass ihm nichts passiert. Sie müssten ins Gefängnis. Nur hätte das Kind dann keine Eltern mehr. Außer, es würde bei ihnen im Gefängnis wohnen.«
»Hast du vergessen, dass es tot ist?«
»Ach ja.«
In der Folge waren Sam und Max von Absichtlichkeit wie besessen. Einmal lief Max in die Küche, die Hände auf dem Bauch. »Ich habe ihn gehauen«, sagte Sam im Wohnzimmer, »aber ohne Absicht.« Oder als Max, um sich zu rächen, Sams halb fertiges Lego-Schloss zertrampelte und sagte: »War keine Absicht. Ich wollte auf den Teppich darunter treten.« Wenn sie Argus unter dem Tisch mit Brokkoli fütterten, dann »aus Versehen«. Wenn sie nicht für Klausuren lernten, dann »unabsichtlich«. Als Max zum ersten Mal zu Jacob sagte: »Schnauze!« – eine Reaktion auf den zeitlich ungünstigen Vorschlag, eine Pause bei einem Tetris-Spiel einzulegen, in dem er gerade die Top-Ten-Ergebnisse des Tages übertrumpfen wollte, obwohl er gar nicht hätte spielen dürfen –, legte er Jacobs Smartphone weg, lief zu ihm, umarmte ihn und sagte mit Angst in den Augen: »War nicht so gemeint.«
Als Sam sich die Finger der linken Hand in der schweren Eisentür klemmte und schrie: »Wieso ist das passiert?«, immer wieder schrie: »Wieso ist das passiert?«, und Julia, die ihn an sich drückte, sodass sich das Blut auf ihrer Bluse verteilte wie früher die Milch, wenn ein Baby geschrien hatte, einfach sagte: »Ich liebe dich, und ich bin bei dir«, und Jacob rief: »Wir müssen zur Notaufnahme«, da flehte Sam, der Ärzte mehr fürchtete als alles, was ein Arzt kurieren konnte: »Bitte nicht! Bitte nicht! Das war Absicht! Ich habe das mit Absicht getan!«
Die Zeit verging, die Welt machte sich geltend, und Jacob und Julia vergaßen, Dinge mit Absicht zu tun, sträubten sich nicht dagegen, manches aufzugeben, und wie die guten Vorsätze, die Dienstagsspaziergänge und die Geburtstagsanrufe bei den Cousins und Cousinen in Israel, wie die drei überquellenden Einkaufstüten mit jüdischen Delikatessen, die sie Uropa Isaac am Ersten jeden Monats brachten, wie das Schulschwänzen beim ersten Heimspiel der Nationals, das Singen von »Singing in the Rain«, während Ed, die Hyäne, durch die Waschanlage rollte, die »Dankbarkeitsbücher« und »Ohrinspektionen«, das jährliche Kürbispflücken und Schnitzen, das Rösten der Kerne und das monatelange Vermodern, entfiel auch die geflüsterte Bekundung des Stolzes.
Das Innere des Lebens wurde viel kleiner als das Äußere, und es entstand ein Hohlraum, eine Leere. Genau darum hatte die Bar Mizwa eine solche Bedeutung: Sie war der letzte Faden des zerfransten Seils. Kappte man diesen Faden, wie von Sam ersehnt und von Jacob gerade entgegen seinem eigentlichen Wunsch vorgeschlagen, dann würde nicht nur Sam, sondern die ganze Familie in dieser Leere verschwinden – dann gäbe es zwar genug Sauerstoff für ein ganzes Leben, aber welche Art von Leben wäre das?
Julia wandte sich an den Rabbi: »Und wenn Sam sich entschuldigt …«
»Für was?«, fragte Jacob.
»Wenn er sich entschuldigt …«
»Bei wem?«
»Bei allen«, sagte der Rabbi.
»Allen? Bei allen Lebenden und Toten?«
Diese Formulierung – alle Lebenden und Toten – kramte Jacob nicht im Hinblick auf das heraus, was bald passieren sollte, sondern benutzte sie im Dunkel des Augenblicks: bevor die zusammengefalteten Gebete auf der Klagemauer erglühten; vor der Japanischen Krise; vor den zehntausend vermissten Kindern und dem Marsch der Million; bevor »Adia« der am häufigsten gesuchte Begriff in der Geschichte des Internets wurde. Vor den verheerenden Nachbeben, vor dem Bündnis der neun Armeen und der Ausgabe von Kaliumiodid-Tabletten, bevor Amerika keine F-16 schickte, bevor der Messias zu abgelenkt oder nicht existent war, um die Lebenden und die Toten zu erwecken. Sam wurde zum Mann. Isaac schwankte zwischen Selbstmord und dem Umzug aus seinem Heim in ein Heim.
»Wir möchten das abhaken«, sagte Julia zum Rabbi. »Wir möchten das ausbügeln, damit die Bar Mizwa wie geplant stattfindet.«
»Indem wir uns bei allen für alles entschuldigen?«
»Wir wollen zurück zum Glück.«
Jacob und Julia registrierten im Stillen, was dieser Satz zum Ausdruck brachte – Hoffnung, Traurigkeit, Verstörung –, während sich die Wörter im Zimmer verteilten, auf die Stapel religiöser Bücher und den fleckigen Teppichboden rieselten. Sie waren vom Weg abgekommen und hatten den Kompass verloren, nicht aber den Glauben, dass es möglich sei, wieder auf Kurs zu kommen – obwohl keiner von beiden wusste, von welchem Glück die Rede war.
Der Rabbi verschränkte seine Finger, wie das ein Rabbi eben so tut, und sagte: »Ein chassidisches Sprichwort lautet: ›Die Suche nach dem Glück ist die Flucht vor der Zufriedenheit.‹«
Jacob stand auf, faltete den Zettel zusammen, steckte ihn ein und sagte: »Sie haben den Falschen.«
Hier bin’icht ich
Während Sam auf der Bank vor Rabbi Singers Büro wartete, trat Samanta an die Bima. Sam hatte sie aus uralter digitaler Ulme erbaut, geborgen vom Grund eines digitalen, selbst angelegten Süßwassersees, in dem er ein Jahr zuvor einen kleinen Wald versenkt hatte. Damals hatte er wie einer jener unschuldigen Hunde, die man wie als Bestätigung der Existenz des Bösen auf eine unter Strom gesetzte Fläche setzt, erfahren müssen, was Hilflosigkeit war.
»Ob du eine Bar Mizwa willst oder nicht, ist egal«, hatte sein Dad gesagt. »Du musst versuchen, die Sache als Inspiration zu sehen.«
Warum war er so besessen von Tierquälerei? Warum so fasziniert von Videos, die seine Meinung über die Menschheit sowieso nur bestärkten? Er verbrachte enorm viel Zeit mit der Suche nach Grausamkeit: Tierquälerei und Kämpfe zwischen Tieren (sowohl von Menschen organisiert als auch in der Natur), Tiere, die Menschen anfielen, Stierkämpfer, die bekamen, was sie verdienten, Skateboarder, die bekamen, was sie verdienten, Athleten, deren Knie nach vorn umknickten, Schlägereien zwischen Betrunkenen, Enthauptungen durch Helikopter und noch mehr: Unfälle bei der Müllentsorgung, Lobotomie durch Autoantennen, Zivilisten, die nach Chemiewaffen-Angriffen an Onanieverletzungen starben; schiitische Köpfe auf sunnitischen Zaunpfählen, verpfuschte Operationen, Verbrennungen durch heißen Dampf, Lehrfilme über die Entfernung der bedenklichen Teile überfahrener Tiere (als gäbe es unbedenkliche Teile), Lehrfilme über schmerzlosen Selbstmord (als wäre dies nicht per se unmöglich) und so weiter, so fort und so weiter. Diese Bilder glichen spitzen Gegenständen, die er gegen sich selbst richtete – so vieles in ihm drängte nach außen, ein Vorgang, der zwangsläufig zu Wunden führte.
Auf der schweigenden Heimfahrt erkundete er seine um die Bima erbaute Kapelle: die federleichten, zwei Tonnen schweren Bänke mit Klauenfüßen zu je drei Zehen; die zu gordischen Knoten verschlungenen Fransen des Teppichläufers im Seitenschiff; die Gebetbücher, in denen alle Begriffe unaufhörlich durch Synonyme ersetzt wurden: Der Herr ist Einzig … der Souverän ist Allein … Der Absolute ist Einsam … Wenn dies lange so ging, würde der ursprüngliche Text kurz wieder auftauchen. Aber selbst wenn die durchschnittliche Lebenserwartung jährlich um ein Jahr stieg, würde es endlos lange dauern, bis die Menschen endlos lange lebten, und deshalb war es unwahrscheinlich, dass irgendjemand das Original jemals sehen würde.
Sams auswegloser innerer Druck äußerte sich oft in Gestalt nutzloser Brillanz, und während Vater, Brüder und Großeltern unten zu Mittag aßen, während sie unweigerlich darüber sprachen, was ihm zur Last gelegt wurde, und sich fragten, was sie mit ihm tun sollten, erschuf er, obwohl er die hebräischen Wörter und die jüdische Melodie der Haftarot pauken sollte, deren Sinn für niemanden jemals von Interesse gewesen war, Bleiglasfenster nach dem Morphing-Prinzip. Das Fenster rechts von Samanta zeigte Moses als Baby auf dem Nil zwischen Müttern. Es war eine Schleife, aber so konstruiert, dass der Eindruck einer endlosen Reise erweckt wurde.
Sam fand die Vorstellung cool, auf dem größten Fenster der Kapelle fortlaufende Bilder der jüdischen Gegenwart zu zeigen, und so paukte er nicht die idiotischen, total nutzlosen Ashrei, sondern schrieb ein Programm, das Schlüsselworte aus einem Google-News-Feed zu jüdischen Themen filterte. Mit diesen suchte er im Zufalls-Modus nach Videos (wobei Redundanzen, falsche Fährten und antisemitische Propaganda ausgefiltert wurden), ließ die Resultate dann durch einen Video-Filter laufen (wieder nach dem Zufallsprinzip, aber so, dass Bilder ausgewählt wurden, die am besten zum runden Rahmen passten, farblich auf ihre Abfolge abgestimmt) und projizierte sie dann auf das Fenster. Die Realität hinkte seiner Vorstellung hinterher, aber so war es mit allem.
Rund um die Kapelle hatte er die Synagoge erbaut: das Labyrinth der Flure, die sich im wahrsten Sinne des Wortes endlos verzweigten; die Fontänen, aus denen Orangensaft sprudelte, die Pinkelbecken aus Knochen von Elfenbein-Wilderern; die Stapel wahrhaft liebevoller, frauenfreundlicher Facesitting-Pornos im Wandschrank des Festsaals im Herren-Klub; der ironisch gemeinte Behindertenplatz auf der Stellfläche für Kinderwagen; die Gedächtniswand mit den winzigen, niemals funktionierenden Glühlampen neben den Namen all jener, denen er einen baldigen, wenn auch schmerzlosen Tod wünschte (ehemalige beste Freunde, Leute, die auf der Haut brennende Akne-Pflaster in Umlauf brachten usw.); mehrere Fummel-Grotten, in denen weichherzige, auf banale Art lustige Mädchen, die der American-Apparel-Werbung entsprungen zu sein schienen und Percy-Jackson-Fan-Fiction schrieben, Idioten erlaubten, an ihren makellosen Titten zu lutschen; Tafeln, die Stromstöße von 600 Volt abgaben, wenn einer dieser blöden, großmäuligen Brutalos, die in fünfzehn Jahren – im Gegensatz zu allen anderen wusste Sam das genau – bierbäuchige Spießer mit öden Jobs und plumpen Frauen wären, mit den Fingernägeln darüber kratzte; Plaketten auf allen freien Flächen, die darauf hinwiesen, dass es Samantas Güte und großer Redlichkeit, ihrem Einsatz für Milde, Gnade und die Vorzüge des Zweifels, ihrer Anständigkeit, ihren inneren Werten und ihrer unboshaften Nichtfiesheit zu verdanken war, dass diese Leiter zum Dach existierte, dass dieses Dach existierte, dass der unaufhörlich alles abfedernde Gott existierte.
Die Synagoge stand ursprünglich am Rand einer Community, die aus Liebe zu Videos entstanden war, in denen Hunde, die etwas angestellt hatten, ihre Beschämung zum Ausdruck brachten. Sam konnte sich diese Videos den lieben, langen Tag anschauen – das tat er auch immer wieder –, ohne sich zu fragen, warum sie ihn so faszinierten. Die naheliegendste Erklärung wäre sein Mitgefühl mit den Hunden gewesen, und das traf natürlich irgendwie zu. (»Warst du das, Sam? Hast du diese Worte geschrieben? Warst du böse?«) Aber er mochte auch die Hundehalter. Jedes Video stammte von jemandem, der sein Haustier mehr liebte als sich selbst; das »Schämen« wirkte stets humorvoll übertrieben und fröhlich, und am Ende vertrugen sich alle. (Er hatte selbst solche Videos drehen wollen, aber Argus war so alt und schlapp, dass er sich bestenfalls eingekotet hätte, und danach war kein fröhliches Schämen möglich.) Es musste also etwas mit Fehltritt und Strafe zu tun haben, mit der Furcht vor ausbleibender Vergebung und der Erleichterung, wenn man wieder geliebt wurde. Vielleicht wären seine Gefühle im nächsten Leben nicht so überwältigend, vielleicht könnte er dann trotzdem noch denken.
Der ursprüngliche Standort war nicht unbedingt falsch, doch im Gegensatz zum Alltagsleben, in dem das Gut-Genug galt, ging es in Other-Life darum, die Dinge an ihrem Sehnsuchtsort zu platzieren. Sam glaubte insgeheim, dass nicht nur alles zur Sehnsucht fähig sei, sondern dass sich alles ständig sehne. Also bezahlte er digitalen Umzugshelfern nach der Standpauke, die ihm später am Tag von seiner Mutter gehalten wurde, eine digitale Summe, damit sie die Synagoge in die größten Teile zerlegten, die in die größten Lkw passten, abtransportierten und entsprechend den Screengrabs wieder zusammensetzten.
»Wir unterhalten uns, sobald Dad von der Sitzung zurück ist, aber ich muss dir etwas sagen. Dringend.«
»Schön.«
»Hör auf, ständig ›schön‹ zu sagen.«
»Tut mir leid.«
»Hör auf, ständig ›tut mir leid‹ zu sagen.«
»Geht es denn nicht darum, dass ich mich entschuldige?«
»Für dein Vergehen.«
»Aber ich habe es nicht …«
»Ich bin schwer enttäuscht.«
»Ich weiß.«
»Ist das alles? Mehr hast du nicht zu sagen? Zum Beispiel: ›Ich habe es geschrieben und bitte um Verzeihung‹?«
»Ich habe das nicht geschrieben.«
»Räum diese Müllhalde auf. Ist ja widerwärtig.«
»Ist doch mein Zimmer.«
»Aber unser Haus.«
»Das Schachbrett muss so bleiben. Wir sind mitten im Spiel. Dad sagt, dass wir es beenden, wenn ich keinen Ärger mehr habe.«
»Weißt du, warum du ihn immer schlägst?«
»Weil er mich gewinnen lässt.«
»Er lässt dich seit Jahren nicht mehr gewinnen.«
»Er strengt sich nicht so an.«
»Oh nein. Er findet es toll, Figuren zu schlagen, aber du bleibst Sieger, weil du immer vier Züge vorausdenkst. Deshalb bist du gut in Schach, und deshalb bist du lebenstüchtig.«
»Ich bin nicht lebenstüchtig.«
»Oh doch. Wenn du überlegt handelst.«
»Ist Dad denn nicht lebenstüchtig?«
Es lief beinahe wie am Schnürchen, nur sind Umzugshelfer nicht ganz so fast-vollkommen wie der Rest der Menschheit, und deshalb gab es Pannen, im Grunde Lappalien – wer außer Sam hätte bemerkt, dass ein Davidstern Dellen hatte und verkehrt herum hing? –, die eigentlich nahezu unsichtbar waren. Die winzigste Abweichung von der Perfektion ruinierte alles.
Sein Dad hatte ihm einen Artikel über einen Jungen gegeben, der seine Bar Mizwa im Konzentrationslager feierte, indem er eine imaginäre Synagoge baute und Zweige hineinsteckte, als stumme Gemeinde. Sein Dad hätte natürlich nie gedacht, dass er den Artikel lesen würde, und sie sprachen nie darüber, und zählt es als Erinnerung, wenn man ständig daran denkt?
Alles war extra angefertigt – das ganze Gebäude der organisierten Religion wurde für ein kurzes Ritual entworfen, errichtet und gepflegt. Trotz des unvorstellbaren Ausmaßes von Other-Life gab es dort keine Synagoge. Und obwohl er sich vehement dagegen sträubte, jemals einen Fuß in eine echte Synagoge zu setzen, musste es eine Synagoge geben. Er sehnte sich nicht danach, er brauchte eine: Was nicht existiert, kann man nicht zerstören.
Glück
Alle glücklichen Morgen gleichen einander, wie auch alle unglücklichen Morgen, und dass sie so furchtbar unglücklich sind, hat folgende Ursache: Das Gefühl, dass man ein solches Unglück schon einmal erlebt hat, dass alle Bemühungen, ihm vorzubeugen, das Gegenteil bewirken oder die Sache sogar noch verschlimmern, dass sich das Universum aus irgendeinem rätselhaften, überflüssigen, unfairen Grund gegen die harmlose Abfolge von Kleidern, Frühstück, Zähnen und nervigen Haarwirbeln, Rucksäcken, Schuhen, Jacken und Abschieden verschworen hat.
Jacob hatte darauf bestanden, dass Julia mit ihrem Auto zu dem Treffen mit Rabbi Singer fuhr, damit sie danach wegfahren und ihren freien Tag genießen konnte. Sie gingen in tiefem Schweigen durch die Schule zum Parkplatz. Sam wusste nicht, dass man als Verdächtigter das Recht hatte, nichts zu sagen, ahnte es aber dunkel. Andererseits spielte das sowieso keine Rolle, denn seine Eltern würden erst mit ihm sprechen, nachdem sie hinter seinem Rücken geredet hatten. Sie ließen ihn im Eingang zwischen den schnurrbärtigen Kind-Männern stehen, die Yu-Gi-Oh! spielten, und gingen zu ihren Autos.
»Soll ich etwas besorgen?«, fragte Jacob.
»Wann?«
»Jetzt.«
»Du musst doch zum Brunch mit deinen Eltern.«
»Ich möchte dir nur etwas abnehmen.«
»Wir brauchen Sandwichtoast.«
»Eine bestimmte Sorte?«
»Die übliche Sorte.«
»Was ist denn?«
»Was soll denn sein?«
»Du wirkst bedrückt.«
»Bist du etwa nicht bedrückt?«
Hatte sie das Handy gefunden?
»Wollen wir nicht über das reden, was gerade gelaufen ist?«
Sie hatte das Handy nicht gefunden.
»Doch, klar«, sagte er. »Aber nicht auf diesem Parkplatz. Nicht jetzt, während Sam auf der Treppe lauert und meine Eltern zu Hause warten.«
»Wann dann?«
»Heute Abend?«
»Heute Abend? Mit Fragezeichen? Oder heute Abend.«
»Heute Abend.«
»Versprichst du das?«
»Julia.«
»Und sieh zu, dass er nicht in seinem Zimmer hockt und über dem iPad schmollt. Er muss wissen, dass wir sauer sind.«
»Das weiß er.«
»Ja, aber er soll es auch in meiner Abwesenheit wissen.«
»Das wird er.«
»Versprichst du das?«, fragte sie, dieses Mal ohne ironischen Unterton.
»Bei meiner Treu und Hand aufs Herz.«
Sie hätte mehr sagen können, Beispiele aus der jüngsten Geschichte anführen oder erklären können, warum es nicht die Bestrafung war, die ihr Sorgen bereitete, sondern die Verfestigung ihrer eingefahrenen und vollkommen falsch verteilten elterlichen Rollen. Stattdessen beschränkte sie sich darauf, ihm sanft den Arm zu drücken.
»Bis heute Nachmittag.«
In der Vergangenheit hatten Berührungen sie immer gerettet. Egal wie groß der Ärger oder die Verletzung war, wie tief die Einsamkeit, schon eine sanfte Berührung im Vorübergehen erinnerte sie an ihre lange Gemeinsamkeit. Eine Hand auf dem Nacken: Alles war wieder da. Ein Kopf auf der Schulter: Aufwallen chemischer Substanzen, die Erinnerung an Liebe. Manchmal war es fast unmöglich, die Distanz zwischen ihren Körpern zu überbrücken, den anderen zu erreichen. Manchmal war es ganz unmöglich. Dieses Gefühl kannten beide sehr gut, in der Stille des dunklen Schlafzimmers, während sie beide zur Decke starrten: Wenn ich meine Finger öffnen könnte, würden sich auch die Finger meines Herzens öffnen. Aber ich schaffe es nicht. Ich möchte die Entfernung überbrücken, ich möchte erreicht werden. Aber ich schaffe es nicht.
»Tut mir leid wegen des Vormittags«, sagte er. »Du hättest eigentlich den ganzen Tag für dich haben sollen.«
»Du hast die Worte ja nicht geschrieben.«
»Sam auch nicht.«
»Jacob.«
»Was?«
»Es darf nicht sein, und es wird nicht sein, dass ihm einer von uns beiden glaubt und der andere nicht.«
»Dann glaub ihm.«
»Er hat es eindeutig getan.«
»Glaub ihm trotzdem. Wir sind seine Eltern.«
»Stimmt. Und wir müssen ihm klarmachen, dass Taten Konsequenzen haben.«
»Ich finde es wichtiger, ihm zu glauben«, sagte Jacob, dem in diesem rasanten Gespräch die eigenen Worte davonrannten. Warum ließ er sich auf dieses Geplänkel ein?
»Nein«, sagte Julia, »wichtiger ist es, ihn zu lieben. Und er wird kapieren, dass unsere Liebe, die es erfordert, dass wir ihm ab und zu wehtun, durch nichts zu erschüttern ist.«
Jacob öffnete die Tür ihres Autos für sie und sagte: »Fortsetzung folgt.«
»Ja, Fortsetzung folgt. Aber ich muss sicher sein, dass wir hier an einem Strang ziehen.«
»Dass ich ihm nicht glaube?«
»Dass du mich, ganz gleich, was du glaubst, unterstützt und wir ihm klarmachen, dass wir enttäuscht sind und er sich entschuldigen muss.«
Jacob hasste das. Er hasste Julia, weil sie ihn zwang, Sam in den Rücken zu fallen, und er hasste sich selbst, weil er ihr nicht Paroli bot. Wäre noch Hass übrig gewesen, dann hätte der Sam gegolten.
»Na gut«, sagte er.
»Ja?«
»Ja.«
»Danke«, sagte sie beim Einsteigen. »Wir reden heute Abend weiter.«
»Okay«, sagte er und schloss die Tür. »Nimm dir so viel Zeit, wie du willst.«
»Und was, wenn der Tag zu kurz ist dafür?«
»Ich habe noch die HBO-Sitzung.«
»Welche Sitzung?«
»Aber erst um neunzehn Uhr. Hatte ich erwähnt. Vorher bist du bestimmt sowieso nicht zurück.«
»Wer weiß.«
»Schon ärgerlich, dass die am Wochenende stattfindet, aber sie dauert nur ein oder zwei Stunden.«
»Ist in Ordnung.«
Er drückte ihren Arm und sagte: »Genieße, was übrig ist.«
»Bitte?«
»Vom Tag.«
Die Heimfahrt verlief schweigend, abgesehen vom National Public Radio, dessen Allgegenwart aber auch den Charakter des Schweigens annahm. Jacob warf Sam im Rückspiegel einen Blick zu.
»Bin abgezischt und habe ’ne Dose von Ihrem Thunfisch gefuttert, Miss Daisy.«
»Hast du einen Schlaganfall oder so?«
»Filmzitat. Hätte auch Lachs sein können.«
Er wusste, dass er Sam eigentlich hätte verbieten müssen, auf dem Rücksitz das iPad zu benutzen, aber der arme Junge hatte heute Vormittag genug durchgemacht. Etwas Beruhigendes war da nur fair. Außerdem wurde so das Gespräch aufgeschoben, auf das er momentan keine Lust hatte und wahrscheinlich niemals haben würde.
Jacob hatte einen üppigen Brunch geplant, aber nach dem Anruf Rabbi Singers um neun Uhr fünfzehn bat er seine Eltern, Irv und Deborah, früher zu kommen, um auf Max und Benjy aufzupassen. Es würde keine mit Ricotta gefüllten Brioches geben. Es würde weder Linsensalat noch einen Salat aus gehobeltem Rosenkohl geben. Sondern Kalorien.
»Zwei Roggentoast mit cremiger Erdnussbutter, diagonal geschnitten«, sagte Jacob und reichte Benjy einen Teller.
Max schnappte sich das Essen. »Ist für mich.«
»Stimmt«, sagte Jacob und gab Benjy eine Schale, »denn du bekommt Honey Nut Cheerios mit einem Schuss Reismilch.«
Max betrachtete Benjys Schale. »Das sind Cheerios mit Honig drauf.«
»Ja.«
»Warum hast du ihn angelogen?«
»Danke, Max.«
»Und ich habe gesagt getoastet, nicht brandgeopfert.«
»Branntopfert?«, fragte Benjy.
»Verbrannt«, sagte Deborah.
»Was ist mit Camus?«, fragte Irv.
»Lass ihn«, sagte Jacob.
»Hey, Maxi«, sagte Irv und zog seinen Enkel an sich, »ich habe da von einem total irren Zoo gehört …«
»Wo ist denn Sam?«, fragte Deborah.
»Lügen ist böse«, sagte Benjy.
Max lachte auf.
»Guter Witz«, sagte Irv. »Oder?«
»Er hat Stubenarrest, weil er Ärger im Religionsunterricht hatte.« Und zu Benjy: »Ich habe nicht gelogen.«
Max äugte in Benjys Schale und sagte: »Du weißt, dass das nicht mal Honig ist. Sondern Agavendicksaft.«
»Mom soll kommen.«
»Sie darf sich heute erholen.«
»Von uns erholen?«, fragte Benjy.
»Aber nein. Von euch braucht sie keine Erholung, Jungs.«
»Erholt sie sich von dir?«, fragte Max.
»Einer meiner Freunde, Joey, hat zwei Dads. Aber Babys kommen doch aus Vaginalöchern. Warum?«
»Warum was?«
»Warum hast du mich angelogen?«
»Niemand hat niemanden angelogen.«
»Ich will einen Tiefkühlburrito.«
»Der Gefrierschrank ist kaputt«, sagte Jacob.
»Zum Frühstück?«, schlug Deborah vor.
»Zum Brunch«, berichtigte Max.
»Sí se puede«, sagte Irv.
»Ich könnte rasch einen besorgen«, sagte Deborah.
»Tiefgekühlt.«
Während der letzten Monate hatten sich Benjys Essgewohnheiten in Richtung dessen entwickelt, was man nicht realisierte Mahlzeiten nennen könnte: Tiefkühlgemüse (soll heißen: tiefgekühlt verspeist), ungekochter Haferbrei, ungekochte Ramen, Teig, rohes Quinoa, harte Makkaroni mit knochentrockenem Käsepulver. Jacob und Julia hatten niemals darüber gesprochen, nur die Einkaufsliste umgestellt; sie fanden die Sache psychologisch so bedeutsam, dass sie nicht daran rührten.
»Und was hat Sammy angestellt?«, fragte Irv, den Mund voller Gluten.
»Erzähle ich später.«
»Bitte einen Tiefkühlburrito.«
»Vielleicht gibt es kein später.«
»Er soll während des Unterrichts ein paar schlimme Wörter auf einen Zettel geschrieben haben.«
»Er soll?«
»Er streitet es ab.«
»Und? Hat er’s getan?«
»Keine Ahnung. Julia hält ihn für schuldig.«
»Als Eltern müsst ihr die Sache gemeinsam angehen, egal, wie es aussieht, egal, was ihr denkt«, sagte Deborah.
»Schon klar.«
»Hilf mir mal auf die Sprünge – was ist ein schlimmes Wort?«, fragte Irv.
»Das kannst du dir sicher vorstellen.«
»Kann ich nicht, nein. Schlimme Zusammenhänge allerdings schon …«
»Die Wörter passen bestimmt nicht in den Religionsunterricht.«
»Welche Wörter?«
»Ist das wirklich so wichtig?«
»Natürlich ist das wichtig.«
»Nein, das ist nicht wichtig«, sagte Deborah.
»Ich sage nur, dass das N-Wort darunter war.«
»Ich will einen Tiefkühl… Was ist das N-Wort?«
»Na, bist du jetzt zufrieden?«, fragte Jacob seinen Vater.
»Hat er es aktiv oder passiv benutzt?«, wollte Irv wissen.
»Erkläre ich dir später«, sagte Max zu seinem kleinen Bruder.
»Man kann das Wort nicht passiv benutzen«, sagte Jacob zu Irv. »Und du unterstehst dich«, sagte er zu Max.
»Vielleicht gibt es kein später«, sagte Benjy.
»Habe ich wirklich einen Sohn großgezogen, der ein Wort als das Wort bezeichnet?«
»Nein«, sagte Jacob, »du hast keinen Sohn großgezogen.«
Benjy ging zu seiner Großmutter, die ihm nichts abschlagen konnte. »Wenn du mich lieb hast, holst du mir einen Tiefkühlburrito und sagst mir, was das N-Wort ist.«
»Und der Zusammenhang?«, fragte Irv.
»Unwichtig«, sagte Jacob. »Und jetzt Schluss mit dem Thema.«
»Es gibt nichts Wichtigeres. Ohne Zusammenhang wären wir alle Monster.«
»N-Wort«, sagte Benjy.
Jacob legte Gabel und Messer weg.
»Schön. Wenn du es genau wissen willst: Der Zusammenhang besteht darin, dass Sam zusieht, wie du dich jeden Morgen in den Nachrichten bis auf die Knochen blamierst und jeden Abend in den Late-Night-Shows bis auf die Knochen blamiert wirst.«
»Du lässt deine Kinder zu viel Fernsehen gucken.«
»Sie schauen kaum welches.«
»Dürfen wir Fernsehen gucken?«, fragte Max.
Jacob ignorierte ihn und wandte sich wieder Irv zu: »Er hat Schulverbot, bis er sich zu einer Entschuldigung entschließt. Ohne Entschuldigung keine Bar Mizwa.«
»Und bei wem soll er sich entschuldigen?«
»Premium-Kabelsender?«, fragte Max.
»Bei allen.«
»Warum schickt ihr ihn nicht gleich nach Uganda und lasst sein Skrotum unter Strom setzen?«
Jacob gab Max einen Teller und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der nickte und stand auf.
»Er hätte das nicht tun dürfen«, sagte Jacob.
»Von seinem Recht auf freie Rede Gebrauch machen?«
»Recht auf gehässige Rede.«
»Hast du wenigstens bei einem Lehrer auf den Tisch gehauen?«
»Nein, nein. Auf keinen Fall. Wir hatten ein Gespräch mit dem Rabbi und sind jetzt voll im Rettet-die-Bar-Mizwa-Modus.«
»Ein Gespräch? Glaubst du, Gespräche wären in Ägypten oder Entebbe unsere Rettung gewesen? Ha! Plagen und Uzis. Gespräche sichern dir einen Spitzenplatz in der Schlange vor einer Dusche, die keine Dusche ist.«
»Himmel, Dad. Muss das sein?«
»Natürlich muss das sein. ›Always so never again‹.«
»Tja, warum überlässt du die Sache nicht mir?«
»Weil du einen so super Job machst?«
»Weil er Sams Vater ist«, sagte Deborah. »Und du nicht.«
»Die Scheiße des eigenen Hundes aufzusammeln ist die eine Sache«, sagte Jacob, »die des eigenen Dads eine andere.«
»Scheiße«, wiederholte Benjy.
»Könntest du Benjy oben etwas vorlesen, Mom?«
»Ich will bei den Erwachsenen bleiben«, sagte Benjy.
»Ich bin hier die einzige Erwachsene«, sagte Deborah.
»Bevor mir gleich der Kragen platzt«, sagte Irv, »würde ich gern wissen, ob ich dich richtig verstehe. Du behauptest, dass zwischen meinem missverstandenen Blog und Sams Problem mit dem ersten Zusatzartikel ein Zusammenhang besteht?«
»Niemand hat deinen Blog missverstanden.«
»Aber vollkommen falsch interpretiert.«
»Du hast geschrieben, Araber hassen ihre Kinder.«
»Stimmt nicht. Ich habe geschrieben, der Hass der Araber auf die Juden ist größer als ihre Liebe zu ihren Kindern.«
»Und dass sie Tiere sind.«
»Ja. Das habe ich geschrieben. Sie sind Tiere. Menschen sind Tiere. Das ist eine Frage der Definition.«
»Juden sind Tiere?«
»Nein, so einfach ist die Sache nicht.«
»Was ist das N-Wort?«, flüsterte Benjy seiner Großmutter zu.
»Nudel«, gab sie flüsternd zurück.
»Nein, ist es nicht.« Sie nahm Benjy auf den Arm und trug ihn aus dem Zimmer. »Das N-Wort ist nein«, sagte er, »stimmt’s?«
»Ja.«
»Nein, ist es nicht.«
»Ein Dr. phil. ist schon einer zu viel«, sagte Irv. »Sammy braucht jemanden, der ihn raushaut. Hier geht es um ein konkretes Problem mit dem Recht auf freie Rede, und wie du weißt oder wissen solltest, sitze ich nicht nur im nationalen Vorstand der American Civil Liberties Union, nein, die anderen Mitglieder erzählen meine Geschichte sogar an jedem Passahfest. Wärst du an meiner Stelle …«
»Dann würde ich mich umbringen, um meine Familie zu retten.«
»… dann würdest du in den Wassern von Adass Jisroel nach einem schlitzohrigen, monomanischen Anwalt fischen, der für das Vergnügen, die Bürgerrechte zu verteidigen, auf weltliche Genüsse verzichtet hat. Ich schimpfe so gern wie jeder andere über Ungerechtigkeiten, glaub mir, aber du bist nicht auf den Kopf gefallen, Jacob, und Sammy ist dein Sohn. Wenn du dir nicht hilfst, wirft dir das niemand vor, aber wenn du deinem Sohn nicht hilfst, verzeiht dir das keiner.«
»Du romantisierst Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie.«
»Hast du jemals Caros …«
»Ich habe die Verfilmung gesehen.«
»Ich versuche, meinem Enkel aus der Patsche zu helfen. Was ist daran so schlimm?«
»Vielleicht sollte ihm nicht geholfen werden.«
Benjy trottete wieder ins Zimmer: »Ist es Mutter?«
»Was ist Mutter?«
»Das N-Wort.«
»Mutter beginnt mit einem M.«
Benjy machte kehrt und trottete wieder hinaus.
»Deine Mutter sagt, dass ihr die Sache gemeinsam angehen müsst. Das ist Blödsinn. Du musst Sam verteidigen. Sollen sich andere den Kopf zerbrechen darüber, was wirklich passiert ist.«
»Ich glaube ihm.«
Und dann, als würde er ihre Abwesenheit erst jetzt bemerken: »Wo steckt Julia überhaupt?«
»Sie entspannt sich.«
»Entspannt sich? Wovon?«
»Sie spannt aus.«
»Danke schön, Frau Lehrerin, aber ich bin nicht taub. Wovon spannt sie aus?«
»Von an. Warum belässt du es nicht dabei?«
»Klar«, sagte Irv nickend. »Wäre eine Möglichkeit. Aber ich will dir eine Weisheit ins Ohr träufeln, die nicht mal die Jungfrau Maria kennt.«
»Ich kann’s kaum erwarten.«
»Nichts schafft sich von selbst aus der Welt. Entweder du erledigst die Sache, oder sie erledigt dich.«
»Soll ich etwa …?«
»Salomon war nicht perfekt. In der Geschichte der Menschheit hat sich noch nie was von allein erledigt.«
»Fürze schon«, sagte Jacob wie zu Ehren des abwesenden Sam.
»Dein Haus stinkt, Jacob. Du riechst es nur nicht, weil es deines ist.«
Jacob hätte darauf hinweisen können, dass in einem Radius von drei Zimmern ein Kothaufen von Argus lag. Das hatte er schon beim Öffnen der Haustür gerochen.
Benjy kam zurück. »Mir ist meine Frage wieder eingefallen«, sagte er, als hätte er die ganze Zeit wie verrückt versucht, sich daran zu erinnern.
»Ja?«
»Der Klang der Zeit? Was ist damit passiert?«
Eine Hand so groß wie Deine, Ein Haus so groß wie dieses
Julia ließ den Blick gern dorthin schweifen, wo kein Mensch hingelangte. Sie mochte unregelmäßiges Mauerwerk, das nicht verriet, ob die Handwerker meisterhaft oder schlampig gearbeitet hatten. Sie mochte die Begrenzung, in der ein Hauch von Weite mitschwang. Sie schätzte Blicke, die nicht durch ein Fenster beschränkt wurden, bedachte aber auch gern, dass jeder Blick von vorneherein beschränkt ist. Sie mochte Türknäufe, die man nicht mehr loslassen will. Sie ging gern treppauf und gern treppab. Sie mochte Schatten, die auf andere Schatten fielen. Sie mochte Frühstücksbankette. Sie mochte Laubwälder (Buche, Ahorn), aber keine »männlichen« Wälder (Walnuss, Mahagoni), sie hatte für Stahl nichts übrig, zumal für die rostfreie Variante, die sie nur in stark zerkratztem Zustand erträglich fand. Imitationen natürlicher Werkstoffe fand sie unsäglich, doch wenn die Künstlichkeit kenntlich gemacht worden war, konnten diese durchaus schön sein. Sie mochte Texturen, die den Augen fremd, Fingern und Füßen aber vertraut waren. Sie mochte Kamine mitten in Küchen, die mitten im Wohnbereich lagen. Sie hatte gern mehr Bücherregale als nötig. Sie mochte Oberlichter in Duschen, aber nirgendwo sonst. Sie mochte beabsichtigte kleine Makel, Nachlässigkeit aber nicht, rief sich allerdings gleichzeitig gern ins Bewusstsein, dass ein absichtlicher Makel ein Ding der Unmöglichkeit war. Die Menschen glauben fälschlicherweise, dass etwas, das gut aussieht, auch für ein gutes Gefühl sorgt.
du flehst mich an, deine enge fotze zu ficken, aber du hast es noch nicht verdient
Sie mochte keine gleichförmigen Strukturen – diese entsprachen nicht der Beschaffenheit der Dinge. Sie mochte keine mitten im Zimmer liegenden Teppiche. Gute Architektur sollte einem das Gefühl geben, man sei in einer Höhle mit Blick auf den Horizont. Sie mochte keine Räume, die doppelt so hoch waren wie normal. Zu viel Glas war ihr zuwider. Ein Fenster diente nicht dazu, den Blick zu rahmen, sondern Licht hereinzulassen. Eine Decke sollte stets so hoch sein, dass der größte Bewohner, auf Zehenspitzen stehend, mit den Fingern nicht ganz heranreichte. Sie mochte keine sorgsam platzierten Ziergegenstände – Dinge sollten an Orten stehen, an die sie nicht gehörten. Eine dreieinhalb Meter hohe Decke war zu hoch. Sie löste ein Gefühl der Verlorenheit, der Einsamkeit aus. Eine drei Meter hohe Decke war zu hoch. Denn alles schien außer Reichweite zu sein. Zweieinhalb Meter waren zu hoch. Etwas, das sich gut anfühlt – sicher, bequem, praktisch –, kann auch so gestaltet werden, dass es gut aussieht. Sie mochte weder Deckenstrahler noch Lampen mit Wandschalter – etwa Kandelaber, Kronleuchter, alles Überkandidelte. Sie hielt nichts davon, Gegenstände zu verstecken – Kühlschränke hinter Paneelen, Toilettenartikel hinter Spiegeln, in Schränken versenkbare Fernseher.
du bist noch nicht heiß genug
ich will sehen, wie es auf dein arschloch tropft
Wie jeder Architekt träumt auch jede Frau davon, ein eigenes Haus zu bauen. Julia war bei dem Anblick eines kleinen Parkplatzes oder einer unerschlossenen Parzelle immer schon in Verzückung geraten: Potenzial. Wofür? Um etwas Schönes zu bauen? Etwas Kluges? Neues? Oder einfach ein Haus, das sich wie ein Zuhause anfühlte? Ihre Freuden waren nicht vollständig die ihren, denn sie wurden geteilt, doch die Verzückung gehörte ihr allein.
Sie hatte nie Architektin werden, aber stets ein eigenes Zuhause schaffen wollen. Sie warf Puppen weg, um die Kartons zu befreien, in denen sie verpackt waren. Sie verbrachte einen Sommer damit, sich unter ihrem Bett einzurichten. In ihrem Zimmer lag alles voller Kleider, weil sie fand, dass Schränke Besseres verdient hatten, als vollgestopft zu werden. Sie begriff erst, wer »sie selbst« war, als sie begann, eigene Häuser zu entwerfen – stets auf dem Papier, jedes Anlass zu Stolz und Beschämung.
»Wirklich toll«, sagte Jacob, als sie ihm den Grundriss erklärte. Julia ließ ihn nur dann an ihrer Arbeit teilhaben, wenn er sie ausdrücklich darum bat. Sie wollte zwar kein Geheimnis daraus machen, fühlte sich aber stets gedemütigt, nachdem sie ihn einbezogen hatte. Er zeigte nie genug Begeisterung, jedenfalls nicht auf die richtige Weise. Und wenn seine Begeisterung erwachte, kam diese ihr vor wie ein Geschenk mit zu kostbarer Schleife. (Das »wirklich« machte alles kaputt.) Er sparte sich die Begeisterung für die nächste Gelegenheit auf, bei der sie sich darüber beklagte, dass er nicht genug Begeisterung für ihre Arbeit zeigte. Außerdem fühlte sie sich gedemütigt, weil sie seine Begeisterung brauchte, ja ersehnte.
Sind solche Wünsche und Bedürfnisse falsch? Nein. Und die gewaltige Kluft zwischen der lange gehegten Vorstellung und dem Erreichten bedeutet noch lange nicht, dass man versagt hätte. Enttäuschung muss nicht unbedingt enttäuschend sein. Die Wünsche, die Bedürfnisse, die Kluft, die Enttäuschung: wachsend, wissend, einander vertrauend, gemeinsam alternd. Man kann wunderbar allein leben, nur kann man so kein Leben führen.
»Toll«, sagte er und bückte sich so tief, dass seine Nase fast den zweidimensionalen Entwurf ihrer Fantasie berührte. »Echt erstaunlich. Wie denkst du dir so was aus?«
»Ich weiß gar nicht, ob ich mir viel dabei denke.«
»Und was ist das? Ein Innengarten?«
»Ja. Die Treppe führt um einen Lichtschacht nach oben.«
»Sam würde sagen: ›Schicht im Schacht …‹«
»Und du würdest lachen, und ich würde es ignorieren.«
»Vielleicht würde ich es ja auch ignorieren. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig super.«
»Danke.«
Jacob berührte den Grundriss, ließ den Finger über mehrere Zimmer wandern, benutzte immer die Türen. »Ich weiß, dass ich diese Pläne nicht ganz verstehe, aber wo schlafen die Kinder?«
»Wie meinst du das?«
»Vielleicht sehe ich die Sache falsch, aber wenn mich nicht alles täuscht, gibt es nur ein Schlafzimmer.«
Julia legte den Kopf schief, kniff die Augen zusammen.
Jacob fragte: »Kennst du den von dem Paar, das sich nach achtzig Jahren scheiden lässt?«
»Nein.«
»Alle fragen: ›Warum jetzt? Warum nicht vor Jahrzehnten, als ihr noch genug Lebenszeit hattet? Könnt ihr denn nicht bis zum Schluss durchhalten?‹ Und die beiden antworten: ›Wir wollten warten, bis unsere Enkel tot sind.‹«
Julia mochte Tischrechner mit Druckfunktion – gleichsam die Juden des Schreibwarenladens, die zahllose verheißungsvollere Büromaschinen überdauert hatten –, und während die Kinder ihre Utensilien zusammensuchten, druckte sie am laufenden Meter Berechnungen aus. Einmal kalkulierte sie, wie viele Tage es noch dauern würde, bis Benjy aufs College ginge. Sie ließ die Rechnung da, als Beweis.
Ihre Häuser waren nur ein dummer, kleiner Zeitvertreib, ein Hobby. Sie und Jacob hätten niemals genug Geld und weder genug Zeit noch Kraft für ein solches Projekt. Außerdem hatte sie sich lange genug mit Wohnarchitektur beschäftigt, um zu wissen, dass das Bestreben, ein paar zusätzliche Tröpfchen Glück herauszuquetschen, unweigerlich zur Zerstörung jenes Glücks führte, das man bereits genoss, aber leider nie zu würdigen wusste. So ist es immer: Eine neue Küche für $ 40000 wird zu einer neuen Küche für $ 70000 (weil jeder meint, kleine Unterschiede wären der große Unterschied), wird zu einer neuen Tür in den Garten (weil die neue Küche heller sein soll), wird zu einem neuen Bad (weil der Bereich sowieso schon wegen Umbauarbeiten gesperrt ist), wird zu einer blödsinnigen Neuverkabelung des Hauses, das unbedingt smart sein soll (damit die Musik in der Küche mit dem Smartphone gesteuert werden kann), wird zu passiver Aggression, weil man sich nicht einigen kann, ob die neuen Bücherregale Beine haben sollen (um den Schmuckrand des Parkettfußbodens zu zeigen), und dann zu aktiver Aggression, deren Ursprung niemand mehr kennt. Man kann das perfekte Haus bauen, aber nicht darin leben.
gefällt dir meine zunge in deiner engen möse?
zeig’s mir
sperma auf meinen lippen
Kurz nach ihrer Heirat verbrachten sie eine Nacht in einer Pension in Pennsylvania. Sie teilten sich einen Joint – für beide war es der erste seit dem College –, lagen nackt im Bett und versprachen einander, alles zu teilen, ausnahmslos, ohne Rücksicht auf Scham oder Verlegenheit oder mögliche Verletzungen. Es schien das ehrgeizigste Versprechen zu sein, das zwei Menschen einander geben konnten. Das Aussprechen geheimster Wahrheiten fühlte sich an wie eine Offenbarung.
»Keine Ausnahmen«, sagte Jacob.
»Eine einzige würde alles untergraben.«
»Bettnässen. Solche Sachen.«
Julia ergriff Jacobs Hand und sagte: »Weißt du, wie sehr ich dich für ein solches Geständnis lieben würde?«
»Ich bin kein Bettnässer, nebenbei gesagt. Ich versuche nur, einen Rahmen vorzugeben.«
»Kein Rahmen. Das ist das Entscheidende.«