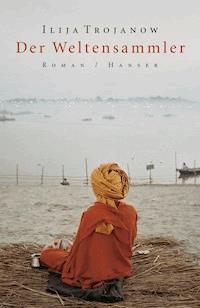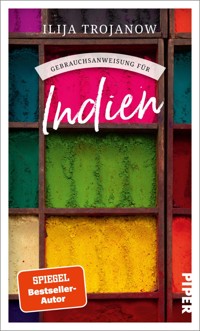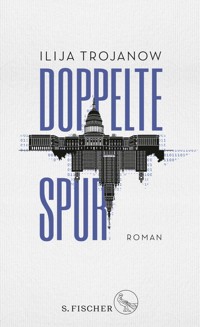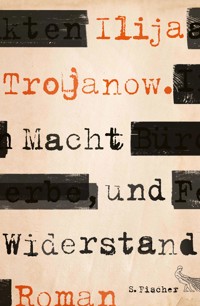12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gegen Profit und Heuchelei: Für Hilfe, die wirklich hilft! Ein Bettler in der Fußgängerzone: Spenden oder nicht? Helfen auf diese Art ist immer zweischneidig: Man hilft kurzfristig und hat ein gutes Gewissen. Langfristig ändert man aber nichts. Thomas Gebauer und Ilija Trojanow hinterfragen in ihrem Buch die vielen Facetten der Wohltätigkeit, von den Aktivitäten der Superreichen über die staatlichen Hilfen bis hin zu lokalen Initiativen. Ausgehend von konkreten Beispielen aus der ganzen Welt, die in Originalreportagen u.a. aus Sierra Leone, Pakistan oder Guatemala beschrieben werden, durchdenken sie das ganze System des Helfens und zeigen, was funktioniert und was nicht. Denn eines tut Not: ein kritischer Hilfsbegriff, der zur Selbsthilfe animiert und dennoch grundsätzliche Veränderungen ermöglicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ilija Trojanow | Thomas Gebauer
Hilfe? Hilfe!
Wege aus der globalen Krise
Über dieses Buch
Ein Bettler in der Fußgängerzone: Spenden oder nicht? Helfen auf diese Art ist immer zweischneidig: Man hilft kurzfristig und hat ein gutes Gewissen. Langfristig ändert man aber nichts. Thomas Gebauer und Ilija Trojanow hinterfragen in ihrem Buch die vielen Facetten der Wohltätigkeit, von den Aktivitäten der Superreichen über die staatlichen Hilfen bis hin zu lokalen Initiativen. Ausgehend von konkreten Beispielen aus der ganzen Welt, die in Originalreportagen u.a. aus Sierra Leone, Pakistan oder Guatemala beschrieben werden, durchdenken sie das ganze System des Helfens und zeigen, was funktioniert und was nicht. Denn eines tut Not: ein kritischer Hilfsbegriff, der zur Selbsthilfe animiert und dennoch grundsätzliche Veränderungen ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. ›Die Welt ist groß und Rettung lauert überall‹, ›Der Weltensammler‹ und ›Eistau‹ sowie seine Reisereportagen wie ›An den inneren Ufern Indiens‹ sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman ›Macht und Widerstand‹ und sein Sachbuch-Bestseller ›Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen‹.
Thomas Gebauer, geboren 1955, studierte Psychologie und Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach dem Diplom arbeitete er für die Hilfsorganisation medico international, deren Geschäftsführer er seit 1996 ist. 2014 wurde er mit der Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main ausgezeichnet. Er war einer der beiden Initiatoren der 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten »Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490636-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Zwischen Himmel und Ebbe
Geben und nehmen
Krise als Normalfall
Das Dilemma der Hilfe
Katastrophale Chancen. Pakistan
Überleben oder leben
Menschenrechte und Hilfe
Investitionsfreundliche Menschenrechte?
Das Recht, Rechte zu haben
Die Menschenrechte gelten nicht für die Verteidiger der Menschenrechte
Ewiges Provisorium. Kenia
Herrschaft und Hilfe
Politik der Entpolitisierung
Die Herrschaft der Berater
Imperiale Lebensweise
Der permanente Krieg. Sierra Leone
Wo die Menschen im Weg sind
Vom Kampf gegen den Bergbauriesen
Land grabbing
Die Stigmatisierung der Überlebenden
Das Bürgermanifest
Geld und Hilfe
Das Geschäft mit der Armut
Der »social business dollar«
Die große Hilfsmesse
Anreize für private Kapitalgeber
Impact Bonds oder »wirkungsorientiertes Spenden«
Philanthrokapitalisten
»Jeder Außenseiter ist nur vorübergehend anwesend.« Mexiko
Die Karawane der Mütter
La 72 – ein Refugium
Helfen? Nein. Gemeinsam kämpfen? Ja!
Die Zukunft zurückerobern
Fatale Strategien
An runden Tischen sitzen
Mit NGOs Staat machen
Die Unsicherheit absichern
Flüchtlinge bekämpfen
Fit für die Katastrophe werden
Güte optimieren
Unmittelbarkeit fingieren
Umkämpfte Vergangenheiten. Guatemala
Eine Oase des Aufbruchs
Wenn die Erde spricht
Die Zukunft ist sichtbar. Nicaragua
Neue Räume des Widerstands
Es geht auch anders
Radikaler Reformismus
Selbstorganisation
Globalisierung von unten
Globale soziale Rechte
Soziales Eigentum
Der Erfolg einer Kampagne
Globale Bürgerversicherung
Transformation der kapitalistischen Lebensform
Ein neues Narrativ
Danksagung
Zwischen Himmel und Ebbe
Ein sanfter Abend in den Subtropen. Lichtergirlanden erleuchten die Wipfel der ausladenden Bäume vor einer altehrwürdigen Stadtvilla, eine Brise streicht über Terrasse und Rasen. Diskret reichen Kellner Mineralwasser, Saft, Bier und Wein. Die Gespräche plätschern vornehm dahin, bis das Mikrophon knackst und eine Stimme um Aufmerksamkeit bittet.
Mit starkem Schweizer Akzent werden die Anwesenden, Vertreter von Kultur, Wirtschaft und Politik, zur feierlichen Eröffnung einer Ausstellung begrüßt: »We the People. We the Arts: Promoting Zero Hunger«. Stolz verweist der Generalkonsul auf den Ausstellungskatalog, den die Vereinten Nationen zusammen mit der Schweizer Botschaft und der Swiss Agency for Development and Cooperation herausgegeben haben, gesponsert von Nestlé (Mineralwasser), Novartis (Arzneimittel), Syngenta (Saatgut) sowie Serena (Luxushotellerie). Großzügiger Applaus hebt an für die Kunststudierenden und ihre düsteren Bilder. Es gibt noch viele Fische im Meer ist das Gemälde eines abgenagten Fischskeletts sarkastisch betitelt. Die zwei Seiten besteht aus zwei Tellerhälften, die eine auf einem schönen karierten Tischtuch mit einer Vielzahl von Erbsen, die andere auf monoton brauner Fläche mit einer einzigen Erbse. Die Kehrseite des Hungers, doziert derweil der Generalkonsul, seien der Überfluss und die alltägliche Verschwendung von Nahrungsmitteln. Auf einem der Bilder isst ein ausgemergeltes Kind ein Buch auf, es stopft sich das Papier in den Mund und kaut. Der Generalkonsul stößt mit einem Glas Fendant auf den Erfolg der Ausstellung und des Kampfes gegen den Hunger an.
Die zweite Rednerin des Abends ist die Vertreterin der UN, eine elegante, hoch aufgeschossene Frau. Für eine Welt ohne Hunger zu streiten, sagt sie, sei ein großartiges Ziel und dessen Verwirklichung zum Greifen nah. Dank der »UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung«, den »Sustainable Development Goals« (SDGs), die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden, erarbeitet in einem mehrjährigen Prozess, an dem auch zivilgesellschaftliche Organisationen mitgewirkt haben. 17 Ziele mit 169 Unterzielen, erklärt die Rednerin, darunter die Bekämpfung von Armut und Hunger, die Förderung von gesunden Lebensverhältnissen, die Verbesserung der Bildung und gute Arbeit für alle. All das, konstatiere die Agenda, sei nur möglich, wenn zugleich die Ungleichheit bekämpft werde, wenn Frieden und Rechtsstaatlichkeit herrschten, wenn der Klimaschutz vorangetrieben und nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen zum Tragen kämen. Endlich – ihre Stimme hebt druckvoll an – habe man eine Strategie, die alle Länder gleichermaßen auf das Ziel »Zero Hunger« verpflichte. Nun könnten die globalen Missstände an der Wurzel gepackt werden. »Leave no one behind«, laute das Motto der Agenda, niemand dürfe zurückgelassen werden. Der Optimismus der Rednerin zieht sich in die Länge, manche der Gäste beginnen zu tuscheln.
Der Abend könnte auch am Genfer See stattfinden, würde die Sonne nicht hinter Mangroven untergehen, würde das Wasser nicht stinken. Der Empfang findet an einem zur Kloake verkommenen Nebenarm des Hafens von Karachi statt. Im Hintergrund ragen die Umrisse von Kränen und Schloten in den nächtlichen Himmel. Karachi, das industrielle Zentrum Pakistans, hat wenig von der selbstzufriedenen Beschaulichkeit Genfs.
Das opulente Büfett bietet europäisches Essen. Unmengen an Frikassee, Gemüsegratin und Kartoffelbrei bleiben übrig; die pakistanischen Gäste fühlen sich eher zur Bar hingezogen. Im Hintergrund, unter einem der alten Bäume, stehen drei junge Menschen in grünen T-Shirts, die aufmerksam das Geschehen beobachten. Sie warten auf ihren Einsatz. Sarah, Anam und Sumaya sind Aktivisten der örtlichen Robin Hood-Armee, einer 2014 in Indien gegründeten Organisation. Eine Armee, die den Überfluss requiriert: Sobald das Büfett abgetragen wird, übernehmen sie die Reste und verteilen diese über selbstorganisierte lokale Netzwerke an Hungerleidende. So wie die »Tafeln«, die in Deutschland und Österreich wie Pilze aus dem nahrhaften Boden der Bedürftigkeit sprießen.
Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) leiden vierzig Prozent der Kinder Pakistans an Unterernährung, knapp die Hälfte der Bevölkerung an Ernährungsunsicherheit, was bedeutet, dass sie nicht jederzeit Zugang zu qualitativ und quantitativ ausreichendem Essen haben. Nicht, weil es zu wenig gäbe. Pakistan ist der achtgrößte Weizenproduzent der Welt, aber die Hälfte der Bevölkerung, mithin neunzig Millionen Menschen, wissen nicht, ob sie morgen etwas zu essen haben werden.
Zweifellos ist es sinnvoll, die Verschwendung von Nahrung zu mindern. Die Aktivisten der Robin Hood-Armee suchen nach technischen Lösungen. Man müsse die Verteilung der Überreste besser organisieren, sagen sie. Hilfreich wäre etwa eine Liste von Restaurants, die regelmäßig verwertbare Abfälle produzieren. Die Verpflegung der Bedürftigen müsse systematisiert werden. Wieso aber haben sie sich nach Robin Hood benannt? Hat dieser jemals nach einem Gelage des Sheriffs von Nottingham angenagte Fasanenschenkel an die Bewohner von Sherwood Forest verteilt? Die Aktivisten schmunzeln. Na ja, der hätte wohl das gesamte Büfett abgeräumt.
Es ist keineswegs so, dass Sarah, Anam und Sumaya keine Notwendigkeit sähen, über bloße Wohltätigkeit hinauszugehen, die Verhältnisse grundsätzlich zu ändern. Zwar gibt es inzwischen Robin Hood-Ableger in über vierzig asiatischen Städten, die etwa zwei Millionen Menschen unterstützen, eine beachtliche logistische Leistung in derart kurzer Zeit. Doch sie hegen keine Illusionen, dass ihr Engagement ausreicht, um den Ernährungsmangel zu überwinden. Zumal die Hungernden größtenteils dort leben, wo es weder Botschaftsempfänge noch Restaurants gibt. Die Menschen auf dem Land in Südasien haben noch nie etwas von der Robin Hood-Armee gehört.
Die Aktivisten sind überzeugt, dass es zu einer nachhaltigen Bekämpfung des Hungers auch grundsätzlicher Eingriffe in bestehende Ungleichheiten und Machtverhältnisse bedarf. Kein halbwegs vernünftiger Mensch könnte dem Prinzip widersprechen, dass es besser wäre, den Hunger zu beseitigen, anstatt die Hungernden zu füttern. Sie bilden sich nicht ein, mit ihren Aktionen den strukturellen Ursachen von Hunger und Armut beizukommen. Und trotzdem: Sie engagieren sich für den Tropfen auf den heißen Stein, weil dieser Tropfen zu verwirklichen ist, im Gegensatz zu umwälzenden Veränderungen, die ihnen unerreichbar erscheinen.
»Gib dem Hungernden einen Fisch, und er ist für einen Tag satt; lehre ihn fischen, und er wird immer satt sein«. Lange Zeit stand dieses Motto hoch im Kurs, in den Augen vieler heutiger Aktivisten wirkt es ein wenig angestaubt, auf jeden Fall unrealistisch. Auch in Deutschland. Wer heute Not und Ungerechtigkeit bekämpft, fordert selten die bestehenden Verhältnisse heraus. Die modernen Heldinnen zivilgesellschaftlichen Engagements halten sich nicht lange mit dem politischen Kontext auf, sondern packen gleich an. Wo früher die Vorstellung von einer anderen, einer besseren Welt zum Handeln motivierte, herrscht heute ein unpolitischer Pragmatismus, der nicht grundsätzlich verändern will, keine Partei ergreifen möchte. Viele Helfer stört es denn auch nicht, wenn sie nur wenig über die Menschen wissen, mit denen sie es zu tun haben. Ihre Hilfe folgt technischen oder formellen Kriterien und erhebt gar nicht erst den Anspruch, in Notleidenden mehr als Objekte einer möglichst effizienten Versorgung zu sehen.
Und die UN-Diplomatin, deren Organisation ein Menschenrecht auf Ernährung propagiert? Wären zu dessen Verwirklichung nicht Eingriffe in die bestehenden weltwirtschaftlichen Strukturen nötig? Studiert man das »Kleingedruckte« der SDG-Agenda 2030, die Passagen, in denen die »means of implementation« (die Mittel zur Umsetzung) ausbuchstabiert werden, gerät man ins Grübeln. Denn die hochgesteckten Ziele sollen nicht über eine gerechtere Verteilung vorhandener Ressourcen verwirklicht werden, sondern allein durch Wirtschaftswachstum. Wobei jedes Land für die benötigten, milliardenschweren Investitionsmittel selber aufkommen muss. Selbstverständlich unter Respektierung aller existierenden internationalen Regeln und Verpflichtungen, die – schaut man nur auf die Freihandelsabkommen – den politischen Handlungsspielraum gerade der ärmeren Länder sehr einschränken. Regeln zur Bekämpfung von Steuerflucht und Korruption sind während der Verhandlungen am Veto mächtiger Industriestaaten gescheitert. Bei der wichtigen Frage des Umgangs mit den Schulden gab es sogar einen Rückschritt. Hieß es in früheren globalen Vereinbarungen noch, dass beide Seiten, die Schuldner wie die Gläubiger, gemeinsam Verantwortung tragen, sind es nun in erster Linie die Schuldner. Wie üppig muss das weltweite Büfett ausfallen, damit genug für alle Hungernden abfällt?
Rasch haben die netten jungen Leute von der Robin Hood-Armee alle Überreste abgeräumt. Inzwischen ist Ebbe und am Hafen von Karachi stinkt es zum sternenklaren Himmel.
Im Februar 2017 haben wir in Pakistan die Aktivisten der Robin Hood-Armee kennengelernt. Im Oktober 2017 sind wir erst nach Kenia, dann nach Sierra Leone gereist, im Januar 2018 durch Mittelamerika, von Mexiko bis nach Nicaragua. Dazwischen waren wir in Brüssel auf der AidEx, der größten Messe für Hilfsgüter, und in den Büros von deutschen Hilfsorganisationen und Entscheidungsträgern. Wir haben auf vier Kontinenten misslungene wie auch gelungene Ansätze von Hilfe recherchiert. In diesem Buch beschreiben wir sowohl Möglichkeiten der Veränderung wie auch ihre strukturelle Verhinderung. Wir erzählen von Formen solidarischer Praxis, die aufzeigen, dass es auch anders geht.
Seit Jahrzehnten beobachten wir die sozialen und politischen Entwicklungen weltweit, Thomas Gebauer als Geschäftsführer von medico international, einer sozialmedizinischen Hilfsorganisation, von innen, Ilija Trojanow als Schriftsteller von außen. Thomas Gebauer stieß zu medico, als in Mittelamerika revolutionäre Bewegungen einen radikalen Neuanfang zu erkämpfen suchten. Die Idee nationaler Befreiung ist zwar gescheitert, der Widerstand aber wird, wie wir schildern, auf anderen Ebenen weitergeführt. Ilija Trojanow hat lange Jahre in verschiedenen Ländern Afrikas und in Indien gelebt und die dortigen Transformationsprozesse als Publizist begleitet. Thomas Gebauer hat als einer der Initiatoren die »Internationale Kampagne zum Verbot von Landminen« mitorganisiert, die 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Aus einer Reihe von privaten und öffentlichen Gesprächen heraus entstand die Idee, unsere unterschiedlichen Perspektiven und gemeinsamen Überzeugungen in ein Buch fließen zu lassen, das anhand des Phänomens »Hilfe« sowohl die Gründe für die Verschärfung der globalen Krisen wie auch mögliche Auswege aufzeigt.
Gegenwärtig herrscht eine merkwürdige Mischung aus Hoffnungslosigkeit und Goldgräberstimmung. Wie der Schriftsteller William Gibson geschrieben hat, ist »die Zukunft schon vorhanden, nur ungleichmäßig verteilt.« Milliarden von Menschen kennen keinen anderen Horizont als ihren täglichen Überlebenskampf, während die global handelnden Eliten überall und in allen Lebensbereichen Chancen der Privatisierung, Wertabschöpfung und Gewinnerhöhung erkennen. Während also den Vielen die Zukunft abhandengekommen ist, schlachten die Privilegierten fette Gänse, die sie nicht selbst gemästet haben.
Die Einsicht in die unerträgliche Ungerechtigkeit der real herrschenden Verhältnisse ist inzwischen weit verbreitet, auch bei uns, die Bereitschaft dagegen zu kämpfen hingegen schwach ausgeprägt. Dieses Buch richtet sich vor allem gegen diesen Missstand.
Wenn Menschen in Not die Initiative ergreifen – das haben wir immer wieder erfahren –, wenn sie sich selbst organisieren, dann scheinen die Grundzüge einer anderen Welt auf, in der Ideen von demokratischer Teilhabe, von Gemeingütern und einer allen zugänglichen, gerechten Daseinsvorsorge verwirklicht sind.
Geben und nehmen
Wohltätigkeit ist die Ersäufung des Rechts
im Mistloch der Gnade.
Johann Heinrich Pestalozzi
Eine alte Parabel erzählt von einem stattlichen Mann, weder jung noch alt, der eines Tages auf feuchtem Untergrund ausrutschte und in einen See fiel. Er schrie sogleich um Hilfe, denn er konnte nicht schwimmen. Passanten liefen am Ufer zusammen und reckten ihm die Arme entgegen: »Gib uns deine Hand!«, riefen sie ihm zu. Der Mann aber schrie weiter und machte keine Anstalten, eine der gereichten Hände zu ergreifen. Bis ein Weiser des Weges kam, ans Ufer trat und sich weit nach vorn beugte. »Nimm meine Hand, hier, nimm sie!« Worauf der Ertrinkende mit allerletzter Kraft die rettende Hand umklammerte und ans Ufer gezogen wurde.
Geben ist seliger als nehmen, heißt es in der Apostelgeschichte. Wer anderen selbstlos zur Seite steht, tut Gutes. Und wer Gutes tut, wird im Himmel belohnt. Das System, in dem wir leben, hat uns aber nicht auf geben, sondern auf Akquise und Akkumulation eingeschworen – von Geiz und Gier ganz zu schweigen –, weswegen selbst ein vom Ertrinken Bedrohter das Geben verweigert. Doch trotz des allherrschenden Turbokapitalismus, trotz der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, gilt vielen das Helfen noch als gut: Wer hilft, ist ein besserer Mensch, eine Gesellschaft, in der viel geholfen wird, ist eine vermeintlich bessere Gesellschaft.
Geben ist traditionell in allen Kulturen hoch angesehen. Ob im Judentum, im Hinduismus oder im Islam – wer nicht einen festgelegten Teil seines Vermögens unter den Notleidenden und Bedürftigen verteilt, verstößt gegen ein Gottesgebot. Lange Zeit galten Zinsen und Profitgier als des Teufels, Habsucht als Sünde. Der gemeine Mensch hatte sich mit einem bescheidenen Lebensunterhalt zu begnügen. Heute ist diese Sicht auf den Kopf gestellt und das Anhäufen von Vermögen als Ziel allen Wirtschaftens mitunter sogar theologisch legitimiert, etwa bei vielen evangelikalen Gruppierungen. Aber ein Unbehagen am eigenen Wohlstand bleibt bestehen, weswegen erfolgreiche Geschäftsleute und Unternehmer seit Jahrhunderten ihre selbstsüchtigen »Sünden« durch soziale Stiftungen ausgleichen.
Stellvertretend für den schneidenden neuen Wind des Paradigmenwechsels erhob der Ulmer Militärtheoretiker Leonhard Fronsperger 1564 in seinem Werk »Von dem Lob des Eigen Nutzen« den Egoismus zum zentralen und segensreichen Antrieb menschlichen Wirkens. Er war ein Vorläufer des einflussreichen Niederländers Bernard Mandeville, der 1714 in seiner »Bienenfabel« das Laster, die Gier, als den entscheidenden Brennstoff ertragreichen Wirtschaftens und des Gemeinwohls ausmachte (»Das Laster des einen ist das Wohl der vielen.«). Es dauerte eine Weile, bis Adam Smith diese »Einsicht« in die Motive des Menschen mit der Notwendigkeit regulierender ethischer und staatlicher Prinzipien vereinte.
Heute ist Wohltätigkeit der kleinste gemeinsame Nenner sozialen Engagements. 2015 spendeten die Deutschen die Rekordsumme von 7,1 Milliarden Euro, fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr. In den USA, dem reichsten Land der Welt, beträgt die Wohltätigkeit seit 1970 etwa zwei Prozent des Bruttosozialprodukts, zuletzt entsprach dies in etwa 300 Milliarden Dollar. Selbst hartgesottene Zyniker werden sentimental bei dem Gedanken an das viele Geld, das für gute Zwecke gesammelt wird, nicht nur zur Weihnachtszeit. Profiteure des real existierenden Finanzkapitalismus treffen sich allmonatlich bei charity events und überbieten sich gegenseitig bei Auktionen, deren Erlös einer Kinderhilfe oder Bildungseinrichtung zugutekommt. Spenden, einst religiöse Pflicht, ist zur neoliberalen Kür geworden, mit Aplomb inszeniert und zelebriert.
Das gilt auch für die internationale Hilfe. Kaum jemand zweifelt, dass es ihrer bedarf, wenn auch seit Jahrzehnten eifrig um ihre Verwendung gestritten wird. Um das richtige Maß. Inzwischen hat sich die willkürlich herbeigezauberte Größe von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens als hehres Ziel der Entwicklungshilfe etabliert. Einige Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien, haben diese Zahl sogar gesetzlich verankert. Doch auch dieses fiskalische Versprechen ist doppelgesichtig: nicht nur von der vielzitierten »moralischen Verantwortung« gegenüber den ärmsten Ländern bestimmt – jeder Politiker muss vor seinen Wählerinnen und Wählern schließlich Herz zeigen –, sondern auch von der Überzeugung, dass gezielte Hilfe im aufgeklärten Eigeninteresse der reichen Länder liegt, weil im 21. Jahrhundert Handel, Sicherheit, Armutsbekämpfung und globale Stabilität eng miteinander verwoben sind.
Seit es organisierte Hilfe gibt, wird sie für eigennützige Zwecke instrumentalisiert. Friedrich von Bodelschwingh, Gründer der Bethel-Stiftungen, des größten diakonischen Unternehmens in Europa, hat unverblümter als viele andere zum Ausdruck gebracht, wie sehr jedes karitative Werk sozialpolitische und staatstragende Aufgaben erfüllt. In einem Brief an den preußischen Kronprinzen aus dem Jahre 1885 schrieb er: »Gelingt es, dass in dreißig bis vierzig Jahren jeder fleißige Fabrikarbeiter vor seiner eigenen Hütte unter seinem eigenen Apfelbaum umgeben von seiner Familie sein Abendbrot essen kann, dann ist die Sozialdemokratie tot, und der Thron der Hohenzollern ist auf Jahrhunderte gesichert.«
Aus solchen Überlegungen heraus stellt der »Westen« jährlich etwa 135 Milliarden Dollar als »offizielle Entwicklungshilfe« bereit. In den letzten fünfzig Jahren kam eine Summe von etwa fünf Billionen Dollar zusammen. Das klingt nach viel Geld – bis man den Betrag mit anderen Ausgaben vergleicht: Allein die Kriege in Irak und Afghanistan haben die USA nach seriösen Schätzungen eine ähnlich hohe Summe gekostet. Die Finanzkrise von 2008 hat nach einer Studie der Asiatischen Entwicklungsbank weltweit Vermögenswerte im Umfang von 50 Billionen Dollar vernichtet. Und die Subventionen der Landwirtschaft in den Industrieländern des Nordens fallen doppelt so hoch aus – jährlich! Der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung betrug zuletzt 8,5 Milliarden Euro, die Rüstungsexporte beliefen sich auf 6,2 Milliarden Euro und die Ausgaben des Verteidigungsministeriums auf 37 Milliarden Euro (2017).
Nicht nur sind die Beträge für Entwicklungshilfe, über die so eifrig diskutiert wird, bescheiden, sie verblassen zudem, wenn man sie in Beziehung setzt zu anderen Geldflüssen. Die OECD schätzt, dass arme Staaten dreimal mehr durch Steuerhinterziehung verlieren (ein Kapitalfluss, der nach dem Gesetz der Finanzgravitation von den ärmeren in die reicheren Staaten strömt), als sie Entwicklungshilfe erhalten. Würden wir also die Steueroasen schließen, wäre den armen Ländern viel mehr geholfen.
Denn trotz des staatlichen und privaten Hilfsaufgebots ist es nicht gelungen, den Hunger zu beseitigen, die extreme Armut zu überwinden. Laut dem aktuellen Bericht der »Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen« (FAO) hungern über 800 Millionen Menschen, mehr als jeder Zehnte, und die soziale Schere geht in fast allen Staaten kontinuierlich weiter auseinander.
Krise als Normalfall
Krise ist längst ein Synonym für die gegenwärtige Normalität geworden. Ihre Ausmaße sind inzwischen so dramatisch, dass der Bedarf an Hilfe die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel übersteigt. Das haben sowohl UN-Organisationen wie auch die Bundesregierung eingestehen müssen. Offensichtlich leidet die Welt nicht an zu wenig Hilfe, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. Die Nothilfe, jene spezifische Form der Unterstützung in und nach Katastrophen, ist zum paradigmatischen Ausdruck einer Hilfe geworden, die zwar Leben retten, aber nicht mehr verbessern kann.
Es sei gut und richtig, einem Obdachlosen ein Bett für die Nacht zu geben, schreibt Bertolt Brecht in seinem Gedicht »Die Nachtlager«, allerdings werde »die Welt dadurch nicht anders/Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht/Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt/Aber einige Männer haben ein Nachtlager/Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten/Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.« Bei der Vorstellung, dass Obdachlose andernfalls auf eisiger Straße schlafen müssten, wird wohl niemand eine solche Hilfe kritisieren wollen, zumal sie in der Realität oft von aufopferungsvollen Idealisten geleistet wird. Und doch muss immer wieder die Frage gestellt werden, wieso die gewährte Hilfe systematisch unzureichend ist, wieso sie, um im Duktus des Gedichts zu bleiben, die Obdachlosigkeit nicht abschafft.
Der Brecht-Schüler Heiner Müller äußerte einmal, er gebe einem Bettler nie Almosen, denn er möchte, dass dieser sich aus Not gegen die Verhältnisse auflehne. Das Dilemma kennen alle: geben oder nicht geben, helfen oder nicht helfen? Aus schlechtem Gewissen, Anstand oder einem unbestimmten Bauchgefühl werfen wir etwas in die Bettlerschale, ahnen aber zugleich, dass wir mit diesem barmherzigen Akt weder an der persönlichen Notlage noch an den Zuständen etwas ändern werden.
Wer hilft, kann sich über die Scham, die wir angesichts von Katastrophen und Massenelend empfinden, hinwegtrösten. Eine Welt, die in Reiche und Arme, in Mächtige und Ohnmächtige, in Privilegierte und Ausgeschlossene gespalten ist, empört; eine Welt von Helfern und Hilfsbedürftigen wirkt dagegen fast versöhnlich.
Menschen in Bedrängnis beizustehen ist ein universeller ethischer Grundsatz. Jesus solidarisierte sich mit den hungrigen, durstigen, nackten, fremden, kranken und inhaftierten Menschen. Doch trägt Hilfe, indem sie Not und Unfreiheit nur mildert, abfedert, auch dazu bei, die gesellschaftlichen Verhältnisse und somit jene eklatante Bedürftigkeit, die unsere Empathie anspricht, zu perpetuieren. Was ist, wenn Unterstützung von außen das Überleben der Bedürftigen sichert, eine wirklich bessere Zukunft für sie aber verhindert? Könnte Hilfe an sich das Problem sein, indem sie die Ursachen für ihre fortwährende Notwendigkeit eifrig nährt? Mit anderen Worten: Was ist eine Hilfe wert, die nicht das übergeordnete Ziel verfolgt, sich selbst überflüssig zu machen?
Hilfsbereitschaft ist ein sympathischer menschlicher Impuls; Wohltätigkeit ein zweischneidiges Schwert. Der Philosoph Zygmunt Bauman hat das wohltätige Geben mit dem Karneval verglichen: Die bestehenden Verhältnisse werden durch eine begrenzte Umkehrung aller Normen bestätigt. »Heute tun wir mal etwas Gutes«, hat der damalige Kanzler Helmut Kohl gönnerhaft gesagt, als er am ersten bundesdeutschen »Afrikatag« Mitte der 1980er Jahre vor laufenden Kameras einen Geldschein in eine Spendenbüchse steckte. Tatsächlich besteht im wohlhabenden Teil der auf Konkurrenz und Eigennutz ausgerichteten Welt die Tendenz, Mitleid und Nächstenliebe an besondere Situationen zu binden, um damit ihr Nichtvorhandensein im täglichen Leben zu kompensieren. Die punktuelle »gute Tat« tröstet über den dauerhaften Mangel an Gerechtigkeit hinweg.
Hilfe versteht sich meist als politisch neutral, teilweise gestützt auf solide pragmatische Argumente (ansonsten wäre kein Wirken möglich). Doch Helfen ist niemals ein unpolitischer Akt, Hilfe ist stets Einmischung, ob zum Guten oder zum Schlechten. Insofern ist weder Neutralität noch vornehme Distanz möglich. Wer hilft, ob im Privaten oder in internationalen Beziehungen, will meist etwas damit bezwecken.
Auch die superphilanthropischen Stiftungen unserer Zeit (Bill & Melinda Gates, Kellogg, Rockefeller u.a.) nehmen Einfluss auf politische Entscheidungen. Sie platzieren Themen, die ihnen wichtig sind, auf der Agenda internationaler Institutionen, und sie setzen ihre Vorstellungen durch, welche Probleme wie angegangen werden. Solche übergestülpte Hilfe etabliert Hierarchien, festigt Herrschaft und lähmt soziale Bewegungen. Aus Aktivisten werden Subunternehmer, die ihre Haltungen und Positionen an die Vorgaben der Geldgeber anpassen müssen, um eine Förderung zu erhalten. Diese müssen nicht immer ausgesprochen sein; viele werden implizit und unreflektiert von Helfern weitergegeben. Immer wieder hörten wir auf unseren Recherchereisen die Klage, das Setzen einer Agenda sei »ein Kontrollinstrument«. Denn der Geber nehme sich das Recht heraus, wesentliche Entscheidungen »zugunsten« des Hilfsbedürftigen zu treffen, Mitbestimmung oder gar Autonomie seien nicht vorgesehen. Viel zu oft gelten Menschen vor Ort als bloße Zielgruppen einer von außen kommenden Hilfe.
Das Dilemma der Hilfe
Obwohl wir uns mit vielen der Themen in diesem Buch schon lange beschäftigen, haben wir im Laufe unserer Recherche vieles neu erkannt und besser begriffen. Die Distanz zwischen den Privilegierten und den Notleidenden ist trotz einer globalisierten Welt weiterhin gigantisch. Niemand kann ernsthaft dafür plädieren, Hilfe in Bausch und Bogen zu verurteilen und abzuschaffen, aber ein kritischer Hilfsbegriff tut not. Die Welt ist voller Projekte, die einen Missstand bekämpfen, eine Beschädigung zu heilen versuchen. Viele Hilfsangebote, die uns auf unseren Reisen begegnet sind, offenbaren das grundlegende Dilemma: Einem Missstand wird mit einem vorübergehenden Nachtlager begegnet, nicht mit einer grundsätzlichen Lösung, die Obdachlosigkeit verhindern würde. Das verdankt sich auch einer systematischen Leerstelle – auf fast allen Entscheidungsebenen fehlt die Perspektive derjenigen, um die es geht, Menschen, die um ihr Überleben kämpfen, die auf der Flucht sind, die für Veränderungen streiten. Für diese Milliarden von Menschen bildet nicht der Fortschritt, sondern das Leiden das Kontinuum ihrer Geschichte. Ihre Hoffnungen und Sehnsüchte speisen sich nicht aus einem abstrakten Ideal, sondern aus schmerzlichen Erfahrungen und dem Aufbegehren gegen das erlittene Unrecht.
Ihre Stimme zu hören, sie wirklich in den Blick zu nehmen, ist Voraussetzung für eine Überwindung der vielfältigen Krisen der Gegenwart. Die zutiefst menschliche Fähigkeit zur Empathie kann nur wirksam werden, wenn wir die Menschen hinter den abstrakten Zahlen zu Gesicht bekommen. Denn die in unserem System »Überflüssigen« sind zumeist unsichtbar.
Die Politik reagiert erstaunt auf Krisen, die sie selber zu verantworten hat, die Öffentlichkeit reagiert erstaunt auf Katastrophen, deren Anzeichen sie geflissentlich übersehen hat. Wir zeigen in diesem Buch auf, wie die strukturellen Fehler der Politik die Krise verstärken. Und wie die zuständigen Organisationen, seien es die Vereinten Nationen, die NGOs, die Militärs, die Wissenschaftler, die Verbände aufgefordert werden, Lösungen zu erarbeiten, die in ihrer Unzulänglichkeit das Fortbestehen der Krise sichern. Diese »fatalen Strategien« behandeln wir in dem vorletzten Kapitel.
Unsere Kritik ist absichtlich zugespitzt. Nur so lässt sich der ritualisierte Umgang mit der Krise erschüttern. Wir wollen nicht die Hilfe und schon gar nicht die Helfer verunglimpfen, denn in Zeiten gesellschaftlicher Atomisierung ist Solidarität ein rares Gut, das es zu verteidigen, aber auch zu stärken gilt.
Allen geschilderten Projekten ist gemeinsam, dass sie Minilösungen anbieten in einer Welt zunehmender, multikausaler Krisen. Deswegen beenden wir dieses Buch mit einem Kapitel, das Auswege vorschlägt, die geeignet wären, Hilfe zu überwinden. Wenn die Menschenrechte einen Sinn haben sollen, müssen sie universell und absolut gelten. Sie fordern uns auf, die Verhältnisse grundsätzlich so zu verändern, dass alle Menschen ein würdiges Leben verwirklichen können.
Was wir vorschlagen, steht der herrschenden neoliberalen Ideologie diametral entgegen. Wenn heutzutage eifrig an das solidarische Handeln appelliert wird, ist nicht eine gerechte Umgestaltung der Gesellschaft gemeint, sondern eine Privatisierung von Verantwortung: Freiwilliges Bürgerengagement soll die verlässlichen sozialen Strukturen ersetzen. Wenn von Eigenverantwortlichkeit gesprochen wird, ist die »Befreiung« des Menschen aus seiner sozialen Verantwortung gemeint. Wenn Resilienz, die Fähigkeit, Krisen mit Hilfe persönlicher Ressourcen zu überwinden und daran zu wachsen, als neue Wunderwaffe gegen kommende Katastrophen beschworen wird, dann entspricht dies der Ausgabe von Gasmasken, anstatt das Giftgas zu vernichten.
In letzter Zeit hat eine Reihe renommierter Autoren anhand von Statistiken zu Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, individuellem Einkommen u.ä. zu beweisen versucht, dass die Verhältnisse immer besser werden. Abgesehen von der berechtigten Skepsis, ob das Wohlergehen von Menschen auf diese Weise überhaupt messbar ist – was ist mit den vielfältigen, nichtmonetären Versorgungsstrukturen, mit all den Ausprägungen ideellen Wohlstands? – werden weitere zentrale Fragen ignoriert: Ist diese Verbesserung nicht auf Kosten gewaltiger ökologischer Verwüstungen erfolgt und hätten die enormen technologischen Fortschritte der Menschheit innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte nicht ganz andere soziale Errungenschaften ermöglichen können? Blicken wir also nicht nur auf das, was wir erzielt haben, sondern auch auf das, was wir hätten erreichen können. Solange nämlich ein Teil der Menschheit dahinvegetiert, lautet die einzig moralisch relevante Frage: Gibt es sinnvolle Alternativen? Wenn ja, dann haben wir eine Verpflichtung, die Krise radikal zu bekämpfen. Damit wäre (fast) allen am meisten geholfen.
Katastrophale Chancen. Pakistan
Das Wasser stieg an, über Ufer und Deiche, es verschlang Felder und Straßen, es riss Dörfer nieder, es schwemmte alles hinweg. Die Menschen wurden überrascht von den Fluten, manche ertranken, manche retteten sich in ein höher gelegenes Schulgebäude oder Krankenhaus. Dort harrten sie aus, bis sie irgendwann zu dem Flecken Erde zurückkehren konnten, wo einst ihr Dorf gestanden hatte.
Das geschah im August 2010 in Pakistan entlang des Indus.
Das Feuer griff um sich. Die Arbeiter versuchten, durch die Türen nach draußen zu gelangen, doch die Türen waren von außen verschlossen (angeblich, um Diebstahl zu verhindern). Sie versuchten, durch die Fenster zu fliehen, doch die Fenster waren vergittert. Einige konnten sich retten. Alle anderen erstickten, bevor sie verbrannten. 259 Menschen starben, der tödlichste industrielle Brand der Geschichte.
Das geschah im September 2012 in Karachi, in einem Stadtteil namens Baldia.
Wasser und Feuer. Eine Überflutung und ein Brand. Eine Naturkatastrophe und ein Verbrechen. Unzählige Tote. Extreme Notfälle. Was geschah in der Folge? Wie reagierte das »Schwellenland« Pakistan, wie die internationale Gemeinschaft auf diese tragischen Ereignisse? Und wie die Menschen vor Ort? Welche Hilfe wurde geleistet, mit welchen Folgen? Inwieweit wurde die Katastrophe zum Anlass genommen, etwas Grundsätzliches zu ändern? »Nie wieder« lautet das gängige Mantra moralischer Empörung. Doch was ist konkret geschehen, um eine Wiederholung solcher Unglücke zu verhindern?
In einem Stadtteil von Karachi, noch vor 150 Jahren ein beschauliches Fischerdorf, innerhalb der letzten fünfzig Jahre um mehr als zehn Millionen Einwohner gewachsen und heute ein Moloch ohne öffentliche Verkehrsmittel, reihen sich Textilfabriken aneinander – mehr als zehntausend. Eine von ihnen ist die zehn Jahre alte Denim Clothing Factory, in der Jeans, Hosen und Röcke hergestellt werden (»alles unterhalb der Taille«, sagt der Manager mit entsprechender Handbewegung). In einer gigantischen Halle von sechstausend Quadratmetern produzieren an die zehntausend Arbeiter für die deutsche Fußgängerzone: H&M, GAP, Zara und Tom Taylor, täglich 70000 Stück, und an jedem fertigen Kleidungsteil hängt ein Schild, das den Preis schon in Euro ausweist: »€ 19,90«. Der Mindestlohn beträgt monatlich umgerechnet etwa 125 Euro, wird aber selten gezahlt (»eher ein Privileg, das man sich durch jahrelange Arbeit verdient«, erklärt ein Arbeiter). »Andere Länder sitzen uns im Nacken. Wenn wir allen den Mindestlohn zahlen würden, könnten wir wegen der ständigen Preisdrückerei der Auftraggeber nicht mehr konkurrieren«, sagt der Manager und führt stolz durch seinen Betrieb.
Eine Hose besteht aus siebzehn bis zwanzig Teilen. »Komplex«, sagt der Manager. Spezielle Maschinen sind nötig, um den international begehrten Trash-Look auf die Jeanshöschen zu zaubern. »Sehr komplex«, sagt der Manager. Das halbzerrissene Produkt unterliegt strengen Qualitätskontrollen. H&M unterhält zu diesem Zweck ein »liaison office« in Karachi. Jedes Produkt wird untersucht, ob es nicht vielleicht Metallspitzen enthält, denn die Nadeln brechen gelegentlich ab und bleiben im Stoff hängen. Für 19,90 € erwirbt der Kunde neben der Hose auch einen Anspruch darauf, sich nicht pieksen zu lassen.
Qualitätskontrollen zugunsten der Arbeitenden sind weitaus weniger streng. In der Denim Clothing Factory leuchtet das Licht hell, die Luft lässt sich atmen, doch neunzig Prozent der Angestellten haben keinen festen Arbeitsvertrag, genießen keinerlei soziale Sicherheit, könnten sich selbst dann nur schwer gewerkschaftlich organisieren, wenn die Eigentümer es nicht verhindern würden. Sie haben keine Identität, sie haben keine Rechte, sie können nicht vor Gericht ziehen, sie existieren nur aufgrund der Tatsache ihrer Ausbeutung, ansonsten sind sie unsichtbar. Ein legalisiertes System der Rechtlosigkeit, in dem Gesetze an fehlender Implementierung leiden und Bürgerrechte an einem Parcours kaum überwindbarer bürokratischer Hürden zerrieben werden. Allein eine neugegründete Gewerkschaft zu registrieren dauert bis zu eineinhalb Jahren. Die Arbeitgeber erhalten vom zuständigen Ministerium eine Liste der Arbeiter, die sich organisieren wollen, quasi als negatives Empfehlungsschreiben. Es fällt zudem eine Gebühr von knapp tausend Euro an, und zwar pro Fabrik. Die Unternehmen verfügen über eifrige Rechtsanwälte, die Arbeiter über wacklige Rechtsansprüche.
Wer die Rechtlosigkeit bekämpft, landet erst recht in der Rechtlosigkeit. Wenn eine Gewerkschaft erfolgreich zu wirken beginnt, werden paramilitärische »Eliteeinheiten« namens Rangers auf den Plan gerufen. Arbeitsrechtlicher Widerstand zieht schnell den Vorwurf des Terrorismus nach sich: Vierzehn gewerkschaftlich aktive Textilarbeiter in Faisalbad wurden zu 490 Jahren Haft verurteilt und erst nach fünf Jahren gegen Zahlung von 2,4 Mio. Rupien (ca. 19000 Euro) entlassen. In Karachi wurden zwölf Arbeiter nach einem zweijährigen Prozess, währenddessen sie keiner Beschäftigung nachgehen konnten, freigesprochen. »Wir werden dich kriegen«, lautet eine beliebte Drohung, berichten Gewerkschafter, »danach bist du nur noch ein Name auf der Liste der vermissten Personen. Eines Tages wird deine Leiche auf die Straße geworfen, und deine Familie meldet das nicht einmal, weil sie Angst hat.«
Das Individuum bleibt auch nach seinem Tod ausgelöscht. Das war im September 2012 bei dem Brand der Textilfabrik nicht anders. In Ermangelung einer Angestelltenliste dauerte es Wochen, die Leichen des Brands zu identifizieren.
Das Fabrikgebäude der Ali Enterprises ist gut angeschlossen an die Hub River Road, eine der Verkehrsadern Karachis. Die Zufahrt erfolgt durch ein gewaltiges Slumgebiet, in dem sich nach der »Partition«, der Abspaltung Pakistans im Jahre 1947, überwiegend Zuwanderer aus dem heutigen Indien angesiedelt haben, arme und ungebildete Landarbeiter, während die gewerkschaftlich organisierten städtischen Arbeiter, mehrheitlich Hindus, nach Indien ausgewandert sind. Unendlich viele hässliche Nutzbauten, grau in grau; allein die riesigen Pepsi-Werbungen bringen Farbe in die Eintönigkeit.
Wer am Ort des Brands einen locus horribilis erwartet, wird enttäuscht. Das Fabrikgebäude wirkt eher banal. Ein verlassener Bau mit Brandspuren an den Außenwänden, der keine offensichtliche Geschichte erzählt. Kein Andenken ist sichtbar außer einem verwelkten Blumenstrauß vor dem abgesperrten Gittertor. Erst das Gespräch mit Hinterbliebenen ermöglicht eine Vorstellung davon, was geschah … wie der 25-jährige Ejaz Ahmed aufgeregte Schreie hörte, wie das Feuer im Nu eine hölzerne Zwischenebene erfasste, auf der vierzig Frauen mit Verzierungsarbeiten beschäftigt waren, wie der Strom ausfiel und in der Dunkelheit Rauch und verzweifelte Desorientierung herrschten. Wo sind die Türen? Wo die Treppen? Die meisten Arbeiter fielen in Ohnmacht. Ejaz muss sich in der Massenpanik einen Weg zur ersten Treppenstufe gebahnt haben. Dort wurde er gefunden. Seine Mutter Saida stand schon eine halbe Stunde nach Ausbruch des Feuers vor der Fabrik, inmitten von Polizei und Einheiten der Rangers; die Mutter war weitaus schneller vor Ort als die Feuerwehr. Die Hitze war unfassbar intensiv, selbst außerhalb des Gebäudes, niemand konnte hineingehen. Sie versuchte es trotzdem, wurde aber von den Polizisten daran gehindert, während sie nach ihrem Kind schrie, immer wieder, nach ihrem Sohn. Sie musste mit ansehen, wie eins der Gitterfenster aufgebrochen wurde und einige Verzweifelte hinaussprangen (manche der Frauen hatten ihre Salwars zu Seilen verknotet). Jemand fuhr mit einem Bulldozer heran und wollte eine Außenwand aufbrechen, damit die Feuerwehrleute hineinkämen, doch er wurde von der Polizei gestoppt, weil angeblich die Gefahr bestand, dass das ganze Gebäude zusammenfallen könnte. Das Feuer brannte drei Tage lang.
Es hatte davor mehrere kleinere Feuer gegeben, zuletzt fünfzehn Monate vorher, bei denen die Fabrikmanager zunächst erfolgreich die Ware gerettet hatten. Es waren keine Feuerlöscher vorhanden, oder sie funktionierten nicht. Kein einziges Mal war geübt worden, was im Notfall zu tun wäre. Eine italienische Firma hatte ein Gutachten verfasst und noch zwei Monate vor dem Feuer das hochkarätige SA-8000-Zertifikat ausgestellt, das unter anderem einen adäquaten Flucht- und Rettungsplan voraussetzt. Doch zum Zeitpunkt des Unglücks waren, bis auf einen, alle Notausgänge verriegelt. Diese vermeidbare Katastrophe hatte sich von langer Hand abgezeichnet.