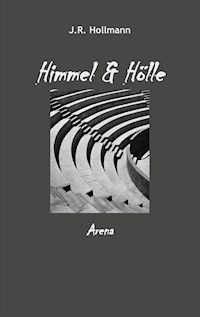
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Himmel und Hölle
- Sprache: Deutsch
Karl ist am Leben. Die Hölle hatte sich für ihn aufgetan und ... wieder ausgespuckt. Seine Gegner hatten alles versucht, ihn zu erledigen, waren aber zu seinem Erstaunen nicht erfolgreich. Außerdem hatte er nicht nur seine Freundin befreien können, sondern auch noch einen blinden Engel gerettet. War sein Leben vor wenigen Wochen noch eher eintönig und einsam, hatte er jetzt plötzlich die Bude voll mit den seltsamsten Personen. Und sein Leben sollte noch ein Highlight bekommen. Nämlich ein mögliches rasches Ende. Er war durch die Hölle gekrochen, hatte gegen ... irgendwelche Katastrophen-Dinger gekämpft und war sogar beim Zahnarzt. Was konnte jetzt noch schief gehen? "Sind es nicht die kleinen Dinge, die einen dem Himmel näher bringen?", fragte ich philosophisch. "Oder der Hölle!", hielt Lissi gegen. "Na, dieser Termin steht ja fest", winkte ich ab und fügte selbstsicher an, "aber ich plane, auch gleich eine Rückfahrkarte zu lösen." "Zur Not mach ich dich einfach zum Vampir", schlug sie vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Kathrin
But only in their dreams
can men be truly free,
‘twas always thus,
and always thus will be.
Aber nur in ihren Träumen
können die Menschen wirklich frei sein.
Es war immer so
und wird auch immer so sein.
John Keating
Du siehst etwas und fragst:
„Warum?“
Ich träume etwas und frage:
„Warum nicht?“
Georg Bernard Shaw
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 1
Alles war friedlich ... Schwärze ... Stille ..., wenn dieses Piepen nicht wäre. Regelmäßig. Eintönig. Nervend. Ansonsten lag ein Schleier der Ruhe über allem. Ganz ganz leise war auch noch ein anderes Geräusch zu hören. Genauso regelmäßig wie das Piepen. Aber unterschwellig. Wie von einem Blasebalg schnaufte es in einem vertrauten Rhythmus ... angenehm ... einlullend ..., wenn dieses Piepen nicht wäre. Es hörte einfach nicht auf.
Ich wollte schlucken. Es gelang mir jedoch nicht richtig. Mein Hals tat weh und etwas schien darin festzustecken.
Ich versuchte, meinen linken Arm zu heben. Vielleicht konnte ich meinen Hals von dem Fremdkörper befreien.
Ich bekam meine Hand nur zwei, drei Zentimeter hoch, als mich ein stechender Schmerz durchfuhr. Ich sog krampfhaft die Luft ein und stöhnte leise. Ich spürte, wie eine Träne über mein Gesicht lief. Etwas Kühles berührte mich und wischte sie weg. Es fühlte sich so vertraut an.
Das Piepen wurde leiser
und ich hatte die Schwärze
wieder für mich.
Da war wieder dieses störende Piepen. Ich wollte doch nur in der Dunkelheit ruhen, die mich umfing ... die Finsternis war so angenehm ... gab mir ein Gefühl der Geborgenheit ...
Wieder gelang mir das Schlucken nur mit Mühe. Meine Kehle fühlte sich wund an. Mehr als ein leises Grunzen brachte ich nicht zustande, um meinen Unmut zu äußern.
Etwas Kühles legte sich wieder auf mein Gesicht
... und ich sank wieder
in die Tiefe.
Das Piepen
wurde leiser ...
Das Geräusch drang in mein Bewusstsein. Setzte sich dort fest. Machte sich breit. Die Augen konnte man schließen oder den Mund. Sogar Gerüche konnte man weitestgehend außen vor lassen, wenn man durch den Mund atmete und nicht durch die Nase. Aber Geräusche?
Ich könnte mir die Finger in die Ohren stecken, aber irgendwas sagte mir, dass das nicht so einfach gehen würde. Verdammtes Piepen.
O.k., ich hatte mich entschieden. Ich würde also meinen friedlichen Kokon aus Dunkelheit verlassen, um festzustellen, was mich da belästigte. Bei der Gelegenheit konnte ich auch gleich schauen, wo ich mich eigentlich befand.
Da traf es mich wie ein Blitz. Ich war tot. Die Dämonen hatten mich gespickt wie einen Partyigel. Nur hatten sie dazu keine mit Käse und Weintrauben gekrönten Zahnstocher genommen. Ich konnte mich an zwei Pfeilspitzen erinnern, die vorne aus mir herausragten. Dann wurde das Bild zunehmend undeutlich.
Auch an Lissis angstgeweitete Augen konnte ich mich erinnern. Meine Vampir-Freundin Lysje de Groot, Schrecken sowohl der Traumwelt als auch der Unterwelt, stand mit den Händen vor dem Gesicht da und musste schockiert ansehen, wie ich zu Boden ging.
Von der Zeit danach weiß ich nichts mehr. Schwärze ... Kichern?
So, wo kam jetzt dieses Geräusch her, das mir so auf den Zünder ging?
Eine Harfe und Engelschöre hätte ich ja noch verstanden, wenn ich mal unterstellte, dass ich in den Himmel gekommen bin. Oder Deutscher Schlager, wenn ich von meiner privaten Hölle ausging. Aber das Piepen?
Ich musste ein wenig strampeln, um an die Oberfläche zu schwimmen. Aber selbst da spürte ich kaum etwas. Wahrscheinlich war ich doch tot. Seltsamerweise war es erneut mein Hals, der mein Bewusstsein oben hielt. Er tat nämlich immer noch weh. Und auch das Gefühl eines Dings in meinem Rachen, das dort nicht hingehörte, war wieder da. Nur wenn ich schon nicht tot sein sollte, warum spürte ich dann den Rest meines Körpers nicht?
Ich öffnete meine Augen.
Anfangs sah ich nur weißes Licht. Ich blinzelte einige Male und der Schleier vor meinen Augen löste sich langsam. Jetzt konnte ich schon mehr erkennen. Ich befand mich offenbar in einem Zimmer. Allmählich dämmerte es mir. Ich musste mich wohl in einem Krankenhaus befinden. Decke weiß, Wände weiß, die Frau mit dem albernen Häubchen auch ganz in weiß. Jetzt machte auch das Piepen einen Sinn.
Immer mehr Details wurden deutlich. Und Stück für Stück fand sich in meinen Erinnerungen auch ein Name oder eine Beschreibung. Auch der Fremdkörper in meinem Hals bekam einen Namen. Man hatte mich natürlich intubiert, um meine Beatmung sicherzustellen. Unangenehm, aber es musste wohl notwendig gewesen sein.
Nicht tot? Ich brauchte einen Moment, mir des Ausmaßes dieses Gedankens klarzuwerden. Mir wurde bewusst, dass ich mich selbst schon abgeschrieben hatte. Ein Lacher wollte sich lösen, kam aber nur als Schnaufen heraus. Der Tubus war im Weg.
Das Gesicht der Frau in Weiß beugte sich über mich. Ja, es war wirklich eine Pflegerin. Kurzzeitig hatte ich noch den Gedanken, es könne ja vielleicht auch ein Engel sein, der auf meine Ankunft wartete. Sie hatte aber definitiv keine Flügel.
„Hallo, Herr Mustermann“, grüßte sie mich freundlich. „Sind Sie wieder bei uns?“
Ich brummte einmal und zwinkerte mit den Augen. Das musste erst einmal genügen. Mir war nicht nach Plaudern. Haha, wie auch!?
„Sehr schön. Ich sag dem Herrn Doktor Bescheid.“
...der mir dann hoffentlich den Gartenschlauch herausnimmt und mir sagt, wo mein Körper hin ist!
Ich freute mich an der Idee, mein Kopf läge allein auf dem Kissen und der Tubus blähte einfach nur die Bettdecke auf.
Der Spaß währte aber nur kurz, denn schon stand wieder ein Weißkittel vor mir. Der schaute dann wichtig über den Rand seiner Brille.
„Guten Tag, Herr Mustermann“, begrüßte er mich ebenso freundlich wie ernst. Dann kam der klassische Fehler: „Wie geht es uns denn heute?“
Diese rhetorische Frage in der ersten Person Plural gehörte für mich in die Top fünf der beklopptesten Fragen überhaupt. Aber man muss wohl ein Hochschulstudium haben, um diesem Hirnfurz noch eins draufzusetzen und die Frage an jemanden zu richten, der dank einer Plastikröhre im Maul gar nicht antworten kann. Ich antwortete also nur, indem ich eine Augenbraue konsterniert hochzog.
Der Arzt erging sich in Routine und untersuchte mich von oben bis unten. Er ließ sich von der Pflegerin oder einer Assistenzärztin noch diverse andere Informationen bringen und wandte sich schlussendlich mir zu.
„So, Herr Mustermann“, begann er, „das sieht alles – den Umständen entsprechend – ganz gut aus.“ Er warf nochmals einen Blick auf eine Tabelle. „Ihre Werte sind stabil. Sie sind sogar wieder aufgewacht.“
Das ’sogar wieder’ machte mich ein wenig stutzig. Die zwei Pfeile allein konnten es nicht gewesen sein. Und nebenbei: Wie lange war ich eigentlich weg?
„Ich werde Ihnen jetzt den Tubus entfernen. Reden Sie, wenn überhaupt, so wenig wie möglich. Ich schicke Ihnen gleich noch jemanden, der die nächsten Stunden auf Sie aufpasst. Wenn Ihre Atmung wieder aussetzt, will ich, dass schnell reagiert wird. Ich habe Sie schon einmal fast verloren.“
„Oh!“, dachte ich so bei mir. Die zweite Augenbraue war jetzt auch oben. Hatte ich überhaupt noch einen Körper?
Zusammen mit der Pflegerin löste der Arzt die Klebestreifen, die den Beatmungsschlauch in Position hielten, und zog anschließend den Tubus vorsichtig aus meinem Mund. Die Pflegerin schmiss alles auf einen kleinen Instrumentenwagen und machte sich dann daran, mein Gesicht zu säubern.
Ich atmete zweimal tief ein und aus. Der Hals kratzte noch reichlich, aber dieses Fremdkörpergefühl war endlich weg.
„Danke!“, krächzte ich.
„Schonen Sie ihre Stimme“, mahnte der Arzt noch einmal.
„Hm!“, machte ich zur Bestätigung. Vielleicht war ja jemand anderes nicht so genau mit meinen Stimmbändern. Warten auf den Schichtwechsel.
Zu den beiden Frauen gewandt sagte der Arzt im Aufstehen:
„So, hier sind wir, glaube ich, fertig.“ Die Angesprochenen nickten nur kurz. „Was ist mit dem Patienten in der 12? Soll ich mir den auch gleich noch ansehen?“
Die Assistenzärztin sprang darauf an und erklärte ihm im Hinausgehen, wie es um den Gesundheitszustand bestellt war. Die Pflegerin beugte sich noch einmal zu mir herunter:
„Es kommt gleich jemand für Sie.“
Ich brummte nur, um ihr zu verstehen zu geben, dass ich verstanden hätte. Sie schnappte sich mit einem zufriedenen Kopfnicken das Wägelchen und folgte den anderen. Ich war wieder allein.
Ich döste etwas, als die Tür zu meinem Raum wieder geöffnet wurde. Zwei Personen unterhielten sich halblaut noch vor der Tür. Sie schienen zu diskutieren. Worum es dabei ging, bekam ich nicht mit. Es interessierte mich auch nicht wirklich. Letztlich traten sie aber beide ein.
Durch ein halb geöffnetes Auge konnte ich sehen, dass es sich bei den Zweien um einen jungen Mann und eine junge Frau handelte.
Wie ich ihrem leise fortgesetzten Gespräch entnehmen konnte, waren die beiden Medizinstudenten. Er sollte aufpassen, dass ich auch ordentlich atmete, und sie wollte offenbar mich sehen.
„Wann sieht man denn schon mal so was“, argumentierte sie. „Also nicht in den normalen Vorlesungen. Hast du die Krankenakte gesehen? Die Fotos?“
„Und wann kriegen wir mal so eine Akte zu sehen?“, hielt er dagegen.
„Hast du gefragt?“
„Nein?!“, gab er zu.
„Dann kommt hier deine Chance“, antwortete sie mit frechem Grinsen. Sie griff in ihre Umhängetasche und förderte eine Akte hervor. „Ich habe nämlich gefragt.“
„Cool!“, flüsterte er beeindruckt.
Meine Ohren wurden größer. Papier raschelte.
„Boah!“
„Heftig, oder?“
Es raschelte weiter.
„Ah, nee! Das ist ja ekelig“, rief der Mann aus.
„Und der lebt noch!“, kommentierte sie.
„Und was ist nun mit dem?“, flüsterte ich mit rauer Stimme. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie beide Studenten zusammenzuckten.
„Shit! Sie sind ja wach“, bemerkte der Mann erschrocken. „Entschuldigen Sie bitte. Wir wollten Sie nicht aufwecken.“
„Kein Problem“, krächzte ich, „ich war eh schon wach.“
„Wie fühlen Sie sich denn so?“, fragte die Frau vorsichtig.
Mir war klar, dass sie nicht in diesem Zimmer sein durfte. Wahrscheinlich nicht einmal auf der Station. Aber egal.
„Ich bin leicht benebelt, mein Hals tut noch vom Schlauch weh und ich spüre meinen Körper nicht. Ist der noch da?“
Der Mann blätterte kurz in der Akte.
„Klar ist der noch da. Sie haben aber einiges an Medikamenten intus. Und bei den Verletzungen ist das auch besser so.“
„Bekomme ich eine Zusammenfassung?“, fragte ich leise. „Meine Erinnerungen sind etwas lückenhaft.“
„Ich weiß nicht, ob ich das darf“, erwiderte der Student zögerlich.
„Micha, du alte Pfeife“, fuhr ihn seine Kollegin an, „der Patient liegt direkt vor deiner Nase. Der hat doch einen Anspruch, zu erfahren, was mit ihm ist.“
„Und wenn der traumatisiert wird, bin ich schuld“, hielt er gegen.
Ein Kichern entfuhr mir, das aber schnell in ein Stöhnen überging. Ja, mein Körper war definitiv noch da. Und die Schmerzen. Komik konnte verdammt wehtun.
Die beiden standen sofort an meinem Bett. Panik in den Augen.
„Sollen wir jemanden rufen?“
„Brauchen Sie etwas?“
„Haben Sie Schmerzen?“
Ich schnaubte nur, während die Schmerzwelle langsam abebbte.
„Bringen Sie mich einfach nicht zum Lachen“, flüsterte ich lächelnd. „Wenn Sie wüssten, was ich in den letzten Tagen vor meinem Zwangsurlaub erlebt habe, würden sie Traumata als Letztes in Betracht ziehen.“
„Wenn ich mir die Akte so anschaue, muss ich ihm Recht geben“, sagte die Studentin an ihren Partner gewandt.
„So, und jetzt mal Butter bei die Fische“, meldete ich mich wieder zu Wort.
Der Mann atmete einmal tief durch, räusperte sich und schlug das Dossier wieder auf.
„Hämatome und Schürfwunden am ganzen Körper ...“, begann er die Aufzählung.
„Das kommt vom Kampftraining“, kommentierte ich leise.
„... Fraktur des Nasenbeins ...“
„Ja, Schuld eigene! Die Felswand war stärker.“
„... tiefe Fleischwunde im Bereich des linken Trapezmuskels ...“
„Kein Kommentar dazu.“
„... und Ihnen wurden sieben Projektile entfernt.“
Dann folgte eine ausführliche Auflistung. Drei Pfeile hatten mich in Rücken und linkem Oberarm getroffen, wobei zwei davon glatt durchgeschlagen waren. An die zwei konnte ich mich sogar erinnern. Ein verirrter Armbrustbolzen hatte meinen rechten Oberschenkel erwischt. Steckschuss.
Dann waren da noch die zwei Speere, die mich im Oberkörper erwischt hatten. Der eine hatte meinen rechten Lungenflügel durchschlagen und der andere meinen Magen.
Die Operationen – vier an der Zahl – dauerten jeweils Stunden. Mehr als einmal war ich dem Tod näher als dem Leben. Ich musste während der Aufzählung einige Male kräftig schlucken.
„Ich hab so schön abgenommen“, machte ich den Anfang, als ein Moment des Schweigens verstrichen war, „und trotzdem hat noch so viel in meinem Körper Platz.“
Die beiden Studenten kicherten.
„Wow!“, schob ich nach. „Nach der Beschreibung hätte ich mich selbst, ohne zu zögern, abgeschrieben.“
„Und doch haben Sie überlebt“, schloss der junge Mann nachdenklich. Er klappte die Patientenakte wieder zu und reichte sie seiner Partnerin.
„Und Sie wissen nicht mehr, was passiert ist?“, hakte die dann nach.
„Als ich die zwei Pfeilspitzen vorne rausragen sah, bin ich wohl ohnmächtig geworden. Ein paar verschwommene Bilder noch und das war’s.“
„Das reicht ja auch für mehr als ein Menschenleben“, schnitt eine Stimme durch die Stille. Die zwei Studenten zuckten wieder heftigst und fuhren herum. Ich hatte genug Drogen in der Blutbahn, um gar nicht zu reagieren. Außerdem wusste ich sofort, wem die Stimme gehörte. Mein innerer Seelenfrieden war wieder hergestellt.
Lissi ging um mein Bett herum und setzte sich auf die Kante.
„Hallo Karl“, grüßte sie mich mit einem bezaubernden Lächeln. Sie beugte sich zu mir und küsste mich vorsichtig. „Schön, dass du wieder da bist.“
„Wie lange war ich weg?“
„Knapp drei Wochen.“
„Oh!“ Damit hatte ich nicht gerechnet. „Hat jemand im Büro Bescheid gesagt?“
„Natürlich. Und liebe Grüße von den Kollegen. Die kleine Schwarzhaarige war sogar hier.“
„Ah, Maria-Sophie“, fiel es mir ein.
„Ja, genau. Sie hat sogar versucht mich anzugraben“, kicherte sie.
„Würde ich auch jedes Mal wieder machen.“
Sie strahlte mich an und strich mir mit einer kalten Hand über die Wange. Mit meiner Rechten, die ich zum Glück bewegen konnte, griff ich nach ihr und hielt sie in meinem Gesicht fest.
„Was ist geschehen, als ich von der Bühne war?“, fragte ich sie dann direkt. „Geht es den anderen wenigstens gut?“
Die beiden Studenten saßen mucksmäuschenstill auf der anderen Seite des Bettes und starrten Lissi mit großen Augen an. Lissi schaute durch ihre Sonnenbrille geschützt einen Moment abschätzend zurück.
„Müssen sie hier sitzen?“, forderte sie dann auch, ohne um den heißen Brei herumzureden.
„Ich schon“, sagte der Mann entschuldigend. „Ich soll aufpassen, dass die Atmung von Herrn Mustermann stabil bleibt.“
Seine Partnerin bedachte ihn mit einem Blick, der mehr als tausend Worte sagte: ’Und wenn du mir nachher nicht alles erzählst, brauchst du auch so ein Krankenbett’.
„Hm“, machte Lissi nachdenklich.
„Denk an den Zahnarzt“, krächzte ich. Lissi verstand. Man würde den beiden wahrscheinlich kein Wort glauben und exzessiven Drogenmissbrauch unterstellen. Und als angehende Mediziner saßen sie ja nach herrschender Meinung sozusagen an der Quelle. Aber ganz ohne Dämpfer wollte Lissi die zwei nicht in unsere Geheimnisse einweihen.
„Alle Informationen bleiben in diesem Raum“, sagte sie ernst. Und um das zu unterstreichen, nahm sie langsam ihre Sonnenbrille ab und redete weiter, ohne diesmal ihre Reißzähne zu verbergen. „Wenn ihr plaudert, seid ihr tot.“
Die zwei Angesprochenen trauten sich nicht einmal, mit dem Kopf zu nicken. Regungslos wie die Schaufensterpuppen saßen sie da und starrten Lissi weiter an. Die Frau zitterte leicht.
„Das wäre dann hoffentlich geklärt“, schloss sie das Thema ab und wandte sich wieder mir zu. Über ein gewohnheitsmäßiges Luftholen hinaus kam sie nicht. Die Medizinstudentin erwachte als Erste wieder aus ihrer Schockstarre.
„Sind Sie blind?“, wollte sie wissen.
Lissi seufzte. „Nein, bin ich nicht. Ich habe nur keine Pupillen im herkömmlichen Sinne. Mein Sichtfeld umfasst den ganzen sichtbaren Augapfel. Darf ich jetzt?“
Ich war stolz auf sie. Sie verlor so gut wie nie die Beherrschung. Und sie ging mittlerweile einigermaßen locker mit ihrer Andersartigkeit um.
„Wie kann das sein?“, fragte jetzt der Mann verwirrt. „Das hätte ich mir gemerkt, wenn in den Lehrbüchern so etwas beschrieben worden wäre.“
„Und Anatomie der Vampire war schon dran?“, gab sie amüsiert zurück.
„Wir sind Humanmediziner“, antwortete die Frau pikiert.
„Und wonach sehe ich aus?“, wollte Lissi dann mit einem breiten Grinsen noch wissen.
„Äh ... aber Sie haben doch gesagt ...“
„Ja, das Wort mit V. Ich kann mich sehr gut an das erinnern, was ich so sage.“
„Aber das sind doch nur Geschichten.“
„Das habe ich auch immer gedacht“, flüsterte ich. „Bekomme ich die Geschichte noch zu hören, bevor ich wieder einschlafe?“
„Natürlich, mein Schatz“, stimmte Lissi mir zu. „Darf ich dann?“
Die Studenten wollten noch etwas sagen, wurden aber von Lissi mit einem strengen Blick zum Schweigen gebracht.
„So, Kurzfassung“, fing Lissi endlich an. „Ich habe schlichtweg gepennt.“
„Ich weiß. Ich hab dich aus dem Kerker geholt“, kommentierte ich lächelnd.
„Leider auch noch als wir auf Michael und seine Leute gestoßen sind“, erwiderte sie reumütig.
„Du hast Perach’el geschützt“, stellte ich fest. Sie machte sich Vorwürfe. Wenn sie sich aber jetzt wieder einkapselte, wie schon einmal, hätte ich wahrscheinlich nicht die Kraft, sie da rauszuholen. Ich musste sie ganz schnell wieder erden. „Und damit hast du ihren Traum bewahrt, aus der Hölle rauszukommen, oder nicht?“
„Doch“, gab sie zu, „und sie war, glaub ich, mit Charlotte schon in der Sonne, wie sie es sich gewünscht hat.“
„Du glaubst?“, hakte ich nach.
„Wir ... reden zurzeit nicht miteinander“, stieß sie zögerlich hervor. Sie hatte den Kopf gesenkt und nestelte an der Kante meiner Matratze.
„Warum das?“ Sie waren noch nicht sehr lange befreundet, nachdem sie jahrelang nur die Vernichtung des anderen im Sinn hatten. Dieser neue Sinneswandel hinterließ bei mir einen unangenehmen Nachgeschmack.
„Ich dachte, der Pfeil durch die Brust wär’s schon gewesen.“
Die Studentin hatte die Nase wieder in meiner Patientenakte und meldete sich auch gleich wieder zu Wort.
„Der Pfeil hat zwar den Thorax vollständig durchschlagen, aber sowohl das Herz als auch knapp die Aorta und die Pulmonalis verfehlt.“
„Was ich nicht wissen konnte“, warf Lissi verärgert ein. „Jedenfalls hab ich dann rot gesehen und mich auf die Daboli gestürzt. Auf die zwei Speere, die dir dann wirklich den Rest geben sollten, habe ich nicht mehr geachtet. Ich war für einen Moment im Blutrausch. Zum Glück bin ich fast von einem deiner felsigen neuen Freunde platt gemacht worden. Das hat mich wieder zur Vernunft gebracht.“
„Und?“
„Ich sah, wie Charlotte leuchtend über dir stand und dir die Hand reichte. Ich wollte dich nicht einfach so gehen lassen. Ich konnte nicht. Also bin ich losgestürmt und hab mich auf dich geschmissen. Tja, und da hab ich dir ... na ja ... den Todeskuss gegeben.“
„Todeskuss?“, fragten wir drei gleichzeitig.
Lissi schaute etwas verschämt in die Runde.
„Na, du weißt schon. Den Lebenshauch geben für das zweite Leben.“
Ich verstand. Sie wollte mich zum Vampir machen. Bei aller Sympathie für sie wäre das so manch einem sicherlich nicht recht gewesen.
„Und Charlotte ...?“, fragte ich dann noch halb rhetorisch nach.
„... ist ausgerastet. Hätte Michael sie nicht aufgehalten, hätte sie mich gleich dort zerfetzt. Sie war so wütend.“
„Ich rede mit ihr“, sagte ich leise. „Ich brauche euch beide und ohne Einschränkung.“ Und nach einem kurzen Moment des Sammelns: „Bin ich denn jetzt ein Vampir?“
Sie schaute mich einigermaßen ratlos an und zuckte mit den Schultern.
„Ich habe mit allen Erzengeln gesprochen, die ich kenne. Ich konnte dich nicht wandeln und keiner hat auch nur den blassesten Schimmer warum.“
„Vielleicht beim nächsten Mal“, antwortete ich lächelnd.
Sie sah mich traurig an. „Ich ... möchte ein nächstes Mal bitte nicht erleben. Ich ... ich wäre fast gestorben, als ich dich da liegen sah“, flüsterte sie.
Ich drückte ihre kalte Hand und streichelte sie. Sie liebte mich. Ich liebte sie. Das musste nicht kommentiert werden. Außerdem spürte ich die Müdigkeit in meinen Knochen. Ich schloss die Augen und atmete einmal tief durch. Im Raum herrschte für einige Augenblicke Schweigen.
„Darf ich Sie etwas fragen?“, flüsterte der Student an Lissi gewandt.
Antwort und Frage hörte ich nicht mehr. Ich war eingeschlafen.
KAPITEL 2
Pierre hatte sein Studium an der ÉNA, der Nationalen Verwaltungshochschule in Straßburg, fast abgeschlossen. In drei Monaten sollten die Prüfungen sein. Er war zufrieden mit seinen bisherigen Leistungen. Er würde einen guten Abschluss schaffen. Das wiederum freute seinen Vater, der ihn zu diesem Studium genötigt hatte. Er selbst sah sich mehr als Künstler und Feingeist, doch sein Vater hatte darauf bestanden. Alle die noch zur Familie gezählt wurden, waren auf der ÉNA. Und auch für ihn war schon ein Vorstandsposten oder ähnliches in irgendeinem Unternehmen sicher. Er musste nur drei oder vier Jahre für ‚Papa Staat‘ arbeiten – den Rest hatte sein Vater schon freigekauft. Aber er hatte sich noch nicht die Mühe gemacht nachzufragen. Sein Vater hatte neulich beim Essen etwas von einem guten Freund gefaselt, den er noch von der ÉNA her kannte, und dessen Firma. Wie immer bei den alten Seilschaften hatte man sich geeinigt und die Zöglinge aus den eigenen Reihen der Enarchen, den Absolventen der ÉNA, in den eigenen Reihen untergebracht. Wenigstens würde er dann genug Geld haben, sich um andere Dinge kümmern zu können. Außerdem würde er endlich aus Straßburg wegkommen. Scheiß Provinz.
Er war so in Gedanken, dass ihm beinahe die zwei jungen Frauen entgangen wären, die mit ihm an der Bushaltestelle standen. Er hätte sein Auto nehmen können, aber er sah sich lieber die Menschen in den Bussen an. Jetzt hatte er die Chance und was machte er? Er dachte an die Schule und sein Leben nach der ÉNA. Idiot!
Die beiden sahen jung aus. Beide nicht sehr groß und schmal gebaut. Die eine hatte kastanienbraune Haare, die ihr fast bis zur Hüfte gingen. Die andere war blond, mit einem flotten Kurzhaarschnitt. Modisch aber sportlich gekleidet waren beide sehr ansehnlich.
Er musste sie anquatschen. Vielleicht ergab sich etwas, was ein wenig Abwechslung in den Alltag des Studierens brachte. Vielleicht sogar mit beiden gleichzeitig. Pierre war kein Kostverächter.
Der Bus kam pünktlich und war wie immer um diese Zeit leer. Die Tür öffnete sich und er stieg ein, wobei er dem Fahrer mit einem freundlichen ’Bonjour’ seinen Dauerfahrschein hinhielt. Der Fahrer brummte nur etwas Unverständliches und trat nach dem Schließen der Tür ordentlich aufs Gas.
Pierre war etwas verwirrt, als er im hinteren Teil des Busses die zwei Frauen sitzen sah. Wann waren die denn an ihm vorbei? Er wollte nicht lange grübeln und arbeitete sich mit dem Schaukeln des Busses zu den beiden hin.
„Salut, ihr zwei Schönen. Darf ich mich zu euch setzen?“
„Aber immer doch“, antwortete die Blonde. Sie hatte eine sehr helle Stimme. Vielleicht waren sie doch noch nicht so alt. Pierre bekam Zweifel, setzte sich den beiden aber dennoch gegenüber. Wegen der Sonnenbrillen der Frauen waren die Augen nur schwer zu erkennen.
Er rutschte zum Fenster durch, worauf sich die Blonde sofort neben ihn setzte, einen Arm bei ihm unterhakte und den Kopf auf seiner Schulter ablegte. Dass es so gut laufen würde, hatte auch Pierre nicht erwartet.
Sie unterhielten sich über dies und das, wobei jetzt mehr die Dunkelhaarige mit ihm sprach. Sie hatte sich als Lucienne und ihre Freundin als Vivianne vorgestellt. Schöne Namen fand er, und passend. Er versuchte noch, herauszufinden, wo die beiden herkamen. Den Dialekt der beiden konnte er partout nicht einordnen. Da biss er aber auf Granit.
Vivianne – die Blonde – angelte nach dem Halteknopf und drückte. Pierre war etwas erstaunt. Die nächste Haltestelle lag in einem Gewerbegebiet. Da würde niemand sein um diese Uhrzeit. Lucienne verwirrte ihn noch mehr, als sie ihn unvermittelt nach seiner Blutgruppe fragte.
Der Bus hielt. Die Tür öffnete sich und schloss sich kurz darauf wieder, bevor er anfuhr und seine Tour durch den späten Abend fortsetzte. An den hinteren Seitenscheiben glitzerte frisches Blut im Licht der aufleuchtenden Straßenlaternen.
Aus dem Halbschatten einer kleinen Gasse zwischen zwei Lagerhäusern wehte Gelächter und Gesang zur Hauptstraße.
Ein altes Kinderlied.
„Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot ...“
KAPITEL 3
Das Piepen war immer noch da. Ach ja, ich lag ja in einem Krankenhaus. Und ich lebte noch. Der Schlaf hatte mich noch gut im Griff.
Die Schmerzmittel, die man mir wahrscheinlich in rauen Mengen eingetrichtert hatte, ließen langsam nach. Ich spürte jetzt auch den Rest meines Körpers und bedauerte es im selben Moment. In dem Maß, indem mein Hals besser geworden war, konnte ich jede andere Verletzung schon dumpf fühlen. Mit dem Vorgeschmack konnte ich nur hoffen, dass ich bald einen Nachschlag bekam.
Ich öffnete also die Augen, um mich bemerkbar machen zu können. Das Zimmer lag im Halbdunkel. Ich sah den jungen Mann, der meine Atmung und meine anderen ’Vitalfunktionen’ beobachten sollte. Er saß zusammengesunken in einem Stuhl. Auf dem leeren Nachbarbett hatte er Notizen, Bücher und laminierte Tabellen ausgebreitet. Seinen Pschyrembel hatte er wie ein Baby vor die Brust geklemmt und schnarchte leise, nur von einer Leselampe beleuchtet.
„Hallo, Schlafmütze“, grüßte mich eine warme Stimme von der anderen Seite des Bettes.
Charlotte saß entspannt auf dem Besucherstuhl und schaute mich an. Ihre Halbmaske, die bei Bedarf ihr fehlendes rechtes Auge verdecken sollte, trug sie heute nicht. Die leere Augenhöhle schockierte mich aber auch nicht mehr. Für mich gehörte das einfach zu ihr dazu.
Die Bewegung tat mir saumäßig weh, aber ich drehte meinen linken Arm in ihre Richtung, um vielleicht eine Hand von ihr erreichen zu können. Sie kam mir entgegen und ergriff meine Hand. Sie streichelte sie gemächlich.
„Wie geht’s dir?“, fragte sie. Und in einem Nachsatz: „Ich weiß, die Frage ist angesichts deiner Verletzungen fast beleidigend, aber ...“
„Nein, ist schon gut“, unterbrach ich sie. Ich stellte erfreut fest, dass Stimme und Hals nicht mehr so rau waren. „Dafür, dass ich tot sein sollte, geht’s mir verdammt gut. Und ich brauche bald wieder verdammt viel Schmerzmittel.“
„Soll ich deine Nanny aufwecken?“, schlug sie grinsend vor.
„Lass den mal schlafen. Noch geht’s halbwegs.“
„Irgendwelche anderen Wünsche?“, forschte sie weiter. Sie wollte auf irgendetwas hinaus, traute sich aber nicht, es offen anzusprechen. Ich seufzte leise.
„Spuck’s endlich aus. Was hast du auf dem Herzen?“
„Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.“
„Das habe ich gemerkt“, erwiderte ich neckend. Und wieder ernst: „Hat es mit Lissi zu tun? Ich weiß, dass ihr euch verkracht habt.“
Charlottes Miene verfinsterte sich und ihre Flügel bauschten sich leicht.
„Da hat sich Fräulein de Groot bestimmt mächtig gefreut, dass sie dich endgültig aus meinen Krallen reißen konnte“, grollte sie.
Das Lächeln war mir für den Moment vergangen. Da sie sich mit dem Spruch aber auch nicht traute, mich anzusehen, entging ihr der harte Blick, mit dem ich sie bedachte. Diesen Zickenkrieg konnte ich beim besten Willen nicht brauchen.
„Mich dürstet nach Blut“, verkündete ich leise – mit boshaftem Hintergedanken. Charlotte riss das Auge schockiert auf und starrte mich an.
„Schön, dass du mich wieder ansiehst“, eröffnete ich ironisch. „Und jetzt schau mir in die Augen und sag mir, dass du mir vollkommen uneigennützig Flügelchen verpassen wolltest.“
Charlotte sah betreten zu Boden und schwieg.
„Das habe ich mir gedacht“, seufzte ich. Jetzt streichelte ich ihre Hand, die trotz allem noch in meiner lag. „Ach, Charly. Würdet ihr noch miteinander reden, hättest du mitbekommen, dass ich immer noch euer Dewer’el bin. Du hast es nicht geschafft, mich zum Engel zu machen. Aber auch Lissi hatte keinen Erfolg. Das mit dem Blut war nur das Horn, mit dem ich versucht habe, deinen selbstgerechten Nebel zu durchdringen.“
Sie sah mich nachdenklich an. Besonders der letzte Satz schmeckte ihr nicht. Sie war verletzt deswegen.
„Der war jetzt nicht nötig“, sagte sie wütend.
Ich rollte mich wieder vorsichtig in die Mitte des Bettes und schloss die Augen. Die Schmerzen wurden stärker, waren aber noch immer auszuhalten. Ich drehte meinen Kopf wieder ein Stück und sah Charlotte traurig an.
„Entschuldige, Charly. Vielleicht ist das wirklich etwas hart gewesen. Aber ich will dieses Déjà-vu so schnell wie möglich wieder loswerden.“
„Und mein Déjà-vu war, dass ich wieder einen Träumer verliere und mir eine Kazass’mar sogar noch seine Seele vor der Nase wegschnappt“, ergänzte sie bitter. „Ich will dich nicht noch einmal sterben sehen.“
„Das ist lieb von dir. Und da sind wir sogar alle drei einer Meinung.“
Was war hier eigentlich das Problem? Verletzter Stolz? Charlotte war dafür anfällig, zumal sie in den letzten zwei Jahren so manche Demütigung von Lissi ertragen musste. Aber das allein? Es könnte noch einen anderen Grund haben. Ich wollte das Thema mal Dewer’el-mäßig angehen.
„Schau mal: Ich liebe euch beide und ich brauche euch beide. Du hast neben mir ja noch Michael, aber Lissi hat sonst niemanden. Deswegen hat sie so reagiert.“
Ich sah, wie bei Charlotte die Gewitterwolken aufzogen. Mein Verdacht hatte sich also bestätigt.
„Na, der hat ja jetzt seine Perach’el wieder“, brummte sie.
„Gib den beiden die Zeit“, antwortete ich sanft. „Ich konnte sie ein bisschen kennenlernen ...“
„Hing sie dir auch wie eine Klette am Hals?“, fragte sie verärgert dazwischen.
„Liebste Charly, sei ein Engel und gib ihr eine Chance. Sie hat einfach nur Angst. Und Michael ist die einzige Bezugsperson, die sie hat.“
„Was ist mit dir?“
„Ich glaube, sie hat auch vor mir Angst. Immerhin bin ich mit einer Nephil liiert.“
Charlotte stöhnte leise.
„Wahrscheinlich hast du recht. Wieder mal.“
„Rede mit ihr. Sie braucht jetzt nichts dringender als Vertrauen und Erklärungen. Vielleicht findest du ja auch noch einen Menschen, der ihr aus seiner Sicht die Oberwelt begreiflich macht.“
Charlotte nickte nachdenklich.
„Sie war wohl sehr lange da unten. Konntest du da was in Erfahrung bringen?“
„Nach Adam sein Riese müssen es rund dreihundert Jahre gewesen sein. Sie ist 1711 oder 1712 gestorben und war noch nicht lange Engel, als sie verschleppt wurde.“
„Dann weiß sie nicht viel über die Welt“, schniefte Charlotte versonnen.
„Geh mal von angenähert null aus. Ach, sie kann wohl das Alphabet lesen und schreiben.“
„Das ist doch wenigstens ein Anfang.“ Sie stand auf und strich ihre Tunika glatt. „Ich muss wieder los. Gabriel hat angeklopft.“
„Grüß ihn von mir. Und Septimus, wenn du ihn siehst. Er kriegt von mir einen eigenen Tempel allein für die Caestus, die er mir geliehen hat.“
„Lieber nicht. Sein Kopf ist eh schon übergroß“, erwiderte sie grinsend. Sie beugte sich zu mir herab und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Sie strich mir noch einmal über die Wange und wandte sich zur Tür, blieb aber auf halber Strecke stehen. „Meinst du, Lissi würde sich bei mir entschuldigen?“
Ich hätte fast laut losgelacht, aber ich biss mir nur auf die Lippen.
„Es wäre ja auch nur für mein Ego“, schob sie nach, ohne aufzusehen.
„Dann sehe ich gute Chancen“, lachte ich. Und etwas nüchterner: „Bevor du gehst. Kannst du den Studenten wecken? Jetzt könnte ich neue Drogen brauchen.“
„Klar!“ Sie breitete ihre Schwingen leicht aus, ließ ein wenig Feuer über die Ränder spielen und rief mit gewaltiger Stimme: „Wach auf, Sterblicher!“
Der junge Mann riss die Augen auf und schaute dem Engel direkt ins Angesicht. Im selben Moment verlor er das Gleichgewicht, ruderte wild mit den Armen und verschwand mit Buch und Stuhl krachend zwischen dem Nachttisch und dem Nachbarbett.
Charlotte grinste breit und verschwand mit einem leisen Plopp.
Der Student kämpfte sich stöhnend und fluchend wieder hoch.
„Was war das denn?“, schnaufte er, während er den Stuhl wieder aufrichtete und seinen Pschyrembel von Eselsohren befreite. „Jetzt seh ich schon Engel.“
„Vielleicht der viele Kaffee?“, schlug ich amüsiert vor.
„Wenn der noch was bewirken würde“, meckerte er. Dann schaute er mich scharf an. „Oder war der doch da?“
„Eine sie! Sie heißt Charlotte“, gab ich lächelnd zurück.
Mein Aufpasser ließ sich schwer auf den Stuhl fallen und schaute einen Moment zu Boden.
„Sie machen mich echt fertig“, sagte er gequält. „Was kommt als nächstes? Zombies?“
„Keine Ahnung. Aber ich möchte Ihnen auch die Vorfreude nicht nehmen.“
„Vorfreude? Sehr witzig. Ich hatte in den letzten acht Stunden so viel Angst, wie nie zuvor.“
„Na, dann wollen wir mal hoffen, dass Ihnen meine furchteinflößenden Bekanntschaften erspart bleiben“, erklärte ich grinsend.
„Sie haben nicht alles vergessen, oder?“, wollte er noch einmal wissen.
„Leider nein“, erwiderte ich mit Bedauern.
„Sie wollen aber auch nicht darüber reden, nehme ich an.“
„Ich will Ihren Intellekt nicht beleidigen, aber ... das würde Ihren Horizont übersteigen“, sagte ich vorsichtig. Zur Erklärung führte ich weiter aus: „Ich habe zwei sehr gute Lehrer, die dieses Anderssein leben. Sie haben beide hier gesehen. Und ich habe selbst Fähigkeiten, die mich – sagen wir mal – von der Masse abheben.“
Er dachte über das Gesagte nach und nickte dann bedächtig.
„Ich check nicht so ganz, was hier abgeht, aber so wie sie es sagen, glaube ich es zu verstehen.“
„Dann hätten Sie mir glatt was voraus“, lachte ich. „Nein, im Ernst, ich bekomme langsam die Zusammenhänge mit. Und wenn ich lange genug lebe, verstehe ich es vielleicht auch mal.“
„Klingt hart“, meinte er kritisch.
„Ach was! Ich mach mir darüber keinen Kopf – vorerst“, erwiderte ich trocken. „Hart ist eher, dass die Schmerzmittel nachlassen.“
„Der Wink mit dem Zaunpfahl. Ich hole jemanden.“ Er legte sein Buch beiseite und verschwand durch die Tür, auf der Suche nach der Nachtschwester.
Nach einer knappen viertel Stunde schlief ich selig und zugedröhnt wieder tief und fest.
Nach einer ausführlichen Untersuchung durch meinen Arzt wurde angeordnet, dass ich mich gelegentlich schon einmal etwas aufrichten sollte. Außerdem kam jetzt zweimal täglich ein Physiotherapeut in meinem Alter vorbei, der meinen linken Arm bewegen sollte. Netter Kerl, nicht sehr gesprächig. Und nach den anfänglichen, heftigsten Schmerzen ließen sich die Übungen auch ganz gut aushalten. Der Arzt war optimistisch, mich wieder vollständig herstellen zu können. Mein Physiotherapeut nickte nur aufmunternd.
++++
Die Polizeipsychologin Patricia Bergheim starrte ungläubig auf den Bildschirm ihres Laptops. Sie hatte ihren Feierabend damit eingeleitet, sich eine Pizza in den Ofen zu schieben, eine Flasche Rotwein aufzuziehen und ihre Mailbox zu checken. Sie wartete auf Rückmeldung zweier Freunde, die sich gerade im Ausland aufhielten. Durch die jeweilige Zeitverschiebung konnte sie nicht nach Lust und Laune dort anrufen. Also hatten sie ausgemacht, dass sie wartete, bis die Tagesabläufe sich eingespielt haben. Dann könnten auch wieder längere Telefonate koordiniert werden. Die Probleme der Globalisierung.
Nicht gerechnet hatte sie mit einer Antwort von diesem dubiosen Anwalt Dr. Krasselt. Es war erst vier Wochen her, dass er mitten in der Nacht in den Verhörraum des Polizeipräsidiums trat und diesen Telekineten, Karl Mustermann, freiboxte, in dessen Wohnung eine Schlacht stattfand, die mit fünfzehn Toten endete.
Er hatte ihr weismachen wollen, dass er rund 2.500 Jahre alt sei. Unglaublich! O.k., ’suggeriert’ wäre passender gewesen. Er hatte ihr einen lateinisch klingenden Namen für einen Ort hingeschmissen, an dem er geboren sein wollte. Ja, es gab diesen Ort. Sie hatte im Internet nachgeforscht. Der Ort war lange vor Christi Geburt zerstört worden. Aber was sagte das über den Mann?
Sie traute sich erst nicht, die Mail zu öffnen. Sie war keine dreißig Minuten alt. Irgendetwas sagte ihr aber, dass sie sich schnell entscheiden müsse.
Mit mulmigem Bauchgefühl bewegte sie den Mauszeiger in Position und klickte die Nachricht an.
Vornan stand ihre eigene Nachricht, in der sie fragte, wie Herr ’Dr. Krasselt’ richtig heiße. Dann kam ihre digitale Visitenkarte. Sie scrollte weiter nach unten und fand eine kurze Mitteilung. Was ihre Frage anbelangte, wurde sie enttäuscht. Der eine Satz, den sie von ihm bekommen hatte, machte sie jedoch neugierig.
Ihre Erfahrung mit Folteropfern wird in der Südallee 37 benötigt.
Woher wusste er, dass sie sich zu diesem Thema extra hatte ausbilden lassen?
Grübelnd machte sie den Ofen wieder aus und verkorkte die Weinflasche. Da sie noch immer ihren Büroanzug trug, musste sie ausnahmsweise einmal nicht über ihr Äußeres nachdenken. Sie war nicht eitel, eher unsicher. Am liebsten hätte sie wie die Kollegen, mit denen sie täglich zu tun hatte, Uniform getragen. Sie war aber kein Polizist im eigentlichen Sinne.
Sie fuhr in die Tiefgarage, setzte sich in ihr kleines Auto und kramte erst einmal den Stadtplan aus dem Handschuhfach. Sie wollte sich schon längst ein Navigationsgerät kaufen, kam aber immer wieder vom Thema ab. Außerdem wusste sie in etwa, wo sie hinmusste. Die Stadt war ja nicht so groß. Ein schneller Blick auf den Plan und es konnte losgehen.
Keine zwanzig Minuten später – der Ampelgott war gnädig – bog sie in die Südallee ein. Sie musste nur noch die Hausnummer finden. Aber auch dabei wurde ihr ein längeres Suchen abgenommen. Sie erkannte schon von weitem die aufrechte Gestalt des Rechtsanwalts, der sogleich auf sie zukam, als sie sich in eine Parklücke fädelte, und die Wagentür für sie öffnete.
„Liebe Frau Bergheim“, begrüßte er sie mit einem breiten Lächeln. „Sie ahnen ja nicht, wie sehr ich mich freue, dass sie meinem Ruf tatsächlich gefolgt sind. Und so schnell noch dazu.“
„Herr Dr. Krasselt, sie haben mich einfach neugierig gemacht“, erwiderte sie zurückhaltend. „Nur scheinen Sie Fragen nur ungern zu beantworten. Erfahre ich denn zum Beispiel, woher Sie von meinem Spezialgebiet wissen?“
„Ins Blaue hineingeraten?“, antwortete er ausweichend. Er seufzte, senkte den Blick und verschränkte die Hände hinter dem Rücken ineinander.
„Ich weiß, ich verlange viel von Ihnen, wenn ich Sie aus dem wohlverdienten Feierabend reiße und Ihnen dann keine Gründe dafür biete. Einiges will ich gerne heute aufklären.“
Er machte eine einladende Handbewegung in Richtung der Hausnummer 37.
„Wollen Sie mir hineinfolgen?“, bat er höflich.
Sie nickte kurz und ging in die angezeigte Richtung. Abschätzend begutachtete sie die schlanke gerade Gestalt des Mannes neben ihr. Aus seiner Körperhaltung konnte sie auf einen militärischen Hintergrund schließen.
„Sie waren Soldat?“, fragte sie aufs Geratewohl.
Er lächelte sie an.
„Sie sind gut.“ Und nach kurzem Zögern, „Ich war Centurio bei den in Germanien stationierten Legionen in der Nähe von Augusta Treverorum. Das ist heute die Stadt Trier. Und um Ihre Frage aus der E-Mail endlich zu beantworten, ich wurde als Septimus Crassus geboren.“
Ihre Gedanken schwirrten. Er sagte das mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr eine Gänsehaut bereitete.
„Sie wollen damit sagen ...“
„Ja“, unterbrach er schnell, „aber es geht hier nicht um mich.“
„Sie werden aber verstehen ...“
„Natürlich. Sie wollen wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Eines vorneweg: Alter spielt in den Kreisen, in denen ich verkehre, keine Rolle. Bitte befreien Sie sich von diesem Konzept. Unser gemeinsamer Freund Karl hatte, so weit ich mich erinnere, etwas in der Richtung angedeutet.“
„Und eine kleine Vorführung abgegeben“, bestätigte sie. „Ich werde dann auch nicht noch mal fragen, woher Sie ihr Wissen über mich haben. Also ... was erwartet mich?“
Er verneigte sich kurz vor ihr. Sie blieben noch vor dem Hauseingang stehen.
„Ich danke Ihnen für ihr Verständnis“, setzte er vorsichtig an. „Wenn Sie denn immer noch wollen, erwartet Sie eine junge Frau, die über viele Jahre auf das Schwerste misshandelt wurde. Sie ist sehr entstellt. Sie hat keinen Bezug zur heutigen Welt.“
„Wenn ich unterbrechen darf? Wie jung ist die junge Frau?“
„Nun ...“, wand er sich, „da sind wir wieder bei der Altersfrage.“
Patricia schluckte.
„Reden wir hier über Menschen?“
Septimus schaute zu Boden, wo er mit der Spitze seiner eleganten Halbschuhe ein Steinchen hin und her rollte.
„Dr. Krasselt ... Crassus ... lassen Sie die Katze aus dem Sack!“, forderte sie.
„Engel!“, sagte er leise.
Sie blinzelte zwei, drei Mal und holte schon Luft, um darauf zu antworten, ließ sie jedoch unverrichtet wieder aus. Karl Mustermann hatte von Höllenwesen und Vampiren gesprochen. Warum also nicht auch Engel? Aber wie sollte sie dann von Nutzen sein? Diese Frage stellte sie dann auch.
Septimus Crassus lachte leise und schloss die Haustür auf. Sie traten in das Treppenhaus und stiegen langsam zur zweiten Etage.
„Die junge Dame war einmal ein Mensch, wie auch das Gros der Engel. Sie ist momentan nur von Nichtmenschen umgeben. Karl hatte vorgeschlagen, das zu ändern. Wenigstens so lange wie er noch im Krankenhaus liegt.“
„Oh, das wusste ich nicht“, rief sie bestürzt.
„Er wurde schwer verletzt, als er die junge Frau und seine Freundin aus der Unterwelt rettete.“
„Das hätte ich ihm nicht zugetraut“, gestand sie.
„Und auch sonst niemand – bis jetzt!“, gestand auch er. „Er hat uns alle überrascht.“
Vor der Wohnungstür hielten sie nochmals inne. Septimus Crassus wackelte zweimal mit den Augenbrauen. Patricia verstand und lächelte.
„Machen Sie schon auf. Wenn mein Verstand anfängt zu entgleisen, wird mich doch sicher jemand rausbringen, oder?“
Septimus’ Lachen hallte durch das Haus.
„Wenigstens das kann ich Ihnen versichern.“
Die Wohnung war ruhig. Man hörte von irgendwo her Geschirr klappern und Wasser rauschen, wie von einer Dusche. Das Plätschern des Wassers endete kurz darauf. Crassus ging den Flur entlang bis zu einer Tür. Patricia blieb noch am Eingang stehen.
„Salve, magister somniorum“, grüßte der Römer in den Raum.
„Ach, hallo Septimus“, grüßte eine Frauenstimme zurück.
„Ich habe die Frau mitgebracht, über die wir gesprochen hatten. Frau Bergheim, die Psychologin.“
„Crassus, ist Euch jemals in den Sinn gekommen, Euch anzukündigen?“, schimpfte die Frau. „Ihr wisst, dass wir hier alle nackt rumlaufen. Und ich habe meine Maske nicht auf.“
„Ja, das sehe ich – das eine, wie das andere“, erwiderte er amüsiert.
In dem Moment ging auch die Badezimmertür auf und eine junge Frau trat vollkommen unbekleidet heraus. Patricia hielt aufgeregt die Luft an, als diese sie kurz mit nachtschwarzen Augen ansah. Das musste der Vampir sein, Karls Freundin. Zur Bestätigung grinste diese leicht und zeigte ihr blitzblankes Raubtiergebiss. Sie hob die Hand zum Gruß, sah aber schon Crassus an.
„Hy, Sep!“, sagte sie halblaut. Sie betonte es amerikanisch, mit einem scharfen S. Der Angesprochene fuhr herum, um gerade noch zu sehen, wie der Vampir in einem weiteren Zimmer verschwand.
Patricia hatte von oben bis unten Gänsehaut. Sie hatte noch im Detail vor Augen, dass der Vampir nicht nur wunderschöne lange, glatte und weiße Haare hatte, sondern auch Narben am ganzen Körper. Die Krönung waren die zwei großen Löcher in ihrem Brustkorb, die sie nicht nur vorn sehen konnte, sondern auch entsprechend am Rücken. Die Wunden gingen also ohne Zweifel einmal durch.
„Salve, Lysje“, grüßte Septimus gegen die sich schließende Zimmertür. Entschuldigend, schulterzuckend wandte er sich Patricia zu. Unschlüssig zeigte er mit beiden Händen auf die Tür, hinter der gerade der Vampir verschwunden war, und anschließend auf den Raum zur anderen Seite.
„Beweg dich, Römer“, knurrte es aus der Küche. „Bring sie ins Wohnzimmer, damit ich zu meinen Sachen kann.“
„Ich könnte mich kurz wegdrehen“, rief Patricia. „Ich will keine Umstände machen.“
Zur Küche gewandt versuchte Crassus sich zu rechtfertigen.
„Ich hab ihr schon von Perach’el erzählt. Da ist Euer Antlitz doch bei weitem nicht so schlimm.“
Ein heller werdendes, flackerndes Licht drang durch die Türöffnung und die Frau brüllte:
„Crassus!“
Der Mann duckte sich in den Flur, als auch schon etwas Silbriges durch die Luft schoss und mit einem Knall die Badezimmertür traf.
Septimus Crassus richtete sich wieder auf und grinste Patricia an.
„Also wenn Sie sich kurz zur Tür drehen würden?“
Sie drehte sich wie angeboten um und hörte auch schon, wie nackte Füße über den Dielenboden patschten.
„Und der Typ will der beste Diplomat sein“, grollte die Frau.
Septimus Crassus räusperte sich kurz darauf.
„Wir könnten dann in das Wohnzimmer wechseln“, schlug er vor.
Keine drei Minuten später verschlug es Patricia die Sprache – wieder. Sie hatten es sich in einer Sitzgruppe aus einer Couch und drei niedrigen Sesseln bequem gemacht und einige Worte gewechselt, als ein leibhaftiger Engel den Raum betrat.
Crassus erhob sich.
„Darf ich bekannt machen? Traummeisterin A’phrax’elení, geborene Charlotte Eidinger.“
Diese hatte sich eine einfache cremefarbene Tunika übergeworfen und ihre weißemaillierte Halbmaske aufgesetzt. Sie trat noch einen Schritt auf Patricia zu und reichte ihr die Hand, während der Römer fortfuhr:
„Charlotte, das ist Patricia Bergheim, Polizeipsychologin.“
„Schön, dass Sie hier sind. Nennen Sie mich bitte Charlotte.“
„Gern. Dann bin ich Patricia.“
Alle setzten sich und Patricia sah gleich, dass die niedrigen Sessel mit Bedacht gewählt waren. Charlotte konnte sich bequem anlehnen, da die Flügel nicht von einem Rückenteil behindert wurden.
„Charlotte, bitte verzeiht, wenn ich als Erstes nach etwas Offensichtlichem frage“, fing Patricia das Gespräch an. „Sie sind tatsächlich ein Engel?!“
„Wie Sie schon sagten, offensichtlich“, lachte sie und wackelte erst mit der einen, dann mit der anderen Schwinge.
„Ihrem sehr bürgerlich deutsch klingenden Namen darf ich entnehmen, dass sie früher kein Engel waren“, forschte die Psychologin weiter.
„Wie die Mehrzahl der Engel habe auch ich vorher ein menschliches Leben gehabt“, antwortete der Engel freundlich.
Weiter hinten in der Wohnung öffnete sich eine Tür und eine weitere Frau rief in den Flur:
„Scharlodde, honn isch Stimma gheert? Met wem hascht gredd?“
Der Engel senkte den Kopf und lächelte breit.
„Das ist die Person, für die wir Sie hergebeten haben“, sagte sie halblaut. Und in die andere Richtung rief sie: „Perach’el, du hast richtig gehört. Wir haben Gäste. Ich hol dich.“
Sie stand auf und ging der anderen Stimme entgegen.
„Isch heer Septimusch, awwr wem sinn Stimm isch de onnere?“, fragte die junge helle Stimme.
„Das ist die Frau, über die wir gestern geredet haben“, erwiderte Charlotte.
„Ah, dr Mensch, wu mer de Neijzitt vrkläre soll“, sagte die Frau aufgeregt. „Awwr isch duu ès vrschregge“, fügte sie ängstlich an.
„Beruhige dich, kleine Blume“, redete Charlotte auf sie ein, „du wirst sie schon nicht verschrecken. Sie hat ein wenig Erfahrung mit Versehrten.“
Patricia sah erst nur Charlotte, die ihre Flügel um ihren Körper und den einer weiteren Person gefaltet hatte, in den Raum treten.
Charlotte sah der Psychologin mit dem einen sichtbaren Auge direkt ins Gesicht und musterte sie einen Moment eindringlich.
„Ich hoffe, wir täuschen uns nicht in Ihnen, Patricia“, sagte sie ernst.
Septimus Crassus stand wieder auf und strich sich die Hose glatt. Und auch Patricia erhob sich.
„Ich darf ankündigen: der Engel Perach’el, geborene Blanche Grandchamp!“
Charlotte öffnete ihre Schwingen und gab den Blick auf eine sehr junge Frau frei, die ebenfalls in eine Tunika gekleidet war. Das dunkelblonde Haar fiel ihr in kleinen Löckchen bis auf die Schultern. Sie war sehr dünn und fast einen Kopf kleiner als Charlotte.
Trotz der Ankündigung als Engel hatte sie keine Flügel, was Patricia etwas verwirrte. Außerdem hatte sie – und die Gänsehaut war wieder da – keine Augen. In diesem hübschen schmalen Gesicht umrahmte eine stark vernarbte Haut zwei dunkle und leere Augenhöhlen. Dennoch lächelte sie, dass der Psychologin das Herz aufging.
Sie musste ein paar Mal schlucken, um nicht zu weinen.
„Mein Gott, so eine schöne Frau“, hauchte sie, ohne weiter nachzudenken und hielt sich ergriffen mit beiden Händen das Gesicht.
Perach’el lehnte sich bei Charlotte an und seufzte berührt.
Nach nur wenigen Tagen mit straffer Planung und reichlich Physiotherapie konnte ich einen Teil meiner Zeit schon außerhalb des Bettes verbringen. Der Arzt trieb mich quasi hinaus, damit mein Körper nicht noch mehr abbaute. Die Schmerzen waren anfangs unbeschreiblich, besserten sich aber je mehr ich mich bewegte. Aber das war nicht anders zu erwarten.
Für mein geistiges und seelisches Wohl sorgten Charlotte und Lissi, die mich regelmäßig besuchen kamen. Charlotte hatte auch schnell wieder das Training aufgenommen, jetzt wo ich wieder wach war. So wechselte ich mit jedem Mal, das ich schlief, ohne zu viel Schmerzmittel intus zu haben, auf die Traumebene und ließ mich von ihr unterrichten.
Lissi konnte sich sozusagen erst einmal zurücklehnen. Sie hielt den Erfolg ihres kurzen Trainings wieder jede Nacht im Arm. Ich hatte überlebt. Und sie legte sich dann immer, wenn sie mich nachts besuchte, mit unter die Decke. So auch dieses Mal.
„Ich hab mit dem Arzt gesprochen“, flüsterte sie mir ins Ohr.
„Hat er überlebt?“, fragte ich leise zurück. Ich spürte, wie sie grinste.
„Ich kauf dir einen Neuen“, gab sie schelmisch zurück.
„Das ist lieb von dir“, spielte ich weiter. „Dann aber bitte einen, der noch Bodenhaftung hat.“
„Ich schau, was sich machen lässt. Nein“, wurde sie wieder ernster, „er sagte, dass du übermorgen nach Hause kannst. Die Heilung geht besser voran, als er erwartet hatte.“
„Das sind doch mal gute Nachrichten.“ Da wir nicht weiter darüber gesprochen hatten, hakte ich noch einmal nach: „Wie sieht denn mein Zuhause jetzt aus?“
„Hat dir Charlotte nichts erzählt?“
„Sie hat bestimmt das Gleiche von dir angenommen.“
„Hm, muss wohl.“
„Ich kann mich noch erinnern, dass ihr bei eurer Party die Möbel etwas umgestellt habt ... und die Wände ...“
Lissi kicherte in meine linke Schulter, die sie vor nicht allzu langer Zeit noch als Kauknochen genutzt hatte. Ich liebte es, wenn sie so kicherte, auch wenn mir jetzt die Schulter dabei noch wehtat. Das würde sich auch bald bessern.
„Gabriel hat eine Idee laut geäußert und Crassus sofort reagiert. Du bist jetzt stolzer Besitzer deiner alten Wohnung und der Nachbarwohnung noch dazu.“
„Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Geld auf meinem Konto ist.“
„Und dass das dann noch von einem kleinen Kloster in Tirol verwaltet wird.“
Ich lachte leise – und so vorsichtig es ging.
„Und die Mönche werden dafür dann gelegentlich mit echten Engelserscheinungen belohnt, nehme ich an.“
„Wenn ich Crassus richtig verstanden habe, läuft es genau darauf hinaus. Viele göttliche Visitationen sind einfach nur Hysterie.“
„Drogen?“
„Wer weiß? Crassus wollte sich nicht so genau darüber auslassen. Jedenfalls gibt es wohl mehr als ein Kloster oder ähnliches, wo echtes himmlisches Geld verwaltet wird.“
„Beeindruckend. Und was mach ich mit der schönen großen Wohnung? Uns beiden hat doch die alte gereicht.“
„Schon, aber Gabriel dachte, dass ein Stützpunkt in der Oberwelt ganz sinnvoll wäre. Und da du in letzter Zeit regelmäßig Besuch auch von Engeln hast ...“
„Ja, ich hab schon über Fliegengitter an den Fenstern nachgedacht.“
Lissi kicherte in meinen Hals und streichelte mich anschließend eine Weile schweigend.
„Was ist mit Perach’el?“, fiel es mir ein. „Lebt sie sich langsam ein?“
„Sie hat ein eigenes Zimmer in deiner Wohnung.“
„Das ist schön“, kommentierte ich.
„... und Crassus hat eine Psychologin engagiert. Patricia irgendwas!“
„Patricia Bergheim? Echt?“, fragte ich verblüfft. „Die kenne ich aus dem Verhör bei der Polizei.“
„Verhör?“, fragte jetzt Lissi.
Ich erzählte ihr kurz von der Zeit nach ihrer Entführung.
„Ach, daher kennt er sie“, schloss Lissi. „Die scheint ganz nett zu sein. Und sie kümmert sich gut um Perach’el. Sie verbringt viel Zeit mit ihr.“
Wir redeten noch eine Weile über alle möglichen Dinge, bis Lissi sich dann aus dem Bett schwang und sich erst einmal verabschiedete. Mir blieben noch ein paar Stunden Schlaf, bevor die Morgenroutine startete.
KAPITEL 4
Geert war schon ganze zwei Jahre Professor für Kirchenrecht an der Radboud Universiteit in Nimwegen. Die zwei Bücher, die er geschrieben hatte, waren quasi seine Eintrittskarte. Er hatte schon an anderen Universitäten gearbeitet, aber von dieser Theologischen Fakultät wurde er geradezu umworben. Und jetzt saß er in seinem Büro in der 16. Etage des Erasmushauses und konnte jeden Tag den Blick über die Stadt genießen. Viel Zeit hatte er dazu nicht. Die Fakultät war klein aber sehr aktiv. Und vor nicht einmal einer halben Stunde hatte er noch mit dem Rektor telefoniert. Der Tag der offenen Tür im Spätherbst musste wieder organisiert werden. Viel Arbeit stand an. Aber nicht mehr heute.
Er sortierte seine Notizen, während er seinen Computer herunterfuhr. Den Wochenplan für die nächste Woche hatte er fast fertig und sein drittes Buch machte gute Fortschritte.
Er schaute auf die Uhr. Kurz nach acht. „De Refter“, das Uni-Restaurant, würde schon zu haben. Dann halt eines der netten Lokale in der Nähe seiner Wohnung.
Seine Frau – Wissenschaftlerin wie er – war ja gerade zu einer Vortragsreise in Frankreich und Spanien unterwegs. Er musste sich selbst versorgen. Und für sich alleine kochen war nicht sein Ding. Er würde sie auf dem Heimweg noch anrufen und fragen, was sie heute essen würde. Da sie noch in Frankreich war, wusste er auch schon, welche Lokale in Frage kämen. Er würde sich das Gleiche bestellen und ein Glas Wein auf ihr Wohl trinken. Das hielten sie so, seitdem sie sich kannten. Er freute sich schon.
Er schaute sich noch einmal in seinem Büro um. Alles war ordentlich und zu seiner Zufriedenheit. Er griff sich die Briefe, die er heute geschrieben hatte, und schloss sein Büro ab.
Er nahm das Treppenhaus, um die eine Etage in den 15. Stock zu gelangen. Im Sekretariat stand ein Korb für den Postausgang, der morgens geleert wurde.
Als er die Tür öffnete, um in den Flur zum Sekretariat zu kommen, hörte er Stimmen. Zwei Frauen schwatzten gedämpft aber in der Stille gut hörbar. Er dachte erst an die Sekretärinnen, die manchmal bis spät abends noch im Büro saßen, wenn viel Arbeit anstand. Aber diese zwei sprachen Französisch. Seine Kenntnisse reichten gerade, um die Sprache zu erkennen. Seine Frau konnte in ihr fließend ’parlieren’. Er beneidete sie manchmal darum. Jetzt zum Beispiel.
Er kam an dem kleinen Wartebereich vorbei, fand aber niemanden vor. Von einer anderen Ecke der Etage hörte er leises Frauenlachen. Verwundert schüttelte er den Kopf. Jetzt hörte er schon tagsüber Stimmen und nicht nur nachts in seinen Träumen.
Er öffnete die Tür zum Sekretariat und warf seine Briefe in den Postkorb. Zufrieden, auch das erledigt zu haben, schloss er wieder ab und ging zum Fahrstuhl.
Er drückte den Rufknopf und wartete eine Weile. Der Fahrstuhl war nicht gerade schnell aber dafür zuverlässig. Er hatte noch nie erlebt, dass er zu seinem Büro hätte die Treppe nehmen müssen. Er war zwar nicht dick, aber er hatte auch keinen Sinn für Sport. Den überließ er gerne anderen.
Die Kabinentür öffnete sich und er trat ein. Er drückte den Knopf für das Erdgeschoss und dann den, um die Kabinentür zu schließen. Als er sich wieder aufrichtete, standen neben ihm zwei junge Frauen in der Kabine.
Ihm entfuhr ein „Huch!“, als er zusammenzuckte. „Euch habe ich ja gar nicht bemerkt.“
Wahrscheinlich waren das Studentinnen. Aber was machten sie so spät noch in seiner Fakultät? Die Neuen waren lange genug da, dass er allen Gesichtern Namen zuordnen konnte, und umgekehrt. Und jetzt standen diese beiden da.
Sie sahen zu jung aus für ein Studium. Die eine mit langen dunkelbraunen, fast schwarzen Haaren, die andere kurz und blond. Er konnte sie schwer einschätzen, da hinter den Sonnenbrillen die Augen leider nicht zu sehen waren. Sie lächelten ihn an.
„Gehört ihr zur Fakultät? Ich habe euch noch nie hier gesehen“, versuchte er nochmals, ein Gespräch anzufangen und vielleicht etwas aus den Zweien herauszulocken.
Die Blonde fragte, sagte etwas auf Französisch. Er hob nur die Schultern und machte mit den Händen eine fragende, entschuldigende Bewegung.
„Ich verstehe leider kein Französisch“, erwiderte er bedauernd.
Die zwei Mädchen schienen auch kein Niederländisch zu sprechen, weswegen er schon überlegte, es mit Englisch oder Deutsch zu versuchen. Doch plötzlich fragte die Dunkelhaarige in gebrochenem Holländisch.
„Welche Blutgruppe hast du?“
Die Kabinentür öffnete sich im Erdgeschoss. Nach einigen Sekunden des Verharrens schloss sie sich wieder. Am Fuß der Fahrstuhltüren bildete sich langsam ein kleiner See, der im Licht der Lampen in der Eingangshalle tiefrot schimmerte.
Von Ferne hörte man glückliches Kinderlachen und Fetzen einer alten Melodie in Latein.
„Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch…“
KAPITEL 5
Der Tag war anstrengend für mich. Der Arzt, der mich bis jetzt behandelt hatte, bot noch einmal alles auf, was die Medizin in meinem Fall so zu bieten hatte. Blutbild, Lungenfunktionstest, Röntgenaufnahmen, EKG, EEG, PVC, DDT, WTF ... Der Herr Doktor zeigte sich widerstrebend zufrieden. Meine Werte waren durchweg gut und für meine Verhältnisse sogar besser, als sie sein dürften. Ich konnte also am nächsten Morgen nach Hause. Endlich.
Lissi hatte sich schon verabschiedet. Ich hatte das Bett wieder für mich. Ich war zu erschöpft für ausschweifende Diskussionen, also hatten wir nur wenig geredet. Lissi wollte noch einiges erledigen, bevor ich zu Hause eintraf. Bei den Details wurde sie recht undeutlich, was verdächtig nach Überraschung roch. Sie hatte jedenfalls ihren Spaß und den gönnte ich ihr von Herzen.
Ich lag entspannt auf dem Rücken. Mit geschlossenen Augen wartete ich dösend darauf, in den Schlaf zu tauchen.
Wie aus dem Nichts bohrte sich plötzlich etwas Spitzes, Kaltes in meinen Hals, ohne jedoch die Haut zu verletzen. Ich rührte mich nicht. Nur mein Herzschlag beschleunigte sich natürlich. Kurz erwog ich, mit meinem Geist zuzuschlagen, verkniff es mir aber. Ich war mir nicht sicher, ob mein Hals genug Platz bot für das, was dagegen gedrückt wurde, sollte ich zu langsam sein.
„Du bist wach, Dabol’krat“, sagte eine raspelige Stimme halblaut neben mir.
Ich seufzte leise und öffnete die Augen. Ein großer kräftiger Dämon stand neben meinem Bett und hielt mir sein Schwert an die Kehle. Er trug dunkle Kleidung und war kaum auszumachen. Die Lichter im Zimmer waren gelöscht und nur die Straßenbeleuchtung sorgte für ein Minimum an Sicht.
„Wer bist du und was willst du?“, fragte ich so ruhig, wie es mir möglich war.
„Ich bin Rabal“, antwortete der Dabol mit kaum unterdrücktem Zorn, „Sohn des Morgarach, Vater des Hardan, oberster Kriegsherr der Daboli!“
‚Scheiße’, dachte ich so bei mir. Nur nicht den Kopf verlieren. Wenn er mich hätte töten wollen ... aber der Gedanke war zu einfältig. Die Daboli sahen das Töten von Menschen sehr sportlich. Er könnte mich lange Schreien lassen und würde sich über jeden freuen, der hereinkam, um nach dem Grund zu sehen. Und zu Ersterem hatte er allen Grund, hatte ich doch sowohl seinen Vater als auch seinen Sohn auf dem Gewissen. Nicht persönlich, aber das spielte für ihn bestimmt keine Rolle. Trotzdem hatte es mir scheinbar den Spitznamen ‚Bezwinger der Daboli‘ eingebracht.
„Hm, und warum bist du hier? Willst du mich töten?“, fragte ich noch immer beherrscht.
„Kuros sagt, rühr Dabol’krat nicht an“, grunzte er wütend. Er kochte innerlich. Und damit ging scheinbar auch seine Grammatik flöten. „Kuros sagt, Dabol’krat geht nicht nach Unten, tötet keine Daboli. Dann alles gut. Lebt weiter.“
„Aber du willst Rache“, stellte ich nüchtern fest.
„Ja“, brüllte er fast, „Dabol’krat darf nicht leben. Morgarach tot. Hardan tot. Dabol’krat nicht tot. Falsch!“
Ich drehte meinen Kopf zu ihm hin, wobei ich ignorierte, dass die Schwertspitze sich in meinen Hals bohrte. Das ging auch an Rabal nicht unbemerkt vorbei. Ein feines Lächeln stahl sich in sein Gesicht. Er hatte verstanden. Auch hatte er sich wieder beruhigt.
„Was schlägst du vor?“, fragte er leise. Er klang amüsiert aber auch gespannt. Der hilflose Mensch forderte ihn heraus. Das gefiel ihm.
„Dreißig Meri und wir kämpfen. Nur wir zwei. Bis einer aufgibt oder tot ist“, gab ich vor.
„Zehn Meri!“, feilschte er. Er nahm aber schon sein Schwert weg. Ich hatte sein Kriegerherz getroffen.
„Zwanzig!“, zischte ihm Lissi ins Ohr und drückte ihm gleichzeitig ein langes Messer an den Hals. Ich hätte nicht sagen können, wann sie den Raum betreten hatte.
Rabal grinste breit und zeigte dabei seine spitzen Zähne. Ohne auf das Messer zu achten, schob er sein Schwert in die Scheide zurück und stand ruhig da.
„Zwanzig! Und Kazass’mar ist unser Zeuge“, schnurrte er.
Ohne die Klinge von seinem Hals zu nehmen, trat Lissi neben ihn und fixierte ihn mit ihren schwarzen Augen, die in der Dunkelheit des Raumes wie tiefe Abgründe wirkten.
„Geh jetzt“, forderte sie.
Er schob mit dem Handrücken behutsam ihren Arm beiseite, verneigte sich – respektvoll, so schien es – vor ihr und verließ auf leisen Sohlen den Raum.
Die Stille, die dann blieb, tat fast weh in den Ohren. Lissi seufzte leise und schob ihren Dolch vorsichtig in die Hosentasche, in die sie irgendwann eine lederne Scheide eingenäht hatte.
„Schön, dass du da bist“, sagte ich halblaut.
Lissi lachte und setzte sich zu mir aufs Bett. Sie legte einen Arm auf meiner Brust ab, beugte sich zu mir herunter und küsste mich. Ich legte meine Linke auf ihre Hüfte und strich ihr mit der anderen über den Kopf. Nach einer Weile fragte ich dann,
„Warum bist du eigentlich so schnell wieder hier? Ich dachte, ich könnte wenigstens noch das Frühstück abgreifen, bevor ich entlassen werde.“
„Ich habe was vergessen“, erwiderte sie grinsend.
„Mir zu sagen, dass du unsterblich in mich verknallt bist?“





























