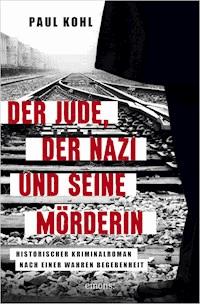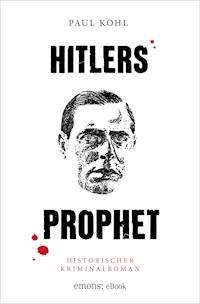
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Atmosphärisch dicht, authentisch, und facettenreich - ein glänzend recherchierter historischer Roman. Berlin 1933: Der berühmt-berüchtigte Hellseher Erik Jan Hanussen ist ein Sympathisant der SA und glühender Unterstützer Hitlers. Doch der Trickbetrüger hat zwei Geheimnisse: Er ist Jude, und er weiß, dass die SA den Reichstag in Flammen aufgehen ließ – Fakten, die niemals an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Eines Tages verschwindet Hanussen spurlos. Als der Journalist Stemmer Hanussens Leiche in einem abgelegenen Waldstück findet, gerät er selbst in das tödliche Netz der Nationalsozialisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Kohl, geboren 1937 in Köln, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft, war Buchhändler und Mitarbeiter bei Fernsehproduktionen. Heute ist er Hörfunk- und Buchautor und schreibt über geschichtliche und sozialkritische Themen, insbesondere über die NS-Zeit. Seit 1970 lebt und arbeitet er in Berlin. 2014 erhielt er den Axel-Eggebrecht-Preis für sein Lebenswerk als Autor für Hörfunkfeatures.
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind die meisten Personen nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/United Archives
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-285-4
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Jetzt tanzen wir nicht mehr auf dem Vulkan.Jetzt ist er ausgebrochen.
Judith am 30. Januar 1933
ADIEU, MEIN KLEINER GARDEOFFIZIER
Der Lechner ist weg. Plötzlich weg. Verschwunden. Seit über einer Woche meldet er sich nicht mehr aus Berlin. Verschollen in dieser Stadt. Hatte er einen Unfall? Liegt er hilflos irgendwo? Wurde er ohne seine Papiere in ein Krankenhaus eingeliefert? Vielleicht hat man ihn aus irgendeinem Grund festgenommen und in ein Gefängnis geworfen. Kein Lebenszeichen von Lechner. In der Redaktion Außenpolitik der Wiener »Arbeiter-Zeitung« breitet sich Unruhe aus, Angst um den Kollegen. Es ist normal, dass sich Lechner vier oder fünf Tage nicht meldet. Doch dass er seit über einer Woche schweigt, ist ungewöhnlich.
Auch bei seiner Frau Lotte ruft er nicht mehr an. Jeden Tag fragt sie in der Redaktion nach einer Nachricht. Voller Panik. Man weiß ja nie, in dieser Stadt, in diesen Zeiten. Redaktionsleiter Gruber vertröstet sie mit allen möglichen Argumenten. Vielleicht hat er zu viel zu tun, vielleicht reist er für eine Recherche übers Land und findet da kein Telefon. Man kann aber in jeder Kneipe, in jedem Restaurant in Deutschland telefonieren. Vielleicht ist er aus dem Volkshaus der SPD ausgezogen und sucht ein neues Zimmer. Normalerweise hätte er die Redaktion darüber informiert. Lechner war immer sehr zuverlässig. Oder er vermeidet einen Anruf aus Angst, die Berliner Politische Polizei oder die Wiener Nationalsozialisten könnten sein Gespräch abhören. Er hat aber früher immer angerufen. Alles, was Gruber Lotte Lechner gegenüber als möglichen Grund für sein Schweigen vorbringt, glaubt er selbst nicht. Auch nicht seine Redakteure. Und Lotte schon gar nicht.
Am Sonntag, dem 22. Januar 1933 sind alle versammelt, um die Montagsausgabe der »Arbeiter-Zeitung« vorzubereiten. Lechners Schweigen ist nicht mehr auszuhalten. Jetzt muss etwas geschehen. Gruber ruft das Volkshaus der SPD in Charlottenburg an, wo Lechner wohnt. Zu diesem hat die »AZ« als Organ der österreichischen Sozialdemokraten eine besonders enge Verbindung.
»Ich möcht Herrn Ludwig Lechner sprechen.«
»Herr Lechner ist nicht mehr hier«, sagt die Frau am Telefon.
»Ist er ausgezogen?«
»Nein.«
»Warum ist er nicht mehr bei Ihnen?«, will Gruber wissen.
»Weiß ich nicht.«
»Seit wann ist er weg?«
Pause. Die Frau scheint in ihrem Gästebuch nachzusehen. Dann: »Seit dem 12. Januar.«
»Haben Sie das der Polizei gemeldet?«
»Ja.«
»Und?«
»Nichts. Vielleicht kommt er wieder, sagten sie.«
»Hat er eine Nachricht hinterlassen?«
»Nein. Er ist am Morgen wie üblich aus dem Haus gegangen, mit seinem Auto weggefahren und nicht mehr zurückgekehrt. Zuerst haben wir sein Zimmer so bewahrt, wie er es verlassen hat. Wir dachten ja, er kommt zurück. Dann haben wir es ausgeräumt und seine Sachen in seinen Koffer gepackt. Der steht jetzt mit seiner Schreibmaschine im Keller. Das muss mal jemand abholen.«
»Wir schicken jemanden. So schnell wie möglich.«
Gruber legt auf und teilt den bestürzten Kollegen mit, was er gehört hat. Er ruft beim Chef der Auslandspresse der NSDAP an, bei Ernst Hanfstaengl, fragt nach Lechner und bekommt zu hören: »Ich weiß von nichts.« Er telefoniert mit den Krankenhäusern Charité, Urban, Westend und Virchow. Am Apparat gäben sie keine Auskunft, man müsse persönlich vorsprechen und sich ausweisen, heißt es. Die gleiche Antwort erhält er vom Leichenschauhaus und von der Gerichtsmedizinischen Abteilung der Charité.
Gruber wendet sich an Martin Stemmer. Ihn hält er für den geeigneten Mann, nach Lechner zu forschen. Stemmer ist trotz seiner dreißig Jahre nicht verheiratet, ist ungebunden und kann problemlos für längere Zeit nach Berlin. Außerdem ist er mit Lechner durch eine besondere Freundschaft eng verbunden. Da mit Lechner vorerst nicht zu rechnen ist, soll er als neuer Berlin-Korrespondent dessen Arbeit übernehmen, bis Lechner wieder auftaucht. Die wöchentlichen Berichte soll er wie bisher unter Pseudonym schicken. Gruber schlägt für ihn ein neues Pseudonym vor: »Servus«. Er ist jetzt der »Servus« der Redaktion und soll morgen mit dem Nachtzug nach Berlin.
Stemmer ist zumute, als habe man ihm mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen. Morgen nach Berlin! Als neuer Korrespondent. Und Lechner suchen. Damit hat er nicht gerechnet.
Das Zimmer, in dem Lechner gewohnt hat, ist noch frei. Gruber lässt es für Stemmer reservieren und schreibt ihm eine Akkreditierung, mit der er sich beim Auslandspresseamt registrieren soll. Dazu eine Vollmacht für seine Nachforschungen über Lechner. Er schlägt vor, für den Nachtzug einen Platz im Schlafwagen zu reservieren. Das mag Stemmer gar nicht. Er möchte nicht mit Fremden so eng zusammenliegen. Vielleicht stinken sie oder belästigen ihn mit stundenlangen Quasseleien. Also bestellt Gruber für ihn einen Fahrschein erster Klasse ab Nordwestbahnhof. Er kann das Billett vor seiner Abreise am Reservierungsschalter abholen. Schließlich bittet Gruber Lotte, ein paar Fotos ihres Mannes herauszusuchen, die Stemmer bei seiner Suche helfen sollen. Er werde sie morgen Nachmittag bei ihr abholen.
Schon seit einiger Zeit waren der Redaktion große Lücken in Lechners Beitragslieferungen aufgefallen. Um den Zugriff der Berliner Politischen Polizei und auch der österreichischen Nationalsozialisten zu verhindern, versteckte er die Berichte, die er bei seinen Anrufen angekündigt hatte, in den abonnierten Berliner Zeitungen, manchmal auch im »Völkischen Beobachter« oder im »Angriff«. Eingetroffen waren jedoch nur harmlose Artikel.
Im Archiv blättert Stemmer Lechners Beiträge der letzten drei Monate durch. Vielleicht findet er darin einen Hinweis auf einen Grund für sein Verschwinden. Er liest über die Reichstagswahl im November 1932, bei der die Nazis gewaltig verloren, die internationale Segelbootausstellung in den Messehallen, ein Avus-Rennen und den Abriss der alten Häuser am Werderschen Markt, wo das neue Gebäude der Reichsbank errichtet wird. Er liest über ein »Biograph-Theater« im Berliner Scheunenviertel und über die Uraufführung der Operette »Glückliche Reise« von Künneke im Theater am Kurfürstendamm. Eine glückliche Reise wünscht er auch sich selbst. Als Nächstes findet Stemmer Lechners Artikel über die Vorstellungen des Hellsehers Hanussen im »Wintergarten« und in der »Scala« und sein Interview mit ihm. Auch Stemmer will Hanussen in Berlin endlich auf der Bühne erleben. Er ist ein Bewunderer dieses genialen und berühmten Hellsehers. In Wien konnte er ihn noch nicht bestaunen. Seit Jahren ist Hanussen nicht mehr hier gewesen. Überall trieb er sich herum, nur nicht in Wien und auch nicht sonst in Österreich. Man munkelt, er sei 1923 für zehn Jahre aus Österreich verbannt worden. Warum, das kann ihm keiner sagen.
Sosehr Stemmer in Lechners Beiträgen sucht, nirgends kann er etwas Brisantes, Gefährliches entdecken. Nirgends ein Sprengstoff, der Lechners Verschwinden erklären könnte. Wo sind seine angekündigten Berichte über die immer mächtiger werdenden Nazis und ihre brutalen SA-Schlägertrupps? Gruber hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das Gespräch abgehört werden könnte. Lechner scherte sich einen Dreck darum. Weiterhin fehlt sein Artikel über den anderen Adolf, den Ganovenboss »Muskel-Adolf« und dessen kriminelle Bande. Stemmer vermisst auch das Interview mit dem Redakteur der »Roten Fahne« der Berliner KPD und seine Reportagen über die katastrophalen Zustände in Berlin. Wo ist das alles geblieben? Wer hat die Artikel in den Bündeln der abonnierten Zeitungen aufgespürt und beschlagnahmt? Sehr merkwürdig.
In seiner Wohnung in der Doderergasse bereitet Stemmer noch am Abend alles vor, was er für seine Zeit in Berlin braucht. Zuerst seine Reiseschreibmaschine, die alte Tornado, sein Schreibzeug, Akkreditierung und Vollmacht, auch warme Wäsche, die dunkle Wollmütze, den dicken Schal und zwei Paar feste Schuhe. In Berlin wird viel Schnee liegen, und es wird sehr kalt sein. Hier in Wien ist es schon seit Langem eisig und die Stadt zugeschneit.
Am nächsten Tag absolviert er seine Abschiedstour. Seit einer Ewigkeit steht bei seiner Mutter alles unverändert herum. Seit vielen Jahren steht auch in ihrem Leben alles still. Ist erstarrt und leblos. Draußen dreht sich die Welt immer schneller, aber davon will sie nichts wissen und hält sich am Krimskrams in ihrer Wohnung fest. So ist alles noch genauso wie das letzte Mal, als er bei ihr war. Und das ist schon eine Weile her. Warum er immer seltener zu ihr kommt, wissen beide.
Im Wohnzimmer welkt noch immer der hochgewachsene Gummibaum in seiner Ecke dahin. An der Wand hängen immer noch das grell kolorierte Herz-Jesu-Bild und der Stephansdom. Auf der Kommode steht seit achtzehn Jahren das eingerahmte Foto seines toten Vaters in K.-u.-k.-Uniform, daneben eines von Stemmer als gesitteter, artiger Junge, das dunkle Haar glatt gekämmt und lachend, so wie ihn seine Mutter gern sieht. Eigentlich hat er strubbeliges, wuscheliges Haar, doch für die Aufnahme musste er seine Frisur mit Pomade einschmieren und ordentlich scheiteln. Ihn hat schon immer gestört, dass seine Mutter sein Foto neben dem Toten aufgestellt hat. Er ist doch noch nicht tot. Er lebt noch. Neben dem Bild seines Vaters leuchtet ein frischer Strauß brauner Astern.
»Neue Blumen?«, bemerkt Stemmer nebenbei.
»Hast du das vergessen?«, fragt seine Mutter vorwurfsvoll.
»Was?«
»Heute vor achtzehn Jahren ist dein Vater gefallen.« Ihr Mund verzieht sich bitter.
Das war 1915 im Krieg gegen Serbien. Stemmer war zwölf. Seine Mutter nimmt es ihm übel, dass er dieses Datum nicht mehr weiß. Sich nicht daran erinnert, an welchem Tag vor achtzehn Jahren sein Vater in Serbien liegen geblieben ist. Seit dessen Tod klammert sie sich an ihn.
»Ich hab doch nur noch dich, Bubi«, wiederholt sie auch jetzt wieder. »Wenn ich dich nicht hätt, wär ich schon längst ins Wasser gegangen.«
Seit dreißig Jahren nennt sie ihn ihren »Bubi«. Das wird sie sich nie abgewöhnen. Bis zu ihrem Tod wird er ihr »Bubi« bleiben. Damit hat er sich abgefunden, mit allem anderen jedoch nicht. Ihre Umklammerung und ihre Eifersucht auf seine Freundinnen stoßen ihn schon lange ab. Vor allem ihre Bosheit gegen Julischka, mit der er eine heftige Liebschaft hatte, die sie durch eine gemeine Intrige hintertrieb. Da war es dann ganz aus gewesen mit ihm und seiner Mutter.
»Ich hab für dich einen Apfelstrudel gebacken. Den magst du doch so gern«, sagt sie und führt ihn an der Hand in die Küche. Auf dem Tisch liegt ihr Apfelstrudel, umhüllt von einer braunen knusprigen Kruste. »Ich freu mich immer, wenn’s meinem Bubi schmeckt.«
Stemmer will ihn jetzt aber nicht essen. Schon gar nicht, wenn ihm seine Mutter dabei zuschaut.
»Hab keine Zeit, muss gleich weiter«, versucht er, sich herauszuwinden.
»Wo musst du denn hin?«
Er erklärt ihr, dass er für die Zeitung für längere Zeit nach Berlin muss und nur gekommen ist, um sich von ihr zu verabschieden. Ihr Gesicht verzerrt sich in bitterem Schmerz.
»Geh nicht nach Berlin.«
»Ich muss dahin.«
»Wann kommst du denn wieder, Bubi?«
»Weiß ich noch nicht.«
»Ob ich da noch leb?«
»Hör auf mit dem Schmonzes.«
»Der Tod schleicht sich an jeden ran. Wir müssen alle mal fort.«
Stemmer kennt ihr Kokettieren mit ihrem Tod.
»Du kommst so selten zu mir, als ob ich schon gar nicht mehr da wär.«
Sie packt ihm den Strudel ein.
»Damit mein Bubi unterwegs nicht verhungert.«
Als er ihr ohne Umarmung Adieu sagt, fleht sie ihn an: »Dass dir nur nichts passiert. Ich hab so Angst um dich. Geh nicht nach Berlin, Bubi. Da gibt’s nur böse Leut.«
Während er die Tür hinter sich zuzieht, hört er sie sagen: »Man ist und bleibt allein.«
Seine frühere Geliebte Julischka macht keine Geschichten. Nach dem Auszug bei seiner Mutter wohnte er zunächst bei ihr im Souterrain in der Unteren Viaduktgasse, doch schon bald in der Beletage in ihrer Wohnung. Sie ist eine ungarische Ballettlehrerin, wesentlich älter als er, aber voller Lebenslust. Als Liebespaar genossen sie Tisch und Bett und hatten eine glückliche Zeit. Bis seine Mutter drohte, Julischka wegen Hurerei anzuzeigen. Julischka verliert kein Wort über diese hässliche Intrige und schenkt ihm zur Erinnerung an ihre schöne gemeinsame Zeit eine langstielige rote Rose.
»In deinem Souterrain wohnt jetzt ein Musikstudent.«
»Verstehst du dich gut mit ihm?«
Sie lächelt vielsagend. »Sehr gut sogar.«
Mehr will Stemmer nicht wissen.
»Pass gut auf dich auf, Liebster. Ich möchte dich bald wieder in die Arme schließen.«
Noch einmal küssen sie sich leidenschaftlich, dann muss er gehen.
Bei Lotte in der Burggasse liegen Lechners Fotos bereit. Stemmer betrachtet sie. Da stehen wieder die alten Zeiten vor ihm. Ludwig, Lotte und er bei einem Ausflug im Prater, einander mit den Armen umschlungen. Ludwig bei der Hochzeitsfeier mit Lotte im August 1929, Stemmer steht als Trauzeuge neben ihnen. Ludwig in der Redaktion an seinem Schreibtisch.
Lotte weint bitterlich. Sie ist völlig verzweifelt.
»Ich hab ihm immer gesagt: Geh nicht nach Berlin. Geh nicht nach Berlin«, schluchzt sie. »Aber nein, er musste hin. War nicht davon abzuhalten.«
Er versucht, sie zu trösten, und nimmt sie in die Arme. »Es wird alles gut werden. Bald ist Ludwig wieder da.« Dabei muss er sich Mühe geben, daran zu glauben. Er erinnert sich, wie er sie vor Jahren oft umarmt und geküsst hat. Damals, als sie noch nicht mit Ludwig verheiratet war. Beide, Stemmer und Lechner, waren flammend verliebt in sie, und Lotte war verliebt in beide. Eine vertrackte Dreiecksgeschichte. Zwei Kollegen liebten dieselbe Frau. Es gab jedoch keine Hahnenkämpfe, keinen Streit, keine Feindschaft, nur ein stilles, glühendes Ringen um Lotte. Das ging eine ganze Weile so, keiner konnte sich für eine feste Bindung entscheiden. Bis Lechner zugriff, sie ihm wegschnappte und Lotte heiratete. Auch danach blieben sie enge Freunde und Lechner ein phantastischer Kollege.
Stemmer steckt die Fotos ein. Beim Abschied nimmt Lotte seine Hände und wünscht ihm viel Glück. Ihr Händedruck ist schwach. Sie hat in den vergangenen Tagen zu viel Kraft verloren. Als er sie verlässt, sieht sie ihm mit verweinten Augen nach.
Da hat er nun den Apfelstrudel von seiner Mutter, die rote Rose von Julischka und Lechners Fotos von Lotte.
EINE REISE, DIE IST LUSTIG, EINE REISE, DIE IST SCHÖN
In einem der Erste-Klasse-Waggons findet er seine Reservierung in einem leeren Coupé. Ein Nichtraucherabteil. Er möchte die Nacht allein und ungestört verbringen und nicht durch Zigaretten- und Zigarrenrauch geräuchert werden. Die Polster sind mit rotem Samt überzogen. Er hat einen Fensterplatz, da kann er sich in der Ecke gemütlich anlehnen. Stemmer zieht den Vorhang vor die Abteiltür, besetzt, basta, und hängt seinen Lodenmantel an den Haken. Seinen schweren Koffer und sein hölzernes Schreibmaschinenkästchen wuchtet er ins Gepäcknetz, wirft Wollmütze, Schal und Handschuhe hinterher und stellt seine Reisetasche mit Julischkas Rose auf das Polster. Bevor er sich setzen kann, muss er ein abgegriffenes Heftchen wegnehmen, das auf dem Samt seines Eckplatzes liegt. Es ist ein Groschenroman, den jemand liegen gelassen hat. Stemmer liest den Titel: »Der Tod fuhr mit – Ein Schicksalsroman«. Als Verfasserin ist eine Lydia von Hohenbrinck angegeben. Sicher ein Pseudonym. Kein Mensch schreibt für diese Schundhefte unter seinem eigenen Namen.
Grundsätzlich interessiert sich Stemmer nicht für Groschenromane, doch dieser Titel reizt ihn: »Der Tod fuhr mit«. Während der Reise will er darin lesen und legt das Heft neben seine Tasche. Dann macht er es sich bequem. Das Fenster lässt er geschlossen. Draußen ist es zu kalt. Auf dem Perron hasten noch Reisende am Zug entlang, suchen ihren Waggon. Er hört, wie sich auf dem Gang vor seiner Tür Menschen aneinander vorbeidrängen. Sie sollen draußen bleiben. Hoffentlich kommt keiner herein. Das ist sein Abteil.
Er hat Glück, er kann allein bleiben in seinem Reisenest. Der Zug fährt ab, verlässt den Bahnhof. Seine Reise beginnt.
Ade, Wien. Willkommen, Berlin.
Der Waggon rattert über die Weichen, schwingt hin und her, gleitet dann ruhig und rauschend dahin. Draußen ziehen Signalleuchten vorbei, Stellwerkhäuschen, gelbliche Straßenlaternen, schwach schimmernde Wohnungsfenster, hinter denen noch eine Lampe brennt. Der Zug passiert eine Brücke, unter ihm die Donau, schwarz. Er sieht die Lichter der letzten Häuser von Wien, dann Finsternis. Der Zug beschleunigt seine Fahrt. Rollt durch die Nacht. Die Schienenstöße pulsieren im gleichmäßigen Takt. Tack-tack – tack-tack – tack-tack pocht es an Stemmers Ohr. Der Lech-ner ist weg – Der Lech-ner ist weg – Der Lech-ner muss her. Er muss seinen Kollegen finden, seinen Freund. Er muss.
Berlin, Berlin, ich fahre nach Berlin, denkt er immer wieder. Trotz seines bedrückenden Auftrags und der überstürzten Abreise freut sich Stemmer auf diese Stadt. Er war noch nie in der Reichshauptstadt, hat aber in Lechners Artikeln so viel darüber gelesen und auch einiges von anderen gehört. Vor allem freut er sich, sein großes, von ihm verehrtes Vorbild Egon Erwin Kisch, den »Rasenden Reporter«, zu treffen, der als Berlin-Korrespondent für seine Brünner Zeitung arbeitet. Er hat fast alles von ihm gelesen. Seine Reisereportagen über Tunesien, Algerien, Amerika, Russland. Kisch war kürzlich sogar in China. Stemmer will auch einmal als Journalist so herumreisen und schreiben wie er. Die Welt in fernen Ländern kennenlernen. Er ist noch nie im Ausland gewesen. Jetzt aber beginnt seine erste Auslandsreise, wenn auch nur in ein Nachbarland. Bis jetzt hockte er alle Zeit im modrigen, morbiden Wien. Er ist froh, dieses Wien zu verlassen, in dem man ohne Krawatte nicht in die Oper darf, während die Nationalsozialisten auf den Straßen Passanten verprügeln. In dem der Expressionismus verpönt ist, der in Berlin gefeiert wird. In dem Tote eingerahmt auf der Kommode stehen und eine Geliebte wegen Hurerei angezeigt werden kann. Luft! Luft! Er braucht frische Luft! Er braucht den flotten Wind von Berlin. Auch freut er sich darauf, in Berlin endlich den genialen Hellseher Hanussen zu erleben, der ihn immer schon begeistert hat, den er aber noch nie auf der Bühne bewundern konnte.
Stemmer wickelt den Apfelstrudel seiner Mutter aus dem Papier und knabbert am knusprigen Ende. Er holt seine Limonadenflasche hervor und nimmt einen kräftigen Schluck. Da stößt der Kontrolleur die Schiebetür auf, reißt den Vorhang auf. Stemmer muss seinen Apfelstrudel beiseitelegen und sein Billett hervorkramen. Der Schaffner knipst ein Loch in den Fahrschein und wünscht »Gute Fahrt«. Bevor er geht, fragt er: »Möchten S’ das Licht weg?«
»Ja, bitte.«
Er knipst die helle Lampe aus. Das Abteil ist nun in einen schwachen dunkelblauen Dämmer gehüllt. Um Stemmer verschwimmt alles im blauen Nebel. Sämtliche Konturen haben sich aufgelöst. Er will jetzt einfach nur dahinduseln und im schummerigen Licht seinen Gedanken nachhängen.
Er denkt daran, wie er zur »AZ« kam. Angefangen hatte es damit, dass er während seines Germanistikstudiums Gedichte schrieb, auch Kurzgeschichten und kleine Reportagen. Er bot sie der populären »Arbeiter-Zeitung« an, die eine sehr hohe Auflage hatte, da würden seine Beiträge von vielen gelesen. Tatsächlich wurde so manches von ihm gedruckt. So kam er mit der Feuilleton-Redaktion ins Gespräch und erhielt nach dem Abschluss seines Studiums eine Festanstellung in der Auslandsredaktion. Gruber war schon damals der Redaktionsleiter. Und einer seiner Kollegen der gleichaltrige Ludwig Lechner, mit dem er sich von Anfang an gut verstand. Aus Kollegen wurden bald Freunde. Doch wenn Stemmer ehrlich ist, kennt er Lechner nicht wirklich. Er erlebte ihn als zuverlässigen Kollegen, aber privat wusste er fast nichts über ihn, und das änderte sich nie. Sie trafen sich hin und wieder nach Redaktionsschluss in einem Beisl, tranken ein Bier oder einen Schoppen Heurigen, sprachen über Kollegen und ihren Redaktionsleiter Gruber, über die immer stärker werdenden Nationalsozialisten in Wien, ihren sonderbaren Kanzler Dollfuß und über neue Filme. Über all das wusste Stemmer Bescheid. Über sein privates Leben hob Lechner jedoch nie den Vorhang. Auch saßen sie nach Ludwigs Hochzeit so manches Mal im privaten Kreis mit Lotte zusammen. Über ihre vorangegangene Dreiecksgeschichte aber sprachen sie nie, obwohl es zwischen Stemmer und Lotte unter der Asche immer noch heimlich glühte.
Lechner war und ist ein guter Journalist, ein echter Spezi. Doch wie arbeitet er wirklich? Ist er der unbestechliche Journalist, für den Stemmer ihn hält? Oder nimmt er Gelder an, um eine sensationelle Story schreiben zu können? Ist er von den Grundsätzen der Sozialdemokratie, wie die Richtlinien der Zeitung als Zentralorgan der SPÖ sie vorgeben, tatsächlich überzeugt? Oder sympathisiert er insgeheim mit einer anderen Partei? Ist er wirklich der treue Ehemann, als der er sich gibt? Oder hatte er während seiner Ehe mit Lotte heimliche Liebschaften? Das alles weiß Stemmer nicht. Überraschen würde es ihn allerdings nicht, wenn man in Lechners dunklen Keller hinableuchten und dabei Verborgenes entdecken würde. Wie bei jedem Menschen.
Seine Mutter geht ihm nicht aus dem Kopf. Apfelstrudel backen, das kann sie, denkt er, aber ihre Intrige gegen Julischka wird er ihr nie verzeihen. Nie. Sie war zerfressen von Eifersucht auf Julischka, hatte Angst, dass sie ihr den »Bubi« wegnimmt, und drohte mit einer Anzeige wegen Hurerei. Besonders ekelt ihn an, dass sie ihm einmal gestand, sie würde sich nach dem Tod seines Vaters sehnlichst wünschen, ihn, ihren geliebten »Bubi«, zu heiraten. Pfui Teufel. Ihn schüttelt es noch heute, wenn er daran denkt. Die Mutter will ihren eigenen Sohn heiraten! In Wien gibt es viel Perverses, aber so was Obszönes nicht. Anscheinend doch. Wenigstens ist es nicht bekannt geworden.
Wenn er Julischka vor sich sieht, wird ihm warm ums Herz. Als Ballettlehrerin hatte sie einen straffen Körper, den er bewunderte. Er riecht noch den betörenden Duft ihres Leibes, spürt, wie sie nackt und eng nebeneinander in ihrem breiten Bett lagen. Die Liebe mit ihr war so schön. Ja, die Julischka, die Julischka aus Buda, Budapest, die hat ein Herz aus Paprika, das keinem Ruhe lässt.
Sie verschaffte ihm Freikarten fürs Ballett, für die Oper und Operette. In der Staatsoper sah er das Ballett »Romeo und Julia« von Prokofjew. Wie die beiden verfeindeten Familien kriegerisch über Kreuz aufeinander zuschritten. Er sah auch »Schwanensee«, bei dem ihre Eleven tanzten, und die berauschende »Fledermaus«. Im Feuerstrom der Reben, da blüht ein himmlisch’ Leben. Das kann er nicht vergessen.
Einmal beschaffte sie sogar Karten für den Opernball. Für Julischka kein Problem. Nach dem offiziellen Teil tanzte sie mit ihm den »L’amour-Hatscher«, diesen engpaarigen, langsamen Tanz. Sie presste ihren Unterleib so dicht an ihn, dass sein Johannes beinahe explodiert wäre. Das wär peinlich gewesen. Er auf dem Gala-Opernball mit so einem großen, nassen Fleck vorn in der Hose! Auf dem Heimweg zupfte er im Stadtpark für sie eine rote Rose ab und überreichte sie ihr wie der Rosenkavalier in der Oper von Richard Strauss. Und jetzt hat er von ihr zum Abschied und zur Erinnerung eine rote Rose bekommen, die er in seiner Tasche bei sich trägt.
Als seine Mutter von seiner Liebe zu ihr erfuhr, ging sie wie eine Furie erbost dazwischen. Ihr »Bubi« im Bett mit einer wesentlich älteren Frau! Noch dazu einer ungarischen Ballettlehrerin. So was Unanständiges! Unmöglich! Julischka warf sie hinaus. Sie mussten sich dennoch trennen. Wenn seine Mutter ernst machte mit ihrer Drohung, sie wegen Hurerei anzuzeigen, hätte das für Julischka schlimme Folgen gehabt.
Plötzlich grelles Licht. Im ersten Moment ist Stemmer durch die Helligkeit geblendet, dann bilden sich Konturen heraus. Ein junger Mann steht in der Tür. Er ist etwa Mitte zwanzig. Sein zitronengelbes Haar und seine veilchenblauen Augen leuchten. Sein rosafarbenes Madonnengesicht glänzt. Sehr höflich fragt er, ob noch Plätze frei sind. Obwohl Stemmer am liebsten gesagt hätte: »Alles besetzt«, nickt er zustimmend. Der Mann setzt sich ihm gegenüber ans Fenster.
»Auch nach Berlin?«, fragt der Fremde mit einer hohen, weichen Mädchenstimme. Wieder nickt Stemmer. Prompt ärgert ihn seine erneute Zustimmung. Wohin er reist, geht den Mann einen Dreck an.
Der Blondschopf nimmt aus seiner Zigarettenpackung eine Memphis, klopft auf seinem Daumennagel die Krümel heraus, steckt sie zwischen seine Lippen und will sie mit einem Feuerzeug anzünden.
Stemmer deutet auf das Nichtraucherschild über der Tür. »Wenn ich bitten darf.«
»Oh, Entschuldigung«, sagt der junge Mann höflich. »Selbstverständlich. Habe ich nicht gesehen.« Er löscht die Flamme seines Feuerzeugs, steckt die Zigarette in die Packung zurück und entschuldigt sich nochmals. »Hätte mir auffallen müssen, dass es keine Aschenbecher gibt.«
Stemmer versucht zu schlummern, doch sein neuer Reisekumpan redet und redet. Er kommt nicht zu dem Schlaf, den er sich so wünscht. Immer wieder wird er durch das Gequassel seines Gegenübers aus seinem Nickerchen gerissen. Dieser nimmt keine Rücksicht darauf, dass Stemmer seine Ruhe haben will. Breitspurig erklärt er ihm, dass er der Sohn eines Konditormeisters sei, das Geschäft seines Vaters aber nicht übernehmen wolle.
»Ich will was Höheres werden als Torten-und-Süßzeug-Konditor. Ich will Kunstgeschichte studieren«, bekennt er. »Habe mir in Wien die Museen angeschaut. Die Bilder von Rubens, Brueghel, Tizian. Grandios!«
Stemmer hat keine Lust, diesem Dampfplauderer länger zuzuhören, er nimmt den Groschenroman zur Hand und beginnt, darin zu lesen.
»Was lesen Sie denn da?«, will sein Reisekumpan wissen. Stemmer zeigt ihm kurz den Titel.
»›Der Tod fuhr mit‹. Interessant«, sagt der junge Mann mit dem glänzenden Madonnengesicht. »Sehr interessant. Noch dazu ein Schicksalsroman. Sicher aus dem prallen Leben gegriffen.« Er schwadroniert darüber, wie der Tod unerwartet zugreifen kann und wie wir alle ihm schutzlos ausgeliefert sind.
Stemmer will ihm nicht zuhören und versucht, weiter in dem Heftchen zu lesen. Doch das Gequassel seines Gegenübers wirft ihn immer wieder aus dem Text. Er holt seinen Reiseführer aus der Tasche. »Jeder einmal nach Berlin! Eine Stadt, wie Sie sie noch nicht erlebt haben!« Er blättert im Inhaltsverzeichnis, wählt das Kapitel »Nachtleben. Bars, Tanz, Amüsement« und versucht erneut, darin zu lesen.
»Was lesen Sie denn da?«, will der Fremde auch jetzt wieder wissen. Als hätte er erraten, was Stemmer aufgeschlagen hat, empfiehlt er ihm: »Sie müssen in die ›Femina‹, ins ›Resi‹ und ins ›Haus Vaterland‹. Da gibt es scharfe Nutten. First class. Muss man gesehen haben. Oder in die ›Adonis-Diele‹ und die ›Zauberflöte‹ zu den Schwulen. Die kann ich zwar nicht leiden, ist aber trotzdem sehenswert. Oder in den ›Alexander-Palast‹ und ins ›Monte-Casino‹ zu den Lesben und Transvestiten. In Berlin ist was los!«
Stemmer staunt. Der Typ scheint sich im Milieu gut auszukennen.
»Oder gehen Sie ins Scheunenviertel«, setzt er nach. »Zu den Juden. Dass es die immer noch gibt, versteh ich nicht.«
Der Kerl widert ihn an. Stemmer will von ihm nichts mehr hören und versucht, in einem anderen Kapitel weiterzulesen. Aber unmöglich. Sein Reisekumpan fängt wieder an: »Was machen Sie in Berlin?«
Stemmer will nicht antworten und entgegnet knapp: »Geschäftlich.«
»Was für ein Geschäft betreiben Sie?«
Der Bengel geht ihm ziemlich auf die Nerven.
»Kommerz? Kunst?« Mit Blick auf Stemmers Schreibmaschinenkästchen im Gepäcknetz bohrt er weiter: »Dichter? Schriftsteller? Journalist?«
Stemmer fallen seine Abstufungen auf. Demnach steht er ganz unten. Er schweigt. Er will endlich weiterlesen und tut so, als sei er vertieft in seine Lektüre, kann aber keine Zeile aufnehmen. Sie halten in einem nächtlichen Bahnhof.
»Brünn!«, kräht der Kerl. »Kennen Sie die Abtei St. Thomas? Muss man gesehen haben. Janácek wurde hier geboren. So eine schöne Musik!«
Bei Brünn kann Stemmer nur an seinen großen Kisch denken, der jetzt in Berlin als Korrespondent für seine Brünner Zeitung arbeitet.
Als der Zug den Bahnhof verlässt, will er weg von seinem lästigen Mitreisenden, will in den Mitropa-Speisewagen. Er nimmt sein Gepäck aus dem Netz und greift nach seiner Tasche. Er traut es dem Burschen zu, dass dieser während seiner Abwesenheit darin herumkramt.
»Sie können ruhig alles hierlassen. Ich pass auf.«
Kommt gar nicht in Frage, denkt Stemmer und schwankt mit seiner Last durch die Gänge der schwingenden Waggons bis zum Speisewagen. Die Mitropa hat gerade noch geöffnet. Nur wenige Reisende sitzen an den Tischen. Stemmer lässt sich an einem Fensterplatz nieder und schaut hinaus in die Nacht. Es dauert nicht lange, da erscheint dieser Aufdringling und setzt sich ihm gegenüber.
»Ich wollte Ihnen Gesellschaft leisten.«
Stemmer ist verärgert. Müde schleppt sich der Kellner heran und macht sie darauf aufmerksam, dass man in einer Viertelstunde schließe. Nicht alles, was auf der Karte stehe, sei noch zu bestellen.
»Was gibt es denn noch?«
»Eierspeis. Hühnerbrühe mit Ei. Fleischbrühe mit Ei. Omelett.«
»Sie wollen wohl Ihre restlichen Eier loswerden«, stichelt der Bursche.
Der Kellner überhört seine freche Bemerkung. Stemmer bestellt einen Braunen und ein Omelett. Sein Reisekumpan ein Bier und eine Hühnerbrühe mit Ei.
Bei der Rückkehr ins Coupé will der Bengel Stemmers Koffer tragen.
»Nein, danke.« Er hat Angst, der Kerl könnte womöglich mit seinem Koffer abhauen, und umklammert den Griff. Im Abteil hüllt er sich in seinen Lodenmantel wie in einen Schutzwall und versucht, wenigstens etwas zu schlafen.
Er ist tatsächlich eingenickt. Da reißt ihn eine Trompete aus dem Schlaf: »Prag!« Schläft der Flegel nie? Immer hellwach, die ganze Nacht.
Schlaftrunken kann Stemmer in der Finsternis des Bahnhofs nicht viel sehen. Nur den schneebedeckten Perron im trüben Laternenschein.
»Kafka!«, trötet der Kerl. »Phänomenal! Habe alles von ihm gelesen. Den ›Prozess‹, ›Das Schloss‹. Alles. Und Rilke! Seine Gedichte. Poesie! Poesie! Und Smetana. Die ›Moldau‹. Und Dvorak.«
Er staunt über ihn. So jung und schon so beflissen in Literatur und Musik. Stemmer denkt nur an seinen großen Kisch. Hier wurde er geboren.
Stemmer mummelt sich erneut in seinen Lodenmantel ein und spürt, wie ihn der Schlaf überwältigt und er langsam in den Schlummer gleitet. Hoffentlich schläft nicht auch der Lokführer ein, denkt er noch, dann weiß er nichts mehr.
»Leitmeritz!« Wieder schreckt ihn sein Gefährte aus dem Schlaf.
Langsam kommt Stemmer zu sich. Eisige Kälte ist in seinen Körper gekrochen. Bis ins kleinste Knöchelchen. Er ist erstarrt, er fröstelt. Sein Mantel hat ihn nicht vor dieser Vereisung geschützt. Er tastet nach seiner Tasche neben ihm. Sie ist noch da. Hat er daraus etwas gestohlen, während er schlief? Er greift hinein. Nichts fehlt.
»Leitmeritz«, wiederholt der schlaflose Typ.
Mit verklebten Augen sieht Stemmer im gelben Lampenlicht ein paar Eisenbahner hin und her rennen.
»Hier war vor ein paar Jahren der Prozess gegen den berühmten Hellseher Hanussen. Leider wurde der Schurke freigesprochen.«
Das rüttelt ihn wach. »Hanussen ein Schurke?«
»Wissen Sie das nicht?«
Das weiß er nicht. Das will er auch nicht wissen. Das kann nicht sein. Seine Bewunderung für diesen begnadeten Hellseher lässt er sich nicht zerstören, nicht von einem wie dem. Seinen Hanussen kann ihm keiner nehmen, schon gar nicht dieser Bursche. Natürlich stimmt nicht, dass Hanussen ein Schurke ist, wie dieser Kerl da behauptet. Er weiß zwar, dass vor drei Jahren in Leitmeritz ein sensationeller Prozess gegen Hanussen begann wegen dessen angeblicher Betrügereien. Der Prozess erregte internationales Aufsehen. Auch von seiner Redaktion wurde ein Berichterstatter entsandt. Am Ende hat man Hanussen jedoch freigesprochen. Es war also nichts dran an der ganzen Anklage.
Deutsche und tschechische Polizisten und Zöllner reißen die Tür auf, bellen: »Passkontrolle. Zollkontrolle.« Stemmer wundert sich, dass sie so früh am Morgen schon so wach sein können. Sein Reisekumpan zeigt ihnen einen Ausweis, seinen Pass wollen sie aber nicht sehen, winken ab. Komisch. Stemmer dagegen muss ihnen seinen Pass geben. Die Polizisten blättern darin hin und her, prüfen die Echtheit, finden nichts Verdächtiges. Dann knallt der deutsche Polizist einen Stempel in sein Dokument. Einreise in das Deutsche Reich genehmigt. Nun schreitet der Zöllner zur Tat.
»Zu verzollen?«
»Nichts.«
Trotzdem muss Stemmer sein Gepäck herunternehmen und seinen Koffer öffnen. Der Zöllner wühlt in der Wäsche herum, während sein Reisekumpan neugierig zuschaut. Der Zöllner greift in Stemmers Tasche und zieht mit einem »Autsch« hastig seine Hand zurück. Die Dornen von Julischkas Rose haben ihn gestochen. Stemmer freut sich. Recht so.
»Und das Holzkistl da?«
»Meine Schreibmaschine.«
»Öffnen.«
Seine alte Tornado kommt zum Vorschein. Die Aktentasche des Burschen durchsucht der Zöllner nicht. Seltsam. Wortlos verschwinden die Uniformierten wieder.
»Hab’s mir doch gleich gedacht: ein Schreiber«, konstatiert der Kerl süffisant. »Interessant. Was schreiben Sie denn?«
Stemmer überhört die Frage. An Schlaf ist jetzt nicht mehr zu denken.
In Dresden steigt gottlob jemand zu. Eine ältere Dame mit einem dunklen Samtbändchen um ihren dürren Hals. Der Bengel hat ein neues Opfer gefunden und redet sofort auf sie ein: »Die Semperoper. Grandios! Wagner. Richard Strauss. Das sind Opern!«
Die Dame nickt stumm. Er lässt nicht von ihr ab. »Der Zwinger, die Frauenkirche. Famos. Famos.«
Sie hat genug von ihm und wendet sich brüsk ab. Der Kunstbesessene quasselt weiter. Ihn stört es nicht, dass er ins Leere redet. Stemmer greift wieder zum Groschenheft, das immer noch neben ihm liegt. »Der Tod fuhr mit« von Lydia von Hohenbrinck. Typisch, dass die pseudonyme Autorin sich bei dieser Art von Schundliteratur als Adelige ausgibt. Noch dazu, da es sich um einen Schicksalsroman handelt. Gelangweilt blättert er durch die Seiten aus billigem Papier und beginnt an irgendeiner Stelle im Text zu lesen.
Ein Zugabteil, nachts. Gräfin Gabriela reist nach Paris, um sich dort endlich mit ihrem Verlobten, dem Marquis de Bourbonion, zu vermählen. Im Palais ihres Marquis ist alles für das glanzvolle Fest vorbereitet. Einhundert Gäste aus den höchsten Kreisen der Pariser Gesellschaft sind eingeladen. Es wird ein unvergessliches Ereignis werden, von dem man noch lange sprechen wird. Im Dämmerlicht des Abteils sitzt ihr gegenüber schweigend ein junger Mann, der sie fortwährend anlächelt. Der Gräfin fällt auf, dass seine Gesichtszüge sehr nobel sind, dass er vornehm gekleidet und sein schwarzes Haar penibel gescheitelt ist. Seine feingliedrigen Finger zeugen von besonderer Sensibilität, seine Fingernägel sind auffallend lang und spitz. Sonst genießt sie es, wenn wohlerzogene Männer aus gutem Hause sie anlächeln. Doch dieses Mal ist ihr unbehaglich zumute. Angst steigt in ihr hoch. Dieser gepflegte Lächler könnte, während sie schläft, seine schlanken Finger mit den langen, spitzen Nägeln um ihren Hals legen und sie erwürgen. Sie gibt sich alle Mühe, nicht einzuschlafen, und fragt ihn, ob er auch nach Paris fahre. Der elegante Jüngling aber antwortet nicht und lächelt sie nur weiter an. Als sie in Paris im Gare du Nord mit ihm aussteigt, ist er gleich darauf im Menschengewühl verschwunden. Gräfin Gabriela ist erleichtert, doch ihre Angst schwelt in ihrem Innersten weiter.
Stemmer legt den Groschenroman weg. So einen Schmarren will er nicht lesen. Sie rollen auf Berlin zu. Nur noch ein Stück, dann sind sie diese lästige Zecke los.
Endstation »Anhalter Bahnhof«. Als sie aussteigen, will Stemmer den Schundroman auf dem Polster liegen lassen.
»Sie haben Ihren mitfahrenden Tod vergessen«, sagt der Reisekumpan und deutet auf das Heftchen. Reflexhaft steckt Stemmer es in seine Tasche.
Auf dem Bahnsteig ist der Widerling gleich darauf im Gedränge verschwunden.
DAS IST DIE BERLINER LUFT
Stemmer ist perplex über die riesige Halle des Anhalter Bahnhofs. Unter der gigantischen Stahlhaube Lärm, Lärm, Lärm. Es kracht, zischt, dröhnt. Unverständliche, hallende Lautsprecherdurchsagen, Rufe, Schreie, Pfiffe der Lokomotiven, schrilles Quietschen der Bremsen. Auf den Gleisen treffen mit fauchenden Dampfloks Züge ein, andere fahren ab. Es riecht nach Rauch, Kohle, Öl. Das gewölbte Glasdach hoch über ihm ist in der morgendlichen Dunkelheit nur zu erahnen. Dicker Qualm hängt unter dem Eisengerippe. Auf den Bahnsteigen drängen sich Menschenmassen. Gewusel überall. So früh am Morgen sind hier schon so viele Menschen unterwegs!
Mit seinem Koffer, seiner Schreibmaschine und der Tasche zwängt sich Stemmer zwischen den hin und her hastenden Reisenden hindurch. Kofferberge versperren ihm den Weg. Am Ende des Perrons muss er sich an einer Menschenansammlung vorbeidrücken. Er sieht eine alte Frau, die auf dem Boden liegt, ein Sanitäter beugt sich über sie. Dicht geht er an der stampfenden Dampflok vorbei, die ihn hierherbrachte und nun ihre weißen Schwaden über den Perron bläst. Ihr mächtiger Bauch strahlt Hitze aus. Er will stehen bleiben, um sich zu wärmen, doch eine palavernde Reisegruppe hinter ihm schiebt ihn weiter. Verwahrloste Jugendliche, auch Kinder wollen ihm sein Gepäck aus den Händen reißen. »Tragen, tragen«, betteln sie. »Fünf Groschen.« Er drängt sie beiseite, sie umringen ihn, strecken die Hände aus. »Vier Groschen, drei Groschen!« Es gelingt ihm, sie abzuschütteln, sie stürzen sich auf einen anderen Reisenden.
Stemmer erreicht die hell beleuchtete Eingangshalle. Auch sie ist voller Menschen. Reisende, die abfahren, suchen auf den großen Anzeigetafeln den Bahnsteig für ihren Zug, Einheimische halten Ausschau nach ihren eintreffenden Gästen. Passagiere hetzen zu ihren Zügen, Ankommende hasten entgegengesetzt zu den Taxen draußen auf dem Platz. Dazwischen schieben Gepäckträger ihre Karren, beladen mit Koffern, Taschen und verschnürten Kartons, andere gieren nach Kundschaft. Händler mit Bauchläden voller belegter Brote und Brezeln oder mit silbernen Bottichen, in denen heiße Würste schwimmen, rufen ihre Ware aus. Lautsprecher plärren Unverständliches über Verspätungen, über Änderungen der Abfahrtsgleise, über Kinder, die ihre Eltern suchen. Lärm, Lärm, Lärm, der an den Wänden aus gelbem und schwarzem Marmor widerhallt wie in einer Schwimmhalle.
In den Ecken kauern Gruppen von Männern und Frauen. Anscheinend haben sie hier die Nacht verbracht und Schutz vor der Winternacht gesucht. Dem Aussehen ihrer verwahrlosten Kleidung nach sind es Arbeitslose, Obdachlose, Tippelbrüder. Angeschwemmtes Strandgut. Betrunkene schlafen auf den Holzbänken. Vor den Fahrkartenschaltern stauen sich lange Schlangen. Ebenso lange Schlangen vor der Gepäckaufbewahrung und den Toiletten. Kioske bieten Illustrierte an, Reiseproviant, Stadtführer und Stadtpläne.
An den Zeitungsständen liest Stemmer die Schlagzeile der »Vossischen Zeitung«: »Auflösung des Parlaments ohne Neuwahl? Gerüchte über Notstandspläne der Reichsregierung«. Die »Berliner Morgenpost« meldet: »Heerlager am Bülowplatz. Demonstration unter schärfstem Polizeischutz. Todesschuss auf Gastwirt«. Schon am Morgen ein Toter. Kein schöner Empfang.
Die Schlagzeilen des »Vorwärts«, der »Roten Fahne« und des »Völkischen Beobachters« kann er nicht lesen. Zu viele Käufer drängeln sich davor.
Mehrere Männer treten dicht vor ihn hin. »Hotel? Hotel? Sehr billig. Ganz nah.« Stemmer weist sie ab. Sie lassen nicht locker. »Zimmer sehr billig. Ganz nah.« Schon wollen sie seinen Koffer und seine Schreibmaschine an sich nehmen, da schreit er sie an: »Schleichts euch!«
Sie lassen von ihm ab und suchen sich neue Opfer.
Gleich in den ersten Minuten diese Brutalität. In Wiener Bahnhöfen geht es gütlicher zu. Da reißen einem nicht verwilderte Lackel das Gepäck aus der Hand. Da gibt es Dienstmänner, die höflich ihre Hilfe anbieten. Da wollen keine aufdringlichen Schlepper die Ankommenden in billige Hotels lotsen. Da heben vertrauenswürdige Werber stumm ihre Schilder mit Zimmerangeboten hoch. Das redet er sich ein.
Nach der Nachtfahrt hat Stemmer Hunger. Er muss etwas essen. An einem Stand kauft er Semmeln, die hier Brötchen, Schrippen oder gar Schusterjungen heißen, und Kipferln, die man Hörnchen nennt. Als er den Verkäufer darum bittet, alles in ein Sackerl zu packen, versteht dieser ihn nicht. Aha, ein Sackerl ist eine Tüte. Bei einem Imbissstand dringt ihm der Duft von frischem Kaffee und der Geruch von gebratenen Würsten in die Nase. Heißen Kaffee und eine Bratwurst könnte Stemmer jetzt brauchen. »Curry« wird angeboten. Er weiß nicht, was Currywurst ist. Von so was hat er in Wien noch nie gelesen oder gehört. Da ihn alles Neue reizt, bestellt er eine Curry, die auf einer Pappe serviert wird. »Schnellimbiss« steht über der Wurstbude. Muss er seine angeschnittene Wurst schnell essen? Sie schmeckt ihm. Besonders diese neuartige dunkelrote Soße, die ihn an die Wiener Kommunistische Partei denken lässt.
Dann tritt Stemmer hinaus auf den verschneiten Bahnhofsplatz, in den dunklen Morgen. Schneetreiben schlägt ihm entgegen. Es ist eisig kalt. Er knöpft seinen Lodenmantel bis oben zu, zupft seinen Schal zurecht, zieht seine Wollmütze tief in die Stirn. Schon wollen ihm wieder Jugendliche das Gepäck entreißen, bieten ihm Männer Fotos mit nackten Frauen an, wollen andere ihn in einen Wagen zerren. Stemmer ist nahe daran, um sich zu schlagen. Er muss an Lechner denken. Kein Wunder, dass der hier untergegangen ist.
Neben ihm ragt eine mächtige Litfaßsäule empor, vollgeklebt mit Plakaten. »Haus Vaterland! Dein Erlebnis in Berlin!« – »Protestaktion der KPD auf dem Bülowplatz!« – »Riesenkundgebung der NSDAP im Lustgarten!« – »Staatsoper: Der Rosenkavalier«. Stemmer muss an die Aufführung des »Rosenkavaliers« in Wien denken, die er mit Julischka besuchte. Weiter geht es mit »Wintergarten: Der große Hellseher und Wunderheiler Max Moecke!« – »Und abends in die Scala!«. Darunter, in fetziger Schrift geschrieben, das Plakat »Hellseher Hanussen! Die Sensation!«. Mit dämonischem Blick starrt er Stemmer an. Kaum ist er in Berlin, schon fixiert ihn sein Idol.
Der Moecke interessiert Stemmer nicht, aber den Hanussen muss er so schnell wie möglich sehen. In Berlin ist was los. Willkommen in Berlin!
Stemmer schaut sich um. Keine Fiaker wie in Wien. Nur Benzinkutschen, die auf Kunden warten. Abseits dösen ein paar Kutscher mit ihren Pferdedroschken. Die Gäule stoßen weißen Dunst aus ihren Nüstern, über ihren Rücken liegen wärmende Decken.
Ein alter Benz fährt vor. Flott springt der junge Fahrer aus dem Wagen und öffnet ihm freundlich den Schlag. Stemmer ist überrascht. Freundlichkeit in dieser Stadt. Erstaunlich.
»Bitte sehr«, sagt der Fahrer gut gelaunt.
Stemmer legt seine Habe auf den Rücksitz und setzt sich nach vorn neben den Fahrer.
»Wohin soll’s denn gehen?«
»Zum Volkshaus der SPD. In Charlottenburg.«
»Rosinenstraße 3.«
»Sie kennen das?«
»Und wie wir das kennen!« In seinem schmalen, blassen Gesicht funkeln dunkle, brennende Augen. Trotz seiner Freundlichkeit hat er etwas Gebieterisches, Respektloses an sich.
Der junge Mann biegt rasant in eine enge, stark befahrene Straße, quetscht sich in den fließenden Verkehr, überholt rechts, überholt links, nimmt anderen die Vorfahrt.
»Wilhelmstraße. Bald flattert hier überall das Hakenkreuz«, prahlt er.
»Glauben Sie das wirklich?«
»Dauert nicht mehr lange.«
»Woher wissen Sie das?«
»Weiß doch jeder.«
Stemmer glaubt nicht daran. Die Nazipartei ist zwar groß, aber ein Haufen von Wirrköpfen.
Rücksichtslos biegt der Fahrer links ab, obwohl der Schutzmann schon die Arme zum Stopp ausbreitet.
»Sie können sich ruhig Zeit lassen. Ich habe es nicht eilig«, sagt Stemmer, um ihn zu bremsen.
»Pah, die anderen sollen bleiben, wo sie wollen«, erwidert der Fahrer. »Ich bin für Tempo, Tempo. Nur wer schnell ist, kommt voran.«
Er braust auf das Brandenburger Tor zu, prescht zwischen den Säulen hindurch und gibt auf der dahinter beginnenden breiten Chaussee noch mehr Gas. Stemmer hat Angst vor einem Unfall auf der eisglatten Fahrbahn und verkriecht sich in das Polster. An beiden Seiten huschen Straßenlaternen und Bäume vorüber.
»Tourist? Ausländer?«, forscht der Fahrer mit einem Blick auf Stemmer.
»Österreicher.«
»Hab’s gleich an der Sprache gehört. Von wo dort?«
»Wien.«
Sogleich fängt er an zu singen: »Wien, Wien, nur du allein sollst die Stadt meiner Träume sein!«, und fügt schnell hinzu: »Also Deutscher. Österreich gehört zum Reich. Ist doch klar.«
»Österreich ist ein eigener Staat«, protestiert Stemmer.
»Nicht mehr lange, dann gehört es uns.«
Er ärgert sich über diese Unverschämtheit, schweigt aber.
Während der Flegel unter einer S-Bahn-Brücke hindurchjagt, kräht er: »Bald werden Sie die Stadt nicht wiedererkennen. Alles wird voller Hakenkreuzfahnen sein.«
Und dann legt er los, mit dem gleichen Schwung, in dem er seinen Wagen noch mehr beschleunigt, verkündet er: »Mit uns beginnt die neue Zeit! Wir schaffen ein neues, ein besseres Deutschland! Mehr Arbeitsplätze, mehr Freiheit für Deutsche! Mit Hitler hat das Elend ein Ende! Deutschland erwacht!«
Stemmer schweigt, obwohl er Lust hat, diesem Großmaul die Meinung zu geigen.
An einem Rondell zwingt der Fahrer den Wagen so scharf in die Kurve, dass Stemmer Angst hat, das Taxi könnte auf dem Eis und Schnee wegrutschen und sich überschlagen. Dann lenkt er ihn in eine andere breite Chaussee hinein und kurz darauf in eine kleine Seitenstraße. Endlich ist Stemmer in der Rosinenstraße angekommen, beim Volkshaus der SPD. Schnell zahlt er, was der Taxameter anzeigt, keinen Pfennig mehr für diesen Halunken, schnappt sich sein Gepäck und rennt zum Volkshaus.
»Wir besuchen euch bald!«, ruft der Lümmel ihm hinterher.
BRÜDER, ZUR SONNE, ZUR FREIHEIT
Das Volkshaus der SPD ist ein großer angewinkelter Gebäudekomplex, drei Etagen hoch. Stemmer tritt in die Eingangshalle. Sie ist mit quirligem Leben erfüllt. Menschen strömen aus den umliegenden Räumen, fluten in sie hinein, stehen gehäuft, die Gruppen lösen sich auf, sammeln sich wieder. An den Wänden künden bunte Plakate Vorträge an, auch Konzerte, Versammlungen, Filmvorführungen und Tanzvergnügungen. Ein Wegweiser zeigt zu den verschiedenen Sälen, zum Restaurant und zu den Zimmern. In einer Staffelage werden Prospekte für die Veranstaltungen angeboten. Auf einem Tisch liegt, gratis zum Mitnehmen, ein Stapel der SPD-Zeitung »Vorwärts«.
Stemmer bahnt sich einen Weg zur Anmeldung. Neben dem Rezeptionstresen döst auf einem Hocker ein alter, magerer Mann in einem blauen Arbeitskittel vor sich hin. Sein graues Gesicht ist eingefallen, seine wenigen Haare kleben straff gescheitelt auf seinem knochigen Schädel.
»Guten Morgen«, wünscht Stemmer der Frau im eleganten grauen Kostüm am Tresen. »Sommer« steht auf ihrem angesteckten Namensschild. Er legt seinen Pass vor. »Die Wiener ›Arbeiter-Zeitung‹ hat für mich ein Zimmer reserviert.«
Die Frau sieht im Gästebuch nach, fährt mit dem Finger über die Zeilen und findet die Reservierung.
»Zimmer 214. Zweite Etage.« Besorgt blickt sie ihn an. »Sind Sie der Kollege des vermissten Herrn Lechner?«
Stemmer nickt.
»Eine schlimme Geschichte«, sagt sie mit gequälter Miene. »Er ist am Abend weggefahren, am zwölften, vor zwei Wochen, und nicht wiedergekommen. Keine Nachricht von ihm. Vielleicht hatte er einen Unfall und liegt in einem Krankenhaus. Aber dann hätten die uns Bescheid gegeben. Wir können uns das nicht erklären.«
»Ich werde der Sache nachgehen.«
»Viel Glück dabei. Wie lange werden Sie bleiben?«
»Kann ich noch nicht sagen.«
»Sie können hier wohnen, solange Sie wollen.«
Stemmer füllt den Meldeschein aus, Frau Sommer greift zum Schlüsselbrett und reicht ihm den Zimmerschlüssel, der an einem hölzernen Klotz hängt.
»Leo, hol die Sachen von Herrn Lechner aus dem Keller.«
Der alte Mann im blauen Arbeitskittel schaut auf und erhebt sich müde vom Hocker.
»Du weißt, wo sie stehen.«
Stemmer bietet ihm an, beim Tragen zu helfen, doch er wehrt stumm ab und schlurft mit hängenden Schultern davon.
»Hoffentlich ist Ihrem Kollegen nichts passiert. Immer wieder verschwinden Menschen in dieser Stadt. Gerade in diesen Zeiten. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. In unserem Restaurant können Sie frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen«, informiert ihn Frau Sommer. »Angenehmen Aufenthalt.«
Mühsam schafft der Alte Lechners Koffer und sein Schreibmaschinenkästchen heran.
»214«, sagt sie zu ihm.
Leo schleppt das Gepäck zum Treppenaufgang. Wieder bietet ihm Stemmer an, ihm wenigstens den Koffer abzunehmen, doch der Alte will keine Hilfe.
»Schon gut. Dafür bin ich da.«
Langsam steigt er die Stufen hoch. Auf dem ersten Treppenabsatz stellt er die Last ab, verschnauft, holt ein großes kariertes Taschentuch aus seinem Arbeitskittel und schnäuzt sich kräftig. Etwas atemlos sagt er: »Ich gehör hier zum Inventar. Ich weiß nicht, junger Mann, ob Sie eine Ahnung davon haben, was das für ein Haus ist. Sie kommen ja aus Wien, und bei Ihrem jugendlichen Alter werden Sie das nicht unbedingt wissen. In diesem Bau habe ich noch einen Vortrag vom Scheidemann gehört. Der ’18 die Republik ausgerufen hat.«
Der Alte ist wieder zu Kräften gekommen und stapft mit Lechners Gepäck weiter die Stufen hinauf, Stemmer hinterher. Schon auf dem nächsten Treppenabsatz muss er wieder haltmachen. Die Puste ist ihm ausgegangen. Stemmer bittet ihn, alles stehen zu lassen. Er werde die Sachen später selbst hinauftragen.
»Nix da«, sträubt sich der Alte. »Ich mach das schon ein halbes Leben. Auch den Bebel hab ich hier erlebt. Ein Prachtkerl. Hab alle seine Bücher zu Hause. Alle gelesen. Die heutigen SPD-Bonzen sind nur kalter Kaffee.« Er greift nach der Bagage, schleppt sie schnaubend hoch und schafft es gerade noch bis zum nächsten Treppenabsatz. Er atmet schwer und muss sich auf den Koffer setzen. »Und den Ebert. Ein feiner Mann. Viel zu schade gewesen für die Drecksbande im Reichstag. Die heutigen Sozis sind alle zu lasch. Lassen sich zu viel gefallen von den Braunen. Hab den Krieg erlebt. Na, danke. Hab ihn überlebt. Und muss jetzt zusehen, wie die Nazis unsere Republik zerschlagen. Darf gar nicht daran denken, wie das enden wird.«
Mit letzter Kraft wuchtet er den Koffer und die Schreibmaschine das letzte Stück bis zur zweiten Etage hoch und stellt beides vor der 214 ab. Während Stemmer aufschließt, greift der Alte in die Brusttasche seines Kittels und drückt ihm ein Flugblatt in die Hand: »Aufruf zur Protestkundgebung gegen die braune Herrschaft des Verbrechens! 26. Januar 1933. 17 Uhr. Lustgarten. Kommt alle! – Sozialdemokratische Partei Deutschlands.«
»Das Letzte, was wir noch machen können«, sagt er keuchend. »Gehen Sie hin. Ich kann nicht weg von hier.«
Stemmer nimmt sich vor, zu dieser Kundgebung zu gehen. Wenn nichts dazwischenkommt. Er dankt dem Alten für seine Schlepperei und will ihm ein paar Mark zustecken, doch der wehrt auch das ab.
»Nix da. Werde vom Haus bezahlt. Passen Sie gut auf sich auf bei Ihrer Suche nach dem verschollenen Kollegen.«
Stemmer schafft sein Gepäck und das von Lechner ins Zimmer. Es ist ein einfacher, heller, wohlig geheizter Raum, ausgestattet mit allem Nötigen. Es gibt eine Kochnische, in der er sich etwas zusammenbrutzeln kann, und eine Kammer mit Dusche und Toilette. Durch das Fenster sieht man auf einen zugeschneiten Hinterhof mit ein paar kahlen Bäumen. Schmutziger Schnee bedeckt die Mülltonnen, einen aufgebockten Karren, eine Kinderschaukel und einen Schuppen, in dem rote Transparente und Fahnen auf ihre nächste Verwendung warten. Auf dem Hof sind vier Personenwagen abgestellt, die Reifenspuren im Schnee sind noch frisch, die Scheiben vom Schnee befreit. Nirgends steht ein zugeschneiter Pkw, der Lechner gehören könnte. Ludwig hatte einen Mietwagen, einen schicken Mittelklassewagen, einen DKW. Das weiß Stemmer, weil Lechner ihm bei einer seiner früheren Kurzvisiten in Wien stolz sein Auto zeigte und dabei betonte, dass es Vorderradantrieb habe. Er wunderte sich damals, dass Ludwig sich so einen teuren Mietwagen leisten konnte. Jetzt kein Auto von Lechner im Hof. Wo mag sein DKW geblieben sein?
Als Erstes nimmt Stemmer seine alte Tornado aus dem hölzernen Kasten, stellt sie auf den Schreibtisch, steckt Julischkas Rose in einen mit frischem Wasser gefüllten hohen Kaffeebecher und platziert ihn neben der Schreibmaschine. Dann packt er seinen Koffer aus und richtet sich ein. Zum Schluss öffnet er Lechners Koffer. Er ist vollgestopft mit Kleidern, Schuhen, Toilettensachen und alten Zeitungen. Alles, was das Personal des Volkshauses bei der Räumung seines Zimmers vorgefunden hat, wurde in den Koffer gepackt. Stemmer durchsucht die Taschen der Hosen und Jacketts, um irgendeinen Hinweis auf Lechners Verbleib zu finden, und stößt in einer Jacke auf ein kleines schwarzes Büchlein. Sein Adressbuch. Säuberlich sind Namen und Telefonnummern eingetragen. Daneben stehen Anmerkungen wie »Nur vormittags anrufen«, »3. Hinterhof, 4. Stock rechts«, »Ist bis 3. Jan. 33 verreist«, »Geht erst nach dem fünften Klingeln ran«. Bei Kisch, Günzelstraße 3, steht: »Prager Bier mitbringen«.
Er findet in diesem Büchlein die Namen Hanfstaengl, Leiter des Auslandspresseamtes, Gennat, Kriminalpolizeirat, Franke, Redakteur »Rote Fahne«, Frei, Herausgeber der »Berlin am Morgen«, und den von ihm bewunderten Hanussen. Alle mit vollständigen Adressen und Telefonnummern. Er findet auch den Namen Ulrike. Bei ihr jedoch keine Anschrift, keine Telefonnummer. Wer ist Ulrike?
Dieses Adressbuch muss er sich näher ansehen. Wer weiß, was er darin noch findet. Jetzt jedoch muss er erst einmal dringend auf die Toilette.
IMMER RAN AN DEN SPECK
Als er die Spülung betätigt, schaut er nach oben zum Wasserbehälter. Da sieht er hinter dem Metallkasten die Ecke eines Päckchens hervorragen. Er holt einen Stuhl, klettert hinauf und zieht das Päckchen heraus. Es ist in eine Zeitung eingehüllt. An seinem Schreibtisch faltet er die Seiten auseinander: Vor ihm liegt Lechners Tagebuch! Eine dicke Kladde in einem grünen Pappeinband. Sein Herz klopft ihm bis zum Hals, seine Finger zittern.
Als er den Band aufschlägt, fällt ihm ein Bündel Geldscheine entgegen. Alles Fünfzig-Mark-Scheine. Er zählt. Einundzwanzig Scheine. Eintausendundfünfzig Mark! Teufel, Teufel. Er muss erst mal schlucken. So viel Kohle hat Stemmer noch nie gesehen. Auch Lechner hat nie so viel Geld besessen. Wie ist er an so eine Summe gekommen? Er hat doch hoffentlich nicht jemanden ausgeraubt, bestohlen, sich bestechen lassen, krumme Geschäfte gemacht, und man hat ihn deshalb verschwinden lassen? Als er den Packen Geld in den Händen hält, ist ihm mulmig zumute. Etwas muss dahinterstecken. Irgendeine schiache Sach.
Immer wieder blättert Stemmer das Bündel Scheine durch. Damit könnte er in Berlin gut leben. Sehr gut sogar. In Saus und Braus ordentlich einen draufmachen. Die Möpse springen lassen. Zugleich schreckt ihn diese Vorstellung ab. Ihm gehört das Geld nicht, es ist Lechners Geld. Und außerdem kann er mit diesem Reichtum nicht sorglos leben, während sein Freund vermisst wird, er nicht weiß, wie es ihm geht und ob er vielleicht schon tot ist. Das kann er nicht. Das wäre schäbig von ihm. Er legt die Banknoten in die Schreibtischschublade.
Das Tagebuch ist nur zu einem Drittel gefüllt. Er sucht Lechners letzten Eintrag und findet ganz unten auf einer Seite: »Donnerstag, 12.01.33 – Bin einer dicken Sache auf der Spur.« Er blättert um. Nichts mehr. Danach nur noch leere Seiten.
Stemmer entdeckt, dass die Fortsetzung seines letzten Eintrags herausgerissen ist. Die Papierzacken am Bund sind deutlich zu sehen. Warum hat er dieses Blatt mit dem anschließenden Text herausgerissen? Was hat er auf der fehlenden Seite notiert? Und was ist das für eine dicke Sache, die er auskundschaften wollte? Der 12.01.33 ist der Tag, an dem er verschwand. Was geschah danach?
Als Stemmer genauer auf den Riss schaut, ist an den Papierzacken deutlich zu sehen, dass Lechner auch eine zweite Seite herausgetrennt hat. Warum? Ist es die Fortsetzung seiner Eintragung vom 12. Januar? Was stand auf diesem Blatt? Etwas, das er unbedingt verheimlichen wollte? Der rätselhafte Ludwig.
Stemmer blättert zurück und liest: »Wollte Thälmann interviewen. Nicht gelungen. Dafür Interview mit Gustav Franke, Redakteur der ›Roten Fahne‹, Karl-Liebknecht-Haus, KPD-Zentrale, Bülowplatz. Hat viel erzählt über die Schikanen der Nazis und ihre Überfälle.«
Weiß er etwas über Lechner? Oder über die Sache, der Lechner auf der Spur war?
»Besuche oft das Romanische Café bei der Gedächtniskirche. Dort Bruno Frei kennengelernt. Journalist und Herausgeber von ›Berlin am Morgen‹. Sehr sozialkritisch. Sehr sympathisch.«
Auch Frei könnte vielleicht etwas über Lechners Verschwinden wissen. Er muss ihn treffen.
Einige Seiten weiter vorn fällt ihm der Name Hanussen auf. »Habe mir seine Vorstellung im ›Wintergarten‹ angesehen. Genial und großartig, dieser Schurke. Erstaunlich, was der Gauner auf der Bühne zeigt.«
Warum nennt Lechner sein Idol einen Schurken und Gauner? Auch sein lästiger Reisekumpan hatte ihn so genannt.
»Wieder einen Hanussen-Auftritt gesehen. Diesmal in der ›Scala‹. Wieder phantastisch, dieses Großmaul! Will unbedingt ein Interview mit ihm. Will ihn fragen, was es mit den Anfeindungen gegen ihn auf sich hat. Bin neugierig, ihn kennenzulernen.«
Wenige Tage später folgender Eintrag: »Interview mit Hanussen. Im Büro seiner Luxuswohnung am Kurfürstendamm, direkt neben dem Gloria-Filmpalast. Enttäuschend. Nicht sehr ergiebig. Unangenehmer Typ.«
Stemmer mag das nicht glauben, er will sein Idol unbedingt selbst kennenlernen und beschließt, sich schleunigst um einen Termin für ein Interview mit ihm zu bemühen.
»Kenne nun die Tricks des Hellsehers Hanussen. Habe mir aus Wien ein Buch eines gewissen Erich Juhn schicken lassen, in dem er sämtliche Tricks aufdeckt. Sehr entlarvend.«
Stemmer fasst sich an den Kopf. Warum kennt er dieses Buch nicht? In Wien hat er nie davon gehört, es nie in einer Buchhandlung gesehen. Wer ist dieser Erich Juhn?
»Werde darüber einen Artikel schreiben. Mal sehen, wie der große Meister darauf reagiert.«
Sofort beginnt Stemmer, in Lechners Koffer dieses Enthüllungsbuch zu suchen. Alles wühlt er durch, alle seine Kleider. Kein Buch von Juhn. Wo ist es? Er befürchtet, dass Lechner es Hanussen gegeben hat, um ihn zu provozieren. Aber so blöd wird er nicht gewesen sein. Oder doch?
Stemmer setzt sich wieder an den Schreibtisch und liest weiter im Tagebuch: »Dieser Hanussen, ein ganz übler Bursche. Großer Trickser, ein dicker Freund der SA. Werde weiter über ihn recherchieren. Ob die ›az‹ meine Enthüllungen veröffentlicht, ist fraglich. Hanussen ist der berühmte große Sohn ihrer Stadt. Werde dennoch alles über diesen Scharlatan auskundschaften. Ist zwar gefährlich, die Nazis schützen ihn. Trotzdem.«
Stemmer zuckt zusammen. Lechner wollte sein Idol entlarven. Seinen bewunderten Hellseher. Hat er sich daran die Finger verbrannt? Wie weit ist Lechner gegangen, hat er die Nazis, die Hanussen schützen, gegen sich aufgebracht? Hat man ihn deshalb verschwinden lassen? Stemmer mag nicht glauben, dass der verehrte Hellseher ein Betrüger sein soll. Doch er weiß auch, dass er dem Urteil seines Freundes trauen kann. Er muss zu Hanussen, ihm etwas über Lechner entlocken.
Ein weiterer Tagebucheintrag erregt seine Aufmerksamkeit: »Wollte die SA-Gruppenführer Helldorff und Ernst interviewen. Haben Termin immer wieder verschoben. Habe über beide brisantes privates Material gesammelt. Ebenso über ihre neuen Folterkeller. Unmöglich, darüber zu schreiben. Zu gefährlich.«
Was ist das für ein brisantes Material, das Lechner über die beiden SA-Führer gesammelt hatte? Wo hat er es versteckt?
In einem geheimen Seitenschlitz des Tagebuchs entdeckt Stemmer einen Zettel mit den gesuchten Informationen. Über Wolf-Heinrich Graf von Helldorff steht da: »Führer der SA-Gruppe Berlin-Brandenburg. Homosexuell. Hoch verschuldet durch sein ausschweifendes Leben. Schuldner von Hanussen. Reichstagsabgeordneter. Organisiert Überfälle auf Juden und Kommunisten.«
Über Karl Ernst liest Stemmer: »SA-Gruppenführer Berlin. Rivale von Helldorff. Homosexuell. Alkoholiker. Intrigant. Hoch verschuldet. Schuldner von Hanussen. Früher Stricher und Page im Hotel Eden. Liebschaft mit dem homosexuellen SA-Stabschef Ernst Röhm. Durch ihn Karriere in der SA. Organisiert Überfälle auf Juden und Kommunisten. Reichstagsabgeordneter. Preußischer Staatsrat. Lässt Regimegegner foltern.«
Dieser Sprengstoff in Lechners Tagebuch! Stemmer kann diese Nachlässigkeit nicht fassen. Ein Glück, dass es nicht in die Hände der Politischen Polizei und der SA geraten ist. Aber Lechner ist trotzdem verschwunden. Warum? Er blättert weiter im Tagebuch.
»Will Muskel-Adolf interviewen. Berüchtigter Ganovenchef und Vorsitzender seines ›Geselligkeitsvereins Immertreu‹. Herrscht über eine Bande gut organisierter Krimineller.«