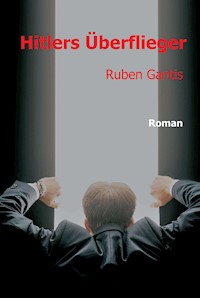
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn im Dritten Reich die Kreativität der arbeitenden Bevölkerung mit modernen Managementmethoden geweckt worden wäre? Hätte der Krieg früher begonnen oder hätten freier denkende Menschen das Regime gestürzt? Berlin, 1934: Der junge Unternehmensberater Frank Foremann kehrt aus den USA nach Nazi-Deutschland zurück, um in seiner Heimat Karriere zu machen. Er gründet ein Consulting-Unternehmen und will in die Zirkel der Macht aufsteigen. Sein Förderer im Reichswirtschaftsministerium entwickelt sich zu seinem Gegenspieler. Erst als Foremanns engster Freund in die Fänge der Gestapo gerät, beginnt er sich zu wehren und den Widerstand zu befeuern. Kann er die Dynamik, die er in der Wirtschaft entfacht hat, aufhalten? Ruben Gantis hat mit "Hitlers Überflieger" einen alternativen Geschichtsroman über Leidenschaft, Männerfeinde und die Macht einer Unternehmensberatung geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ruben Gantis
Hitlers Überflieger
© 2021 Ruben Gantis
Lektorat, Korrektorat: Christoph Wöhrle, Michael Haas-Busch
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-23975-3
Hardcover:
978-3-347-23976-0
e-Book:
978-3-347-23977-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Kapitel 1 – Tempelhof - Juli 1934
Frank Foremann streckte seinen Oberkörper und fuhr mit der rechten Hand seinen Seitenscheitel nach. Dann faltete er die Hände und ließ die Finger knacksen. Für einen Augenblick dachte er an seinen Abschied aus Bosten, wo er die letzten sieben Jahre gelebt hatte. Zunächst in Harvard studiert und dann bei den Gavry‘s gearbeitet, wie seine früheren Kollegen ihre verschworene Gemeinschaft liebevoll nannten. Aber er war nie Teil davon geworden. Er war immer nur der blonde Deutsche gewesen. Und dabei hatte er alles getan, um dazuzugehören. Nach der langen Schiffsreise nach London war der kurze Flug nach Berlin ein Kinderspiel. Er schaute aus dem Fenster der Junkers und sah die Umrisse der Hauptstadt des Reiches. Bedächtig faltete er das Blatt zusammen und steckte es in die rechte Innentasche seines Sakkos. Dieses Ritual hatte er von seinem Vater übernommen. Geldbörse in die linke Innentasche, wichtige Schriftstücke rechts. Vater würde seinen Plan ablehnen, so wie er die Nazis ablehnte.
Seine Maschine setzte mit einem heftigen Ruckeln in Tempelhof auf und bremste ab. Foremann wurde in seinen Sitz gepresst. Die Maschine rollte aus. Während das Flugzeug seine Landeposition fand, spähte Foremann aus dem Fenster. Die bereits fertig gestellten Bauten des neuen Flughafens imponierten ihm. Hatte ihm seine Schwester nicht geschrieben, dass jetzt überall in Berlin so eindrucksvoll gebaut würde? Dieses neue Deutschland war wie für ihn geschaffen, hier würde seine Karriere Fahrt aufnehmen. Hier würde er aufsteigen, als Deutscher akzeptiert werden und es zu Ruhm bringen. Er lächelte. Wenige Sitzreihen vor ihm öffnete die Stewardess die Tür. Er sah sie beeindruckt an. Nur vier Jahre war es her, als in den USA die erste Frau zur Flugbegleiterin zugelassen wurde. Eine Krankenschwester. Weil sie beruhigend auf Passagiere mit Flugangst wirken sollte. Seine Mitreisenden formierten sich zu einer Schlange. Foremann blieb noch sitzen. Er wollte diesen neuen Abschnitt seines Lebens nicht mit eingezogenem Kopf zwischen Wartenden zubringen. Noch einmal holte er das Blatt aus dem Sakko. Sein Plan klang simpel: Consulting-Unternehmen aufbauen – Produktionsprozesse der Kunden optimieren - Größen der deutschen Wirtschaft und Politik beraten.
Sein Vater hatte ihn gewarnt. Überall gäbe es jetzt Uniformierte von der SA, die harmlose Bürger drangsalierten. Wo auch immer sie das tun mochten, auf dem Flugfeld konnte Foremann nur weite, sorgsam gepflegte Rasenflächen entdecken und dazwischen teergedeckte Rollbahnen. Die Stewardess stand plötzlich neben ihm. Er zuckte zusammen, als sie sich zu ihm herunterbeugte.
„Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug mit uns, Herr Foremann. Aber jetzt müssen Sie aussteigen, sonst warten ihre Liebsten vergeblich.“
Er senkte die Augenlider und nickte freundlich. Sein Vater würde sicher nicht auf ihn warten. Er hatte Foremanns Sympathien für die Nazis nie gutgeheißen. Er müsse sich nicht mit dem Teufel einlassen, nur weil er nicht in der elterlichen Firma arbeiten wollte, beklagte er sich regelmäßig. Das fahle Gesicht seines Vaters war ihm lebendig vor Augen.
Dieses braune Pack würde Deutschland wieder in einen Krieg führen, hatte er früher gezürnt und dabei auf den Eichentisch im Esszimmer geschlagen, so dass der Tischschmuck vibrierte.
Auch die Beschwichtigungen der Mutter, dass Hitler doch Autobahnen bauen und Arbeitsplätze schaffen wollte, hatten nichts geholfen. Er hasste die Nationalsozialisten.
Mühelos öffnete Foremann das schwere Schloss des Gurtes und streckte die Arme nach oben, als ob er die Gedanken an die Eltern verrücken wollte wie schwere Möbel. Er drückte seine langen Beine durch, erhob seinen trainierten Körper und langte zur Gepäckablage über ihm. Er nahm seine schwarze Aktentasche und seinen Hut und trat als Letzter auf die Flugtreppe. Er stieg die Stufen hinunter und ließ die Augen von rechts nach links wandern, als ob er nach einem Empfangskommando Ausschau hielte. Foremann musste leise über sich selbst lachen. Wer sollte schon wissen, dass er gerade jetzt deutschen Boden betrat?
Das Dach, ein mächtiges Stahlmonster, überragte das Flugzeug fast vollständig. So gewaltig hatte er sich den Flughafen nicht vorgestellt. Nach wenigen Schritten trat er durch eine massive Stahltür in die Gepäckstation. Erdrückender Granit, wohin er auch schaute. Er drehte sich um die eigene Achse, ohne den Blick vom Mauerwerk zu nehmen, das ihn umgab. Winzig kam er sich vor, eingeschüchtert von der Imposanz, die von diesem Saal ausging.
„Brauchen Sie einen Gepäckträger?“, wurde er von einem Mann mit Schiebermütze und abgetragener Uniform aus seinen Gedanken gerissen.
„Nein danke“, antwortete Foremann verdattert, „ich habe nur einen Koffer“.
Er erntete ein unbeteiligtes Nicken. Pomadig schleppte sich der Träger weg und lehnte sich an einen der Granitpfeiler. Foremann schaute ihm nach und ließ den Blick an dem Pfeiler nach oben gleiten. So hoch wie acht bis zehn Mann, schätzte er. Kräftige Arbeiter hoben die Koffer vom Rollwagen. Seiner war mit einem braunen Gürtel umschnürt. Einer der Männer stellte ihn auf den Boden. Wie benommen von seinen Eindrücken lief er hinüber und griff nach seinem Gepäck, das eher wie eine große Reisetasche wirkte als ein Überseekoffer. Sein Leben verstaut in einem einzigen Gepäckstück. Einige wenige Fotos von den Feiern in der Firma. Keine Liebesbriefe, keine sentimentalen Erinnerungsstücke, keine liebevollen Mitbringsel aus Amerika. Nur seine maßgeschneiderten blauen und grauen Zweireiher und die bequemen Blue-Jeans mit Hosenträgern – der letzte Schrei in den Staaten. Dazu seine Wäsche und seine nagelneuen Sportschuhe. Mehr hatte er nicht mit zurückgenommen.
Müde vom Flug trug er seinen Koffer durch eine schwere Tür zum Zoll in der Empfangshalle. Eine Schweißwolke lag in der Luft. Er reihte sich in die Schlange ein. Noch wenige Meter und er war wieder im Deutschen Reich. Er hatte sich seit Monaten danach gesehnt. Was seine Schwester Frieda in ihrem letzten Brief nur meinte, als sie schrieb, es wäre der richtige Zeitpunkt, ins „neue Deutschland“ zurück zu kommen? Sie war eine eingefleischte Anhängerin der Nationalsozialisten und als Mutter und Apothekerin das Paradebeispiel einer deutschen Frau. In feiner Schrift hatte sie auf ihrem beigen Briefpapier von der NS-Revolution geschrieben, die die Ewiggestrigen weggefegt und mutigen jungen Anführern den Weg bereitet hatte. Friedas Worte hatten ihn begeistert. Nur langsam bewegte sich die Schlange auf das Zollhäuschen zu, das zwischen den in die Wände geschlagenen Skulpturen winzig wirkte. Jemand hinter ihm tippte ihn an.
„Wollen Sie nicht mal weiter gehen?“
Foremann senkte den Kopf. Er hatte vor lauter Staunen nicht gemerkt, wie groß die Lücke zu seinem Vordermann geworden war, der schon vor dem Zöllner stand. Schließlich war er an der Reihe, nahm Haltung an und legte seinen Reisepass auf die kleine Theke. Der blasse Zöllner in seiner blauen Uniform schaute ihn mit Grimm im Blick an. Lautlos griff er nach Foremanns Pass.
"Lange nicht mehr hier gewesen, wie es scheint, junger Mann. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Willkommen in Deutschland. Heil Hitler".
Ungläubig schaute Foremann ihn an, unsicher, ob er den rechten Arm heben sollte. Er ließ es. Es würde komisch aussehen.
„Heil Hitler“, erwiderte er leise. Daran würde er sich erst noch gewöhnen müssen. Er trat rechts an dem Zollhäuschen vorbei und ging mit großen Schritten zum Ausgang der Empfangshalle. ‚Hier entsteht der größte Flughafen der Welt‘, las er. „Meine Güte“, sagte er im Flüsterton, „die Nazis wollen hoch hinaus.“ Foremann malte sich aus, wie er bald vor den Bossen der deutschen Wirtschaft sprechen würde. Er spürte, am richtigen Ort zu sein, um seinen Plan umzusetzen und dazu beizutragen, Deutschland wieder stark zu machen.
Kapitel 2 – Familie - Juli 1934
Jakob Justens Augenlider fühlten sich an wie zwei Sargdeckel. Ein dumpfer Schmerz pochte in seinem kantigen Schädel, als er die Wohnungstür ins Schloss fallen hörte.
„Jakob!“, drang eine schrille Stimme durch seinen Geist. Er richtete seinen Kopf auf und die Sargdeckel öffneten sich einen Spalt weit. Sein dürrer Körper versagte ihm den Dienst. Annes Gesicht erschien aus dem Dunkel der Küche. Er versuchte, ihrem anklagenden Blick zu entgehen und sah den randvollen Aschenbecher und die umgefallenen Bierflaschen auf dem Tisch. Nur in Schemen erkannte er, wie Anne sich ein Tuch vor den Mund hielt. Er hörte sie würgen. Mit kurzen Zügen atmete er den ätzenden Geruch ein, der in der Luft lag und hörte seine Frau über den Gestank maulen, während sie die Vorhänge zur Seite zog und das Fenster öffnete. Mit weitem Mund sog sie die frische Luft ein, als ob sie ihre Lungen ausspülen wollte. Sie drehte sich wieder Justen zu und stampfte an ihm vorbei zur Spüle. Mit zwei Fingern hob sie die Hosen ihres Sohnes auf und drehte den Wasserhahn auf. Angewidert ließ sie sie in die Zinkschüssel fallen.
„Jakob!“, hörte er sie wieder lauter rufen. Er konnte seinen Kopf mit den eingefallenen Wangen und dem Spatenkinn nicht nach oben bewegen.
„Hast du im Beisein der Buben getrunken oder konntest du sie noch ins Bett bringen, bevor du abgestürzt bist?“, schnauzte sie ihn an. Justen hielt sich die Ohren zu. Er drehte sich weg, noch immer in seinem zu weiten dunklen Anzug vom vorigen Abend in dem alten Schaukelstuhl liegend.
„Jakob, wach endlich auf, was ist denn los mit dir?“, hörte er seine Frau rufen. Doch er drehte sich noch weiter zur Seite und atmete leise, als ob er so unsichtbar werden könnte. Sie trampelte durch die Wohnung und baute sich mit verschränkten Armen neben ihm auf. Dann schüttelte sie ihn kräftig. Erschrocken öffnet er die Augen.
„Du könntest wenigstens ins Bett gehen und dort deinen Rausch ausschlafen!“
Doch trotz seines Zustandes hörte er aus ihrer Stimme die ihm so vertraute Sanftheit. Sie hatte einfach Angst um ihn. Seit die Nationalsozialisten an der Macht waren, war das Leben mühsam geworden. Seit den Boykottaufrufen gegen Juden vom 1. April 1933, vor kaum mehr als eineinhalb Jahren, und der Verbannung von Journalisten und Beamten waren bereits über 20.000 Juden aus Deutschland geflohen. Er wusste, dass Anne über Auswanderung nachdachte, obwohl sie Deutsche war. Sie machte sich wegen ihm und der beiden Buben Sorgen. Sie weckte ihn sanft, während sie seinen Kopf in die Hände nahm und ihn auf die Stirn küsste.
„Was ist denn passiert? Du trinkst doch sonst praktisch nichts. Jakob, was ist los?“
"Machst du mir bitte einen Kaffee, Anne. Ich habe zu viel geraucht, nicht zu viel getrunken."
Mit seinen schlanken Klavierhänden rieb er sich die Augen. Dann massierte er seine Schläfen.
"Es gab wieder mächtig Ärger in der Firma gestern, in der Produktion. Wir kriegen den geforderten Ausstoß nicht hin. Menschenskinder, mir brummt der Schädel", jammerte er.
„Geh ins Bad und mach dich frisch, du musst ins Büro. Du kannst mir mehr später mehr erzählen.“
Justen schob sich aus dem Schaukelstuhl nach oben und sah Anne an.
„Ich liebe dich. Danke.“
Kapitel 3 – Adlon – Juli 1934
Von vorne winkten ihm die Taxifahrer zu, als er rau neben sich hörte: Viel zu teuer, die U-Bahn ist preiswerter, da vorne ist der Eingang. Seine Schwester hatte ihm geschrieben, dass Berlin die einzige Stadt sei, in der die U-Bahn direkt zum Flughafen führe. Er folgte der Person mit der rauen Stimme, kramte einige Münzen, die er noch in Boston besorgt hatte, aus seiner Hosentasche und kaufte sich am Schalter ein Billet. Foremann stieg die steilen Stufen hinunter zur Nord-Süd-Bahn. Mit jedem Schritt kroch ihm mehr modriger Kellergeruch in die Nase. Stehende Luft und Kohle. Er rümpfte die Nase. Der Bahnsteig wurde durch zwei grelle Scheinwerfer erhellt, als sich der erste gelbe Wagen mit quietschenden Bremsen näherte. Mit lautem Zischen kam die Bahn zum Stehen. Durch die sich öffnenden Türen strömten Fahrgäste aus dem Zug. Foreman betrat den Wagon zusammen mit einer Reihe Geschäftsmännern, die uniform ihre Aktentaschen unter den Arm geklemmt hatten. Er suchte Halt an einer der Stangen, als sich die Türen mit einem lauten Knarzen schlossen und die Bahn anfuhr. Geschickt verlagerte er sein Gewicht, um nicht durch die Beschleunigung zu wanken. Sein Nebenmann trug einen großen Hut und stand aufrecht und gerade da, die Schultern nach hinten gedrückt. Sein Blick fiel auf zwei junge Frauen. Die große Blonde trug einen dunklen Hosenanzug und hatte ihr Haar hochgesteckt. Die andere fixierte ihn mit ihren hellblauen Augen. Sie nestelte an ihren Locken. Foremann wollte das Leben in Berlin genießen, nicht nur den beruflichen Erfolg. Aber das musste warten.
Frieda hatte ihm das Adlon empfohlen, denn es sei ein grandioser Ort, um Kontakte zu knüpfen. Vom U-Bahnhof Französische Straße nahm er den direkten Weg über den Prachtboulevard Unter den Linden zum Adlon. Vom Boden der Allee hätte man Essen können, so sauber war der Bürgersteig. Und dann sah er sie. Sie waren noch ungefähr zweihundert Meter von ihm weg, aber das harte Klacken ihrer Stiefel konnte er bereits hören. Eine Gruppe von Braunhemden kam im Stechschritt auf ihn zu. Die Formation schwenkte rot-weiße Fahnen mit schwarzem Hakenkreuz. Einige Passanten applaudierten und feuerten die Gruppe an. Andere machten sich davon und verschwanden in den Cafés am Boulevard.
„Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen! SA marschiert mit ruhig festem Schritt.“
Die eisigen Augen, die an ihm vorbeizogen, machten ihm fast Angst. Foremann stand still da. Ein Jungspund riss sich plötzlich von seiner Mutter los und ging durch die Truppe auf die gegenüberliegende Straßenseite. Vor einem älteren, gebückten Mann blieb er stehen und schrie ihn an. Foremann konnte nicht hören, was er rief. Mühsam richtete sich der Alte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf und applaudierte. Ein paar Minuten später war der Spuk vorbei. Foremann folgte mit gefrorenem Lächeln dem Trupp. Das hatte Vater mit seinen Andeutungen wohl gemeint.
Langsam ging er weiter Richtung Adlon. Riesige Hakenkreuzfahnen hingen von der eleganten Fassade. Ehrfürchtig trat er unter den weißen Baldachin, der zum Eingang führte.
„Kann ich dem Herrn mit dem Gepäck helfen?“, sprach ihn der Wagenmeister an.
Aber Foremann schüttelte mit einem kurzen “Danke“ den Kopf. Wie von Zauberhand öffnete sich das hohe Eichentor und er betrat Berlins erste Adresse am Platz. Mannomann, dachte er, fuhr sich mit der Hand durch die Haare und blieb stehen.
„Tja, da staunst du, was?“
Foremann senkte den Blick und schaute in ihm so vertraute Augen. Er stellte seinen Koffer ab und breitete die Arme aus.
„Frieda, das ist ja eine Überraschung! Was machst du denn hier?“
„Ja was wohl? Ich bin das Begrüßungskomitee!“
Sie drückte ihren Bruder mit einer langen Umarmung. Er schob sie von sich weg und schaute sie von oben bis unten an. Ihr kurzer, blonder Pagenschnitt betonte ihre Stupsnase, auf denen die braunen Augen zu sitzen schienen.
„Ist das eine Fleischbeschauung?“
„Nein, lass dich doch einfach nur ansehen, du Maultante.“
Er zog sie wieder an sich und drückte sie innig.
„Es ist so schön, dass du wieder bei uns bist, Frank.“
Ihre Stimme überschlug sich. „Du musst mir alles erzählen, wie der Flug war, die Wochen seit unserem letzten Brief, einfach alles.“
Sie nahm seine Hand und zog ihn zu einem runden Tisch auf der linken Seite des Empfangssaals. Foremann konnte nur drei Bowler Melonen erkennen. Die Herren schienen in ein Gespräch vertieft.
„Schau mal, wer noch da ist“, piepste seine Schwester. Einer der Herren stand auf und drehte sich langsam zu ihm um. Dann streckte er ihm die Hand entgegen.
„Sohn, es ist schön, dich wiederzusehen.“
„Vater, du hier?“, stammelte Foremann.
Kühl überspielte der die Situation. „Darf ich dir meine Geschäftspartner vorstellen, Graf Anton von Herbrich und Professor Franz Stulp. Sie nahmen Haltung an, hoben ihre Hüte und stellten sich als Geschäftsleiter und als Prokurist der AEG Aktiengesellschaft in Berlin vor. Der Graf begrüßte ihn freundlich und erklärte in zwei Sätzen die AEG. Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft war eines der größten deutschen Unternehmen und ein sehr bedeutendes in Berlin. Es war maßgeblich an der weltweiten Elektrifizierung beteiligt und produzierte elektrische Produkte für Haushalte und Unternehmen. Ihre Produktpalette reichte von Haushaltsgeräten bis zu Lokomotiven.
"Hast du die SA marschieren gesehen, mein Sohn? Die tun so, als ob ihnen die ganze Stadt gehört. Wenn sie nicht marschieren, stehen die dumm rum und halten Wache."
"Was auch immer sie bewachen, AEG jedenfalls nicht“, erwiderte der Professor.
„Die üben schon für den Einmarsch beim Reichsparteitag im September in Nürnberg“ warf von Herbrich ein. Foremann zog die Augenbrauen nach oben.
„Junger Mann, das wird ein großer Tag für Deutschland, denn das Land wird sich angesichts des Parteitages in Nürnberg modern zeigen.“
„Tja, das kann Goebbels, eine große Show machen", kommentierte der alte Foremann.
"Hör auf Vater, nicht so laut. Wir haben alle was davon. Und du mit deinen Fräsmaschinen sowieso. Das Land blüht wie lange nicht mehr. Lass das ewige Lamentieren. Wir sind wieder wer. Wir können stolz sein, Deutsche zu sein", erwiderte Frieda dem Vater. Foremann musste unwillkürlich schmunzeln.
Kapitel 4 – Reichswirtschaftsministerium – Juli 1934
Doktor Meyer lehnte sich zurück und wippte in seinem breiten Lehnstuhl, den er als Schreibtischstuhl missbrauchte. Er schaute auf die aktuelle Statistik in der Ausgabe der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom Vortag: Industrieproduktion im ersten Halbjahr 1934. Was der deutschen Industrie half, war auch gut für das Land. Er wollte das Vaterland nach der Schmach von Versailles wieder stark sehen. Im Friedensvertrag von Versailles hatte man Deutschland gezwungen, anzuerkennen, der Urheber des Krieges und für alle Schäden und Verluste verantwortlich zu sein. Er wollte für sein Land kämpfen, nicht wie sein Vater, der sich wegduckte, wo immer er konnte. Apathisch und unpolitisch. Als Kriegsverletzter mit einer durchschossenen Lunge dauerte dessen Leben nicht lang. Meyer hatte keinen Grund zu trauern, als der Vater 1925 an einer Lungenentzündung starb.
Seine Karriere war schnell und steil. Vor vier Jahren wurde er zum Abteilungsleiter im Reichswirtschaftsministerium berufen. Als er im September des letzten Jahres zum Staatssekretär ernannt wurde, hatte er den richtigen Platz gefunden, um seinen Traum umzusetzen. Meyer drückte sich von der Tischplatte ab und hob seinen massigen Körper. Er öffnete die schwere Holztüre zu seinem Vorzimmer.
"Fräulein Schneider, holen Sie mir Schwans und Streiter ins Büro.“
„Wird erledigt, Herr Staatssekretär.“
„Jetzt sofort!", brüllte er in gewohnter Schärfe hinterher.
"Ja, Herr Doktor Meyer.“
Mit dem Bleistift in der rechten Hand wählte sie hastig Schwans Nummer. Wenige Minuten später klopfte es zweimal an Fräuleins Schneiders Tür. Schwans öffnete zurückhaltend die Tür. Er schnaufte schwer, als ob er vier Stufen auf einmal genommen hätte. Streiter schob ihn ins Zimmer.
"Ist der Chef drin?“, fragte Streiter etwas laut und Fräulein Schneider führte ihren Zeigefinger zum Mund. Streiter schmunzelte. Er kannte die Zeichen der Sekretärin: Vorsicht, der Chef ist gereizt.
"Kommen Sie rein, meine Herren, wir haben nicht viel Zeit." Schwans ging voraus und hob beim Betreten des langgestreckten Büros von Meyer den rechten Arm.
"Heil Hitler!"
Der lange Streiter folgte ihm mit kurzem Abstand und noch einmal knallte „Heil Hitler!“ durch den Raum.
"Heil Hitler, nehmen Sie Platz, meine Herren.“
Zwei schwarze Ledersofas füllten den halben Raum des Büros. Deren Patina konnte Geschichten über Meyers Vorgänger erzählen. Meyer ließ sich behäbig auf die Mitte des Sofas fallen. Die Couch sank tief ein. Die Abteilungsleiter nahmen auf der gegenüberliegenden Couch Platz wie Schulbuben vor dem Rektor. Fräulein Schneider wartete auf die Bestellung. Die blonden Haare der Sekretärin waren zu Zöpfen gebunden. Meyer ließ seinen Blick über ihre weiße Bluse und ihren überlangen karierten Rock nach unten gleiten.
„Für mich einen Schwarzen, wie immer, und für die Herren auch?“, bellte Meyer.
"Meine Herren, durch die Maßnahmen des Vierjahresplans und die Planung von Reicharbeitsministerium, Reichswirtschaftsministerium und Reichsbank ist es dem Führer gelungen, die Arbeitslosigkeit drastisch zu senken. Wir sind fast wieder auf dem Stand von 1926. Das Konjunkturprogramm zeigt seit der Machtübernahme in der Automobil- und Investitionsgüterindustrie sichtbare Erfolge. Die deutsche Wirtschaft wird Stück für Stück autarker."
Streiter kniff die Augen zusammen und Schwans legte die Stirn in Falten.
„Also für Sie nun zum Mitschreiben: die zunehmenden Probleme für unsere Industrie sind Arbeitskräfte. Aber vor allem Devisen für Vorprodukte, die wir nicht im Reich produzieren. Unser Problem ist die Kompetenzüberschneidung zwischen den Bezirkswirtschaftsämtern und den Arbeitsämtern. Rohstoff- und Arbeitskräftezuteilung werden nicht effizient gehandhabt.“
Meyer wuchtete sich bis an die Kante des Sofas und fixierte Schwans.
„Und verstehen Sie, was das bedeutet? Wir behindern unsere Industrie und damit die Produktion der kriegswichtigen Produkte“, fuhr Meyer fort. „Denn nicht alle Unternehmen brauchen Zuteilungen von Rohstoffen. Diejenigen, die nicht darauf angewiesen sind, bestrafen wir mit unserer Verwaltung.“
Wieder eine Kunstpause.
„Ich bin deshalb zu dem Schluss gekommen, dass wir bezüglich Vorgaben, Gleichbehandlung, Planung und Ergebniskontrolle der Unternehmen die Schrauben überdreht haben."
Just in dem Moment betrat Fräulein Schneider mit einem Tablett das Büro. Sie balancierte wie eine professionelle Serviererin. Während sie den Herren ihren Kaffee reichte, kniete sie sich dabei so weit, wie es ihr enger Rock zuließ.
"Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Staatssekretär, dann suchen Sie Wege, wie wir Branchen je nach Rohstoffbedarf unterschiedlich behandeln können. Also eben gerade nicht gleichschalten, sondern den Unternehmen, die nur heimische Rohstoffe benötigen und damit keine Devisen, freiere Hand lassen bei der Optimierung ihrer Produktion.“
Streiter schaute erwartungsvoll, so als ob er nun großes Lob abernten dürfte. Meyer nickte und fasste mit militärischem Ton zusammen.
"Jawoll, Sie haben es verstanden. Ich muss dem Reichwirtschaftsminister am kommenden Montag einen Vorschlag unterbreiten, wie wir das praktisch machen."
Kapitel 5 – Produktivität - Juli 1934
Justen stand vor dem stumpfen Spiegel in ihrem Bad, dessen Krönung eine Sitzbadewanne war. Er zog die Klinge an seinem Hals hoch.
„Hoffentlich sind diese üblen Zeiten bald vorbei, so dass wir wieder frei sprechen, denken und uns bewegen können“, brummelte er vor sich hin, als er zurück in die Küche ging, während er mit dem Handtuch den Schaum aus dem Gesicht wischte.
„Was geht bald vorbei?“, erwiderte seine Frau. Sie presste die Handmühle zwischen ihren Knien zusammen und malte Kaffeebohnen. Der Wasserkessel pfiff auf dem Kohlenherd wie das Signalhorn einer Dampflok.
„Ach nichts. Ich muss mir überlegen, wie wir die Produktivität steigern können", suchte er eine Ausflucht.
„Nun sag‘ schon.“
„Wir haben neue Vorgaben: den Ausstoß sollen wir um zwanzig Prozent erhöhen und gleichzeitig die Arbeitskräfte in der Verwaltung reduzieren. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.“
„Und wie stellen sich deine Nazi-Kameraden das vor?“
„Die hocken auf ihrem hohen Ministeriums-Ross in der Invalidenstraße und machen schlaue Vorgaben.“
„Aber Jakob, dir fällt doch immer was ein. Du bist doch mein Superhirn. Was meinst du wohl, warum ich dich geheiratet habe?“
Er lächelte sie müde an und musste an ihre Hochzeit denken und wie sie sich wenige Jahre davor kennengelernt hatten. Er hatte eines Abends seinen Vater aus der Bank abgeholt, der Dresdner Bank Filiale am Schlossplatz Stuttgart. Fast gleichzeitig wie der Vater war eine zierliche Frau durch die Tür gekommen, die sich vom Vater verabschiedete. Justen erinnerte sich, wie er sie mit offenem Mund angestarrt und sich augenblicklich verliebt hatte. Nur zwei Jahre später, als er gerade mit dem Maschinenbaustudium fertig war, machte er ihr, der frisch gebackenen Bankkauffrau, einen Antrag.
„Hallo Jakob, träumst du?“
Er schüttelte sich.
„Ich weiß nicht, welche Abläufe wir in der Verwaltung noch straffen könnten. In der Buchhaltung machen die Leute alle Überstunden.“
„Na dann probiert es doch mal im Werk, du Schlauberger.“
„Auch in der Turbinen-Endmontage im Werk in der Huttenstraße kommen die Arbeiter seit Wochen nicht raus, wenn sie nicht mindestens zwölf Stunden malocht haben. Und auch im Magnetophon-Werk am Gesundbrunnen arbeiten die Leute im Zweischichtbetrieb. Sie sind kaputt und die Fehlerquote steigt.“
„Klingt so, als ob alles schlechter statt besser wird. Das hat unser lieber Führer aber ganz anders versprochen!"
Jakob schaute sie streng an, aber bevor er antworten konnte, fiel Anne ihm ins Wort. "Ihr müsst mit euren Mitarbeitern halt so umgehen, wie wir unsere Söhne erziehen wollen: zu rechtschaffenen Leuten, die mitdenken, die ihre Ideen einbringen, die mutig Vorschläge machen.“
„Ja klar, Anne. Du hast aber schon gemerkt, dass die Weimarer Republik abgedankt hat und wir von einem judenhassenden Diktator geführt werden?“
„Die deutsche Rasse muss das Ruder übernehmen und den Juden vertreiben aus allen Führungsaufgaben“, äffte sie den Reichsführer nach.
„Anne bitte, du musst vorsichtig sein, was du sagst. Die Wände sind dünn.“ Und ohne sie zu Wort kommen zu lassen setzte er nach: „Die Kollegen werden immer stärker ausgebeutet. Sie haben kein Interesse, über Lösungen unserer Produktionsprobleme nachzudenken.“
"Jakob, nun sei doch nicht so deprimiert“, entgegnete Anne ihm ernst. "Du tust dein Bestes. Ich finde, du engagierst dich ohnehin zu viel. Die Nazis danken es dir nicht. Du musst eher aufpassen. Nur weil du so gut bist auf deiner Stelle, lassen sie dich in Ruhe im Moment."
„Und weil ich mit einer Deutschen verheiratet bin.“
"Naja, dein Aufstieg zum Organisationsleiter war schon sehr schnell. Und hat nichts mit mir zu tun.“
„Stimmt, ohne unseren Geschäftsleiter Graf von Herbrich hätte ich das nie geschafft."
Kapitel 6 – Vater - Juli 1934
Sie winkte Foremann aufgeregt zu. Er stand verwundert auf und ging hinüber zum Empfang.
„Frank, darf ich dir Herrn Böser vorstellen, den Geschäftsführer des Adlon.“
Mit tiefer Stimme erwiderte Böser: „Herr Foremann, Ihre Schwester hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich freue mich, Sie als unseren Gast im Adlon begrüßen zu dürfen. Bitte zögern Sie nicht, mich oder meine Kollegen anzusprechen, wenn Sie etwas benötigen.“
„Vielen Dank, Herr Böser, sehr freundlich. Zunächst könnte mir in der Tat einer Ihrer Kollegen helfen und die Eintragung ins Gästebuch vorbereiten.“
„Kein Problem, wird sofort veranlasst.“
Böser deutete einen Diener an und verschwand in ein Zimmer hinter dem Empfang.
„Na, du hast ja gute Kontakte, Schwesterchen.“
„Stimmt, und wenn du erst ein paar Tage hier bist, wirst du interessante Geschäftsleute hier treffen. Ich hab‘ es dir doch geschrieben.“
Sie konnte ihr Grinsen nicht verhehlen. Beide gingen zurück an den Tisch. Aus dem Lautsprecher am Boden war Zara Leander zu hören. Die neue Zeit hatte im Adlon Einzug gehalten. Das Radio übertrug ihre neusten Aufnahmen. Sie setzten sich zum Vater und den Herren von AEG. Ein Moment peinlicher Stille entstand.
„Also, ich bin zurück in Deutschland und jetzt kann es losgehen.“
Foremann fummelte an seinem Kugelschreiber herum.
„Na, da bin ich ja mal gespannt, was du so Großes und Tolles vorhast und der Führung unseres Unternehmens vorziehst.“
„Du hast es mir nicht verziehen, nicht wahr? Du wolltest nicht, dass ich in Harvard studiere und dann in eine Unternehmensberatung gehe. Du wolltest, dass ich deine Firma übernehme. Verstehst du es nach den vielen Jahren immer noch nicht? Ich gehe meine eigenen Wege.“
„Frank“, zischte seine Schwester.
„Sie waren in Harvard?“, grätschte von Herbrich mit einem Räuspern dazwischen. „Beeindruckend, und was haben sie danach gemacht?“
Foremann musterte den AEG Geschäftsleiter, bevor er vorsichtig antwortete.
„Ich habe bei Gavry & Partner angeheuert als Unternehmensberater.“
„Was ist eine Unternehmensberatung? Davon habe ich noch nie etwas gehört“, kommentierte der Professor.
„Ihren Ursprung hatten Beratungen am Ende des letzten Jahrhunderts in der technologischen Forschung“, holte Foremann ein wenig aus. „Daraus wurden vor wenigen Jahren Management-Beratungsfirmen, wie zum Beispiel Arthur D. Little oder McKinsey. Als die USA 1929 in die Wirtschaftskrise schlitterten und viele Unternehmen unter die Räder kamen und saniert werden mussten, nahmen die Banken die Leistungen von solchen Beratungen in Anspruch. Gavry wurde 1924 gegründet und als ich dort anfing vor knapp fünf Jahren, spezialisierte das Unternehmen sich auf die Verbesserung von Abläufen in Unternehmen.“
„Und woher wissen Sie als noch recht junger Mann, wie man Abläufe optimiert?“, hakte Herbrich interessiert ein.
Foremann atmete tief durch und antwortete ruhig. „Beratungsunternehmen messen und beobachten Abläufe bei ihren Kunden, zum Beispiel in der Produktion. Sie analysieren die Daten, zeichnen die Prozesse auf Papier nach und arbeiten so heraus, wo Schwachstellen liegen. Verbesserungsvorschläge entwickeln sie in Teams mit den Kundenmitarbeitern. So werden die Vorschläge nicht abstrakt, sondern passgenau für ein Unternehmen. Gemeinsam werden neue Ideen entwickelt, wie man zum Beispiel einen Ablauf schneller machen kann oder weniger Ressourcen benötigt.“
„Und was wollen Sie mit diesem Wissen nun in Deutschland machen?“, fasste der Graf erneut nach.
Foremann wartet einen Moment, bevor er antwortete. „Ich will mein eigenes Beratungsunternehmen hochziehen, Foremann & Partner. Und meine Dienstleistungen deutschen Unternehmen wie den I.G. Farben oder Daimler-Benz anbieten. Oder auch gerne der AEG und bei den Kunden Wege finden, die Produktion deutlich zu erhöhen.“
„Mehr nicht? Du spinnst ja“, funkte der Vater dazwischen.
„Doch, noch mehr, auch wenn es dir nicht passt“, konterte Foremann. „Ich will im Reich Karriere machen und in Partei und Ministerium als Spezialist für solche Themen angesehen sein.“
Verächtlich winkte der Vater ab. „Die werden gerade dich mit deinen schlauen Ideen benötigen.“
„Vater!“, fuhr die Schwester ihm über den Mund und setzte ein Lächeln auf. Der alte Foremann kniff die Lippen zusammen und rollte mit den Augen. Von Herbrich furchte die Brauen und lehnte sich vor.
„Machen Sie in den nächsten Tagen einen Termin in meinem Sekretariat. Ich möchte mehr über Ihre Methoden erfahren.“
Aus der Seitentasche seines Jacketts zog er eine Visitenkarte. Foremann rutschte auf seinem Sessel hin und her. Sein Vater verschränkte währenddessen die Arme vor der Brust.
„Vielen Dank, Herr Graf von Herbrich. Ich melde mich kurzfristig.“
Der Herren von AEG erhoben sich. Foremann erwartete den Hitlergruß, aber sie reichten ihm nur die Hand. Dann nahmen sie den Vater beiseite. Foremann konnte nicht hören, was sie zu ihm sagten. Er warf seiner Schwester einen kurzen Blick zu. Sie sah Genugtuung und Stolz in seinen Augen.
Kapitel 7 – Recherchen – Juli 1934
Foremann ließ den Blick durch die übergroßzügige Lobby des Adlon wandern. Er entdeckte, was er suchte: einen einzelnen Sessel in einer ruhigen Ecke. Lässig winkte er den Kellner herbei und bestellte ein kühles Berliner Pils. Mit geübtem Griff öffnete er das Schloss seiner abgewetzten Ledertasche. Auf zahlreichen Geschäftsreisen in den USA war sie ihm ein wichtiger Begleiter gewesen. Hätte die graue Tasche Augen, hätte sie wichtige Schriftstücke gesehen: seine Masterarbeit, Projektpläne, Sitzungsprotokolle. Und nun einen nagelneuen Schreibblock mit dem Aufdruck seines Firmenlogos: Foremann & Partner. Seine Brust schwoll an. Er richtete den Block exakt zur Tischkante aus, legte den Füller neben den Block. Dann ließ er seine Finger knacken, als er sich fertig machte für die „Denkarbeit“ – wie er diese Momente nannte. Mit der linken Hand drehte er die Füllerkappe ab und notierte Stichpunkte. Wohnung, Anmeldung, Konto, Kontakte, Verbindungen, Industrie-Clubs, Nachtclub. Er fiel nach hinten in den Sessel und grinste, als er den letzten Begriff nochmal las und strich ihn wieder durch. Auf diese Seite kommen nur die geschäftlichen Aktivitäten, dachte Foremann. Er ergänzte seine Liste und markierte die Stichworte sortiert nach Geschäftsführer und Concierge. Plötzlich stand ein Bote neben ihm. „Herr Foremann, ein Telegramm für Sie.“
Überrascht öffnete er den Umschlag und las. ‚Wir wünschen dir einen guten Start in Berlin. Deine Gavries‘. Er war gerührt, dass seine alten Kollegen an ihn dachten. Dann fuhr er fort mit seinen Planungen. Den Concierge würde er bitten, ihm bei praktischen Dingen zu helfen: Verwaltung, Konto, Wohnungen und ähnliches. Und eben auch, wo es Night-Clubs gäbe. Den Geschäftsführer, den ihm seine Schwester vorgestellt hatte, würde er um Tipps bitten. Etwa wie er geschäftliche Kontakte in der Stadt knüpfen könne. Teil 1 seines Plans stand. Ungeduldig winkte er den Kellner heran und bat ihn, Geschäftsführer Böser zu rufen.
"Sie scheinen sich ja keine ruhige Minute zu gönnen, Herr Foremann.", begrüßte ihn der feiste Geschäftsführer ein paar Minuten später. "Wie kann ich Ihnen helfen?".
Foremann erhob sich, stellte sich breitbeinig vor Böser, da er ihn sonst um mehr als eine Kopflänge überragt hätte.
"Zeit ist Geld! Und Sie können mir ganz einfach helfen", begann Foremann und erklärte dem Geschäftsführer, was er vorhatte. Der hörte ihm mit großen Ohren zu, zog die Augenbrauen nach oben.
„Gehen Sie bei allen Aufgaben so systematisch vor, lieber Herr Foremann?“
„Ja. Und meine eigene Firma ist mein Lebenstraum.“
Böser legte das Kinn in seine Hand und neigte den Kopf: "Solche jungen Männer wie Sie braucht das neue Deutschland. Energisch, mit Visionen und mit Tatkraft. Ich sehe, was ich tun kann. Wir machen einen Schlachtplan, um Ihr Netzwerk in Berlin aufzubauen. Und wir beginnen mit unserem Herrn Doktor von Siemens, Urenkel des Gründers. Er kommt regelmäßig zu unserem organisierten Zigarrenabend. Und nicht nur er. Auch andere Industrielle schätzen den Austausch bei einer gemütlichen Zigarre und entsprechendem Whiskey oder Rum. Ich werde bei nächster Gelegenheit bei ihm vorstellig. Er kennt jeden mit Rang und Namen in der Stadt: Unternehmer, Verbandspräsidenten, Lobbyisten und vor allem Abgeordnete. Schließlich ist Siemens einer der größten Arbeitgeber in Berlin. Der Zigarrenabend ist übrigens mittwochs, alle vier Wochen, in der Zigarrenlounge. Vielleicht können Sie es einrichten. Ich bringe Sie gern mit den Teilnehmern zusammen. Und eine Frau ist auch dabei", grinste Böser.
"Hervorragend! Also nicht nur, dass eine Frau dabei ist“, stieg Foremann darauf ein, „sondern dass Sie mir helfen".
Böser schmunzelte.
„Und ich stelle Ihnen eine Liste mit relevanten Gesprächspartnern zusammen.“
„Ich habe den Eindruck, Sie kennen sehr einflussreiche Menschen in dieser Stadt“, bedankte sich Foremann mit einem Diener.
„Man tut, was man kann“, verabschiedete sich der Geschäftsführer.
Foremann zog die Hosenbeine hoch und ließ sich wieder in den Sessel nieder. Der teure Aufenthalt im Adlon würde sich bald gelohnt haben.
Kapitel 8 - Geschichte – Juli 1934
Der Vater ließ sich auf einer Parkbank vor dem Brandenburger Tor nieder. Frieda setzte sich zu ihm. Foremann blieb stehen.
„Du hast Eindruck hinterlassen, mein Junge. Gratuliere.“
Bei diesen Worten stellten sich die Härchen auf Foremanns Haut. Er kannte seinen Vater als Erfolgsmenschen, der sich über Leistung definierte. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass dem Alten jemals ein Wort des Lobes über die Lippen gekommen war.
„Danke“, antwortete er trocken und wartete ab.
„Du weißt, mein Sohn, dass ich dich gerne als meinen Nachfolger aufgebaut hätte. Als ich das Unternehmen von meinem Vater übernommen hatte, hatte der Metallbetrieb nur acht Arbeiter. Heute haben wir mehr als einhundertfünfzig Mitarbeiter. Und das Geschäft brummt. Die Nazis bestellen Panzer um Panzer und unsere Präzisionsfräsmaschinen erlauben es den Waffenschmieden, Glattrohrkanonen mit höchster Treffgenauigkeit herzustellen. Damit verdienen wir unser Geld.“
„Warum produzierst du überhaupt Waffen, Vater? Als ich nach Amerika ging, hast du Landwirtschaftsmaschinen hergestellt. Du hasst doch alles Militärische.“





























