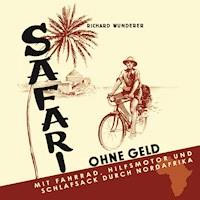16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Herzenswunsch hält Gregor Lindau ganz in Beschlag: Er möchte möglichst bald einen Erben zeugen. Nachdem seine Frau allzu früh gestorben und er selbst an einem rätselhaften Leiden erkrankt ist, fürchtet er, dass sein Gutshof schon bald in fremde Hände geraten könnte. Der einsame Mann verfällt auf eine merkwürdige Idee: Er möchte eine Scheinehe auf Zeit führen, aus der der ersehnte Erbe hervorgehen soll. Regina Hofer ist bereit, sich auf den Handel einzulassen. Ihr Vorleben ist möglicherweise zwielichtig, aber bald scheint sie sich zum guten Geist auf dem Buchenhof zu entwickeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © unpict – Fotolia.com
Bearbeitung, Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen, Villingen-Schwenningen
eISBN 978-3-475-54616-7 (epub)
Worum geht es im Buch?
Richard Wunderer
Hoffnung für den Buchenhof
Ein Herzenswunsch hält Gregor Lindau ganz in Beschlag: Er möchte möglichst bald einen Erben zeugen. Nachdem seine Frau allzu früh gestorben und er selbst an einem rätselhaften Leiden erkrankt ist, fürchtet er, dass sein Gutshof schon bald in fremde Hände geraten könnte. Der einsame Mann verfällt auf eine merkwürdige Idee: Er möchte eine Scheinehe auf Zeit führen, aus der der ersehnte Erbe hervorgehen soll. Regina Hofer ist bereit, sich auf den Handel einzulassen. Ihr Vorleben ist möglicherweise zwielichtig, aber bald scheint sie sich zum guten Geist auf dem Buchenhof zu entwickeln.
1
Wie goldene Flammen leuchteten die Lärchen aus dem dunklen Grün der dichten Nadelwälder. An den meisten Laubbäumen hatten sich die Blätter zwar schon gelb oder blutrot gefärbt, aber sie hielten den Böen des Herbstwindes, der schon kräftig an ihnen zerrte, noch stand. Sogar der Feuerball der Sonne glänzte matt am leicht verschleierten Himmel, und es war so warm, dass man meinen konnte, der Sommer wolle sich noch nicht vertreiben lassen.
Als eines Morgens das Tal jedoch unter einer dicken Nebeldecke zu ersticken schien, kamen die Menschen nur missmutig aus den Häusern zur Arbeit. Sie schauten nicht mehr zu den Vorbergen hinauf und konnten sich erst recht nicht vorstellen, dass die Felswände am Hohen Kösselstein noch weiter im Sonnenlicht glühten. In den nasskalten Dorfstraßen von Bernegg schlichen sogar die Kinder ohne das sonst übliche fröhliche Geschrei in die Schule. Der Hauptplatz lag verlassen, nur ein schwarz gekleideter Herr huschte eilig vom Pfarrhaus zur Kirche hinüber, der Hochwürden Leo Walden. Erst mit zehn Minuten Verspätung sperrte Kurt Spiegel seinen Laden auf. Dabei schimpfte er mürrisch vor sich hin, dass bei diesem Wetter sich ohnehin so bald kein Kunde in sein Geschäft verirren würde.
»Ganz sicher bleiben die Bauern bei dem Sauwetter hinter dem Ofen hocken!«, jammerte auch der Wirt Sepp Steiner ins Ofenloch, denn bei solchen Temperaturen musste er schon in aller Früh den Kachelofen einheizen. Wenn an diesem Tag zu ihm überhaupt einer in die Gaststube kommen würde, wollte bestimmt kein kaltes Bier, sondern viel eher einen heißen Glühwein trinken, um sich damit aufzuwärmen. »Zeit genug hätten die Bauern grad jetzt, denn die Ernte ist eingebracht, das Vieh von den Almen geholt und der Hof winterfest gemacht. Recht so, denn wer jetzt noch nicht vorgesorgt hat, verliert viel und hat nachher kein Geld mehr für einen armen Wirt!«
Ausgerechnet an diesem ersten unfreundlichen Tag Anfang November kam Gregor Lindau im geländegängigen Jeep aus dem sonnigen Süden nach Bernegg zurück. Bei der Ortstafel bremste er sein Auto beinahe auf Schritttempo ab, denn zumindest ein streunender Hund konnte immer noch über die Dorfstraße laufen. Aber der dichte Nebel machte ihm das Heimkommen sogar leichter, denn an diesem Tag musste er nicht den Friedhof sehen, auf dem seine geliebte Frau Gertrud lag. Er konnte den Anblick ihres Grabes selbst nach zwei Jahren nicht ertragen.
»Wie ausgestorben«, murmelte Lindau und fuhr durch Bernegg, ohne auch nur einmal anzuhalten. Zum Haus des Doktor Fritz Loidl warf er einen kurzen Blick, worauf seine Gedanken noch um einiges düsterer wurden. Dieser Arzt hatte vor zwei Jahren bis zu ihrer letzten Stunde um das Leben der Gertrud Lindau gekämpft. Jetzt war er sein einziger Freund, sein Partner beim Schachspiel an den langen, nach Gertruds Tod einsam gewordenen Abenden.
Der Buchenhof, beinahe schon ein herrschaftliches Gut, lag etwas außerhalb des Dorfes. Deshalb war das Leben dort der Gertrud immer zu einsam gewesen. Gregor hingegen fühlte sich seit ›damals‹ eher in menschlicher Gesellschaft einsam. Er litt darunter, dass er in seinem Leben keinen Sinn mehr erkannte. Zwar fühlte er sich körperlich nicht krank, wohl aber seelisch, und er tat nichts dazu, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Nur eine letzte Aufgabe verlieh ihm noch die Kraft zu ernsthafterem Streben: Er wollte seinen Buchenhof vor der Geldgier aller Spekulanten retten.
Darum atmete er nun doch erleichtert auf, als er im Nebel den vertrauten Schattenriss des Wohnhauses und der Wirtschaftsgebäude erkannte. Dort hatte man schon die Lichter seines Autos näherkommen gesehen, und so stellten sich sieben Dienstleute zu seinem Empfang auf. Sobald der Wagen durchs Hoftor rollte, bewies Michel, mit kaum fünfundzwanzig Jahren der jüngste Knecht, sein gutes Benehmen. Er sprang zum Auto und riss die Tür auf. Die Burga Högel verlebte mit ihren sechzig die meiste Zeit auf dem Lindau-Hof, war noch voll bei Kräften und fühlte sich beinahe schon als Herrin über die anderen Dienstleute. Sie drängte den übereifrigen Michel zur Seite. »Schön, dass du wieder daheim bist, Bauer!«, sagte sie.
Er stieg aus und reichte ihr die Hand. »Ich komme auch gern wieder zu euch zurück.« Seine Stimme klang freundlich, aber nicht wirklich freudig. »Auf dem Hof ist doch alles in Ordnung?«
»Wie’s halt so geht, wenn der Herr nur selten im Haus ist«, deutete sie mit leicht vorwurfsvollem Ton an, dass er vielleicht doch einiges zu bemängeln haben werde. »Die meiste Herbstarbeit ist getan, alsdann legt sich mancher lieber auf die faule Haut, als dass er sich vor der Winterruhe noch einen Buckel anarbeitet!«
Schon drängte sich die Karin Speidel an ihr vorbei. Die war halb so alt wie die Burga und mit dreißig ein unübersehbar gut gestelltes Frauenzimmer. »Mit dir, Bauer, kommt bestimmt wieder Leben auf den Hof!«, freute sie sich, wobei sie bestimmt weniger an den Arbeitstag als an den Feierabend dachte. Doch auch damit irrte sie. Gregor Lindau ergriff zwar ihre Hand, die sie ihm voreilig entgegenstreckte, aber er schenkte ihr sonst kaum noch Beachtung.
Suse Kobler war das jüngste Dirndl und nahm sich deshalb das Recht heraus, den Herrn unmissverständlich schmachtend anzulächeln. Er übersah dennoch, dass sie sich für seinen Empfang besonders hübsch und sogar ein bissel frech gekleidet hatte.
Den Karl, der auf dem Buchenhof den Großknecht machte, fragte Gregor Lindau: »Ist vom Vieh keines krank?«
Bevor der antworten konnte, spielte sich schon Paul, der Jüngere von ihnen, auf: »Bauer, auf uns kannst du dich eben alleweil noch verlassen. Ich hab auch beim Almabtrieb mitgemacht und dafür gesorgt, dass in der Schlucht keines von den Viechern auch nur gestolpert ist. Du weißt es ohnehin: Die fremden Treiber schlagen manchmal recht derb zu. Wird die Herde aber erst einmal unruhig, so geschieht fast immer ein Unglück!«
Da mischte sich Michel wieder ein und bremste Pauls Eigenlob: »Niemand hat das Vieh unvernünftig angetrieben, in der Schlucht ist der Boden schon fest und trocken gefroren gewesen, also ist die Herde von allein ruhig gegangen. Ich hab auch mitgeholfen, versteht sich.«
Ganz zuletzt trippelte noch eine alte Frau zu ihm. Über achtzig war sie, klein, hager und von den Jahren gebückt. Aber in ihren Augen leuchtete noch immer der Wille zum Leben. Und jetzt auch die ganz große Freude über die Heimkehr Gregors. »Hauptsache, du bist gesund«, sagte sie mit erstaunlich fester Stimme. »In der nächsten Zeit bleibst du aber daheim, Bub!« So durfte sie ihn anreden, denn sie hatte ihn als Kindsdirn aufgezogen, gehätschelt und geliebt, wie wenn er ihr eigenes Kind gewesen wäre.
»Johanna, du wirst allerweil noch jünger!«, scherzte er und drückte vor aller Augen auf ihre welke Wange sogar ein Bussel. Sie kicherte glücklich und stolz, denn auch mit über achtzig war sie noch ein bissel eitel. Gute Worte von ihrem Gregor waren lebenslang ihr größtes Glück gewesen. Dafür meinte er es wirklich so, als er sagte: »Und hoffentlich bleibst du noch die nächsten fünfzig Jahre so frisch bei mir!«
Somit reichte dem Lindau die Begrüßung, weshalb er nun genau das sagte, worauf seine Leute schon die ganze Zeit über gewartet hatten: »Jedem einen Wochenlohn extra. Am nächsten Sonntag seid ihr beim ›Roten Stier‹ eingeladen. Michel, du bringst mein Gepäck aus dem Auto ins Haus.«
»Mach ich, Bauer!«, dienerte der. »Soll ich auch deinen Wagen gleich in die Garage fahren?«
»Untersteh dich!«
In seinem Stolz gekränkt, eröffnete ihm daraufhin der Michel: »Wenn ich doch vor zwei Wochen den Führerschein gemacht hab! Mir fehlt nur noch ein bissel was auf die Praxis!«
Lindau blieb unbeeindruckt und dämpfte seinen Helfer ab: »Praxis kannst du dir später mit deinem Auto aneignen. Falls du einmal eines hast!«
»Ja, Bauer, aber ich hätte dir doch nur helfen wollen.«
Als Gregor Lindau ins Haus trat, blieb das beglückende Gefühl der Rückkehr nach zwei Monaten zum Großteil aus. Zwar hatte Burga dafür gesorgt, dass die Suse den großen Kachelofen in der Stube anheizte, und sie selbst trug schon für ihren Bauern eine deftige Brotzeit auf, aber dem wurde nun erst recht bewusst, dass er nur in leere Mauern heimkam. Was ihm so schmerzhaft fehlte, war die Gegenwart seiner Gertrud und die Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft.
Beim Essen leistete ihm die Burga Gesellschaft. Von allen Dienstleuten störte ihn ihre Gegenwart noch am wenigsten.
Aus dem Dorftratsch wusste sie einiges zu berichten, aber wer mit wem eine Liebschaft hatte, interessierte ihn wenig. Da plätscherten ihre Worte nur an seinem Ohr vorbei. Wirklich aufmerksam hörte er ihr erst zu, als sie sich entrüstete: »Der Stadelberg Ignaz, der Baumeister, hat drei Wiesengründe an Stadtleute verkauft, und der Breitner-Bürgermeister genehmigt bestimmt die Umwidmung in Bauland. So werden halt heutzutage die Geschäfte gemacht: Eine Hand wäscht die andere, und darum hat zuletzt keiner von ihnen eine schmutzige! Bauer, red lieber gleich morgen mit dem Breitner, er soll unser schönes Land nicht für Häuselbauer von Zweitwohnungen zersiedeln lassen! Das hätt’s früher, zu meiner Zeit, nicht gegeben!«
»Unser Bürgermeister hält sich alleweil noch ans Gesetz«, redete er seiner alten Dirn dagegen. »Die Zeit ist auch auf dem offenen Land nicht stehen geblieben, und deshalb ist die Welt leider nicht mehr so wie zu deiner Jugendzeit.«
»Vielleicht gar schöner?« Die Burga baute sich aufsässig vor ihm auf, aber diesmal nützte ihr das nichts, denn auch ihr Bauer plante, im kommenden Frühjahr seine Stallungen größer auszubauen. Für die Genehmigung dazu brauchte er das Wohlwollen der Baubehörde, deren erste Instanz der Bürgermeister Alois Breitner war. Viel mehr regte er sich auf, als die Burga ihm erzählte, dass auf dem schwarzen Brett der Gemeinde schon wieder zwei Höfe zum Verkauf ausgeschrieben seien.
Drei Tage später saßen Gregor Lindau und Doktor Fritz Loidl beim Schachspiel, zu dem sie sich regelmäßig trafen. Zwar starrten sie vor jedem Zug eine ganze Weile auf die Figuren, aber nach einer Stunde geschah doch, was keiner von ihnen erwartet hätte: Diesmal gewann der Arzt! Der konnte seinen Erfolg kaum fassen und freute sich. »Lieber Freund, was ist los mit dir?«, fragte er fröhlich. »Hat dir Afrikas Sonne deinen Verstand aus dem Kopf gebrannt? Oder bist du jetzt unter die Wohltäter der Menschen gegangen und lässt mich aus Freundschaft auf dem Schachbrett gewinnen? Letzteres erscheint mir bei deinem Ehrgeiz als weniger wahrscheinlich.«
Dann jedoch beobachtete er mit Sorge, dass Gregor wohl aus quälenden Gedanken aufschreckte. »Entschuldige«, bat der. »Ich kann mich heute noch gar nicht so richtig aufs Spiel konzentrieren.«
Loidl überlegte laut und immer noch halb scherzhaft: »Das kann doch nicht mehr an der Umstellung von Afrikas Sonnenglut auf unseren nassen Nebel liegen. Dafür hattest du auf deiner Heimreise schon genug Zeit gehabt.«
Gregor Lindau schüttelte verneinend den Kopf. Er sagte dem Freund, was er sich selbst kaum gestehen wollte: »Während der Fahrt durch Wüsten bin ich tagelang keinem Menschen begegnet und mir doch nie einsam vorgekommen. Ich habe mich stark genug gefühlt, alle Schwierigkeiten zu bewältigen. Seit ich daheim bin, leide ich darunter, inmitten all dieser Menschen meiner Umgebung allein zu sein! Ich bin so müde, dass ich am liebsten allen Problemen ausweichen wollte. Sogar denen auf dem Schachbrett. Fritz, sag du mir nun als mein Arzt: Bin ich krank?«
Loidl überlegte eine Weile, bis er sagte: »Körperlich bist du wahrscheinlich gesund, denn die Erschöpfung merkt man erst, wenn die Anstrengungen vorbei sind.« Ein paar Augenblicke lang schwieg er, dann entschloss er sich, das unangenehme Thema anzusprechen: »Bei deiner Heimkehr bist du doch am Bernegger Friedhof vorbeigefahren, oder?«
»Im Nebel hab ich ihn nicht einmal von weitem gesehen!«, wehrte sich Gregor gegen den Gedanken, den der Arzt andeuten wollte.
Der blieb bei seiner Meinung: »Zumindest hast du an ein Grab gedacht, und jetzt fällt es dir besonders schwer, dich wieder an ein Daheim zu gewöhnen, in dem es die geliebte Frau nicht mehr gibt.«
»Daran ist etwas Wahres«, gestand der Lindau-Bauer, damit ihn sein Freund nicht noch weiter ausfragte. Auf keinen Fall sollte er zu bald erfahren, welch andere, nicht weniger quälende Sorgen noch in seiner Seele fraßen. Er wollte und konnte nicht einsehen, dass ausgerechnet ihn das harte Schicksal treffen würde, vor dem er sich fürchtete. Die Ungewissheit ließ ihm noch Hoffnung, und so ertrug er sie eher als eine endgültig alles zerstörende Wahrheit. »Noch eine Partie?«, versuchte er, seine düsteren Gedanken vor dem Arzt zu verheimlichen.
Schon ordnete er die Figuren wieder auf dem Schachbrett, da klingelte Loidls Handy. Hilde, seine Frau, rief ihn wegen eines Notfalls in die Praxis, aber er bat sie: »Schatz, sei so lieb und sag dem Holzer Toni, er müsse an seinem Schnupfen ganz bestimmt nicht sterben. Für heute ist die Sprechstunde bereits geschlossen, er soll morgen wiederkommen, dann ist immer noch Zeit, ihn zu retten!«
Als Arztfrau gab die Hilde Loidl noch nicht auf, sondern hielt ihm vor: »Wie soll ich den lästigen Quälgeist denn loswerden? Er bildet sich ein, bis morgen könnte es für ihn schon zu spät sein! Jedenfalls hält er sich für einen Notfall!«
»Tut mir für den armen Toni schrecklich Leid, aber auch hier handelt es sich um einen Notfall! – Sogar um einen echten!«
Unwillig warf ihm seine Frau vor: »Ich kann’s mir schon denken: Du verlierst mal wieder beim Schach!«
Doktor Fritz Loidl dämpfte seine Stimme zu einem Murmeln ab, das der Lindau nicht so deutlich verstehen konnte. »Erstens habe ich gewonnen«, verteidigte er sich, »und außerdem ist es meine Pflicht als Arzt und Freund, einem Verzweifelten zu helfen! Ende!« Bevor seine Frau noch weitere Fragen stellen konnte, legte er schon den Hörer auf.
2
Auch in den nächsten Tagen drang kein Sonnenstrahl durch den dichten Hochnebel. Gregor Lindau fiel es noch umso schwerer, sich als Bauer auf seinem Buchenhof wieder in den Arbeitsablauf des Tages einzureihen. Während der letzten Monate hatte die Burga bewiesen, dass sie mit ihren sechzig Jahren als Großdirn die Helfer beinahe ebenso umsichtig wie eine Bäuerin führen und alle auftauchenden Schwierigkeiten meistern konnte. Nur manche ungeliebte Arbeit war liegen geblieben, und das bemerkte auch Gregor Lindau, als er seine Pflichten wieder aufnahm. Er befahl sich, auf dem Hof Ordnung zu schaffen, aber es gelang ihm nur mit Mühe, alle seine Gedanken auf die Arbeit zu richten.
Manchmal wurde es ihm bewusst, dass mitten beim Reden seine Stimme leiser geworden war, bis sie verstummte. Wenn er dann aufschreckte, las er vom Gesicht des Großknechts Karl Höll etwas wie Mitleid ab, weshalb er ihm daraufhin mit besonders knappen, beinahe herrisch barschen Worten aufzählte, welche Arbeiten mit mehr Eifer in Angriff genommen und erledigt werden sollten. »Wir dürfen auch im Winter nicht nachgeben, denn im Frühling werde ich sogar noch junges Zuchtvieh dazukaufen.«
Auch wenn er es nicht so deutlich erkannte: Mit solchen Worten zwang er sich selbst, noch an einen nächsten Frühling zu glauben.
»Du kannst dich allerweil noch auf mich verlassen«, versprach der Karl und war heilfroh, als er vom Wohnhaus zum Stall hinübergehen durfte. Dort gab er an Karin, die gerade ausmistete, die letzten Neuigkeiten weiter: »Wenn alles gut läuft, werden wir noch Vieh einstellen.«
Drohte Mehrarbeit, so verlor die Speidel-Karin sogar ihre fröhliche Art und greinte: »Genau das taugt mir! Unsereins muss sich bucklert arbeiten, damit der Lindau künftig sogar das ganze Jahr über in der Welt herumkutschieren kann! Nur dafür blast er hier die Wirtschaft auf, aber eines Tages wird ohnehin alles zerplatzen! Ist der Lindau erst einmal für immer fort, so zerfetzen fremde Leut ohnehin alles in lauter kleine Stückl, und wir Dienstleut können betteln gehen!«
Bis dahin konnte ihr der Karl in beinahe allem beipflichten. Er seufzte nur mit etwas mehr Mitgefühl: »Es ist halt ein Unglück, dass unser Bauer keinen Erben in der Wiege, aber in der weit entfernten Verwandtschaft zu viele Erben für den Hof hat.«
Wieder einmal brachte die Dirn das recht herzlos auf den Punkt, denn sie sagte eiskalt heraus: »Wäre halt unser Herr Lindau nicht so viel in der Welt herumgefahren, sondern lieber daheim geblieben und hätte sich einen Buben gemacht!«
Von solchen Reden seiner Dienstleute ahnte der Bauer nichts, denn niemand wollte in seiner Gegenwart den Hof krank jammern.
Aber ausgerechnet die Burga, die sich aus Treue für ihn auch hätte vierteilen lassen, löste die nächste Katastrophe aus.
Die Kammer neben dem Schlafzimmer des Bauern blieb unbenützt und für gewöhnlich versperrt, denn zu Lebzeiten der Gertrud Lindau war sie als Kinderzimmer vorgesehen. Auch nach dem unerwarteten Tod der jungen Bäuerin vor zwei Jahren durfte darin nichts verändert werden. Gregor hatte den Raum seit damals noch nicht wieder betreten. Von Zeit zu Zeit putzte und lüftete die Burga das Kinderzimmer durch, wobei sie darauf achtete, dass der Bauer sie dabei nicht überraschte.
Nach eisig kalten Tagen brach Ende November Föhn vom Hohen Kösselstein ins Tal. Der erste Schnee schmolz wieder, und der Burga blieb keine Wahl, sie musste es ihrem Bauern sagen. Ihm zuliebe vermied sie das Wort »Kinderzimmer« tunlichst, indem sie sagte: »In der Kammer neben deinem Schlafzimmer hat sich an der Wand ein feuchter Fleck gebildet, der immer größer wird. Soll der Michel aufs Dach steigen und nach einer undichten Stelle suchen?«
Schlecht gelaunt schnarrte sie der Gregor an: »Was sonst? Soll vielleicht das ganze Haus verschimmeln? Noch ist es nicht so weit!«
Sie wusste, dass ihm die Erwähnung des leeren Kinderzimmers wehtat, und verübelte ihm deshalb keineswegs den unfreundlichen Ton. Zu ihrer Erleichterung wollte er die feuchte Stelle in der Wand nicht selbst untersuchen, sondern vertraute auf ihren Bericht. In Burgas Augen ist die Szene glimpflicher verlaufen, als sie sie sich vorher ausgemalt hatte. Sie ahnte ja nicht, was danach folgen würde.
Am nächsten Tag sollte die Suse beim Reinigen und Renovieren der Kammer helfen, denn sie war größer als die Burga und konnte deshalb leichter die feuchte Stelle in der Wand mit dem Haarföhn austrocknen. Als sie in die Küche zurückkam, fragte sie der Bauer: »Fertig mit der Arbeit?«
Die Burga hörte mit Entsetzen, wie die Suse unüberlegt drauflosschnatterte: »Hätte es nicht beim Föhn von den Bergen heruntergetaut, nachher wäre kein so großer Schaden entstanden. So aber hat sich die Feuchtigkeit auch in die Möbel gezogen. Von der Wiege ist Malerei abgeblättert und im Kinderbett ... Aber so etwas geschieht halt, wenn im Haus keine Bäuerin ...«
»Jesus, Maria!«, schrie die Burga auf und konnte den taumelnden Mann gerade noch in ihren Armen auffangen. »Hilf mir! Führen wir ihn ... Nein, nicht in sein Zimmer, weil die Tür in die Kammer noch immer offen steht!«
Sie mussten ihn stützen, beinahe tragen, damit er in die Stube gehen und sich dort auf die Eckbank legen konnte.
Die Suse war ehrlich verzweifelt und verteidigte sich beinahe weinerlich: »Was hab ich schon Schlechtes gesagt? Woher hätt ich denn wissen sollen, dass ich von der Kinderkammer und der Bäuerin nicht reden darf? – Mein Gott, so etwas kann doch nach zwei Jahren keinen richtigen Mann mehr umschmeißen!«
Ohne darauf zu antworten, fauchte die Burga sie nur an: »Verschwind aus seinen Augen!« Zur Sicherheit ließ sie die Tür vom Flur in die Stube offen, damit sie auf den regungslos liegenden Bauer hinsehen konnte. Ins Telefon flüsterte sie beschwörend: »Herr Doktor, komm gleich auf den Buchenhof! Es ist keiner von seinen üblichen Schwächeanfällen, sondern ich fürchte, es ist viel ernster. Wieso? Das weiß ich auch nicht, aber er schaut drein, wie wenn er im nächsten Augenblick sterben wollte. Oder wenigstens den Verstand verlieren könnte! Da krieg ich ehrlich Angst!«
Nach zwei Wochen holte der Doktor Loidl seinen Freund aus dem Krankenhaus in der Kreisstadt wieder heim. Beim Abschied dankte dieser noch sehr herzlich den Ärzten und Krankenschwestern.
»Ich habe mich hier beinahe wohl gefühlt, aber jetzt bin ich wieder ganz gesund und freue mich schon aufs Heimkommen«, sagte er und bemühte sich, seine Fröhlichkeit möglichst glaubhaft zu spielen. Gleich im Auto verlangte er: »Fritz, sag endlich du, was mir in Wahrheit fehlt! Die weißen Götter haben sich ausgeschwiegen, und aus den Schwestern habe ich auch nicht viel herausbekommen. Also los und ohne falsche Rücksichtnahme! Ich bin so weit wieder beisammen, dass ich auch eine schlechte Nachricht ertragen kann!«
»Du hast dich jedenfalls großartig erholt«, schwindelte der Dorfarzt. Dann sagte er wahrheitsgemäß: »Was deinen Zusammenbruch verursacht hat, wissen ohnehin wir beide, doch gerade darüber wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. Du darfst nicht ständig in der Vergangenheit leben und sollst auch nicht in der Gegenwart stehen bleiben, sondern musst wieder an die Zukunft denken!« Dabei konnte selbst er seine Aufregung nicht verbergen.
Gregor Lindau ging darauf nicht ein, sondern gab vor, nur ganz allgemein zu reden. »Auf den Bergen liegt schon Schnee, bald wird auch im Tal der Winter herrschen. Das Jahr neigt sich seinem Ende zu, wie unser Leben auch. Worauf können wir jetzt noch warten? Auf den Winter, der sein Leichentuch über die Erde mit all ihren Menschen legt!«
Für unbelehrbare Patienten brachte der Loidl üblicherweise wenig Geduld auf, aber Gregor war nicht nur sehr krank, sondern außerdem sein Freund. Ihm zuliebe schluckte er die unfreundlichen Antworten hinunter und erwiderte freundlich: »Mein Lieber, für einen echten Landwirt weißt du herzlich wenig über die Natur. Darum möchte auch ich etwas zum Winter sagen: Der Schnee ist nämlich geradezu das Gegenteil von einem Leichentuch. Darunter stirbt die Natur nicht, sondern sie ruht sich aus, damit sie Kräfte sammeln kann für das neue Leben im Frühling. Wie wir Menschen auch. Oder sind wir vielleicht kein Stück Natur?«
Über das Wiedererwachen der Liebe im Frühling sagte er lieber nichts. Das gebot ihm sein Taktgefühl, denn er wusste, dass er gerade mit diesen Worten seinem Freund wehtun könnte. Schließlich war Gregor Lindau mit fünfundvierzig Jahren zwar kein alter, doch wahrscheinlich ein sehr kranker Mann, der seiner großen verlorenen Liebe nachtrauerte und auf eine neue nicht mehr hoffen wollte.
Als der Bauer auf seinem Hof aus dem Auto stieg, umringten ihn Mägde und Knechte. Sie alle begrüßten ihn mit ehrlicher Freude.
Die Burga hatte Tränen in ihren Augen. Durchs Küchenfenster winkte ihm die alte Johanna. Sie hatte ihn seit der Wiege sein ganzes Leben lang umsorgt und kannte ihn so gut, wie eine Mutter ihren Sohn kennt. Aber ihrem ›Buben‹ lief sie besser doch nicht entgegen. Sie fühlte sich zu sehr aufgeregt und wollte auch ihre Rührung niemandem zeigen.
»Du kommst doch mit mir ins Haus?«, lud er den Doktor ein. »Keine Angst, ich fühle mich wohl. Lass den Arzt bitte draußen, ich brauche den Freund. Nach dem stumpfsinnigen Dahindösen im Krankenhaus sehne ich mich nach geistiger Herausforderung. Wenigstens eine Partie Schach darfst du mir nicht abschlagen!«
Fritz Loidl war nicht nur in Bernegg, sondern auch im weiteren Umkreis der einzige Arzt. Deshalb brachte er am frühen Nachmittag vorerst kein Verständnis für das Verlangen Gregors nach einer Partie Schach auf. In der Praxis warteten vielleicht Patienten mit Schmerzen auf ihn. Aber ein Blick in die Augen seines Freundes warnte ihn, und so machte er zur Bedingung: »Aber nur, wenn ich noch schnell deine Temperatur messen darf.«
»Hört denn für dich das Doktorspielen überhaupt nicht auf?«, versuchte Gregor einen letzten Protest, dann fügte er sich einer Schachpartie zuliebe. »Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, aber du bist nicht weniger lästig als die jungen Stationsärzte, die sich so gern wichtig machen. Meinetwegen.«
»Nur etwas erhöhte Temperatur«, stellte Fritz Loidl scheinbar beruhigt fest, auch wenn das Thermometer einiges über achtunddreißig anzeigte. »Eine Partie, dann legst du dich nieder und ruhst von den Anstrengungen dieses Tages aus. Strengste Verordnung von deinem Hausarzt!«
Wie immer sprachen sie beim Schachspiel kein überflüssiges Wort, sondern konzentrierten sich ganz auf das Spiel. Ein paar Mal hörten sie an der Tür zur Stube herein Schritte schleichen. ›Wie in einem Sterbehaus‹, kam es Gregor in den Sinn. Trotz der düsteren Gedanken fühlte er sich in dieser Stunde unerwartet gut.
Fritz Loidl dagegen merkte, dass seinem Partner bei diesem Spiel zahlreiche Fehler unterliefen, aber weder machte er ihn darauf aufmerksam, noch nützte er sie aus. Nur verbotene Züge ließ er ihn verbessern. Um das Spiel zeitlich abzukürzen, beging er dann selbst Fehler, und Gregor freute sich arglos über jeden Erfolg.
Nach einer halben Stunde konnte Loidl sein ärztliches Gewissen nicht länger beruhigen. Er beobachtete, wie Gregors Hände fortschreitend unsicher wurden und zuletzt so sehr zitterten, dass er eine Schachfigur kaum mehr führen konnte, ohne eine andere zu verrücken oder gar umzuwerfen. Auf Lindaus Stirn traten Schweißtropfen.
Loidl legte seinen König um, womit er andeutete, das Spiel aufzugeben. Dabei sagte er: »Du hast gewonnen, Gregor!«
»Weil du mich hast gewinnen lassen«, widersprach der mit seltsam schwerer Zunge. »Ich lasse mich aber von niemandem mehr täuschen, auch von dir nicht!«
»Du bist eben noch nicht ganz gesund!«, wiederholte der Arzt. »Ich bring dich jetzt noch ins Bett, dann fahre ich in meine Praxis. Schließlich fängt die Sprechstunde gleich an. Kein Widerspruch! Störrische Patienten bereiten mir Ärger und machen mir unnütz viel Mühe, also mag ich sie nicht. Du aber bist mein bester Freund, dich werde ich morgen wieder besuchen, und wenn’s dir besser geht, steht wieder eine Partie Schach auf dem Plan! Versprochen!«
Auch wenn die Burga keine Verwandte war, vertraute ihr Doktor Loidl seine Sorgen offen an: »Dein Bauer ist noch immer ein seelisch und körperlich kranker Mann. Beruhige ihn, falls ich morgen erst später zu ihm kommen sollte. Ich muss auf jeden Fall in die Stadt fahren und mich mit dem Professor besprechen, der ihn behandelt hat. Für seine Krankheit gibt es bestimmt noch andere Ursachen als Trauer um die tote Ehefrau, die Angst vor Einsamkeit und die trostlosen Erwartungen für die Zukunft. Darüber wissen wir noch manches nicht, aber ich möchte alles erfahren. Erst dann wird es mir möglich sein, ihm wirklich zu helfen.«
Burga spürte, dass sie totenbleich wurde. Es fiel ihr schwer, die nächste Frage auszusprechen, aber sie hatte ihre Gründe, warum sie es unbedingt wissen musste: »Sag’s mir ehrlich, Herr Doktor: Wird er sterben?«
Darauf gab der Loidl nur dann gern eine Antwort, wenn er den Menschen mit ehrlichem Gewissen Mut machen durfte. Zur Burga sagte er: »Wir alle werden eines Tages sterben.«
Die Magd bewegte recht mühselig die Lippen, denn sie brachte es nicht leicht heraus: »Wie lang gibst du ihm noch?«
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com