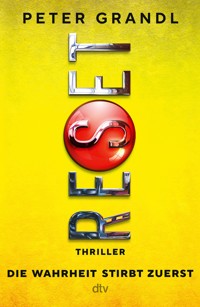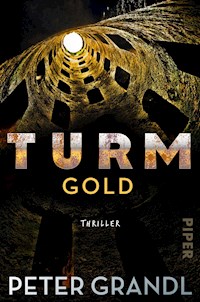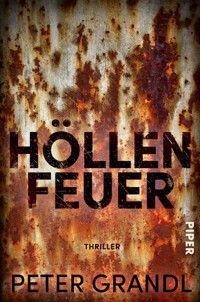
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach den Aufsehen erregenden Thrillern »Turmschatten« und »Turmgold« folgt jetzt ein neuer aufwühlender Thriller aus der Feder des preisgekrönten Autors Peter Grandl! Islamisten verüben in der Münchner U-Bahn einen grauenvollen Anschlag, der weltweit für Entsetzen sorgt. Mehr als 300 Menschen sterben. Die Medien sprechen von einem zweiten Nine-Eleven. Besonders brisant: In der U-Bahn sollte sich der Bayerische Staatsminister des Inneren, Martin Himmel, befinden, der sich jedoch verspätet. Galt der Anschlag ihm? Schnell hat Kommissar Torge Prager einen Verdächtigen: Laid Abaaoud, einen Syrer. Doch Torge kann den Verdacht nur bestätigen, wenn er das Gesetz bricht. Eine Frau glaubt an Laids Unschuld: Oberregierungsrätin Antonia Himmel, die Tochter des Ministers. Dass Torge und Antonia ein Paar waren, erschwert die Ermittlungen. Während sie nach der Wahrheit suchen, merken sie nicht, dass die Attentäter dem Innenminister erneut gefährlich nahe kommen. Exzellent recherchiert und erschreckend real! Begeisterte Stimmen zu »Turmschatten« und »Turmgold«: »Peter Grandl legt gezielt den Finger in die Wunde der deutschen Gesellschaft. Mit großartigem Erzähltalent verbindet er fiktive Elemente mit einer Wirklichkeit, die davon leider nicht allzu weit entfernt bleibt; das alles aber auf jeder Seite spannend und niemals belehrend. ›Turmschatten‹ ist ein Zeugnis unserer Zeit, das am Leser – im besten Sinne – nicht spurlos vorübergeht.« Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern »Hammer-Buch. Kommt bei Erstlingen nicht allzu oft vor. Peter Grandl ist so ein Coup gelungen. ›Turmschatten‹ ist unfasslich spannend, ein Pageturner, bei dem sogar die Flashbacks (jede Figur hat ihren sinnvollen Hintergrund) interessant sind. Überall ist die aktuelle Zeitgeschichte eingewoben, eine chronique scandaleuse des rechtsradikalen Terrors in der Bundesrepublik.« Thomas Wörtche, Culturmag »Extrem fesselnder und sehr gut recherchierter Polit-Thriller. ›Turmschatten‹ hat mich auf Grund seines hohen Realismus bis zur letzten Seite nicht mehr losgelassen.« Heiner Lauterbach »Peter Grandl beherrscht es grandios, Realität und Fiktion zu verbinden.« literaturschock.de Peter Grandl erhält den Stuttgarter Krimipreis 2023 Aus der Begründung der Jury: »›Turmgold‹ ist ein aufregender, wachrüttelnder, beklemmender Thriller. Realitätsnah, weil er gut recherchiert die Kulmination von Ereignissen durchspielt, die fast alle schon einmal geschehen sind oder geschehen wären, wenn die Sicherheitsbehörden nicht vorher eingegriffen hätten. Jeder, der sich ein wenig mit der rechtsextremen Szene in Deutschland auseinandergesetzt hat, weiß, dass Grandl hier keine Märchen erzählt, sondern allenfalls dramaturgisch zuspitzt. Die Voraussetzungen für alles, was in ›Turmgold‹ passiert, liefert die Realität. Wir sind gefragt, dass es nicht so weit kommt. Dass die Serienverfilmung bereits geplant ist, verwundert nicht. So großes Blockbusterkino gibt es in der deutschsprachigen Spannungsliteratur selten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels » Höllenfeuer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Getty Images (Colors Hunter - Chasseur de Couleurs; R.Tsubin); FinePic®, München
Redaktion: Lars Zwickies
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
I
GENESIS
Kain und Abel
Operation Kayla Mueller
26. Oktober 2019
Syrien
II
EXODUS
Die zehn Plagen
Tag 1
Montag, 12. September 20226:30 Uhr – 10 Uhr
München
7:30 Uhr
Tag 1
Montag, 12. September 202210:00 Uhr – 12:00 Uhr
Karlsruhe
München
Karlsruhe
Bonn
Tag 1
Montag, 12. September 202212:00 Uhr – 22:00 Uhr
München
Tag 2
Dienstag, 13. September 20222:30 Uhr – 3:30 Uhr
III
Levitikus
Tag der Versöhnung
Tag 8
Montag, 19. September 20229:00 Uhr – 14:00 Uhr
Tag 8
Montag, 19. September 202214:00 Uhr – 19:00 Uhr
Tag 8
Montag, 19. September 202219:00 Uhr – 24:00 Uhr
IV
Numeri
Rache an den Medianitern
Tag 14
Montag, 26. September 20227:00 Uhr – 14:00 Uhr
Tag 14
Montag, 26. September 202214:30 Uhr – 20:00 Uhr
Tag 14
Montag, 26. September 202221:00 Uhr – 24:00 Uhr
V
Deuteronomium
Der letzte Tag im Leben Mose
Tag 21
Montag, 3. Oktober 20229:00 Uhr – 15:00 Uhr
Samstag, 9. Oktober 2021, 12:00 Uhr
Montag, 3. Oktober 2022
Personenregister der wichtigsten Figuren
Familie Himmel
Polizei
Flüchtlingsrat
Krankenhauspersonal & BKK
Terroristen
Flüchtlinge
Glossar zu realen Organisationen im Roman
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Diejenigen, die nicht an unsere Zeichen glauben,
die werden wir im Feuer brennen lassen:
So oft ihre Haut verbrannt ist,
geben wir ihnen eine andere Haut,
damit sie die Strafe kosten.
Die Unseligen werden dann im Höllenfeuer sein,
wo sie laut aufheulen und hinausschreien
und wo sie weilen, solange Himmel und Erde währen.
Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise.
Koran Sure 4 & 11/Islam
Wo auf Anordnung Gottes die Seelen
der Dahinscheidenden Todsünder sogleich
nach ihrem Tod zur Hölle hinabsteigen,
wo sie mit den Qualen der Hölle gepeinigt werden.
Benedictus Deus/römisch-katholische Kirche
I
GENESIS
Kain und Abel
Operation Kayla Mueller
26. Oktober 2019
Syrien
Die rote Erde, durchsetzt von dornigem Gestrüpp, verlor mit zunehmender Dämmerung ihre kräftige Farbe. Es war ungewöhnlich warm an diesem Abend, selbst für syrische Verhältnisse. Unweit des Dorfes Bārīšā, inmitten eines Olivenhains, standen drei Flachbauten, jeweils etwa hundert Meter voneinander entfernt. Zwei von ihnen verband eine Schotterstraße, das dritte Gebäude, das von einer hohen Mauer umgeben war, erreichte man nur über einen unbefestigten Feldweg.
Über der weiten Steppe lag eine unnatürliche Stille. Weder das Zirpen von Grillen noch das für die Region typische Blöken von Ziegenherden war zu vernehmen. Nur der Wind rauschte leise in den Blättern der Olivenbäume und brachte Staub mit sich, der die Fenster der Flachbauten mit einem matten Schleier belegte.
Blārīšā lag in einer Gegend, welche die Einheimischen die »Toten Städte« nannten. Gemeint waren damit über siebenhundert einst florierende Siedlungen aus der spätrömischen Zeit. Tausende von Sklaven hatten damals hier im Olivenanbau gearbeitet und das römische Imperium mit Öl versorgt. Heute zeugten nur noch unzählige Ruinen von dieser Epoche.
Kaum einer der Anwohner Bārīšās hatte davon Kenntnis, dass in ihrer Nähe, in einem von hohen Mauern geschützten Haus, der einst mächtigste Mann des selbst ernannten »Islamischen Staats«, Abu Bakr Al-Baghdadi, lebte. Allein der Name der dschihadistisch-salafistischen Terrororganisation verbreitete Furcht und Schrecken in der Region; der IS hatte selbst die Großmächte in Bedrängnis gebracht.
Al-Baghdadi öffnete die Fenster im ersten Stock des Hauses, blickte hinaus auf die Steppe. Der Wind spielte mit dem weißen Leinengewand, das der rundliche Mann trug. Al-Baghdadi hatte einen ovalen Kopf mit nur wenigen Haaren, dafür aber einen vollen Bart. Die schmale Brille mit transparentem Kunststoffgestell saß streng auf seinem Nasenansatz und passte so gar nicht zu seiner sonst kräftigen Erscheinung.
Eine Böe wirbelte Staub auf und vernebelte den Blick auf den Horizont. Einen Moment lang erinnerte Al-Baghdadi sich daran, wie aus solchen Staubwolken die glorreiche Armee erschienen war, die er einst befehligt hatte. Panzer, Flugzeuge und Soldaten, so weit das Auge reichte.
Der feine Staub verflog, was blieb, waren wehmütige Erinnerungen an jene Zeit, als die Welt noch vor ihm gezittert hatte.
Am Höhepunkt seiner Macht, 2014, kontrollierten seine radikalen Gotteskrieger ein Territorium, das dreimal größer war als Israel. Innerhalb weniger Jahre hatten seine Armeen große Teile Syriens und des Iraks erobert und ihre Bewohner grauenvoll unterworfen. Im Juni jenen Jahres rief er in Mossul sein Kalifat aus und nannte sich fortan »Kalif Ibrahim«. Strafen wie öffentliche Enthauptungen, Kreuzigungen, Ertränkungen und Verbrennungen bei lebendigem Leib erwarteten von da an Staatsfeinde, Angehörige anderer Religionsgruppen sowie politische Gegner. Oder einfach all jene, die die strengen Gesetze des Kalifats nicht befolgten.
Die Brutalität, mit welcher der selbst ernannte Kalif Ibrahim sein neu geschaffenes Reich regierte, veranlasste im September mehr als hundertzwanzig islamische Gelehrte aus allen Teilen der Welt, einen offenen Brief in Form eines islamischen Rechtsgutachtens zu veröffentlichen. Darin sprachen sie ihm seine Kalifenwürde und die Legitimation, Recht zu sprechen, ab. Die Handlungsweisen des sogenannten Islamischen Staates seien nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Islam.
Hätte er damals gekonnt, dann hätte er jeden Einzelnen von ihnen öffentlich vierteilen lassen. Wie konnten sie es wagen, sich gegen ihn zu stellen? Gegen ihn, der berufen war, die Söhne Mohammeds zu vereinen, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Welt von den Ungläubigen zu befreien. Und tatsächlich schlossen sich daraufhin nur noch mehr Freiwillige als Kämpfer dem IS an. Allein aus Westeuropa waren es fünftausend.
Auch politische und wirtschaftliche Sanktionen verfehlten ihre Wirkung. Denn wenn es etwas gab, wovon der IS noch mehr besaß als Waffen und Anhänger, dann war es Geld. Unendlich viel Geld.
Mit einem geschätzten Gesamtvermögen von zwei Milliarden US-Dollar war es die reichste Terrororganisation der Welt. Allein durch die Förderung und den Verkauf von Öl flossen täglich drei Millionen Dollar in die Kassen der Terroristen. Dazu kamen Einkünfte durch Kunstraub, Lösegeld und Sklaverei sowie Steuereinnahmen aus allen gewerblichen Geschäften in ihrem immer größer werdenden Einflussbereich.
Bereits im August hatte sich der amerikanische Präsident Barack Obama an die Öffentlichkeit gewandt und den ersten amerikanischen Luftschlag gegen IS-Streitkräfte gerechtfertigt. In den kommenden zwölf Monaten folgten fünftausend weitere Luftangriffe. Es dauerte jedoch vier weitere Jahre, bis der Islamische Staat durch eine Allianz aus mehr als vierzig verbündeten Staaten in die Knie gezwungen werden konnte. Die Gefahr, die von den verbliebenen radikalen Anhängern und ihren Anführern ausging, die allesamt untertauchten oder mit den Flüchtlingsströmen unerkannt ins Ausland gelangten, war damit aber nicht gebannt.
Eine Küchenschabe betastete mit ihren langen Fühlern den nackten Fuß von Al-Baghdadi. Er blickte hinab, betrachtete das Insekt geduldig, hob den Fuß leicht an, und schon schlüpfte die Kakerlake in einen vermeintlich sicheren Spalt im Fußboden. Seine Feinde würden sich genauso in Sicherheit wiegen, bevor er sie zerquetschte.
Sanft erhöhte er den Druck auf das Insekt, das nun verzweifelt nach einem Ausweg suchte. Die feinen Nervenzellen an Al-Baghdadis Fußsohle übertrugen das Zappeln des Ungeziefers.
Es knackte laut, dann hörten die Bewegungen auf, und unter seiner Sohle bildete sich eine klebrige Masse. Al-Baghdadi ging zurück in sein Arbeitszimmer, um letzte Anweisungen zu notieren. Er erwartete heute noch einen wichtigen Besucher.
Es war kurz vor fünf Uhr, als sich im Abendlicht aus der Ferne ein Fahrzeug dem Gebäude näherte. Lange bevor ein Wachtposten auf dem Flachdach des Hauses den Wagen sehen konnte, verriet eine dichte Staubwolke den nahenden Besuch.
Wie aus dem Nichts stellten sich dem Pick-up drei IS-Kämpfer in camouflagefarbenen Schutzwesten in den Weg. Sie zielten mit ihren Maschinenpistolen auf den Fahrer, der ein schwarzes Kopftuch und eine Sonnenbrille trug.
Tufan Baran Shirazi verringerte die Geschwindigkeit und blieb dann vor den drei Männern stehen. Einen vierten Kämpfer konnte er in der Nähe unter einem Tarnzelt im Schatten eines Baumes ausmachen. Seinem geschulten Auge entgingen auch nicht die Umrisse der Kornet-Panzerabwehrlenkwaffe, die dieser Mann auf ihn gerichtet hatte. Das beruhigte ihn. Bei der Schlacht um Al-Bab vor drei Jahren hatte seine Einheit mit solchen Raketenwaffen aus russischer Fertigung zehn Leopard-Panzer der türkischen Streitkräfte vernichtet.
Langsam öffnete er das Fenster und legte seine Hand auf den Fensterrahmen. An seinem kleinen Finger funkelte ein goldener Ring mit einem grünen Smaragd im Sonnenlicht. Dann setzte er seine Sonnenbrille ab. Ehrfürchtig wichen die drei Männer zurück und verbeugten sich. Tufan erwiderte den Gruß, dann fuhr er weiter, ohne ein Wort mit ihnen zu wechseln.
Es tat gut, zu sehen, dass der Kalif für seine Sicherheit gesorgt hatte. Aber er hoffte, dass der Schutz des gesamten Gebäudes umfangreicher war als der schwach besetzte Vorposten mit einer Panzerabwehrwaffe. Seit dem verlorenen Krieg war der Kalif der meistgesuchte Mann der westlichen Allianz. Fünfundzwanzig Millionen US-Dollar hatten die amerikanischen Streitkräfte als Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, fünfundzwanzig Millionen Dollar, die die Zungen seiner engsten Vertrauten lösen sollten.
Tufan parkte den Pick-up wenige Meter vor der Mauer, die Al-Baghdadis Unterschlupf schützte, dann stieg er aus und musterte die Umgebung. Er trug einen schwarzen Kaftan, der bis zum Boden reichte – einen Gallabija, wie er traditionell im Sudan getragen wird. Auf dem Dach hinter der Mauer erfasste sein prüfender Blick einen MG-Schützen hinter aufgetürmten Sandsäcken. Der Mann stand auf und winkte. Tufan nickte ihm nur zu und schritt mit großen Schritten auf ein Metalltor zu, das von zwei weiteren Kämpfern bewacht wurde. Sie verneigten sich und öffneten ihm die Pforte. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, ging er durch den Torbogen und gelangte in einen saftig grünen Garten, dessen Anblick ihn innehalten ließ.
Es war, als hätte er die Welt des Kriegs mit einem einzigen Schritt hinter sich gelassen und stünde nun in einer Oase des Friedens. Zwei spielende Kinder kreuzten seinen Weg, ohne ihm Beachtung zu schenken. Augenblicklich verschwand seine grimmige Miene, und er sah ihnen lächelnd nach. Während er an seine unbeschwerte Kindheit in den Bergen dachte, band er sich das dunkle Tuch, das lose auf seinen Schultern hing, nach oben auf den Kopf. Zwei verschleierte Frauen knieten in der Nähe in einem Gemüsebeet und sahen ihn an. Mit einer angedeuteten Verbeugung sagte er leise: »As-salamu alaykum.«
Die beiden standen sogleich auf, verbeugten sich ebenfalls und erwiderten demütig den Gruß: »Waalaykum as-salam.«
Ohne ein weiteres Wort widmeten sie sich danach wieder eilig ihrer Arbeit. Hatten sie Angst vor ihm? Mit seiner Körpergröße von fast zwei Metern überragte er die meisten seiner irakischen Landsleute und konnte allein durch seine physische Präsenz bedrohlich wirken.
Im Krieg hatten ihn seine Truppen ehrfürchtig »aleazim Tufan« genannt, was so viel bedeutete wie »der große Sturm«. Womit nicht nur seine Erscheinung gemeint war, sondern auch die Gerissenheit und der Mut, mit denen er seine Männer von Sieg zu Sieg geführt hatte. Sein Ruf eilte ihm schließlich voraus.
Man sagte: »Wohin der große Sturm auch ziehen würde, allein sein Name versetzte seine Feinde bereits in Angst und Schrecken.«
Tufan war in einem Bergdorf im Nordosten des Irak, in den Ausläufern des Taurus-Gebirges, aufgewachsen. Im Winter bestimmten Schnee und Eis das beschwerliche Leben der Dorfgemeinschaft. Im Frühling jedoch wurden die Hügel grün, dufteten nach Blumen und Kräutern, und mit jedem erneuten Erwachen der Natur überwanden die Bewohner seines Dorfes die Entbehrungen der kalten Monate und dankten Allah für seine Gaben.
Seine Familie lebte von der Viehzucht, und schon als kleiner Junge oblag ihm die Aufsicht über eine Ziegenherde, die er von Weide zu Weide treiben musste, teils über steile Berghänge und felsige Schluchten. Er dachte gerne an diese unbeschwerte Zeit zurück, vor allem aber an die Berge. Er war fasziniert gewesen von ihrer majestätischen Pracht. Es schien ihm fast so, als würden die Felsen zu ihm sprechen und die Gipfel ihn herausfordern. Und so lernte er, sich fast so geschickt in den steil aufragenden Felswänden zu bewegen wie die Bergziegen, die er hütete. Dabei machte er eines Tages die Bekanntschaft eines Eremiten, der sich in einer verborgenen Felsenhöhle eine bescheidene Behausung eingerichtet hatte. Nur selten zog der Eremit in die umliegenden Dörfer, um zu predigen, wofür sich die Bewohner mit Nahrungsmitteln und Kleidung erkenntlich zeigten. Keiner wusste, woher der Eremit kam und wo er lebte, nur Tufan kannte sein Geheimnis. Er besuchte den einsamen Priester regelmäßig, um dessen Weisheiten zu lauschen. Dabei achtete er jedes Mal sorgsam darauf, den Priester mit ein paar Äpfeln oder einem Kanten Brot zu entlohnen, und so wurden sie Freunde.
Es war ein karges, aber friedliches Leben, das Tufan führte, ein Leben abseits der Weltpolitik, die seine Heimat zu zerreißen drohte.
Tufan war gerade sechzehn Jahre alt geworden, als er zum ersten Mal davon hörte, dass amerikanische Soldaten seine Heimat angriffen. Doch die Invasion der Amerikaner schien weit entfernt, und der Krieg würde sicher nicht nach den Bergen des Taurus-Gebirges greifen. Tufan irrte sich. Nur waren es nicht die Amerikaner, die Tod und Verderben in seine Region brachten, sondern kurdische Freiheitskämpfer der Peschmerga, die sich der »Koalition der Willigen« angeschlossen hatten, wie der amerikanische Präsident George W. Bush seine Allianz gegen die »Achse des Bösen« nannte.
Tufan verstand nicht, warum er und seine Familie plötzlich Feinde von irgendjemandem waren, aber darauf nahm das Schicksal keine Rücksicht.
Seine Kindheit endete in einem Sturzbach aus Blut und Gewalt an einem verregneten Nachmittag, eine Woche nach dem islamischen Opferfest. Er hatte die Ziegen diesmal nicht auf die hoch liegenden Bergwiesen getrieben, sondern war dem Flusslauf gefolgt, der in Jahrtausenden eine tiefe Schlucht in die Felsen getrieben hatte. Am Ende der Schlucht, dort, wo sich der schäumende Fluss in einen stillen Bach verwandelte, hatte er seine Ziegen auf einem Feld mit bunten Blumen, die im Regen ihre schweren Köpfe hängen ließen, weiden lassen. Er selbst suchte unter einem überhängenden Fels Schutz und beobachtete die düsteren Wolken am Himmel.
Das gleichmäßige Rauschen des Bachs verschluckte die Kampfgeräusche und Schreie der Bewohner seines Dorfes, die nur eine Viertelstunde entfernt unbarmherzig massakriert wurden. Erst als Tufan dichte Rauchschwaden am Ende der Schlucht aufsteigen sah, ahnte er, dass etwas Schreckliches geschehen war.
Mit brennender Lunge und aufgeschlagenen Knien erreichte er die rauchenden Hütten, die einst sein Zuhause gewesen waren. Doch am schmerzvollsten brannte sich ihm für alle Zeiten der auf dem Dorfplatz angehäufte Berg von Leichen ein, die man mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Es waren ausschließlich Männer und Jungen, deren Gesichter man in den Flammen kaum wiedererkennen konnte. Auch sein Vater und seine zwei Brüder waren darunter, während von den Frauen jede Spur fehlte.
Zuerst hatte er verzweifelt versucht, das Feuer zu löschen, doch irgendwann verließen ihn seine Kräfte, und er kniete weinend vor dem Scheiterhaufen seiner Kindheit, bis seine Tränen und der Wille, am Leben zu bleiben, versiegten.
Nach zwei Tagen und zwei Nächten fand der Eremit den regungslosen Jungen, den er bereits tot wähnte, wäre da nicht eine der Ziegen gewesen, die mit scharrenden Hufen nicht von seiner Seite wich. Er brachte den Jungen in seine Berghöhle, gab ihm zu trinken und zu essen und betete täglich für ihn, bis sich sein Zustand langsam besserte.
Er führte dem Jungen schließlich vor Augen, dass es Allahs Wille gewesen war, dass er das Massaker überlebte. Und ebenso sei es Allahs Wille, dass er von nun an ein Gotteskrieger war im ewigen Kampf gegen die Ungläubigen. So lange, bis Allah ihn in sein Paradies Dschanna einladen würde. Bäche, in denen kühles Wasser und Milch fließt, und zweiundsiebzig Jungfrauen wären dann der Dank für all seine Opfer.
Jetzt empfing Abu Bakr Al-Baghdadi ihn im Madschlis, einem orientalisch geschmückten Raum mit türkisfarbenem Teppich, Sitzkissen und Bodensofa. Al-Baghdadi saß mit angezogenen Beinen vor einem niedrigen Tisch und bereitete Tee in einem Caydanlik zu, einer Konstruktion aus zwei aufeinandergestellten Kannen.
Er legte einige angefeuchtete Teeblätter in die obere Kanne, die von dem kochenden Wasser in der unteren erhitzt wurden. Der große Mann sah nur kurz auf, um seinen Gast zu begrüßen, dabei erhaschte er einen Blick auf dessen verstümmeltes linkes Ohr. Eine Verletzung aus dem Krieg, auf die sein Besucher sehr stolz war und die er wie eine Trophäe trug.
»Tufan, mein Sohn, setz dich zu mir! Mögest du Hoffnung und Glück in mein bescheidenes Heim bringen.«
Tufan entledigte sich seiner Kopfbedeckung und nahm auf einem Kissen gegenüber dem Sofa Platz.
Zu Beginn vermieden die beiden Männer politische Themen. Ihr Gespräch kreiste um die Familie Al-Baghdadis, Tufans beschwerliche Reise und das Wetter. Währenddessen schloss Al-Baghdadi die Zubereitung des grünen Tees damit ab, dass er das heiße Wasser aus der unteren Kanne auf die gedünsteten Blätter in der oberen Kanne goss. Wenige Minuten später reichte er Tufan ein Glas des Getränks, der sich bedankte und daran nippte.
Während Al-Baghdadi sich auch ein Glas einschenkte und ihn eingehend betrachtete, saß Tufan entspannt und hoch aufgerichtet auf dem Kissen. Auf seiner Stirn war deutlich ein Gebetsfleck zu erkennen. Ein Zeichen als Folge der Niederwerfung vor Gott durch das wiederkehrende Berühren des Bodens bei den fünf täglichen Gebeten.
Al-Baghdadi trank sein Glas zur Hälfte leer, stellte es ab und lehnte sich gegen das Rückenpolster des Sofas. Er sah müde und erschöpft aus. Im Namen Allahs hatte er alles gewonnen und alles wieder verloren. Der prachtvolle Gottesstaat, den er erschaffen wollte, war nur noch eine neblige Vision, die sich nach und nach verflüchtigte wie ein Traum, den man allmählich vergaß.
»Allah prüft uns.«
Tufan nickte und schwieg.
»Seine Wege sind weit und verschlungen, und auch wenn wir nicht wissen, wohin er uns führen wird, so müssen wir uns dennoch würdig erweisen und uns seiner Fügung hingeben.«
Al-Baghdadi beugte sich nach vorn und sah seinem Krieger tief in die Augen.
»Tufan Baran Shirazi, der Krieg ist nicht vorbei. Doch nun kämpfen wir nicht mehr nur um unsere Heimat, mein Freund, sondern werden die Flamme Allahs in die Dörfer und Städte unserer Feinde tragen. Wir werden ihre Häuser niederbrennen, ihre Frauen schänden und ihre Kinder töten. Also frage ich dich, Tufan Baran Shirazi, ob du dafür bereit bist. Ob du Allahs Willen erfüllen wirst, fern von deinen Brüdern und Schwestern, in einem Land, das dir fremd sein wird.«
Tufan verbeugte sich und blickte dann kurz nach oben.
»Ich werde mich würdig erweisen, Kalif. Ich werde Allahs Willen erfüllen. Ich werde keine Gnade zeigen. Mein Geist ist rein, mein Arm ist kräftig, und meine Klinge wird ein Meer aus Blut erschaffen. Ja, ich bin bereit!«
Die Sonne war bereits untergegangen, als Tufan in seinen Pick-up stieg und eine lange Reise antrat. Er wusste, er war nicht der einzige Gotteskrieger, den Al-Baghdadi auf künftige Missionen eingeschworen hatte. Er hatte folgsame Anhänger wie Tufan in alle Welt entsandt, damit sie am Ziel ihrer Reisen Keimzellen bildeten, die Tod und Verderben unter ihren Feinden säen sollten.
Die Hubschrauber kamen kurz nach der Waschung zum fünften Gebet, eine Stunde nach Beginn der Ischā’-Zeit. Al-Baghdadi rezitierte in sich gekehrt die Iqama, den zweiten Gebetsruf, und verbeugte sich auf einem Gebetsteppich stehend Richtung Mekka, das tausendfünfhundert Kilometer südwestlich in Saudi-Arabien lag. Knapp zwei Milliarden Angehörige des Islam taten es ihm weltweit gleich, darunter auch seine Frauen, seine Kinder, seine Gotteskrieger sowie seine Leibgarde, die die acht amerikanischen Kampfhubschrauber erst entdeckte, als es bereits zu spät war.
Einer von Al-Baghdadis engsten Vertrauten hatte ihn verraten. Die Macht des Geldes und die Aussicht darauf, mit einer neuen Identität in Amerika leben zu können, waren stärker als seine religiöse Überzeugung gewesen. Doch bevor der amerikanische Geheimdienst dem Verräter Glauben geschenkt hatte, forderte man einen DNA-Nachweis. In einem frankierten Umschlag schickte ihnen ihr Kontakt einen Umschlag mit einer getragenen Unterhose der Zielperson, deren Analyse keinen Zweifel mehr ließ: Al-Baghdadi war ihnen nach all den Jahren endlich ins Netz gegangen.
Während sich die Spezialeinheit der amerikanischen Streitkräfte Al-Baghdadis Unterschlupf näherte, saß Präsident Donald Trump im Situation Room des Weißen Hauses, umgeben von seinen engsten militärischen Beratern, und fieberte dem Zugriff auf einem Widescreenmonitor entgegen. Einen Tag zuvor hatten die Männer noch beim Lunch zusammengesessen und dem Präsidenten die Hand geschüttelt.
Jetzt waren sie Hunderte Kilometer weit vom Weißen Haus entfernt, aber die Wärmelichtkameras der Hubschrauber lieferten so gestochen scharfe Monochromaufnahmen, dass sie den Eindruck erweckten, der Einsatz würde in unmittelbarer Nähe von Washington stattfinden.
Fünf Monate lang hatte sich die Eliteeinheit Delta Force auf diese riskante Mission vorbereitet. Nun wollten die Befehlshaber ihrem obersten Dienstherrn und seinem Stab ein außergewöhnliches Livespektakel bieten, wenn sie Al-Baghdadi zur Strecke brachten.
Trump würde später in einer Presseerklärung sagen: »Wir haben es so deutlich gesehen … Es war perfekt. Als ob man einen Spielfilm sehen würde.«
Al-Baghdadis Leibwachen auf dem Dach seines Hauses waren die ersten Opfer der US-Operation »Kayla Mueller«. Der Himmel bebte, als sich die Hubschrauber näherten, doch in der Dunkelheit war die unbeleuchtete Luft-Armada kaum zu erkennen. Die Leuchtspurmunition, die Al-Baghdadis Männer blindlings auf die schwarzen Objekte am Himmel schossen, zog gleißende Striche in die Nacht, ohne auch nur einem der Kampfhubschrauber gefährlich zu werden.
Für die Angreifer waren die Männer hinter ihren Sandsäcken hingegen ein leichtes Ziel.
»Für Kayla«, flüsterte der Richtschütze.
»Für Kayla!«, erwiderte der Pilot, dann verwandelte eine Lenkrakete das gesamte Dach in eine Feuersbrunst. Schreiend und brennend stürzten die MG-Schützen vom Dach. Sie waren tot, bevor sie am Boden aufkamen.
Kayla Mueller war eine amerikanische Menschenrechtsaktivistin gewesen, die 2013 im syrischen Aleppo gemeinsam mit ihrem Verlobten von IS-Kriegern entführt worden war. Daraufhin brachte man die junge Frau zu Al-Baghdadi, der sie eineinhalb Jahre lang als persönliche Gefangene hielt, folterte und mehrfach vergewaltigte. Zwei Jahre später gelangte der US-Geheimdienst in den Besitz von Fotos, auf denen zweifelsfrei ihre Leiche zu erkennen war. Ihr zu Ehren hatte das amerikanische Militär der nächtlichen Operation gegen Al-Baghdadi ihren Namen gegeben.
Die Bordwaffen der Black Hawks rissen tiefe Furchen in die sorgsam gepflegten Beete des Gartens und töteten dabei zwei weitere Leibwächter des selbst ernannten Kalifen. Dann seilte sich ein Stoßtrupp aus den Hubschraubern ab. Suchscheinwerfer leuchteten den Männern den Weg und blendeten die Fenster des Gebäudes, ohne auf Gegenwehr zu stoßen.
Gleichzeitig setzten die Amerikaner in einem Radius von fünfzig Metern rund um den Zielpunkt Bodentruppen der Delta Force und einen Spürhund ab.
Die verbliebenen zwei Hubschrauber vom Typ Apache sicherten die Umgebung. Da über die Truppenstärke Al-Baghdadis in der Region keine gesicherten Informationen vorlagen, war die gesamte Operation höchst riskant. Die Task Force war siebzig Flugminuten in feindliches Territorium eingedrungen. An Verstärkung war nicht zu denken. Aus diesem Grund errichteten die Bodentruppen rund um den Zielpunkt einen Verteidigungsring, denn der Rückzug durfte erst erfolgen, wenn Al-Baghdadi tot oder in Gewahrsam genommen worden war.
Al-Baghdadi schrie nach seinen Kindern. Eine seiner vier Frauen brachte ihm den kleinen Jungen und das Mädchen. Beide weinten und klammerten sich verzweifelt an die Beine ihrer Mutter, die sie hastig fortstieß. Al-Baghdadi hingegen erstarrte förmlich. Er war sich nie sicher vorgekommen in seinem Versteck, hatte geahnt, dass er eines Tages verraten werden würde. Darum hatte er begonnen, einen Fluchtplan auszuarbeiten, aber dass seine Feinde ihn so schnell finden würden, damit hatte er nicht gerechnet. Ein Querschläger blieb nur wenige Zentimeter neben seinem Kopf in der Wand stecken und riss ihn aus seiner Lethargie.
Fast mechanisch zog er sich eine Stirnlampe auf und legte zitternd einen Sprenggurt um. Er war fest entschlossen, sich nicht zu ergeben. Die Frauen schrien wild durcheinander. Eine von ihnen verteilte kugelsichere Westen und Maschinenpistolen, während draußen die Erde bebte und Scheinwerfer grelle Lichtschneisen durch die Fenster schnitten. Al-Baghdadis persönlicher Adjutant Shihab Abdulkareem prüfte nervös ein letztes Mal den Sitz des Sprenggurts, dann drückte er seinem obersten Führer den Auslöser in die Hand. Einen Moment lang hielten die beiden Männer inne und sahen einander in die Augen.
»Allah wird mit dir sein …«, sagte Abdulkareem.
»… und unsere Feinde zu Staub zermalmen!«, fügte Al-Baghdadi mit trockener Kehle hinzu.
Shihab beugte sich hinab und steckte zwei Kabel, die an der Weste lose herabhingen, zusammen.
»Sie ist jetzt scharf.«
Al-Baghdadi nickte, dann nahm er das Mädchen hoch, das sich an seinen Hals klammerte. Mit der freien Hand packte er den Jungen und zog ihn mit sich. Shihab Abdulkareem schob einen Teppich am Boden auf die Seite, unter dem sich eine Klappe befand. Draußen war es merkwürdig still geworden. Die Frauen kauerten mit ihren Maschinenpistolen neben den Fenstern und sahen zu, wie Abdulkareem die Klappe zu einem unterirdischen Tunnel öffnete und Al-Baghdadi mit den Kindern in der Öffnung verschwand. Sie weinten und klagten, denn sie ahnten, dass sie die drei nie wiedersehen würden. Abdulkareem schloss die Klappe und legte den Teppich darüber. Gerade als er nach seiner Kalaschnikow griff, brach um ihn herum die Hölle aus. Zwei synchrone Detonationen rissen gewaltige Löcher in die Hausmauern. Betonbrocken, so groß wie Stühle, fetzten durch die Luft. Der Luftdruck ließ seine Trommelfelle platzen und schleuderte ihn an die Wand, wo er bewusstlos liegen blieb. Die vier Frauen waren auf der Stelle tot.
»Alpha 1, wir gehen rein«, meldete einer der amerikanischen Soldaten über Funk seinem Vorgesetzten. An ihren ballistischen Helmen trugen die Männer des Stoßtrupps einen Augenschutz, der die Sicht der Soldaten behinderte, die im dichten Rauch der Explosion ohnehin kaum etwas erkennen konnten. Langsam tasteten sie sich in das Innere des Gebäudes vor, ohne auf irgendeine Gegenwehr zu stoßen. Nach und nach fanden sie fünf leblose Körper, deren Gliedmaßen grotesk angewinkelt waren, als wären sie Marionetten, die man lieblos auf den Boden hatte fallen lassen.
»Alpha 1, Zielpunkt gesichert. Fünf feindliche Personen kampfunfähig, keine eigenen Verluste. Conan kann jetzt mit seiner Suche beginnen.«
»Delta Leader, Conan ist auf dem Weg«, antwortete eine blecherne Stimme auf dem Helmlautsprecher.
Conan war der Name des Militärhundes, den man extra für diese Operation darauf trainiert hatte, Al-Baghdadi zu identifizieren. Er war ein belgischer Malinois, die Zuchtvariante eines Deutschen Schäferhundes, und sollte nun mit seinem Trainer Al-Baghdadi aufspüren.
In der Zwischenzeit hatten die stationierten IS-Kämpfer in den beiden umliegenden Häusern ihre Waffen geschultert und machten sich auf, ihren obersten Führer zu befreien. Jedoch nicht, ohne vorher ein codiertes Notrufsignal abzusetzen, um Verstärkung anzufordern.
Knapp zwanzig IS-Elitekämpfer näherten sich von zwei Seiten dem Verteidigungsring der amerikanischen Bodentruppen. Sie waren erfahrene Kämpfer und schwer bewaffnet. Jeder Trupp führte einen 82-mm-Mörser mit sich. Waren diese Granatwerfer erst einmal in Schussreichweite, würde es für den Verteidigungsring brenzlig werden. Doch so weit kam es nicht. Tief fliegende Kampfdrohnen der US-Streitkräfte bannten die Gefahr binnen weniger Minuten und lieferten dazu dramatische Liveaufnahmen direkt ins Weiße Haus. Schemenhaft zeigte die Monochromübertragung die hellen Umrisse der IS-Kämpfer, die sich auf die amerikanischen Stellungen zubewegten. Dann blitzten ihre Gestalten lautlos in einem gleißenden weißen Licht auf und erloschen. Per Funkübertragung meldete die Stimme eines taktischen Offiziers: »Feindzugriff verhindert, siebzehn Angreifer ausgeschaltet, keine eigenen Verluste.«
Trump und seine Männer jubelten und klatschten.
Conan hatte die leblosen, mit einer dicken Staubschicht bedeckten Körper beschnuppert, schlug aber nicht an. Der Hundeführer informierte den Einsatzleiter. Der gab sich mit der Nachricht nicht zufrieden und erwiderte: »Aber irgendwas muss der Hund doch gefunden haben. Die Hinweise waren stichhaltig und wurden mehrfach verifiziert. Die Zielperson muss in diesem Gebäude sein.«
»Negativ. Gesuchte Zielperson ist definitiv nicht unter den Opfern.«
In diesem Augenblick fing Conan an zu jaulen. Seine Nase war nach unten gerichtet. Dann begann er laut zu bellen und scharrte am Boden mit den Vorderläufen.
»Was ist los? Was hat Conan gefunden?«, fragte der Offizier, der außerhalb des Gebäudes bei den Bodentruppen kniete. Der Hundeführer kniete sich neben den Hund und befreite die Stelle vor ihm von Schutt und Dreck. Er stieß auf den Teppich.
»Vielleicht ein unterirdisches Versteck«, meldete er zurück.
»Ich bete zu Gott, dass Sie recht haben, Sergeant!«
Die Männer des Stoßtrupps mussten gemeinsam einen großen Betonbrocken beiseitewuchten, der auf dem Teppich lag, dann hatten sie den Zugang zu dem unterirdischen Fluchtweg freigelegt.
»Wir haben viel Zeit verloren, die Zielperson könnte uns in letzter Sekunde noch entkommen. Schicken Sie den Hund vor, und bleiben Sie ihm so gut wie möglich auf den Fersen«, lautete der Befehl des Einsatzleiters.
Al-Baghdadi kam in dem niedrigen engen Gang nur langsam voran. In gebückter Haltung zog er den Jungen hinter sich her, der keinen Laut mehr von sich gab. Es roch nach feuchtem Lehm, und die Luft war stickig. Im Licht der Stirnlampe konnte er kaum etwas erkennen. Das Mädchen in seinem Arm flehte ihn an, umzukehren, als Al-Baghdadi das Kläffen eines Hundes hörte, das schnell lauter wurde. Ein letztes Mal nahm er all seine Kräfte zusammen, um seinen Verfolgern zu entkommen, doch vor ihm endete der Tunnel in einer Sackgasse. Er sank zu Boden und drückte beide Kinder fest an sich.
Der Hund musste inzwischen ganz nah sein.
»Ich will zu Mama«, jammerte das Mädchen. Al-Baghdadi nickte ihr zu und streichelte ihre Wange.
»Du wirst gleich bei ihr sein«, sagte er mit tröstender Stimme. Dann drückte er den Auslöser seines Sprengstoffgürtels.
Die ersten Männer des Stoßtrupps, die dem unterirdischen Gang gefolgt waren, wurden durch die Druckwelle von den Füßen gerissen, dann hörten sie weit entfernt das Jaulen des Hundes.
Siebzig Minuten hatte der Einsatz gedauert, und erst als man Al-Baghdadi eindeutig verifiziert hatte, verließen die Einheiten der Delta Force den Einsatzort. Die Reste seiner Leiche hatte man in einen Plastiksack gepackt und mitgenommen. Danach machten zwei US-Kampfjets das Anwesen dem Erdboden gleich. Nichts sollte übrig bleiben, damit Al-Baghdadis letzter Zufluchtsort keine Wallfahrtsstätte für seine Anhänger werden konnte.
Nur eine Stunde nach der erfolgreichen Operation trat Präsident Trump sichtlich gut gelaunt vor die Presse und verkündete das Ende der IS-Terrororganisation.
Ganz besonders hob er dabei die Leistung des Spürhundes Conan hervor, der den Einsatz leicht verletzt überlebt hatte. Einen Monat später empfing Trump unter großem Presseauflauf Conan im Weißen Haus und verlieh ihm eine Hundevariante der bronzenen Medal of Honor in Form einer Pfote mit dem Aufdruck AMERICAN HERO.
Tufan verfolgte die Übertragung davon live auf CNN, während er in Zürich auf seinen Anschlussflug wartete. Eine Durchsage an seinem Gate veranlasste ihn, seinen Laptop zuzuklappen und sich in die Schlange der Passagiere einzureihen.
»Ihr Flug LH857 nach Frankfurt ist nun zum Einsteigen bereit.«
Tufan zeigte der freundlich lächelnden Flugbegleiterin seinen Boarding Pass und lächelte höflich zurück.
II
EXODUS
Die zehn Plagen
Tag 1
Montag, 12. September 20226:30 Uhr – 10 Uhr
München
Martin Himmel stand auf einem Scheiterhaufen. Flammen schlugen bis zu seinem Gesicht empor. Und obwohl der Schmerz unerträglich war, entging ihm nicht, dass alle Menschen, die er je im Leben gekannt hatte, sich hier versammelt hatten, um tatenlos seinem Ableben beizuwohnen. Alles Schreien und Flehen half nichts, die Gäste dieses infernalen Schauspiels standen unbewegt wie Statuen da und sahen zu, wie er qualvoll verbrannte.
Ganz nah am Feuer, in der vordersten Reihe, standen seine erste Frau Christiane, ihre gemeinsame Tochter Antonia und seine zweite Frau Shohreh. In ihren Augen zuckten leuchtend rote Flammen vom Widerschein des Feuers.
Ein Junge von schmächtiger Gestalt und mit verweinten Augen trat aus dem Schatten heraus in den Kreis des Feuerscheins und spuckte verächtlich in die Flammen; Lukas, sein Sohn.
Martin flehte ihn mit letzter Kraft an, ihm zu verzeihen, aber seine Stimmbänder versagten. Und noch während er hoffte, in den Gesichtern der Geschöpfe Gottes Mitleid zu erkennen, wandten sich die Lebenden ab und überließen seinen Leib dem Feuer. Nur Shohreh blieb, mit einem gütigen Lächeln im Gesicht.
Furchtlos stieg sie die brennenden Holzbalken zu ihm hinauf, während seine Haut in der Hitze des Feuers aufplatzte und er das Bewusstsein zu verlieren drohte. Ihre kühle Hand berührte seine verkohlten Wangen.
»Du musst loslassen, Martin. Es ist vorbei, und ich bin bei dir, für immer!«
Dann küsste sie ihn zärtlich auf den Mund oder auf das, was davon noch übrig war.
Schweißgebadet wachte Martin auf.
Es war kurz vor sieben Uhr. Das schwache Licht der Morgendämmerung betonte sanft die Konturen des Raums, hob die Stehleuchte mit dem Tiffanylampenschirm hervor, den Shohreh so liebte, und legte sich behutsam über einen reich verzierten Schminktisch im Rokokodesign.
Shohreh lag neben ihm. Sie schlief noch. Ihr Hinterkopf war ihm zugewandt, und ihr langes schwarzes Haar breitete sich wild über das weiße Kopfkissen aus wie feine schwarze Adern, die genau an der Stelle endeten, wo sich ihre beiden Matratzen berührten. Kein einziges Haar hatte den Spalt überwunden. Er war wie eine Kluft, die sie trennte, nicht nur an diesem Morgen.
Bedacht darauf, seine Frau nicht zu wecken, erhob sich Martin vorsichtig aus dem Bett, griff nach seiner Brille mit dem dunklen Horngestell und ging ins Badezimmer, das direkt an das Schlafzimmer grenzte. Ein Bewegungssensor schaltete gedimmtes Licht im Bad ein. Leise lehnte er die Tür hinter sich an und betrachtete sein Antlitz in dem kunstvoll geschliffenen Art-déco-Spiegel.
Ein Mann von über sechzig Jahren mit schütterem Haar blickte ihm entgegen, mit listigen grau-grünen Augen und feinen Gesichtszügen. Glatt rasiert und gepflegt, ein wenig übergewichtig, aber immer noch sportlich.
Hinter ihm zeichnete sich im Spiegel eine frei stehende Badewanne ab, daneben ein Holzgestell mit einer welken Zimmerpflanze sowie eine Vitrine aus Nussbaum, in der sich fein säuberlich blau-weiß gestreifte Handtücher stapelten.
Allem in diesem Haus hatte Shohreh ihren unvergleichlichen Stempel aufgedrückt. Jedes Kissen, jedes Schälchen und jeder noch so kleine Bilderrahmen war von ihr ausgewählt, platziert und angebracht worden – und doch mit einer bewussten Unvollkommenheit, die das Haus erst zu einem Ort machte, an dem man sich wohlfühlte. Ein Ort, an dem sie viele glückliche Jahre verlebt hatten.
Ein vertrautes Raunen drang aus dem Schlafzimmer zu ihm. Shohreh schien wach zu werden. Er glaubte zu hören, wie sie sich streckte, und sah vor seinem inneren Auge, wie sie einen Arm um den Kopf beugte und mit dem anderen Arm weit von sich zeigte.
»Martin …?«
»Ich bin hier, mein Schatz!«
»Hast du gut geschlafen?«, fragte sie. Eine simple Frage, aber an diesem Morgen stutzte er. War das schon immer so gewesen, dass ihr erster Gedanke am Morgen seinem Wohlbefinden galt?
»Nein, ich hatte einen Albtraum. Ich wurde auf einem Scheiterhaufen verbrannt«, antwortete er wahrheitsgemäß, denn auch wenn er durch seinen Beruf gelernt hatte, die Wahrheit gewissermaßen zu beugen, vermied er ihr gegenüber jegliche Umschreibungen oder Ausflüchte. In Shohrehs Gegenwart die Wahrheit zu sagen, war so befreiend wie die regelmäßige Beichte in seiner Kirche.
»Oh, mein Armer, das ist ja fürchterlich! Komm wieder ins Bett.«
Seine Knie wurden weich bei dem Gedanken, sich an ihren warmen Körper zu schmiegen. In dem Duft ihrer wilden Haare würden sich die Probleme verflüchtigen, denen er sich Tag für Tag mit aller Kraft entgegenstemmte.
»Du weißt, ich kann nicht. Ich muss ins Ministerium.«
Sie antwortete nicht. Es war nicht ihre Art, ihn zu irgendetwas zu drängen. Aber vielleicht war das auch nur ein letzter Rest ihrer iranischen Erziehung, die schweigsame Frauen zum Idealbild stilisierte.
Jedenfalls hatte er ihre Zurückhaltung zeitlebens als Desinteresse interpretiert. Er hatte sich oft unverstanden und zurückgesetzt gefühlt, während sein dominantes Wesen sich unaufhaltsam, wie ein Bollwerk, zwischen ihre Liebe geschoben hatte.
Inzwischen war es zu spät, um diese Mauer einzureißen.
Und selbst wenn er sich jetzt, da ihm all diese Dinge bewusst geworden waren und er seine eigenen Schwächen als Wurzel allen Übels erkannt hatte, von Grund auf ändern würde, gäbe es keine Möglichkeit mehr, ihre Beziehung zu retten. Die Zeit ließ sich nicht zurückdrehen.
Er dachte an die große weiße Uhr, die im Inneren des Ministeriums über dem Haupteingang hing wie eine Bahnhofsuhr. Ihr galt sein erster und sein letzter Blick an jedem harten Arbeitsalltag. Sie war der Anfang und das Ende – und in all den Stunden und Minuten dazwischen wurde Martin, der Familienvater und Ehemann, von den gewaltigen Zahnrädern seiner Aufgaben als Innenminister zermalmt.
Hatte Shohreh ihn dann endlich einmal für sich, für ihre Familie, reichte die gemeinsame Zeit kaum aus, um tief in seinem Inneren den Menschen auszugraben, der liebevoll, aufmerksam und sensibel sein konnte, bevor die Zahnräder ihr zerstörerisches Werk fortsetzten.
Martin ging zum Urinal, das hinter einem kurzen Mauerstück verborgen war. Eines der wenigen Dinge, auf die er im Haus bestanden hatte und das sie so geschickt in das Badezimmer integriert hatte, dass man es kaum wahrnahm.
Auch das war eine ihrer großen Begabungen: die unangenehmen Dinge in ihrem Leben kunstfertig zu verbergen oder sie gar aus dem Bewusstsein ihrer Beziehung zu verdrängen, um für sie beide eine Scheinwelt der Harmonie zu erschaffen.
Martin konzentrierte sich auf die beschwerliche Entleerung seiner Blase. Ein Umstand, den sein zunehmendes Alter mit sich brachte. Erst als es endlich plätscherte, konnte er wieder einen neuen Gedanken fassen.
Sein Traum kam ihm erneut in den Sinn. Und schon formten seine Lippen eine rhetorische Frage, wie immer darauf erpicht, sein Wissen weiterzugeben, um unentwegt die Beachtung zu erhalten, ohne die er kaum noch leben konnte.
»Wusstest du, dass es in fast jeder Religion eine Hölle gibt?«
Sie antwortete wieder nicht, und so fuhr er in der festen Annahme fort, dass sie seine Ausführungen hören wollte.
»Bei der Beschreibung der Hölle gibt es zwischen den Religionen einen deutlich größeren Konsens als bei der des Himmels. Die Hölle ist immer ein Ort der Qual und des Martyriums, der all jenen gewiss ist, die im Diesseits Unrechtes getan haben. Was genau Unrecht bedeutet, obliegt den irdischen Oberhäuptern, was natürlich Tür und Tor für vielseitige Interpretationen öffnet.
Aber jetzt kommt der interessante Teil: Anders als in deinem islamischen Glauben, in dem Sünder ohne Umschweife direkt im Höllenfeuer brennen müssen, gibt mein Glaube den Verdammten nach ihrem Dahinscheiden noch eine Chance: das Fegefeuer. Ein tröstlicher Gedanke, oder?«
Er zog die Schlafanzughose hoch, ging zurück an den geschwungenen Waschtisch und betrachtete sich erneut im Spiegel, während er wie gewohnt zur Dose mit Rasierschaum griff und sie schüttelte.
»Das Fegefeuer ist nicht etwa die Hölle, sondern eher eine Art Vorzimmer zu Himmel oder Hölle. Die frühe Kirche bezeichnete es als ›refrigerium interim‹, als einen Ort, an dem sich die Seele erfrischen kann, bis das Jüngste Gericht über sie ein Urteil fällt. Und als einen Ort der Läuterung, der Selbstfindung, um in letzter Sekunde der Hölle doch noch zu entkommen.«
Mechanisch drückte er Rasierschaum aus der Dose und trug ihn auf Kinn und Wangen auf. Wieder hatte er das Bild von sich auf dem brennenden Scheiterhaufen vor Augen.
»Ich sollte den Erzbischof anrufen und das Thema mit ihm ein wenig vertiefen.«
Er hielt inne und horchte in den Raum hinein. Er war es gewohnt, dass sie ihm in seinen Sprechpausen mit einem leisen Raunen zustimmte, doch es blieb still. Shohreh war wohl wieder eingeschlafen. Ohne den Klang seiner Stimme wirkte die Stille erdrückend. Er fröstelte. Das Haus war einmal voller Wärme gewesen, jetzt fühlte es sich kalt und leer an.
Eine Viertelstunde später eilte Martin Himmel mit seiner Aktentasche die geschwungene Treppe hinunter in die großzügige Diele. Dort angekommen, warf er erneut einen prüfenden Blick in den Spiegel. Der dunkelblaue Maßanzug saß perfekt, kaschierte seinen Bauchansatz und ließ seine Schultern breiter wirken. Nur die dezent gemusterte Krawatte hatte am Hemdkragen ein wenig Spiel. Er stellte die Aktentasche ab und korrigierte den Fehler, dabei ließen ihn Geräusche aus dem angrenzenden Zimmer seines Sohnes aufhorchen.
Heute war der letzte Tag der großen Ferien, Lukas hatte in den vergangenen sechs Wochen nur selten zu Hause geschlafen. Martin zögerte und spielte mit dem Gedanken, einfach zu gehen, dann entschied er sich aber für einen kurzen Blick in Lukas’ Zimmer. Er atmete tief durch, um sich auf die Begegnung vorzubereiten, ging hinüber zu Lukas’ Zimmertür und klopfte sacht.
Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis Lukas beiläufig öffnete, ohne den Blick von seinem Handy zu nehmen. Danach ließ er sich barfuß auf einem kreisrunden Designersessel nieder, den einen Fuß angezogen, mit dem anderen auf den Boden tippend, um den Sessel langsam um die eigene Achse drehen zu können.
»Du bist zu Hause und begrüßt mich nicht mal?« Martins Stimme klang vorwurfsvoller als gewollt, aber das passierte ihm im Umgang mit Lukas ständig.
»Dein Zuhause, nicht meins.«
Martin unterdrückte den Wunsch, zu kontern – Shohreh wäre nicht glücklich, wenn es wieder zum Streit käme. Stattdessen sah er seinen Sohn nur an, wie er sich langsam auf dem Stuhl im Kreis drehte und seine ganze Aufmerksamkeit dem Handy widmete.
Lukas wurde in wenigen Wochen achtzehn Jahre alt, sein schmaler Körperbau und seine kindlichen Züge ließen ihn aber deutlich jünger aussehen. Er hatte das ebenmäßige Gesicht seiner Mutter, das Martin immer an eine griechische Statue erinnerte, mit einer geraden Nase, großen dunklen Augen und dichten schwarzen Haaren. Anscheinend hatte er nur die helle Haut von ihm geerbt – vielleicht noch seine Impulsivität.
»Morgen geht die Schule wieder los«, versuchte er ungeschickt, ein Gespräch in Gang zu bringen.
»Na und?«, antwortete Lukas gleichgültig.
»Hör mal, junger Mann, die letzte Klasse der Oberstufe kann entscheidend sein für dein ganzes Leben. Du solltest gut vorbereitet sein.«
»Ist das so?«
Martins Stimme schwoll an.
»Ja, das ist so, und leg das Handy weg, wenn ich mit dir spreche!«
Lukas ließ das Smartphone auf seinen Schenkel sinken und gab dem Stuhl einen Schubs, der sich daraufhin drehte, bis er Martin in die Augen schauen konnte.
»Du willst mit mir sprechen, ehrlich jetzt? Haben wir jetzt unsere … Vater-Sohn-Quality-Time? Wenn ja, erklär mir bitte, wie das läuft, ich hab da nämlich so gut wie keine Erfahrung. Erzählst du mir, was dich den ganzen Tag so umtreibt, welche ultrawichtigen Sachen du heute entscheiden musst und was ich von dir für ’nen heißen Scheiß lernen kann? Und ich komm dann rüber mit dem Scheiß, der mich fertigmacht – läuft das so? Und am Ende sitzen wir dann wie dicke Buddys auf der Couch und ziehen an ’ner Wasserbong, bis wir so dicht sind, dass wir ganz vergessen haben, wie scheißegal uns der andere eigentlich ist?«
In Ermangelung einer passenden Antwort schluckte Martin. Nervös wich er dem starren Blick seines Sohnes aus und sah auf die Uhr.
»Ich muss los.«
Er würde einen Zeitpunkt finden, um sich dieser Konfrontation zu stellen, aber nicht heute, vielleicht noch nicht einmal diese Woche.
Gerade als er die Tür wieder schließen wollte, setzte Lukas erneut an.
»Martin …«
Das tat weh. Früher hatte er ihn noch Papa genannt.
»… hat gutgetan, sich mal richtig auszusprechen, das sollten wir bei Gelegenheit wiederholen.«
Lukas’ Worte trafen ihn unvorbereitet und tief.
Seine Hand zitterte noch, als er die Aktentasche wieder hochnahm und das Haus verließ.
In der Auffahrt konnte er einen gepanzerten schwarzen 7er-BMW mit Blaulicht auf dem Dach erkennen. Es war sein Dienstwagen, mit dem er normalerweise täglich ins Ministerium am Odeonsplatz gefahren wurde. Außer montags.
Ein wenig ungehalten ging er zur Fahrerseite, klopfte gegen die Seitenscheibe und wartete, bis sie sich geöffnet hatte. Eine Frau mit kurzen grauen Haaren blickte ihn irritiert an.
»Herr Minister?«
»Heute ist Montag.«
»Verzeihung, Herr Minister, aber ich verstehe nicht.«
»Wer sind Sie, und wo ist Malik, mein üblicher Fahrer?«
»Herr Türkan ist ab heute in Elternzeit. Mein Name ist Wolf, Juliane Wolf, ich bin Ihnen jetzt für die nächsten vierundzwanzig Monate zugeteilt.«
Martin kochte innerlich. Vierundzwanzig Monate Elternzeit? Was war bloß aus den Männern in diesem Staat geworden?
Die Fahrerin ergänzte nervös: »Es tut mir wirklich leid, Herr Minister, aber Herr Türkan hat mir versichert, dass der Wechsel mit Ihnen abgesprochen war und …«
Martin hob abwehrend die freie Hand. Niemals war so ein Wechsel mit ihm abgesprochen worden. Malik war kein Freund vieler Worte, weshalb er ihn als Fahrer sehr schätzte. Hätte sich Malik entsprechend geäußert, würde er sich daran erinnern.
»Hören sie, Frau …«
»Wolf.« Sie klang jetzt streng und zeigte auf das Namensschild, das sie an ihrer Bluse trug.
»Hören Sie, Frau Wolf. Offensichtlich hat Malik, ich meine, Herr Türkan, einfach vergessen, Ihnen mitzuteilen, dass ich montags immer die U-Bahn nehme. Sie haben den Weg leider umsonst gemacht. Sie werden sehen, wenn Sie noch auf dem Ring im Stau stehen, ziehe ich mir bereits die erste Tasse Kaffee aus dem grässlichen Automaten im Ministerium.«
Das war natürlich eine Lüge, denn sein Assistent brühte ihm persönlich Tag für Tag eine frische Kanne Kaffee auf. Aber der Anflug von einem kurzen Lächeln machte die Geschichte glaubwürdig und Martin in den Augen von Juliane Wolf hoffentlich ein wenig menschlicher.
Die leichteste Übung für einen Vollblutpolitiker wie ihn. Kaum hatte sich die Seitenscheibe wieder geschlossen, verschwand der gütige Ausdruck in seinem Gesicht.
7:30 Uhr
Lukas stand seit Minuten seitlich an seinem Fenster und beobachtete aufmerksam die Szene in der Auffahrt. Er konnte zwar nicht hören, was gesprochen wurde, doch Martins Körperhaltung, seine Mimik und seine Gesten waren ihm sehr vertraut – aber vor allem waren sie ihm zuwider. Ganz offensichtlich hatte er die Fahrerin zurechtgewiesen, herablassend streng und am Ende ein wenig gönnerhaft.
Hatte es jemals eine Zeit gegeben, in der es zwischen ihnen irgendeine zwischenmenschliche Wärme gegeben hatte? Jene Wärme, die er empfand, wenn er an seine Mutter dachte? Er konnte sich nicht an einen solchen Augenblick erinnern.
Der Dienstwagen wirbelte die ersten Herbstblätter auf. Martin sah der schwarzen Limousine nach, bis sie in die schmale Allee einbog und verschwand, erst dann machte er sich mit großen Schritten auf den Weg in Richtung U-Bahn-Station.
Lukas sah selbst dann noch auf die Einfahrt hinab, als sein Vater längst aus seinem Blickfeld verschwunden war. Aber die Zeit blieb nicht stehen, war unaufhaltsam im Fluss, und mit jeder Minute entfernte Lukas sich mehr von einer scheinbar heilen Welt, die nur noch in seinen Erinnerungen existierte. Einer Welt, in der sein Vater kaum eine Rolle gespielt hatte, in der er morgens sofort zu seiner Mutter ins Bett gekrochen war, wenn Martin das Haus verlassen hatte.
Schwermütig verließ er sein Zimmer. Selbst sein Handy ließ er liegen. Stufe für Stufe schritt er die geschwungene Treppe mit dem eleganten Handlauf empor, die all den Luxus und den Einfluss seines Vaters repräsentierte, immer höher dem elterlichen Schlafzimmer entgegen. Früher war der Eingangsbereich ein beliebter Ort für Spiele mit seinen Freunden gewesen, bis sein Vater die Tollerei an der Treppe verboten hatte. Wie er nach und nach so vieles verboten hatte, was seine Ruhe hätte stören können. Lukas dachte oft darüber nach, ob er seiner Tochter Antonia genauso viele Regeln auferlegt hatte wie ihm, als sie noch hier gewohnt hatte. Lukas’ Stiefschwester war längst erwachsen und lebte ihr eigenes Leben. Sicher ein Leben nach den Vorstellungen des Vaters. Ganz anders als er.
Oben angekommen, war er Mamas Schlafzimmer ganz nah. Er streifte einen silbernen Bilderrahmen, der auf einem schmalen Sideboard im Flur stand. Laut scheppernd zerbrach der Rahmen auf den Marmorfliesen. Er erschrak nicht einmal und wusste auch nicht, ob es ein Versehen gewesen war oder ob er das Hochzeitsbild seiner Eltern absichtlich auf den Boden gestoßen hatte. Scheinbar glücklich blickten sie ihm durch die zerbrochene Glasscheibe entgegen. Er spürte, wie sich seine Kehle zuschnürte, dann machte er einen großen Schritt, um nicht mit seinen nackten Füßen in die Scherben zu treten. Vergeblich.
Ein Splitter schnitt in seine Ferse und erinnerte ihn einmal mehr daran, wie schmerzvoll die Vergangenheit war und die Zukunft noch sein würde. Ohne Rücksicht auf den blutenden Fuß zu nehmen, betrat er leise das Schlafzimmer. Der helle, weiche Teppich fühlte sich vertraut an. Unzählige Male war er als kleiner Junge nachts über diesen Teppich gelaufen, wenn er nicht schlafen konnte, und immer hatte sie ihn gehört, hatte ihn erwartet und im Dunkeln die Decke weit aufgeschlagen – und immer war er danach sofort in ihren Armen eingeschlafen.
Nun war ihre Seite des Bettes unberührt, flach, ordentlich zurechtgemacht und mit einer Tagesdecke versehen. Martins Seite hingegen war unordentlich und aufgebauscht.
Lukas schenkte diesem Teil des Bettes keine Beachtung. Er ging auf Mamas Seite und kroch unter das kalte Plumeau. Sie fehlte ihm. Sie fehlte ihm so sehr, dass er jämmerlich zu weinen begann. Dabei zog er die Füße an den Unterleib und presste die angewinkelten Arme fest an sich, bis er sich einzubilden begann, wie sich von hinten der Leib seiner Mutter an ihn drückte und ihn ihre Arme fest umschlossen.
***
Die Orhan-Moschee im Münchner Norden lag in einem Hinterhof und war von außen kaum als solche zu erkennen. Es war ein einfach gehaltener, funktionaler Bau ohne Minarette oder prächtige Kuppel und eins von etwa vierhundert islamischen Gotteshäusern, die es in Bayern gab und die mehr als einer halben Million islamischen Gläubigen als Ort zum Gebet und zur Ausübung ihres Glaubens dienten. Obwohl der Islam das Gebet an jedem Ort erlaubte, war es in der Moschee laut Überlieferung des Propheten Mohammed fünfundzwanzigmal so viel wert wie ein Gebet zu Hause. Nur das Freitagsgebet war unbedingt an eine Moschee gebunden, sonst verlor es seine Gültigkeit. Entsprechend gut besucht waren die Gotteshäuser am Ende der Woche. An diesem wolkenverhangenen Montagmorgen war die Moschee jedoch fast leer. Nur ein einziger Gläubiger befand sich im Gebetsraum mit den sieben Kristallleuchtern, ein junger Mann in hellen Gewändern namens Safaa Al Aifuri.
Er war gekommen, um Kraft zu schöpfen und die letzten Zweifel abzuschütteln, die ihn marterten. Sein tiefschwarzer Vollbart wippte bei jeder Bewegung auf und ab. Er hatte einen Platz am Rande des Teppichs gewählt, dessen Gesamtfläche in zweihundert Felder unterteilt war. Jedes der Felder enthielt im Zentrum die grafische Darstellung eines Mihrab, einer Gebetsnische, wie es sie in größeren Moscheen gab. Die Spitze jedes Mihrabs war in Richtung der Kabaa in Mekka ausgerichtet.
Safaa wiederholte seit der Morgendämmerung immer und immer wieder das Fadschr-Gebet. Wenn Allah ihm beistand, würde er das Mittagsgebet bereits im Jenseits erleben, im Paradies voll sinnlicher Genüsse inmitten der Huris, mit schönen großen Augen, gleich wohlverwahrten Perlen, wie es in den Versen 22 und 23 der Sure 56 heißt. Kamal Abdeslam, sein geistiger Führer, hatte ihm erklärt, dass Huris die Paradiesjungfrauen waren, von denen gleich zweiundsiebzig an der Zahl im Jenseits auf ihn warten würden. Safaa hatte nichts dergleichen im Koran finden können, aber er wagte es nicht, Kamals Verheißungen infrage zu stellen. Denn Kamal war mehr als nur sein geistiger Führer, er war auch Gottes General, dessen Schwert Safaa heute werden würde.
Wer sich wie Safaa bereit erklärte, sein irdisches Dasein zu opfern, um Allah einen Dienst zu erweisen, tat das nicht leichtfertig. Er hatte sich über viele Monate hinweg intensiv mit dem Leben im Paradies auseinandergesetzt, hatte Stunde um Stunde damit verbracht, die Lehren eines islamischen Gelehrten, eines Ulamā, in sich aufzunehmen, die ihm als Videofile auf einem goldenen USB-Stick feierlich von seinem Imam übergeben worden waren. Und er hatte in seinem sechshundertseitigen Koran alle Stellen markiert, an denen vom Dschanna, dem islamischen Paradies, die Rede war. Safaa wusste sehr wohl, dass sein Leben wertvoll war, nicht nur für ihn, sondern insbesondere für all jene, die in ihm eine Waffe sahen. Und wie alles, was etwas wert war, hatte deshalb auch sein Leben einen Preis.
Der Imam hatte ihm erklärt, der Gegenwert seines Lebens wäre nicht nur ein ewiges Leben im Dschanna, sondern die hundertprozentige Sicherheit, nicht im Dschahannam, im Höllenfeuer, zu enden.
Auf seine Frage, warum man sich dann überhaupt das irdische Dasein, das nur aus Kummer und Qualen bestand, antun sollte und nicht jeder gottesfürchtige Muslime sein Leben in jungen Jahren beendete, antwortete der Imam:
»Nicht jeder Gläubige erhält von Allah dem Allmächtigen eine so gewaltige und wertvolle Aufgabe, durch deren Erfüllung ihm Einlass in das Paradies gewährt wird. Im Koran steht über das Paradies, Dschanna, geschrieben: Ein Ort, in dessen Niederungen Bäche fließen. Und es hat andauernd Früchte und Schatten. Das ist das letzte Ziel derer, die gottesfürchtig sind. Das letzte Ziel der Ungläubigen aber ist das Höllenfeuer. Und du, mein gelehriger Schüler, wirst nach der Erfüllung deiner Aufgabe an der Seite Allahs sein, auf der höchsten aller Stufen. Du wirst für immer seine Gunst besitzen und ein Leben voll Freude, Gesundheit und Glück führen.«
FREUDE, GESUNDHEIT und GLÜCK.
Das schien Safaa ein fairer Gegenwert für seine irdische Existenz zu sein. Er wäre dann frei. Frei von all der Unbill des Lebens, die ihm so hart zugesetzt hatte.
Safaa Al Aifuri war 1998 in Bengasi geboren worden, der zweitgrößten Stadt Libyens, eines Landes an der Nordküste Afrikas. Obwohl 1959 die Entdeckung reicher Erdölvorkommen Libyen zu einem der bedeutendsten ölexportierenden Länder der Welt gemacht hatte, führten innere soziale Spannungen 1969 zum Sturz der Monarchie durch einen Militärputsch. Von da an herrschte Muammar al-Gaddafi bis 2011 ohne politisches Amt wie ein Diktator. Safaas Vater, der ein getreuer Anhänger des Machthabers und Funktionär seines politischen Apparats gewesen war, verlor bei der Entmachtung Gaddafis seine Stellung, sein Ansehen und sein ganzes Vermögen. Acht Monate lang hatte ein Bürgerkrieg das Land verwüstet. Gaddafi selbst wurde bei einem Feuergefecht kurz nach seiner Festnahme erschossen. Danach begann die Jagd auf Gaddafis Getreue. Sechsundsechzig Mitglieder seines letzten Konvois hatte man bereits einen Tag nach seinem Tod in einem Hotel standrechtlich erschossen.
Statt Freiheit und Demokratie folgten Denunzierungen, willkürliche Verhaftungen und Folter.
Für Safaa, seine Mutter, und vier Geschwister war das der Beginn eines furchtbaren Martyriums. Vom Vater fehlte jede Spur. Ihr nobles Haus im Regierungsviertel wurde gewaltsam geräumt, aber erst, nachdem Soldaten der Befreiungsarmee seine Mutter und seine Schwester vergewaltigt und ihn und seine kleinen Geschwister gezwungen hatten, dem grausamen Akt zuzusehen. Danach folgte ein Leben auf der Straße, ein Leben, das von Hunger und Verzweiflung geprägt war.
Am 11. September 2012, dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York, stürmte eine aufgebrachte Menschenmenge teils schwer bewaffnet die amerikanische Botschaft in Bengasi, setzte sie in Brand und tötete vier Amerikaner, darunter auch den amerikanischen Botschafter. Safaas Vater, der sich angeblich der al-Quaida angeschlossen hatte, gehörte mutmaßlich zu den Drahtziehern hinter dem Anschlag. Wenige Tage später fand man seine Leiche. Man hatte ihn geköpft und ihm seine abgehackten Finger in den Mund gestopft.
Es dauerte weitere drei Jahre, bis Safaas Mutter mithilfe ehemaliger Freunde des Vaters genügend Geld zusammengebracht hatte, um das Land verlassen zu können. Drei Jahre, in denen sie geächtet, bespuckt und bedroht worden war. Drei Jahre, in denen sie täglich Angst um ihr Leben und das ihrer Kinder haben musste.
Am 19. April 2015 bestieg die Familie Aifuri in Mahdia, Tunesien, einen Flüchtlingskutter. Nach Bezahlung der Schleuser blieb ihnen nichts als ihr Leben und die zerschlissene Kleidung an ihren Leibern – und die Hoffnung. Die Hoffnung, mit diesem Kutter ein Land zu erreichen, das ihnen eine bessere, eine sichere Zukunft bieten würde. Aber ihr Traum von einem besseren Leben erfüllte sich nicht.
Der siebzehnjährige Safaa befand sich bei der nächtlichen Überfahrt auf Deck. Seine kleine Schwester Ranai, erst fünf Jahre alt, plagte der Hunger. Seit knapp achtundvierzig Stunden hatten sie keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Safaa hatte sich deshalb zwischen all den schwitzenden Leibern im Frachtraum nach oben geschlichen, vorbei an zwei schlafenden Wachen. Als er an Deck stand, tauchte plötzlich aus der Dunkelheit der Rumpf eines Frachtschiffs über ihm auf wie eine riesige Wand. Geistesgegenwärtig sprang Safaa in die eiskalten Fluten des Mittelmeers. Einen Wimpernschlag später zerbarsten die Holzplanken des Kutters an der massiven Metallhülle des Frachters. Ein Geräusch, das Safaa sein Leben lang verfolgte.
Aber das Entsetzlichste war die Stille danach. Es gab keine Schreie, keine panischen Menschen, die versuchten, ihr Leben zu retten. Die Wassermassen drangen so schnell und mit solcher Wucht in das Innere des Kutters ein, dass die fünfhundert Passagiere unter Deck keine Zeit hatten, um ihr Leben zu retten. Nur zwanzig Sekunden später verschwand das Flüchtlingsboot unter der schwarzen Meeresoberfläche und mit ihm seine Mutter und seine Geschwister.
Immer wieder war Safaa in den Abgrund hinabgetaucht, um seine Familie zu finden. Hatte die Hände nach unten gestreckt, in der Hoffnung, im Dunkeln etwas greifen zu können, irgendetwas tun zu können, aber vergeblich. Es grenzte an ein Wunder, dass schließlich ein Schiff den regungslos im Wasser treibenden Körper entdeckte. Safaa und siebenundzwanzig weitere Überlebende wurden gerettet.
2019 stellte der Schweizer Künstler Christoph Büchel das geborgene Wrack als Mahnmal auf der Biennale de Venezia aus. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt setzte Safaa Al Aifuri mithilfe des Flüchtlingshelfers Abu Yahya Elkekli zum ersten Mal seinen Fuß auf deutschen Boden. Abu war im Flüchtlingscamp von Lampedusa auf Safaa aufmerksam geworden. Jemand wie Safaa war der Grund, warum er sich hier engagierte. Safaa war alleine, hatte keine Familie, er war jung, gesund und vor allem verzweifelt. So verzweifelt, dass ihm sein eigenes Leben nichts mehr wert zu sein schien. Und so schenkte Abu Yahya Elkekli ihm seine Freundschaft und verkaufte Safaa gegen ein gebührendes Kopfgeld schließlich an den Chef der IS-Terrorzelle in Deutschland, Ahmed al-Bāṭin, der Safaas Ankunft als Geschenk Allahs feierte.
Eine Hand legte sich jetzt auf Safaas Schulter, der tief ins Gebet versunken war. Die Berührung kam nicht unerwartet, aber für Safaa war es ein unmissverständliches Zeichen, dass die Zeit des Gebets für ihn vorüber war. Seine Füße fühlten sich schwer wie Zement an, als er sich erhob, während der Mann neben ihm nun selbst mit seinen Gebeten begann. Ohne ein weiteres Wort verließ Safaa den Gebetsraum und führte den Auftrag aus, dessen einzelne Schritte man Woche für Woche immer wieder minutiös mit ihm durchgegangen war.
Hinter einer losen Kachel in der Wandvertäfelung des Vorraums befand sich ein Schlüssel. Er nahm ihn an sich und ging damit in den Keller. Modriger Geruch von Schimmel und Feuchtigkeit stieg ihm in die Nase. Licht kam nur von einer einzigen Glühbirne, die an einem Kabel von der Decke baumelte. Am Ende eines Ganges öffnete er mit dem Schlüssel die Tür zu einem schmalen Raum. Darin stand auf einem vergammelten Tisch ein breiter grüner Kanister mit zwei Schultergurten, aus dem ein schwarzer Schlauch ragte, an dessen Ende ein Stab mit einem pistolenartigen Griff angebracht war. Außerdem befanden sich auf dem Tisch ein paar weiße Turnschuhe, eine zusammengelegte Jeans und ein dunkelgrauer Pullover. Daneben lagen eine FFP2-Maske, eine Geldbörse, ein Handy und eine Kleinkaliberpistole.
Safaa zog ein zerknittertes Bild aus seiner Tasche, das er aus einer Zeitung ausgeschnitten hatte. Es zeigte eine glückliche arabische Familie. Dies war nicht seine Familie, aber er stellte sich oft vor, dass sie es wäre. Die Frau, umgeben von Kindern, neben einem stattlichen Mann mit kräftigem Bartwuchs, hatte Ähnlichkeit mit seiner Mutter. Aber vielleicht auch nicht, denn die Gesichter seiner Geschwister, seines Vaters und seiner Mutter waren in seinen Erinnerungen längst verblasst. Er küsste den Zeitungsschnipsel, faltete ihn wieder zusammen und steckte ihn in das Portemonnaie, das auf dem Tisch lag. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Zwei zivile Kriminalbeamte einer aus fünfzehn Mann bestehenden operativen Einheit für Observationen warteten vor der Orhan-Moschee im Auto darauf, dass Safaa Al Aifuri das Gebäude wieder verlassen würde. Seit 5:30 Uhr war die Moschee geöffnet, um sieben Uhr hatte die Zielperson das Gotteshaus betreten.
Safaa Al Aifuri war bereits vor Monaten als gefährlich eingestuft worden und galt mit über tausend anderen Personen im Bundesgebiet als ausländerrechtlicher Gefährder. So nannte man Personen mit Plänen, die freiheitlich demokratische Grundordnung anzugreifen. Für diese Einstufung mussten zum Beispiel Tatsachen den Schluss zulassen, dass sie vor ihrem Asylantrag in Deutschland einer Organisation angehört hatten, die von der Bundesregierung als terroristische Vereinigung eingestuft wurde, wie es bei den Taliban oder dem IS