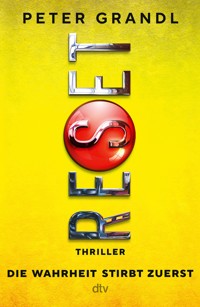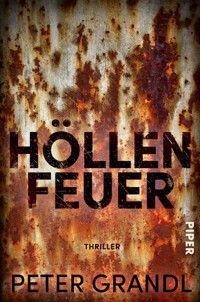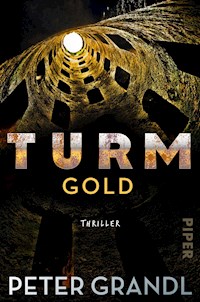14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der große Gesellschaftsthriller, über den man 2022 reden wird! Ein spektakuläres Verbrechen hält eine Kleinstadt in Atem: Drei Neonazis werden in einem Turm gefangen gehalten. Ephraim Zamir, der Geiselnehmer, konfrontiert sie in einem Verhör mit ihren Gewalttaten und überträgt das Ganze live im Netz. Die Zuschauer sollen abstimmen: freilassen oder hinrichten? Es ist der Beginn eines weltweiten Medienspektakels. Für die Polizei ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Womit sie nicht rechnen: Sie haben es mit einem ehemaligen Mossad-Agenten zu tun, der nicht bereit ist zu verhandeln. Hochspannend und brandaktuell – Peter Grandls grandioser Reihenauftakt! Die Presse ist begeistert: »Ein gewagter, kontroverser Plot. Auch sonst ist die im Jahr 2010 spielende Handlung sehr nah an der bundesrepublikanischen Wirklichkeit dran. Die NS-Zeit, das Oktoberfest-Attentat, das Geiseldrama von Gladbeck, die Wahlerfolge der NPD, der geplante Anschlag auf die Münchner Synagoge: Das alles wird im Roman in Beziehung gesetzt, über die Figuren oder die bereits sehr filmisch wirkende Montage, die die Handlung bis zum überraschenden, den moralischen Kompass noch einmal neu einstellenden Finale vorantreibt. Ein Thriller mit knapp 600 herausfordernden Seiten, die wegen der spannenden Handlung aber schnell verfliegen.« Süddeutsche Zeitung »Hammer-Buch. Kommt bei Erstlingen nicht allzu oft vor. Peter Grandl ist so ein Coup gelungen. ›Turmschatten‹ ist unfasslich spannend, ein Page Turner, bei dem sogar die Flashbacks (jede Figur hat ihren sinnvollen Hintergrund) interessant sind. Überall ist die aktuelle Zeitgeschichte eingewoben, eine chronique scandaleuse des rechtsradikalen Terrors in der Bundesrepublik.« Thomas Wörtche, Culturmag »Peter Grandl hat fünf Jahre lang für ›Turmschatten‹ recherchiert. Er hat Milieus wie die rechtsradikale Szene, jüdisches Leben, sowie die Macht der Medien beobachtet und Polizeieinsätze begleitet. Darauf aufbauend hat er einen packenden Thriller geschrieben, der die Grenzen von Gut und Böse aufhebt. Absolut lesenswert.« Donaukurier »Peter Grandl beherrscht es grandios, Realität und Fiktion zu verbinden. Er lässt in meinem Kopf schaurige Bilder entstehen. Nach dem Ende der Geschichte, die so ganz anders daherkommt, als ich es mir die ganze Zeit vorgestellt habe, bleibe ich erst mal sprachlos zurück. Für mich ist ›Turmschatten‹ eines der besten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ein Buch, bei dem ich ein Kapitel nach dem anderen verschlungen habe. Ein Buch, dessen Einblicke in die menschliche Psyche mich teilweise verstört haben. Ein Buch, dessen Aktualität greifbar ist.« literaturschock.de »600 hoch spannende Seiten, auf denen existenzielle Fragen ebenso abgehandelt werden wie die Skrupellosigkeit von Reality-TV-Shows und die Gesetzlosigkeit der digitalen Kommunikation. Fünf Jahre hat Grandl an seinem dicken Werk gearbeitet, das 2010 spielt, in der Hochzeit der NPD, und doch genau heute wieder ganz aktuell ist.« Augsburger Allgemeine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Turmschatten« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Dieser Thriller ist 2020 als Hardcover-Ausgabe bei Das neue Berlin – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage erschienen. Bei der vorliegenden Ausgabe handelt es sich um eine ungekürzte, komplett überarbeitete Neuausgabe.
Dieser Roman ist ein fiktionales Werk. Jegliche Ähnlichkeit mit aktuellen Ereignissen und lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Überarbeitete Neuausgabe
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Lars Zwickies
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: arcangel/Jaroslaw Blaminsky; FinePic®, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Mein blaues Klavier
Prolog – Der Turm I
Montag, 8. Januar 1945
Ephraim I
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Karl I
Sonntag, 23. August 1992
Achtzehn Jahre später
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Seligmann I
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Marie I
Juni 1985
Fünfundzwanzig Jahre später
Freitag, 15. Oktober 2010
Karl II
Freitag, 15. Oktober 2010
Marie II
August 1991
Sechs Jahre später
Dreizehn Jahre später
Freitag, 15. Oktober 2010
Esther
Samstag, 16. Oktober 2010, Sabbat, 9:30 Uhr
Ephraim II
Samstag, 16. Oktober 2010, 13:30 Uhr
Der Turm II
Samstag, 16. Oktober 2010, 16:20 Uhr
Thielen I
Samstag, 24. März 1984
Zweiundzwanzig Stunden später
Sechsundzwanzig Jahre später
Samstag, 16. Oktober 2010, 18:10 Uhr
Ephraim III
Samstag, 14. Oktober 1944
Karl III
Samstag, 16. Oktober 2010, 18:25 Uhr
Steiner I
Oktober 1994
Sechzehn Jahre später
Samstag, 16. Oktober 2010, 19:10 Uhr
Kleinfeld
Mittwoch, 17. August 1988
Zweiundzwanzig Jahre später
Samstag, 16. Oktober 2010, 20 Uhr
Koch I
Samstag, 16. Oktober 2010, 20:20 Uhr
Steiner II
Samstag, 16. Oktober 2010, 21:00 Uhr
Marie III
Samstag, 16. Oktober 2010, 21:31 Uhr
Steiner III
Samstag, 16. Oktober 2010, 21:43 Uhr
Conrad
Samstag, 16. Oktober 2010, 22:05 Uhr
Seligmann II
Samstag, 16. Oktober 2010, 22:45 Uhr
Der Turm III
Samstag, 16. Oktober 2010, 23:44 Uhr
Udo I
Montag 26. Februar 2007, 11 Uhr
Dreieinhalb Jahre später
Sonntag, 17. Oktober 2010, 0:40 Uhr
Marie IV
Sonntag, 17. Oktober 2010, 0:25 Uhr
Udo II
Sonntag, 17. Oktober, 1:10 Uhr
Siebzehn Monate zuvor
16. Juni 2008, 22 Uhr
2. Juli 2008, 9:04 Uhr
Thomas I
Samstag, 16. Oktober 2010, 13:03 Uhr
Fünf Jahre zuvor
September 2008
Koch II
Sonntag, 17. Oktober 2010, 1:55 Uhr
Der Turm IV
Sonntag, 17. Oktober 2010, 2:04 Uhr
Sonntag, 17. Oktober 2010, 2:11 Uhr
Fünf Minuten zuvor
Udo III
Sonntag, 17. Oktober 2010, 2:48 Uhr
Thomas II
Sonntag, 17. Oktober 2010, 3:05 Uhr
Fünfundvierzig Minuten zuvor
Shalhevet
Mittwoch, 10. September 2003
Karl IV
Sonntag, 17. Oktober 2010, 3:40 Uhr
Thielen II
Sonntag, 17. Oktober 2010, 4:01 Uhr
Karl V
Sonntag, 17. Oktober 2010, 4:21 Uhr
Der Turm V
Montag, 8. Januar 1945
Sonntag, 17. Oktober 2010, 5:08 Uhr
17. Oktober 2010, 6:30 Uhr
Rabbi Moshe
Montag, 18. Oktober 2010, 7:30 Uhr
Thielen III
Montag, 18. Oktober 2010, 7:30 Uhr
Epilog
Non-Fiction Facts
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Mein blaues Klavier
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
Und kenne doch keine Note.
Es steht im Dunkel der Kellertür,
Seitdem die Welt verrohte.
Es spielten Sternenhände vier
Die Mondfrau sang im Boote –
Nun tanzen die Ratten im Geklirr.
Zerbrochen ist die Klaviatür …
Ich beweine die blaue Tote.
Ach liebe Engel öffnet mir
Ich aß vom bitteren Brote –
Mir lebend schon die Himmelstür –
Auch wider dem Verbote.
Else Lasker-Schüler, 1937
Prolog – Der Turm I
Montag, 8. Januar 1945
Es war kurz nach Mitternacht. Ein auf- und abschwellender Signalton zerriss die Stille der abgedunkelten deutschen Großstadt im Süden. Nur acht Kilometer östlich vom Stadtzentrum befand sich nahe einem Moosfeld ein kleines Dorf, dessen Kirche jetzt ebenfalls Alarm schlug und den bevorstehenden Bombenangriff einläutete. Diese Angriffe hatten bisher immer nur der Innenstadt gegolten, aber was waren schon acht Kilometer? Erst am Tag zuvor war einer der britischen Bomber im Wald abgestürzt und bei einer riesigen Explosion in Flammen aufgegangen. Bomben hatten die angrenzenden Felder verwüstet, einen großen Bauernhof sowie dessen noch verbliebenen Viehbestand mit einem Schlag vernichtet und das gefrorene Ackerland in eine unwirtliche Kraterlandschaft verwandelt. Am nächsten Tag fand man eine einzelne Kuh, die in der Mitte eines Bombenkraters stand und brüllend versuchte, die steile Anhöhe zu erklimmen. Ihre Artgenossen waren, angekettet im Stall, der Feuersbrunst zum Opfer gefallen.
So fürchterlich diese Bombenangriffe auch waren, so sehr gehörten sie inzwischen zur schaurigen Routine der Stadtbewohner. Die langen Abstände zwischen den Angriffen halfen dabei, das Grauen zu verarbeiten und den Unverbesserlichen wieder Hoffnung auf den Endsieg zu geben. Zwischen Juli und Dezember 1944 hatte man die Stadt gänzlich verschont. Die Strategen des »Moral Bombing« schickten die Luftflotten zur Unterstützung der Soldaten an der nahenden Front monatelang zu Städten im Norden und Westen. Doch nun waren die Bombergeschwader zurückgekehrt, mit dem Ziel, die Moral der Stadtbevölkerung mit Gewalt zu brechen. Die Abstände zwischen den nächtlichen Angriffen waren mittlerweile kürzer geworden, doch zwei Angriffe hintereinander, in einer Nacht, das hatten selbst die leidgeplagten Bewohner der Siedlung noch nie erlebt.
Als die Sirenen in dieser Nacht zum zweiten Mal heulten, waren die Bewohner gerade wieder erschöpft in ihre Häuser zurückgekehrt. Eine Brandbombe hatte im Dorfzentrum das Haus der Familie Engelhard getroffen. Die Bombe krachte durch die Dachziegel, durchschlug die Böden von zwei Stockwerken und explodierte schließlich im Wohnzimmer. Die fünf Hausbewohner – eine junge Frau, ihre Eltern und ihre zwei Kinder – hatten zu diesem Zeitpunkt im Keller Schutz gesucht und die Explosion überlebt. Doch dann fegte ein Feuersturm über sie hinweg, der ihnen die Luft zum Atmen raubte.
Ein angrenzendes Haus brannte ebenfalls lichterloh und konnte erst nach zwei Stunden in gemeinsamer Anstrengung aller Dorfbewohner gelöscht werden. Es dauerte eine weitere Stunde, bis man die Trümmer weit genug abgetragen hatte, um in den Keller der Familie Engelhard zu gelangen.
Im Licht der Taschenlampen fand man schließlich die zusammengekauerte Familie. Sie alle waren jämmerlich erstickt.
Im Flammenschein der fernen Innenstadt trug man die fünf Leichen in die nahe gelegene Kirche, die beim Angriff unversehrt geblieben war. Dort legte man sie im Kirchenschiff auf dem eiskalten Steinboden ab und hüllte sie in Armeedecken, auf denen höhnisch das Hakenkreuz prangte. Die Beerdigung sollte am nächsten Morgen stattfinden.
Die Tragödie der Familie Engelhard führte dazu, dass nun kaum einer der Dorfbewohner noch glaubte, im eigenen Keller sicher zu sein. Alle Hoffnung auf Überleben richtete sich von da an auf den Turm.
Dieses achteckige Gebäude stand am Rande des Dorfes auf einem Hügel und überragte mit seinem mittelalterlich anmutenden Schindeldach sogar die Spitze der Kirche, was den Dorfpfarrer seit jeher störte. Der mächtige Turm war breit und massiv gebaut und hatte bereits einen Bombentreffer ohne nennenswerten Schaden überstanden. Doch das Privileg, während eines Angriffs dort unterzukommen, war genau reglementiert. Ausgewählte Dorfbewohner, darunter alle Parteimitglieder, hatten einen Sonderausweis für Schutzsuchende erhalten, der ihnen gestattete, im Notfall den Turm aufzusuchen. Der Eingang wurde vom Ortsgruppenleiter der NSDAP streng kontrolliert. Wolfgang Danner besaß zur Wahrung der öffentlichen Ordnung eine Dienstwaffe und drohte jeden zu erschießen, der versuchte, den Turm ohne Sonderausweis zu betreten. Danner neigte trotz der Entbehrungen der Kriegsjahre zu starker Fettleibigkeit. Er war erst Mitte vierzig, doch dank seiner politischen Beziehungen hatte man ihn als »nicht kriegsdienstverwendungsfähig« eingestuft. Stattdessen durfte er an der Heimatfront Wach- und Sicherungsaufgaben übernehmen.
Da mit Erlass des »Volkssturms« im Oktober 1944 der Kreis der wehrfähigen Männer auf die Jahrgänge 1884 bis 1924 erweitert worden war, fand er sich unter Frauen, Kindern und Greisen wieder. Es war niemand mehr da, der ihm seine Macht hätte streitig machen können – und trotz all der Zerstörung und des täglichen Grauens war es für Wolfgang Danner die bis dahin schönste Zeit seines Lebens. Er war jemand! Man respektierte ihn! Oder zumindest tat man so. Wenn er in seiner Uniform mit dem rot-schwarzen Parteiabzeichen durch den Ort flanierte – Benzin gab es auch für seinen Parteiwagen nicht mehr –, dann fühlte er sich allmächtig. Schließlich war er derjenige, der über die Zuteilung von Sonderrationen und die Verteilung von Ausgebombten auf angrenzende Bauernhöfe entschied. Danner hatte außerdem die Macht, Strafen zu erlassen, und rein theoretisch durfte er sogar Todesurteile gegen Volksverräter verhängen.
Als in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 1945 fünfhundertsiebenundneunzig Bomber der Royal Air Force ihre tödlichen Ladungen über der Großstadt abwarfen, war Wolfgang Danner als Erster am Turm, um akribisch zu kontrollieren, wer ihn betreten durfte und wer nicht. Und obwohl er fast jeden im Dorf persönlich kannte und genau wusste, wem der Zugang gestattet war, bestand er darauf, die Sonderausweise zu sehen. Er hatte die Macht, er ganz allein – und er genoss es, diese Macht auszuüben.
Der Horizont war rot erleuchtet von den Feuerstürmen, die acht Kilometer entfernt im Zentrum der Großstadt gerade unzählige Leben auslöschten. Die weißen Strahlen der Flak-Scheinwerfer suchten den schwarzen Himmel ab, doch die Bomber waren längst abgedreht. Das Schauspiel erinnerte an die Ouvertüre einer Oper, bei der die Bühnenscheinwerfer einen roten Vorhang beleuchteten.
Die Gesichter der sinnlos ums Leben gekommenen Familie Engelhard waren den Dorfbewohnern noch frisch in Erinnerung. Auch wenn keiner schlafen konnte, so versuchte man trotz alledem, die Kinder zu beruhigen, ins Bett zu gehen und nicht an die Qualen zu denken, die andere Menschen in unmittelbarer Nähe die ganze Nacht lang erleiden mussten.
Wolfgang Danner ging nach dem ersten Angriff jedes Stockwerk des massiven Turms ab und kontrollierte Raum für Raum. Vor Monaten hatte sich hier mal eine junge Frau erbrochen. Er selbst musste am folgenden Tag die Sauerei aufwischen. Daraufhin hatte er wutentbrannt der Frau und ihrer Familie den Sonderausweis entzogen. In dieser Nacht konnte Danner zum Glück keine unliebsame Hinterlassenschaft entdecken – selbst die Toiletten waren gespült worden, soweit sich das bei der dürftigen Notbeleuchtung erkennen ließ. Danach ging er nach unten ins Erdgeschoss, verließ den Turm und sperrte die schwere Stahltür ab. Auf seinem Weg nach Hause schien das nächtliche Firmament erneut zu erbeben. Wieder heulten die Sirenen los, wieder ertönten Kirchenglocken.
Doch diesmal kam der Alarm zu spät. Schon regnete es Staniolstreifen, mit denen die ersten Bomber den Radar der deutschen Flugabwehr störten. Schaurig schön flatterte das Lametta glitzernd vom Himmel und eröffnete den zweiten Satz einer minutiös geplanten Symphonie des Todes.
Es war das grausame Ziel der Angreifer, nun all jene Einsatzkräfte in den Tod zu reißen, die ausgerückt waren, um den Notleidenden zu helfen. Die brennenden Straßen in der Innenstadt waren voll von Feuerwehrleuten, Sanitätern und zivilen Hilfskräften, die versuchten, Leben zu retten. Genau ihnen galt diese zweite Bombardierung.
Hatte bei der ersten Angriffswelle im Dorf noch eine gewisse Ordnung geherrscht, brach jetzt blanke Panik aus. Zu frisch war der Eindruck der fünf Toten, zu strapaziös waren die vergangenen Stunden gewesen.
»Der Turm ist unsere Rettung«, hieß es plötzlich überall. Sonderausweis hin oder her, der Turm würde Schutz bieten, und Danner würde das sicher einsehen.
Da der Turm auf einer leichten Anhöhe lag, konnte Danner, der keuchend dahin zurückgelaufen war, die Silhouette der Menschenkette ausmachen, die sich schwarz vom rot leuchtenden Hintergrund der brennenden Großstadt abhob.
Viele hatten kaum etwas an, manche waren trotz der Minustemperaturen barfuß. Mütter trugen ihre Kleinsten im Arm und trotzten der Erschöpfung. Schritt für Schritt näherten sie sich dem Turm, der sich vor ihnen aufrichtete wie eine verheißungsvolle Festung aus einer germanischen Sage, während um sie herum die Welt im donnernden Bombenhagel versank.
Danner brach trotz der Kälte der Schweiß aus. Nur etwa die Hälfte des herannahenden Pöbels hatte eine Zutrittsberechtigung. Er erinnerte sich an seine Aufgabe, für Ordnung zu sorgen. Sein direkter Vorgesetzter in der Parteizentrale hatte ihm immer wieder eingebläut, dass Chaos der Anfang vom Untergang sei. Nur durch Ordnung bis in die letzte Volkszelle könne der Endsieg gewährleistet werden. Es lag an ihm, diesem Chaos ein Ende zu bereiten, aber wie sollte er das anstellen? In seiner Waffe, die er nun entsicherte, befanden sich gerade einmal sechs Kugeln. Sechs Kugeln, um Hunderte von Menschen aufzuhalten. Als die ersten Schutzsuchenden den Hügel langsam erklommen, feuerte Danner einen Schuss in die Luft ab. Der Lärm der Bomber über ihnen und die Explosionen, die die brennende Stadt erneut erschütterten, übertönten jedes andere Geräusch, auch den verzweifelten Schuss aus der Pistole.
Danner ließ die Waffe fallen und wandte sich der Stahltür des Turms zu. Zitternd steckte er den klobigen ersten Schlüssel ins Schloss und entriegelte es klackend. Dann griff er zum zweiten Schlüssel, während er hinter sich den Atem der Meute zu spüren glaubte. Noch hielt sie respektvoll Abstand und wartete darauf, dass er die schwere Stahltür öffnete. Erneut hörte er ein Klacken. Doch Sekunden später fuhr in zweihundert Metern Entfernung eine Bombe in den gefrorenen Boden und explodierte mit ohrenbetäubendem Krach in einem gleißenden Licht. Die Druckwelle warf die Menschen um wie Streichhölzer. Splitter pfiffen durch die Luft, zerfetzten Arme, Beine und Gesichter. Inmitten der Schreie und des Leids war Danner im Schatten des Turms wie durch ein Wunder unversehrt geblieben, doch er war benommen und taumelte. In seinen Ohren schrillte ein hoher Pfeifton, der ihn für jedes andere Geräusch taub machte.
Das Letzte, was er vor der Explosion gehört hatte, war das Klacken des zweiten Schlosses gewesen. Nur langsam drang die Erinnerung an dieses Klacken wieder in sein Bewusstsein. Sie weckte seinen Überlebensinstinkt, und schließlich beherrschte ihn nur noch ein Gedanke: Der Turm würde ihn schützen.
Mit letzter Kraft zog er an der schweren Tür, doch sie öffnete sich nur einen kleinen Spalt weit. Ein lebloser Körper, den er in der Dunkelheit nur schwer ausmachen konnte, erschwerte das Öffnen, aber er hatte weder den Mut noch die Zeit, sich der Person anzunehmen, die offensichtlich gegen den Eingang geschleudert worden war. Danner bot seine letzten Kräfte auf, um den Spalt zumindest so weit zu vergrößern, dass er seinen wulstigen Leib hindurchzwängen konnte. Kaum war er im Inneren des Turms in Sicherheit, zog er das Tor wieder zu und verriegelte es mit zitternden Händen.
Verzweifelte Menschen trommelten gegen den kalten Stahl. Auch wenn Danner sie nicht hören konnte, weil das Pfeifen der Explosion noch in seinem Kopf nachhallte, konnte er sie dennoch spüren, als er langsam mit dem Rücken am Tor zu Boden glitt.
Er schloss die Augen und presste die Hände auf seine Ohren. Was sollte er nur tun? Sollte er wirklich sein eigenes Leben gefährden – oder sollte er das Chaos und das Leid einfach aussperren?
Zwei weitere Bomben der Royal Air Force nahmen ihm die Entscheidung ab. Sie mussten in unmittelbarer Nähe explodiert sein. Der Turm wurde so stark erschüttert, dass der Putz von der Decke bröckelte und auf Danner herabregnete. Nun erlosch selbst die gelbliche Notbeleuchtung im Turm. Für einen kurzen Augenblick war Danner bereit, alles zu bereuen, was er den Menschen im Dorf angetan hatte. Er gelobte, von nun an ein besserer Mensch zu sein, doch sein Stoßgebet kam zu spät. Plötzlich war es still. Sehr still. Und auch die trommelnden Fäuste, die er eben noch durch die Stahltüren gespürt hatte, waren für immer verstummt.
Ephraim I
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Fünfundsechzig Jahre waren seit der Ermordung seiner Familie vergangen. Fünfundsechzig Jahre, in denen Ephraim Zamir an jedem einzelnen Tag von diesem schmerzlichen Verlust begleitet wurde. Vor allem nachts holten ihn die grauenvollen Erinnerungen ein und zwangen ihn, die schmerzlichsten Momente immer und immer wieder aufs Neue zu durchleben.
Er hatte die Todesmaschinerie Auschwitz überlebt. Aber die Erinnerungen an diese Zeit, an den Tod seiner gesamten Familie und an die grauenvollen Versuche, die man an ihm und seinem Bruder durchgeführt hatte, quälten ihn Tag für Tag. Er fühlte sich schuldig, weil er als Einziger überlebt hatte, und schuldig, weil seine Mutter ihr Leben gelassen hatte, um seines zu schützen.
Zweimal hatte er nach dem Krieg als junger Mann die Rampe in Auschwitz besucht. Zweimal war er darauf zusammengebrochen und hatte mit den Fäusten auf den Beton gehämmert, auf die Stelle, an der er noch immer das Blut seiner Mutter zu sehen glaubte. Fast sein ganzes Leben lang war er nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt. Es gab eine Zeit, in der allein der Klang der deutschen Sprache die schlimmsten Erinnerungen wach werden ließ. Selbst Deutsch zu sprechen wagte er nicht, um sich nicht vor sich selbst ekeln zu müssen. Die Ironie des Schicksals war, dass ausgerechnet sein »arisches Aussehen« und sein akzentfreies Deutsch seinen Lebensweg bestimmt hatten. Mit zweiundsiebzig Jahren begann nun ein neuer Lebensabschnitt für ihn, ohne Beruf, ohne Verpflichtungen und ohne Familie, aber mit einer neuen Verantwortung.
Er war zurückgekehrt in die Geburtsstadt seiner Mutter, um dort seine letzten Jahre in Frieden zu verbringen. Das Haus, das einst der Familie seiner Mutter gehört hatte, stand längst nicht mehr – und doch fühlte er sich wohl bei dem Gedanken, dass seine Mutter hier eine unbeschwerte Kindheit und Jugend verlebt hatte, bevor sie seinen Vater kennenlernte und mit ihm in Falkenau eine eigene Familie gründete.
Nach all der Zeit suchte er nun endlich den Weg der Vergebung, versuchte nicht mehr, das Unrecht zu verstehen, sondern damit zu leben und zu verzeihen.
Gemächlich fuhr Ephraim in seinem schwarzen Jaguar einen Schotterweg entlang. Der Weg führte einen Hügel hinauf zu einem dunklen Turm, der sich in der Dämmerung vom Horizont abhob. Sein neues Zuhause.
Das achteckige Gemäuer wirkte wie das Überbleibsel einer mittelalterlichen Festung, war etwa dreißig Meter hoch und trug ein imposantes, spitz zulaufendes Schindeldach mit sechs integrierten Fenstern.
Der Turm hatte einst zu einem Dorf außerhalb der Stadt gehört. Er stand auf einem Hügel, der sich zwischen einem kleinen Wald und der Siedlung erhob. Inzwischen war dieses Dorf zu einem von vielen Stadtteilen der stetig wachsenden Metropole geworden. Und doch schien hier die Zeit stehen geblieben zu sein; prächtige Villen oder moderne Neubauten gab es kaum. Das mochte auch am neu erbauten Flughafen liegen, der in unmittelbarer Nähe lag und die Grundstückspreise auf niedrigem Niveau hielt. Tag und Nacht donnerten die Verkehrsflugzeuge über die Einwohner hinweg und nahmen dabei fast die gleiche Route wie einst die englischen Bomberflotten aus dem Norden.
Doch die Erinnerungen an jene düstere Zeit verblassten langsam, genau wie die Bilder auf den Grabsteinen der Gemeindekirche. Nur diese Grabsteine und eine Gedenktafel legten noch Zeugnis ab von der Tragödie, die am 8. Januar 1945 durch einen fehlgeleiteten Bombenabwurf hundertsiebenundsechzig Menschen, fast nur Frauen und Kinder, das Leben gekostet hatte.
Von alledem hatte Ephraim Zamir nichts gewusst, als er das Grundstück mit dem Turm erwarb. Während er das Dachgeschoss des Turms innerhalb eines Jahres aufwendig hatte umbauen lassen, verschwendete er keinen Gedanken an dessen verwilderte Umgebung, wo kniehohes Dornengestrüpp im Kampf mit dem Herbstwind lag. Den Anwohnern aber war dieser Schandfleck unerträglich. Selbst den Turm, dessen monströse Erscheinung schon in den Nachmittagsstunden einen breiten Schatten auf die angrenzenden Reihenhäuser der kleinen Siedlung warf, konnten sie nicht leiden. Seit man dieses hässliche Ding zudem unter Denkmalschutz gestellt hatte, blieb nur noch das verwahrloste Feld, das den Zorn der braven Bürger auf sich zog. Die Gemeinde war froh gewesen, dieses Problem durch den Verkauf an Ephraim Zamir loswerden zu können. Nun aber hagelte es Eingabe um Eingabe, was schließlich zu einem Ultimatum an den neuen Besitzer führte, der das Grundstück innerhalb eines Jahres angemessen begrünen musste. Ephraim hätte eine mannshohe Hecke mit Zaun um das Gelände errichten können, unterließ es aber, denn Mauern, Stacheldraht und Zäune hatten ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Ihr Anblick hatte sich in seine Seele eingebrannt wie die Tätowierung auf seinem linken Unterarm.
Unweigerlich musste er an den sauberen Spielplatz und die kleine Freizeitanlage denken, welche die Lagerkommandantur in Auschwitz für die Angehörigen des Personals hatte bauen lassen. Dort wurde, abgeschirmt durch eine hohe Mauer und einen elektrischen Stacheldraht, mit den Kindern gespielt und an geschmackvoll eingedeckten Kaffeetafeln gefeiert, während draußen der Tod wütete. Ordnung war des Deutschen liebstes Kind. Das hatte sich bis heute nicht geändert.
Trotz allem war Ephraim fest entschlossen, den Menschen wieder Vertrauen zu schenken, sich zu öffnen und andere an seinem Leben teilhaben zu lassen. In die Heimat seiner Eltern zurückzukehren, war ein erster Schritt in diese Richtung, der Beitritt zur jüdischen Gemeinde der Stadt ein nächster. Doch die größte Kraft schöpfte er aus der väterlichen Liebe zu Esther Goldstein, deren zarte Silhouette sich hinter einem beleuchteten Fenster im obersten Stockwerk des Turms abzeichnete. Sie war die Herausforderung, der er sich nun mit ganzer Kraft widmen wollte.
Das Schicksal hatte sie zusammengeführt, hatte beiden die Chance auf ein neues Leben gegeben. Und die Hoffnung darauf, die Vergangenheit vergessen zu können, auszusperren aus diesem Turm, der sie wie ein Bollwerk gegen Tiefschläge des Lebens schützen sollte und von dem aus sie den Blick hinab auf eine scheinbar heile Welt richten konnten.
An diesem Herbstabend zog ein heftiger Sturm auf. Früher als gewöhnlich verdunkelte die schnell dahinziehende Wolkendecke den Himmel. Ephraim Zamir parkte seinen Jaguar direkt vor den zwei geschwungenen Steintreppen, die symmetrisch von zwei Seiten am Fuße des vierstöckigen Turms aus zu den geschmiedeten Flügeltüren im ersten Stockwerk führten. Es gab einen weiteren Eingang auf der linken Seite des Turms, der in einen Garagenanbau mündete.
Ephraim war von kräftiger Statur und wirkte trotz seines hohen Alters durchtrainiert. Er trug einen dunklen Anzug über einem grob gestrickten, grauen Pullover. Dieser unterstrich das raue Äußere seiner Erscheinung ebenso wie der wild wuchernde Bart, der direkt in das volle, silberweiße Haar überging.
Kaum hatte er das Portal erreicht, schaltete sich vier Meter über ihm ein Scheinwerfer ein und tauchte den Eingang in warmes Licht. Eine automatische Kamera hatte ihn längst erfasst. Sie schickte ihre Bilder in das Dachgeschoss des Turms, wo Esther in der großzügig ausgebauten Wohnküche gerade das Essen zubereitete.
Der weiß getünchte Raum maß annähernd hundert Quadratmeter und besaß schräg sitzende Fenster in alle vier Himmelsrichtungen, die in einen spitz zusammenlaufenden Dachstuhl eingelassen waren. An seinem höchsten Punkt maß er sicher acht Meter. Der frei stehende steinerne Küchenblock, an dem Esther Kreplach zubereitete, erweckte den Eindruck, man stünde in der Kuppel einer Kathedrale vor einem Altar. Vor allem, wenn das Abendlicht schräg durch die Dachfenster auf den Küchenblock fiel, hatte der runde Raum etwas Sakrales, Ehrfürchtiges.
Kreplach richtig zuzubereiten war eine Kunst, die Esther von ihrer verstorbenen Mutter gelernt hatte. Es waren Teigtaschen nach Art der jüdischen Küche, die mit Rinderleber gefüllt wurden und die man traditionell am Vorabend von Jom Kippur aß, dem höchsten aller jüdischen Feiertage. In Augenblicken wie diesen war Esther ihrer Mutter ganz nahe und versank in Erinnerungen an glückliche Tage ihrer Kindheit.
Ein hoher Pfeifton ertönte in der Küche, den Esther aufgrund ihrer starken Hörbehinderung allerdings kaum wahrnahm. Doch das rote Blinken einer LED-Leuchte direkt oberhalb des Ofens kündigte ihr auch visuell unmissverständlich an, dass sich ein Besucher am Portal befand. Ihre konzentrierte Miene verwandelte sich in ein strahlendes Lächeln. Sie lief hinüber zur Wand, wo ein Monitor Ephraim zeigte, der mit stoischem Blick in die Kamera winkte.
Ephraim hätte am Eingang auch einen sechsstelligen Zahlencode eintippen können, um die Pforte zu öffnen, doch Esther hasste es, wenn er plötzlich unerwartet hinter ihr stand und sie dadurch fast zu Tode erschreckte.
Läuten zu müssen war nicht besonders effizient – und Ephraim war ein Mensch, für den Effizienz über alles ging –, doch für Esther war er bereit, sich von Grund auf zu ändern. Ja, er arbeitete an sich, auch wenn er dabei nur kleine Fortschritte machte. Esther kannte nur einen Teil seiner Lebensgeschichte, doch das war genug, um zu verstehen, dass diese gequälte Seele endlich zur Ruhe kommen musste. Und so war sie stolz auf jede seiner menschlichen Gesten, auf jede seiner positiven Veränderungen, waren sie auch noch so klein und unscheinbar.
Sie betätigte die Sensortaste zum automatischen Öffnen der schmiedeeisernen Tore und entledigte sich ihrer Küchenschürze. Nach allem, was sie in ihrer Heimat Israel erlebt hatte, kam es ihr wie ein Wunder Gottes vor, dass sie dieser gütige Mann wie eine Tochter aufgenommen hatte und die grauenvolle Vergangenheit mit jedem Tag mehr und mehr im Nebel verschwand.
Mit gebührendem Respekt und anerzogener Zurückhaltung wartete sie darauf, dass Ephraim die vier Stockwerke hinaufkam, während unten die Pforte mit einem leisen Klicken wieder automatisch ins Schloss schnappte.
Ephraim nahm immer mehrere Treppenstufen auf einmal, denn er mochte die unteren Stockwerke des Turms nicht besonders, die kalt und grau waren und nur wenig Licht abbekamen. Die steinerne Treppe endete schließlich vor einer schweren Holztür im dritten Stock, den er zum Großteil schon hatte renovieren lassen. Hinter der Holztür verbarg sich ein schmaler Gang, von dem aus mehrere Zimmertüren abzweigten. Nichts erinnerte hier mehr an die steinerne Kälte der unteren Stockwerke. Am Ende des Gangs führte eine steile Wendeltreppe nach oben, die schließlich in dem beeindruckenden ausgebauten Dachstuhl endete.
Kurzatmig begann sich Ephraim zu entschuldigen, sobald er Esthers engelsgleiches Antlitz über sich erblickte. Ihre weichen Gesichtszüge mit den großen, dunklen Augen wurden von tiefschwarzem, langem Haar eingerahmt, das ihr bis über die Schultern reichte und in starkem Kontrast zu ihrer hellen Haut stand. Die junge Frau trug eine hochgeschlossene Bluse mit einer Schleife sowie einen knielangen Rock, aus dem ihre Beine ragten wie zwei zerbrechliche Stelzen.
»Esther …« Er holte Luft. »Esther, es tut mir leid … Ich bin zu spät … Aber mein Gespräch mit dem Rabbi hat länger gedauert, als ich dachte …«
Esther lächelte milde, legte ihre Hände auf seine Schultern und küsste seine Wangen.
»Chalom, Ephaaim.«
Ihre Kehle brachte Laute hervor, die sie selbst kaum hörte, und so war es umso erstaunlicher, dass es ihr trotz ihrer fast vollständigen Gehörlosigkeit gelang, sich verbal zu artikulieren.
»Schalom, Esther«, erwiderte Ephraim und lächelte gequält, was Esther erahnen ließ, dass sein Gespräch mit Rabbi Shlomo Moshe nicht ganz so verlaufen war, wie er es sich erhofft hatte. Von Neugierde getrieben, stellte sie ihm hastig eine Frage in Gebärdensprache. Konzentriert, aber offensichtlich überfordert, versuchte Ephraim den schnell wechselnden Zeichen zu folgen, schüttelte aber schon bald den Kopf und nahm ihre kleinen Hände in seine.
»Halt, halt … Langsam, Esther.«
Er blickte ihr in die Augen, und seine Gesichtszüge entspannten sich leicht.
»Ich tue ja mein Bestes, um die Zeichen zu lernen, aber du bist … Du bist zu schnell.«
Ephraim öffnete seine Hände und gab ihre wieder frei. Langsam formte sie nun Zeichen für Zeichen und versuchte dabei zu sprechen, soweit es ihr möglich war.
»Aat die Gemeinee as Geel fü ie Synagooe anenommen?«
Den »Tanz der Finger«, wie Esther es gerne nannte, lernte Ephraim mit mäßigem Erfolg, aber ungebrochenem Willen seit einigen Monaten. Ein Scheitern kam nicht infrage, denn wie so oft in seinem Leben würde er am Ende triumphieren. Doch im Augenblick fiel es ihm leichter, ihrer Stimme zu lauschen, als ihre Zeichen richtig zu deuten.
»Es ist nicht einfach, Esther, du musst die Gemeinde verstehen. Sie sind nur vorsichtig und vielleicht auch zu stolz, um so viel Geld als Spende anzunehmen.«
Esthers Augen verrieten Unmut. »Sdoolz is die Masge de eigenen Fehlä.«
Ephraim war immer wieder überrascht, wie viel Entschlossenheit das zierliche Mädchen besaß. In dieser Hinsicht war sie ihm sehr ähnlich.
»Esther, es reicht nicht, aus dem Talmud zu zitieren, um die Ältesten von meinen ehrlichen Absichten zu überzeugen. Ich bin mir ganz sicher, früher oder später werden sie meine Spende akzeptieren, und dann wird der Bau der Synagoge fortgesetzt. Rabbi Moshe und die Stadträtin Seligmann sind auf meiner Seite.«
Ephraim legte ihr eine Hand väterlich auf die Schulter und schob die andere vorsichtig unter ihr Kinn, um ihr Gesicht anzuheben, bis er ihr tief in die Augen schauen konnte. Dabei zeigte er zum ersten Mal ein ehrliches Lächeln, eines, aus dem Esther Zuversicht und Hoffnung schöpfte.
»Esther, du wirst sehen. Der Bau der Synagoge wird in wenigen Wochen fortgesetzt. Da bin ich mir sicher.«
Er brachte es nicht übers Herz, Esther die komplizierte Wahrheit zu beichten, die zur Spaltung der jüdischen Gemeinde und am Ende zum Finanzierungsstopp geführt hatte. Geld allein konnte die Streithähne der Gemeinde nicht wieder zusammenbringen, aber Rabbi Moshe und Stadträtin Seligmann traute er durchaus zu, die Probleme gemeinsam zu lösen.
»Ephaaim, du bis ein guder Mensch!«
Der unerwartete Zuspruch sollte Ephraim in seinem Vorhaben bestärken und ihm Zuversicht geben, doch Esther erreichte damit das Gegenteil.
Ephraim zog seine Hände zurück. Sein Blick war nun wieder so kalt wie zuvor. Das Kompliment hatte eine Tür zu seinen dunkelsten Abgründen aufgestoßen. Denn anders als Esther besaß er nicht die Fähigkeit, einen dichten Nebel über seine Vergangenheit zu legen. Seine Geheimnisse verbargen sich hinter Hunderten von Türen, und kaum hatte er eine davon verschlossen, öffnete sich eine andere wie von selbst und peinigte seine Seele aufs Neue.
Ephraims Stimme klang schroff und zurechtweisend.
»Nur weil ich Geld spende, macht mich das noch lange nicht zu einem guten Menschen, Esther.«
Wortlos wandte er sich ab und zog sich ein Stockwerk tiefer in seinen Privatbereich zurück.
Esther sah ihm nach, wie er die Wendeltreppe hinunterging und verschwand. Morgen würden sie zum vierten Mal gemeinsam Jom Kippur feiern, und noch immer war ihr dieser gütige Mensch so fremd wie kaum ein anderer.
Karl I
Sonntag, 23. August 1992
Die Vorhänge im zweiten Stock des Altbaus waren zugezogen, damit die Bewohner am Sonntagmorgen nicht allzu früh durch die Sonne geweckt wurden. Das Mehrfamilienhaus lag in Anklam, östlich vom Zentrum im Stadtteil Schanzenberg, wo es keine Plattenbauten gab. Trotz aller Abwanderungsprobleme hatte sich hier nach dem Fall der Mauer der wohlhabende Mittelstand angesiedelt. Karl Riegers Vater hatte nach der Wende den richtigen Riecher gehabt und einen Telefonladen im Ort eröffnet. Anfangs hielten ihn seine Bekannten und Freunde für verrückt, doch mittlerweile boomte das Geschäft. Anfang des Jahres hatten sie sich endlich eine bessere Wohnung leisten und die verhasste Plattenbausiedlung verlassen können.
Es würde wieder ein heißer Sommertag werden. Da Karls Zimmer nach Osten hin lag, bekam er schon in aller Frühe die Kraft der Sonne zu spüren, die sich auch durch die dünnen Vorhänge an seinen Fenstern kaum abhalten ließ.
Karl wälzte sich unruhig im Bett herum und schlug schließlich die Augen auf. Verdammte Hitze!
Es war Sonntag, sein letzter freier Tag. Fast sechs Wochen Ferien lagen hinter ihm. Sechs Wochen Langeweile in diesem grauenvollen Kaff am Arsch der Welt.
Karl setzte sich verschlafen auf die Bettkante und fuhr sich mit beiden Händen über die kurzen Haarstoppel, rieb sich das pickelige Kinn, auf dem ein erster heller Bartflaum wuchs. Die hohen Wangenknochen und dunklen Augen verliehen seinem Äußeren eine bedrohliche Aura. Er trug ein weißes Unterhemd, unter dem sich sein sehniger Körper abzeichnete, der dem regelmäßigen Karatetraining geschuldet war. In ein paar Wochen würde er die Prüfung für den braunen Gürtel ablegen – ungewöhnlich für einen Jungen, der gerade sechzehn geworden war.
Karls Blick streifte seinen Schulranzen mit Camouflage-Muster. Morgen würde die Schule wieder losgehen. Er hatte kein Problem damit, im Gegenteil, er war der Beste seiner Klasse am Lilienthal-Gymnasium und wusste, dass ein guter Abschluss seine Fahrkarte in eine bessere Welt war.
Ach, Scheiße. Eine bessere Welt? Eine Welt voll mit Schwulen, Asylanten und Juden.
Er griff nach der Zigarettenschachtel, die er auf seinem Nachttisch deponiert hatte, dann ging er zum Fenster, zog den Vorhang zur Seite und öffnete es. Die Sonne blendete ihn, doch er genoss die warmen Strahlen und zündete sich eine Zigarette an. Er schloss die Augen. Ein tiefer Zug füllte seine Lunge mit Nikotin, bis schließlich weißer Rauch langsam aus seiner Nase stieg.
Er musste an seinen Opa Alois denken, der immer nach Zigaretten gerochen hatte. Ein tapferer, alter Kriegsveteran, der viel zu früh gestorben war. Seine Soldatengeschichten hatten ihm schon als kleiner Junge mehr Freude bereitet als alles andere auf der Welt.
Er erinnerte sich gut an die Besuche bei Oma und Opa in Stralsund. Es war jedes Mal eine zeitraubende Reise mit dem Zug gewesen. Einen Trabi konnten sich seine Eltern nicht leisten. Belohnt wurde der kleine Karl bei der Ankunft immer mit Erdbeeren aus Omas Garten und mit Opas Kriegsgeschichten.
Eine sehr steile und enge Treppe im Haus seiner Großeltern führte hinauf in Opas kleines Reich. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals wieder solch eine abenteuerliche Treppe gesehen zu haben. Seine Mutter hatte immer furchtbare Angst um den kleinen Karl gehabt, wenn er mit seinen kurzen Beinchen die Treppe hinaufstieg. Versuchte sie zu helfen, kam sofort von oben die mahnende Stimme des Vaters. »Der Bengel wird nie ein Mann, wenn du ihn nicht mal allein die Treppe hochsteigen lässt!«
»Und wenn er stürzt?«, entgegnete sie besorgt.
»Na und? Ein paar Schrammen haben noch niemanden umgebracht!«
Opa war selbst mit siebzig Jahren noch ein rüstiger Mann mit borstigem, silbergrauem Haar gewesen, im Nacken und über den Ohren militärisch korrekt abrasiert. An der linken Schläfe hatte eine breite Narbe die Haare wie ein Seitenscheitel geteilt. Wegen seiner hängenden Wangen und großen Tränensäcke hatte er Karl an die traurig dreinblickende Dogge seines Onkels erinnert. Kaum vorstellbar, dass dieser liebevolle Opa, der mit ihm gespielt und Panzermodelle zusammengebaut hatte, einst der kernige Oberfeldwebel gewesen war, den er aus Omas vergilbten Fotoalben kannte. Das Bild, auf dem er in Ausgehuniform stolz sein Eisernes Kreuz erster Klasse präsentierte, umringt von seiner Frau, seinem erwachsenen Sohn und seinen zwei kleinen Töchtern, gefiel dem kleinen Karl ganz besonders. Auf seinem Schoß sitzend, eng an seinen Brustkorb geschmiegt, folgte er gebannt Opas Geschichten, in denen er Partisanenstellungen in die Luft jagte oder den Angriff russischer Einheiten praktisch im Alleingang abwehrte.
Als Karl zwölf Jahre alt und zu schwer für Opas Schoß geworden war, fuhr dieser eines Tages mit ihm an die polnische Grenze und nahm ihn mit auf einen winterlichen Spaziergang. Opa war nicht der Typ, der gerne spazieren ging. Gewöhnlich saß er in seinem Zimmer und ging nur selten aus dem Haus. Aber an diesem kalten Wintermorgen wurde aus dem liebevollen Opa ein Mann mit einem Namen, ein Mann mit einer Botschaft, der seinem Enkel die Tragödie erklärte, in der sich Deutschland, ja, sogar die ganze Welt befand. In Karl fand dieser Mann einen willigen Schüler, der alles begierig aufsaugte, was der Mentor von sich gab.
»Die Juden sind an allem schuld!« Das war der Satz, der sich Karl tief ins Bewusstsein brannte, genauso wie die Geräusche des knirschenden Schnees unter ihren Füßen und Alois’ verbissene Miene.
Alois erzählte ihm von der Verschwörung des »jüdischen Bolschewismus«, der nicht nur die Weltherrschaft anstrebte, sondern auch für den Ersten und sogar den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war. Er klärte ihn darüber auf, dass Hitler gar nicht anders konnte, als Russland anzugreifen, um einem Angriff zuvorzukommen. Alois erzählte ihm vom angeblichen Holocaust. Davon, dass diese Gräueltaten nie geschehen seien, dass der Holocaust eine Erfindung der Siegermächte war, um die Deutschen kleinzuhalten und sie gnadenlos ausbeuten zu können. Und er erzählte ihm vom Schicksal seiner Familie, die ursprünglich aus Ostpreußen stammte, wohlhabend gewesen war und ihres ganzen Besitzes beraubt wurde, als sie vor den russischen Eroberern flüchten musste.
Sie waren eine Stunde durch kniehohen Schnee gestapft, und Alois hatte nicht eine Sekunde lang aufgehört zu reden, während Karl sich anstrengen musste, mit ihm Schritt zu halten. Schließlich waren sie an einem Fluss angekommen, wo Alois den Arm Richtung Osten ausstreckte.
»Das ist die Oder, Karl. Und dahinter liegt heute Polen. Früher einmal gehörte das alles zu Deutschland. Vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg.«
Dann schwieg er. Sein Blick hing fest am Horizont, fast so, als könnte er die Vergangenheit vor seinem inneren Auge wieder zum Leben erwecken. Ihr Atem bildete in der Kälte neblige Wolken.
Alois holte ein Stofftaschentuch aus seiner Manteltasche, schnäuzte sich laut und fuhr schließlich mit ruhiger, tiefer Stimme fort: »Unsere Heimat, der Ort, an dem ich und deine Großmutter geboren wurden, liegt heute in Polen, weil die Russen nach dem Krieg den Polen ein riesiges Gebiet abgenommen und ihnen dafür unser Land als Entschädigung gegeben haben.«
Minutiös erklärte er Karl, dass nicht nur die Teilung Deutschlands großes Unrecht war, sondern auch die Abtretung dieser Gebiete, die, völkerrechtlich gesehen, niemals hätte passieren dürfen.
»Krieg hin oder her«, seine Hand erhob sich wieder gen Osten, »hier hat die Welt tatenlos zugesehen, wie der Iwan Tausende von Deutschen ermordet und vertrieben hat, um unser Land zu stehlen.«
Karls Hände begannen zu zittern. Er konnte nicht sagen, ob es an der Kälte oder der Wut über diese Ungerechtigkeit lag.
Der Großvater packte ihn schließlich an den Schultern, dann kniete er sich vor ihm in den eisigen Schnee.
»Wir dürfen dieses Unrecht niemals vergessen, Karl.«
Seine Augen hatten jegliche großväterliche Wärme verloren.
»Du darfst das niemals vergessen! Deine Generation muss zu Ende bringen, was wir nicht geschafft haben. Verstehst du das?«
Karl nickte, auch wenn er nicht wirklich verstand, was Alois damit meinte.
Auf dem Rückweg durch den Schnee sprach Alois kein einziges Wort. Karl hatte so viele Fragen und konnte doch keine einzige aussprechen. Die vielen neuen, schockierenden Erkenntnisse schwirrten in seinem Kopf herum wie ein wild gewordener Bienenschwarm. Nur ein Satz durchdrang diesen Schwarm immer wieder:
»Die Juden sind an allem schuld!«
Es war das letzte Mal, dass Karl seinen Opa gesehen hatte. Er war nur wenige Monate später gestorben, noch bevor die Mauer fiel.
Karl zog ein letztes Mal an der Zigarette, dann schnippte er den Stummel weit von sich. In hohem Bogen flog er auf die Straße. Langsam trottete Karl in Unterhose und Unterhemd in die Küche. Normalerweise war seine Mutter um diese Uhrzeit schon wach und brutzelte für »ihre Jungs« Eier mit Speck, aber der Speck lag unangetastet auf einem Brett neben der kalten Pfanne.
Dann hörte er den Fernseher aus dem Wohnzimmer – ungewöhnlich um diese Uhrzeit, da seine Eltern ihn eigentlich nur am Abend einschalteten. Neugierig betrat Karl das Wohnzimmer. Zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass nicht nur seine Mutter, sondern auch sein Vater gebannt auf den Bildschirm starrten.
Dort waren nächtliche Krawalle zu sehen, Demonstranten warfen Steine auf Polizisten, die offensichtlich versuchten, ein Asylantenheim vor der Menge zu schützen. Es war von zweitausend Bürgern die Rede, die am vergangenen Abend gegen das Asylantenheim in Rostock-Lichtenhagen demonstriert hatten.
Karls Augen funkelten vor Erregung.
»Deutschland erwacht!«, rief er aus und erntete dafür Applaus von seinem Vater. »Ich muss Kai anrufen! Es geht los, es geht endlich los …«
Mit diesen Worten wandte er sich ab und stürzte zurück in sein Zimmer, um sich anzuziehen.
Seit Wochen war klar gewesen, dass es in Rostock irgendwann krachen würde. Das Auffanglager für Asylbewerber in Lichtenhagen war vollkommen überfüllt. Es lag in einem elfgeschossigen Plattenbau und belegte dort einen von zwölf Hauseingängen. Über dreihundert Neuankömmlinge kampierten in Decken und Plastiksäcken gehüllt auf den angrenzenden Grünanlagen und mussten ihre Notdurft an der Mauer des Plattenbaus verrichten. Die Stadt weigerte sich, mobile Toiletten aufzubauen, um die Situation nicht zu »legalisieren«. Der Zorn der Anwohner wurde von Tag zu Tag größer. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dieses Pulverfass explodieren würde. Sogar die Zeitungen hatten über die Drohungen der rechten Szene geschrieben, aber die Behörden hatten weiterhin tatenlos zugesehen.
Karl und sein bester Freund Kai hatten die Entwicklung mit Spannung verfolgt. Ihr Plan war ganz einfach: Sobald die ersten Steine flogen, würden sie sich auf den Weg machen, um endlich den Anschluss zur Szene zu bekommen.
Gerade als Karl seinen Freund anrufen wollte, läutete das Telefon. Kai war am Apparat.
»Hast du es gesehen?« Er atmete schnell, und seine Stimme vibrierte vor Aufregung.
»Und wie ich es gesehen habe. Ist das geil!«
»Wie schnell kannst du fertig sein?«
»Ich bin fertig!« Karl blickte auf seine Unterhose. »Ich bin fertig, wenn du da bist. Hast du das Auto?«
»Alles organisiert. Nach Rostock sind’s eineinhalb Stunden. Aber was machen wir, wenn die Sache länger dauert? Morgen ist Schule.«
Karl grinste. »Scheiß auf die Schule!«
Achtzehn Jahre später
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Die Wohnung in der Großstadt befand sich in einem der schmucklosen Häuser, die man nach dem Krieg im Rahmen des »Großsiedlungsbaus« aus dem Boden gestampft hatte und die in ihrer Uniformität kaum zu überbieten waren. Die Architektur mit kleinen Fenstern in niedrigen Räumen hinter ebenso kleinen Balkonen gab den Bewohnern der Sozialwohnungen, die man in den Sechzigern und Siebzigern in Trabantenstädten am Rande der Ballungszentren zusammengepfercht hatte, deutlich zu verstehen, dass sie Menschen zweiter Klasse waren.
Der Bestand von hunderttausend Wohnungen des staatlichen Konzerns Neue Heimat hatte sich damals in kürzester Zeit verdoppelt. Die Profitgier der Verantwortlichen kannte keine Grenzen, denn dank der staatlichen Subventionierung war mit Immobilien in den sozialen Brennpunkten der Städte mehr Geld zu verdienen als mit Luxusvillen und Golfplätzen. Als der Spiegel in den Achtzigerjahren nachweisen konnte, dass sich der Vorstand des Konzerns jahrelang an den Mieteinnahmen bereichert hatte, löste dies zwar einen großen Skandal aus, für die Betroffenen änderte sich aber letztendlich nichts.
Ironischerweise hatten einst die Nationalsozialisten bei ihrer Machtübernahme 1933 den Konzern mit enteignetem Gewerkschaftsbesitz gegründet und ihm 1939 schließlich den Namen »Neue Heimat« gegeben.
All das hatte Karl Rieger jedoch nicht gewusst, als er vor einigen Jahren diese Wohnung bezogen hatte. Hätte er es gewusst, hätte er die Wohnung deutlich mehr geschätzt und sich darin bestätigt gefühlt, dass wieder einmal eine starke nationalsozialistische Idee zur Verbesserung des Volkskörpers vom Geschwür des demokratisch kapitalistischen Staates erdrückt worden war.
So aber war das Gebäude, in dem dieses dunkle Loch lag, nur ein von dreckigen Ausländern verseuchtes, notwendiges Übel, das er zutiefst verabscheute.
Die Sonne war fast untergegangen, und der Computerbildschirm tauchte die Einzimmerwohnung in gespenstisches Licht. Der Computer stand an der Wand direkt unter einer Hakenkreuzfahne. Ansonsten gab es kaum Wandschmuck, bis auf ein großes Banner, auf dem in Frakturschrift ein Zitat des einstigen Propagandaministers Joseph Goebbels prangte:
WIR DENKEN MIT UNSEREM BLUT!
Auf einem Sideboard standen Bilderrahmen mit Porträts von Hitler, Himmler, Göring und Heß fein säuberlich aufgereiht. Davor lag auf einem weinroten Samtkissen ein Offiziersdolch mit den SS-Runen. Überhaupt hatte Karl jeden Gegenstand und jedes Foto mit Bedacht platziert, und auch die Nazi-Relikte und Spielzeugpanzer der deutschen Wehrmacht in einer Glasvitrine waren exakt symmetrisch ausgerichtet.
Selbst seine Hemden hatte Karl Rieger ganz in soldatischer Tradition exakt im DIN-A4-Format gefaltet und im einzigen Schrank übereinandergeschichtet. Es war ein IKEA-Schrank, ein gutes, nordisches Produkt, auch wenn Karl dem Gründer Ingvar Kamprad übel nahm, dass sich der einst aktive Nationalsozialist 1994 öffentlich von der Bewegung abgewandt hatte, um seinen wirtschaftlichen Erfolg nicht zu gefährden. Außerdem gab es hier nur noch eine Couch, einen Tisch und ein Bücherregal. Der Raum wirkte durch die schlichte Ausstattung größer, als er eigentlich war.
Karl startete an seinem iMac Facetime. Er trug schwarze Jeans und dazu ein Unterhemd, das nicht ausreichte, um das tätowierte Hakenkreuz auf seinem Rücken zu verbergen, da die Ausläufer der Swastika bis zu seinen Schultern reichten.
Seine Glatze war von kurzen, schwarzen Stoppeln besetzt, während sein Mund durch einen fein säuberlich gestutzten Oberlippenbart eingerahmt wurde, der in zwei schmalen Streifen bis hinab zum Kinn führte.
Sein Körper war immer noch durchtrainiert und sehnig. Längst hatte er den schwarzen Gürtel in Karate erreicht, aber bei Straßenkämpfen vertraute er lieber auf eine kurzläufige Schusswaffe, die er immer am Rücken im Hosenbund trug. Die Zeit, in der Karl dumpfe Krawallmache gesucht hatte, war allerdings vorbei. Er hatte längst eingesehen, dass es galt, strategischer und überlegter vorzugehen. In der Szene hörte man auf ihn. Er war ein geborener Anführer. Einer, der andere für eine Sache begeistern konnte. Einer, der durch seine Bildung und rhetorischen Fähigkeiten weit gefährlicher war als der Rest seiner braunen Clique.
Der Computer zeigte an, dass eine Verbindung zu »Leitwolf« aufgebaut wurde. Die Webcam filmte währenddessen Karls Gesicht, der sein Spiegelbild ungewollt in Augenschein nahm.
Hackfresse, was willst du? Du siehst aus wie dreißig und hast immer noch keine Ahnung, wer du bist oder was du eigentlich willst. Der Knast hat dich weich werden lassen!
Ein Piepton signalisierte, dass Leitwolf das Gespräch angenommen hatte. Karls Gesicht schrumpfte und rutschte in die linke untere Ecke des Bildschirms, als sein Gesprächspartner erschien. Ein karger Mann um die fünfzig, dessen wenige Haare nicht der Gesinnung, sondern dem Alter geschuldet waren. Er trug ein blaues Hemd mit offenem Kragen, und man konnte ihm förmlich ansehen, dass er sich soeben seiner Krawatte entledigt hatte. Sein schmales Gesicht wurde von einer schwarzen Hornbrille dominiert, deren starke Gläser die Augen kleiner erscheinen ließen, als sie waren.
Er grinste über das ganze Gesicht, als er Karl sah. Seine Stimme hatte einen stechenden, hohen Klang.
»Karl … Karl Rieger!«, sagte er, als könnte er es gar nicht fassen, ihn wiederzusehen. »Du siehst gut aus, Kamerad! Scheint, als hättest du im Gefängnis Urlaub gemacht. Du hast dich nicht unterkriegen lassen, stimmt’s?«
Karl schwieg. Es waren die üblichen Floskeln, wenn einer der Ihren nach dem Gefängnisaufenthalt begrüßt wurde. Bei diesem Ritual wurde keine Antwort erwartet, denn niemand wollte wissen, wie beschissen der Knast wirklich gewesen war.
»Gerd hat erzählt, du hättest im Knast einem Neger die Nase gebrochen, weil er dir an die Wäsche wollte! So kenne ich dich, Kamerad, immer schön die Arschbacken zusammen und Fünf auf die Zwölf. Karl lässt sich nicht ficken, von niemandem, habe ich recht?«
Nein, er hatte nicht recht. Karl hatte im Knast Prügel kassiert, und zwar heftig. Das Hakenkreuz auf seinem Rücken wirkte auf Kanaken und Neger wie ein rotes Tuch in der Stierkampfarena. Aber davon hatte er nach außen natürlich nichts durchdringen lassen. Im Gegenteil, als ihn Kameraden ein- oder zweimal im Knast besucht hatten, gab er sich als starker Mann mit Führernatur, der dem Untervolk den Willen der arischen Rasse aufzwängte.
»Ich konnte dich leider nicht persönlich abholen. Du weißt schon …«, fuhr Leitwolf, der eigentlich Wilhelm Thielen hieß, in gesenktem Tonfall fort.
»Du musst dich nicht entschuldigen!«, antwortete Karl, obwohl er ziemlich enttäuscht gewesen war, dass keine Sau aus der Kameradschaft ihn abgeholt hatte.
»Die Zeiten sind hart, Karl, wir müssen die Partei aus den Schlagzeilen halten. Und du weißt, wie schwer das im Augenblick ist.«
Alles für die Partei, dachte Karl.
Seit er denken konnte, war Thielen Bundesvorsitzender der NPD und hatte es in den letzten Jahren geschafft, die Partei aus der politischen Versenkung ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu holen. Doch seit man in jüngster Vergangenheit wiederholt versucht hatte, die NPD verbieten zu lassen, waren die Funktionäre bei öffentlichen Kundgebungen und Neonazi-Aufmärschen auf Tauchstation gegangen. Selbst bei den Kameradschaften ließen sich Parteimitglieder nur noch höchst selten blicken.
»Du verstehst, wenn man mich mit dir sieht, könnte das für neuen Wirbel sorgen und …«
Karl nickte und fiel ihm ins Wort: »Ist schon in Ordnung.«
Thielen grinste wieder und beugte sich näher zur Kamera.
»Hör zu. Wir haben große Pläne mit dir. Du kennst mich, Karl, ich mach keine Sprüche. Du weißt das, Karl, oder? Alles klar?«
Karl nickte, auch wenn er skeptisch war. Zu oft hatten ihn die Parteigenossen schon enttäuscht, zu oft hatten sie die radikalen Ideen der Kameradschaft boykottiert, und zu oft war Willkür die Triebfeder zahlreicher Aktionen. Aber es war der falsche Zeitpunkt, das zur Sprache zu bringen, also hörte er weiter zu.
»Du bist keiner dieser hirnlosen Schläger. Du hast Köpfchen, Karl. Du, du bist gerissen. Dir kann keiner in die Karten schauen, richtig?«, schmeichelte ihm Thielen. »Das ist gut, Karl, ich mag das. Ich bin selbst so. Keiner kann mich einschätzen, verstehst du? Immer erst denken, dann reden. Da sind wir uns ziemlich ähnlich.«
Karl wurde ungeduldig, wollte, dass Thielen endlich auf den Punkt kam.
»Was ist aus der Synagoge geworden?«
Thielen lehnte sich wieder zurück und zündete sich eine Zigarette an.
»Die Synagoge?«
Thielen zog tief an seiner Zigarette, so als müsse er sich erst stärken, um die Kraft für eine Antwort zu haben. Er inhalierte und blies den kalten Rauch in die Kamera, sodass sein Gesicht für kurze Zeit wie hinter Nebelschwaden verschwand.
»Eine blöde Sache ist das. Ein echt unangenehmes Thema. Willst du das wirklich wissen? Wird dich stinksauer machen!«
Das war keine rhetorische Frage, auch wenn Thielen wusste, dass Karl nicht lockerlassen würde.
»Sehe ich aus, als mache ich Witze?«
Thielen hatte keine Chance, er musste antworten.
»Die Juden haben … Die haben vielleicht eine neue Geldquelle.«
Thielen senkte etwas den Kopf und zog erneut an seiner Zigarette. Karls Augen weiteten sich leicht, ansonsten ließ er sich seine Wut kaum anmerken.
Eine scheiß Synagoge, mitten in meiner scheiß Stadt.
Doch seine Stimme blieb ruhig.
»Ich dachte, die Stadt hätte den Bau gestoppt?«
Thielen atmete durch. Eigentlich hatte er einen Tobsuchtsanfall von Karl Rieger erwartet, aber der Kamerad überraschte ihn immer wieder. Wer weiß? Eines Tages würde er es in der Partei vielleicht weit bringen.
»Die Stadt ist nicht das Problem. Die halten die Kassen geschlossen, solange sich die Itzigs gegenseitig fertigmachen. Nein, nein. Das Geld kommt offensichtlich von einem Privatmann. Irgendeiner reichen Judensau.«
»Irgendeine Idee, wer dieses Arschloch ist?«
An der Wohnungstür war ein Geräusch zu hören, das Karl für einen kurzen Augenblick ablenkte. Jemand versuchte aufzuschließen, scheiterte aber, da Karl seinen Schlüssel innen hatte stecken lassen. Karl ignorierte es und blickte wieder zum Bildschirm. Seine Augen verrieten nun blanke Wut.
»Noch nicht, aber das ist nicht deine Sache. Du hast Bewährung, Karl. Du musst jetzt sauber bleiben und schön brav zu deinem Bewährungshelfer gehen. Verstehst du? Brav bleiben! Hast du kapiert?«
Thielens Stimme klang nun fast väterlich. Er musste dafür sorgen, dass Rieger keinen Mist baute.
»Ich kümmere mich um die Sache«, sagte er beschwichtigend.
Der Besucher war inzwischen dazu übergegangen, die Türklingel zu malträtieren. Das schrille Geräusch war auch für Thielen nicht zu überhören.
»Ich muss Schluss machen!«, brachte Karl das Gespräch zum Abschluss. Und auch Thielen dankte innerlich dem Besucher für das unerwartet schnelle Ende des Gesprächs. Er zog nochmals an seiner Zigarette und blies den Rauch durch die Nasenlöcher.
»Bleib sauber, Karl, ich verlass mich auf dich! Heil Hitler!«
»Heil Hitler«, entgegnete Karl mechanisch, wobei seine rechte Hand kurz zuckte, dann aber doch nur die Maus betätigte, um die Verbindung zu beenden.
Der ungeduldige Besucher klopfte jetzt gegen die Tür. Karl öffnete mit einem kräftigen Ruck. Vor ihm stand grinsend ein schmächtiger Junge, der wie die Teenagerausgabe eines klassischen Skinheads aussah. Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel und die ersten Pickel im Gesicht. Der Kleine hieß Thomas Worch und gehörte seit knapp zwei Jahren zur Kameradschaft. Seine Freude über Karls Rückkehr war unübersehbar. Am liebsten hätte er ihn umarmt und fest an sich gedrückt. Aber so was machten echte Kerle nicht. Also versuchte er, seine Freude mit einem lässigen Spruch zu überspielen: »Na, Schlappschwanz, haben sie’s dir im Knast ordentlich besorgt?«
Dabei deutete er einen linken Haken an, aber Karl wehrte die harmlose Faust des Kindes blitzschnell ab und verpasste Thomas einen leichten Schlag in die Magengrube, der ihn ächzend in die Knie gehen ließ.
Thomas biss sich auf die Zähne und rappelte sich wieder auf.
»Scheiße, Mann! Das hat wehgetan.«
Karl verzog keine Miene.
»Sei kein verdammtes Mädchen, Kleiner.«
Er musterte den Jungen, der ihm mittlerweile bis zum Kinn reichte.
»Bist verdammt gewachsen in dem Jahr.«
»Fünfzehn Monate.«
Thomas hatte mitgezählt. Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag.
Endlich, Karls eiserner Blick verwandelte sich in ein Lächeln. Auf diesen Moment hatte Thomas all die Monate gewartet. Er hätte heulen können. Karl war nicht nur sein bester Freund, er war wie ein Vater, den er nie hatte.
»Hab deinen dreizehnten Geburtstag verpasst, tut mir echt leid …«, sagte Karl.
»Schon gut, ich werd doch schon in zwei Wochen vierzehn … alles cool …«
»Ehrlich?«
»Ehrlich.«
»Komm her, Großer!«, sagte Karl und drückte den Jungen, der hoffte, dieser Moment der Glückseligkeit würde nie vergehen, mit seinen kräftigen Armen fest an sich.
Nach einem kurzen Augenblick packte Karl den Kleinen an den Schultern und schob ihn wieder von sich. »Alles klar?« Er wandte sich ab und ging zielstrebig auf die Küche zu, während Thomas die Wohnungstür zuzog.
»Hast die Bude sauber gehalten. Hast sogar den alten Hermann abgestaubt. Dafür schulde ich dir was.«
»War keine große Sache, ehrlich«, sagte Thomas mit kleinlauter Stimme und fummelte nervös an einem Zippo-Feuerzeug herum, das er aus seiner Jackentasche geholt hatte.
Karl kehrte mit einer Flasche Wasser und zwei Gläsern aus der Küche zurück.
»Hast du Durst?«
»Hast du nicht was Anständiges? Einen Klaren oder so?«
Thomas ließ das Sturmfeuerzeug rhythmisch auf- und zuschnappen.
»Mach nicht auf harten Mann. Habe ich dir schon tausendmal gesagt. Die richtig harten Jungs brauchen keinen Schnaps.«
»Okay. Nein, lass mal …«
Karl zuckte mit den Schultern, schenkte nur sich Wasser ein und stellte die Flasche zusammen mit dem leeren Glas auf dem Sideboard neben der Göring-Büste ab.
»Mann, du hast das alte Teil noch!« Er nahm Thomas das Feuerzeug aus der Hand und betrachtete es aufmerksam. »Hatte Angst, du würdest es verticken!«
»Klar, Alter, seit du es mir geschenkt hast, habe ich es immer bei mir. Ist mein Glücksbringer.«
Nachdenklich fuhr Karl mit den Fingerspitzen über das eingravierte Hakenkreuz auf dem Metallgehäuse. Es war eine Fälschung. Nur die US-Armee hatte diese Feuerzeuge im Krieg benutzt, nicht die Wehrmacht, aber das wusste Thomas nicht. Im Gegenteil, Karl hatte ihm weisgemacht, dass dieses Unikat ein Erbstück seiner Familie sei und dass sein Großvater es bereits bei der Schlacht von Stalingrad dabeigehabt hatte. Er hatte Thomas die Geschichte im Beisein anderer Kameraden aufgetischt, und alle hatten sich fast in die Hosen gemacht, als der Junge das Stück mit leuchtenden Augen entgegennahm. Er war so leichtgläubig, man konnte ihm alles erzählen, er würde alles glauben. Nun hatte Karl fast ein schlechtes Gewissen, aber Thomas jetzt die Wahrheit zu sagen würde ihn sicher tief verletzen. Also ließ er es bleiben, deutete einen kurzen Haken an und öffnete dann seine Faust, aus der Thomas das geliebte Stück wieder entgegennahm.
»Erzähl vom Knast. Wie war das?«, forderte Thomas ihn auf. Karls Miene verzog sich, und er schüttelte kurz den Kopf.
»Das willst du nicht hören. Glaub mir einfach.«
»Die Jungs haben coole Sachen erzählt, wie du einem Neger die Zähne eingeschlagen hast.« Dabei lachte er fies, doch Karl war dabei gar nicht zum Lachen zumute.
»Alles Scheiße, Mann. Noch mal zum Mitschreiben: Der Knast war kein Zuckerschlecken. Verstehst du? Einmal und nie wieder. Hörst du mir zu?«
Thomas versuchte gerade, eine verknitterte Zigarettenpackung aus der Innentasche seiner Bomberjacke zu ziehen.
»Klar hör ich zu!«
»Scheiße, nein. Du hörst zu, aber du verstehst gar nichts.«
Endlich brachte Thomas die Zigarettenschachtel zum Vorschein, bemerkte dabei aber den gefalteten gelben Zettel nicht, der unbeachtet zu Boden fiel.
Karls Tonfall wurde rauer. »Schau mich an, Thomas!«
Thomas fummelte gerade eine der Zigaretten aus der zerknitterten Schachtel, ließ nun aber davon ab und gehorchte.
»Ich werde alles tun, um nie wieder in den Knast zu müssen. Verstanden?«
Sein Zeigefinger richtete sich auf Thomas.
»Und du, Kleiner, wirst da auch nie hinmüssen, verstehst du? Und wenn es das Letzte ist, wofür ich sorgen werde.«
Seine Halsschlagadern traten deutlich hervor. Er atmete schwer, und noch immer schwebte sein Zeigefinger bedrohlich vor Thomas’ Gesicht.
»Das Thema ist beendet. Sind wir uns einig?«
Thomas war etwas verstört. Er hatte eigentlich spannende Geschichten erwartet, die vor Blut und Gewalt nur so strotzten und bei denen Karl immer als Sieger hervorging. Aber das hier war nicht mehr der Karl, den er kannte. Karl hatte sich irgendwie verändert.
»Sind wir uns einig?«, hakte er noch einmal nach.
Thomas nickte, zog nun nervös eine Zigarette aus der Schachtel und steckte sie sich in den Mund. Doch offensichtlich hatte der neue Karl Rieger auch etwas gegen das Rauchen.
»Lass die Scheiße, das Zeug macht dich krank. Goethe hat schon gesagt: Rauchen macht dumm.«
Dabei verzog Karl versöhnlich seine Mundwinkel zu einem Grinsen, und Thomas atmete auf.
»Du liest Goethe?«, fragte er erleichtert. Geschickt entzündete er mit nur einer Hand das Zippo und steckte sich die Zigarette an. Karl ging in Richtung Küche, um einen Aschenbecher zu holen.
»War Pflichtlektüre an der Uni, zumindest bei unserem Prof.«
Er kam zurück und drückte Thomas den gläsernen Aschenbecher in die Hand.
»Weißt du, wie Zigaretten entstanden sind?«
Thomas schüttelte den Kopf.
»Ist schon lange her, weißt du? Damals gab’s noch keine Zigaretten, nur Pfeifen«, fuhr Karl fort. »In den mexikanischen Tabakfabriken haben die Arbeiterinnen den Tabak gesammelt, der auf den Boden gefallen war, und haben ihn in weißes Papier gerollt und verkauft, um sich was dazuzuverdienen. Verstehst du? Sie nannten die Dinger Papelitos.«
Thomas war immer wieder beeindruckt davon, was Karl alles wusste. In seinen Augen war Karl der klügste Mann, den er kannte. Man konnte ihn einfach alles fragen, und er hatte auf alles eine kluge Antwort.
»Was läuft zu Hause ab, alles okay?«
Das war ein wunder Punkt, aber Karl war der Meinung, ein Recht auf eine Antwort zu haben. Immerhin war er für Thomas so etwas wie ein Ersatzvater gewesen.
»Chris ist ausgezogen.«
»Chris? War das der aalglatte Typ mit der hässlichen Brille?«
»Nee. Das war der vorletzte Macker. Chris war ganz okay, nicht so ein Arschloch wie die anderen.«
Thomas zog an seiner Zigarette und versuchte dabei gelassen zu wirken.
»Und jetzt?«
»Jetzt hat sie ’nen dreckigen Jugo.«
Karl nahm die Hand vor die Augen und fuhr sich dann den Bart entlang, während er den Kopf schüttelte.
»O Mann, ist nicht dein Ernst.«
»Doch, ein scheiß Jugo!«
Thomas schnippte seine Asche ab und sagte ganz ruhig: »Ich sag’s nicht gern, aber meine verfickte Mutter ist eine verfickte Hure.«
Karl wusste, dass die coole Fassade nur Show war. Der Kleine hing an seiner Mutter und noch mehr an seinem Vater, aber der war ein richtiger Arsch. Statt bei der Scheidung um das Sorgerecht für seinen Sohn zu kämpfen, hatte der erfolgreiche Chirurg der Mutter gedroht, jeglichen Kontakt zu ihr und ihrem Sohn abzubrechen, sollte sie die Scheidung durchziehen – und genau das hatte er getan. Du kannst einem Mann per Gericht verbieten, sein Kind sehen zu dürfen – aber es gibt kein Gesetz der Welt, das einen Vater zwingen kann, seinen Sohn zu sehen oder gar zu lieben. Alle Briefe und Mails ließ er unbeantwortet, seine Telefonnummern hatte er ändern lassen. Ein Besuch der Mutter mit ihrem damals elfjährigen Sohn im Krankenhaus, wo der Vater arbeitete, lief völlig aus dem Ruder und endete in Geschrei, Tränen und dem Einsatz einer Polizeistreife, die Mutter und Kind aus dem Gebäude zerren musste. Etwas Vergleichbares hatten die beiden Polizisten zuvor nie erlebt, und zum ersten Mal in ihrer Laufbahn fragten sie sich, ob Recht und Gesetz wirklich dasselbe waren. Noch im Flur des Krankenhauses hatte der Vater seiner Ex-Frau hinterhergerufen: »Du hast es so gewollt, du hast das unserem Sohn angetan. Nicht ich!«
Eine Woche später bekamen Thomas und seine Mutter eine Unterlassungsklage und noch etwas später einen gerichtlichen Bescheid wegen massiven Stalkings, der beiden verbot, sich dem Vater künftig auf eine Entfernung von weniger als fünfzig Meter zu nähern.
»Und dein Alter?« Die Frage war Karl irgendwie herausgerutscht. Schnell ergänzte er deshalb: »Vergiss es.«
»Kein Problem«, gab sich Thomas ganz gelassen.
»Echt, vergiss es … Ist doch auch scheißegal, oder?«
»Klar, Mann. Hauptsache, die Kohle kommt jeden Monat rüber!« Thomas lachte gekünstelt, ballte die Hand zur Faust und reckte sie Karl entgegen, der sie mit seiner Faust berührte. In diesem Augenblick fiel Karl der zusammengefaltete Zettel am Boden auf, der Thomas aus der Tasche gerutscht sein musste.
»Was ist das?«
Thomas erschrak, als er den Zettel sah, und bückte sich danach. Aber Karl war schneller und stellte seinen Fuß darauf.
»Was soll das? Das ist mein Zettel!« Mit seinen immer noch kindlichen Fingern versuchte der Junge das Stück Papier unter dem Schuh hervorzuziehen, doch Karl gab ihm einen kräftigen Stoß, der ihn nach hinten umwarf. Der Aschenbecher polterte über den Laminatboden.