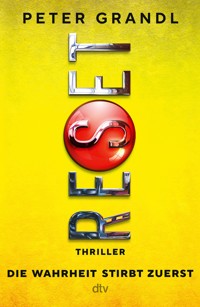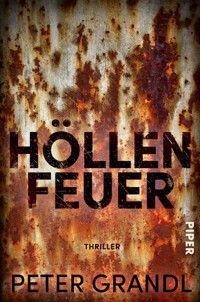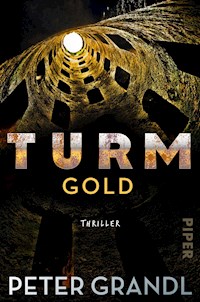
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach »Turmschatten« der zweite Band der aufsehenerregenden Thrillerreihe von Peter Grandl – noch aktueller, noch brisanter, noch packender! Rechtsextreme Terroristen halten in einem Hochbunker zehn jüdische Kinder und zwei Betreuerinnen gefangen. Die Forderung der Geiselnehmer: die Herausgabe ihres ehemaligen Kameraden Karl Rieger, der im Zeugenschutzprogramm lebt. Bekommen sie ihn nicht, werden die Kinder sterben. Kriminaloberrat Achim Schuster und sein Team steht vor einer unmöglichen Entscheidung. Was keiner der Betroffenen ahnt: Unter dem Turm befinden sich geheime Katakomben, in denen etwas lagert, das skrupellosen Mächten mehr wert ist als das Leben der Geiseln. Erschreckend nah an der Realität In »Turmgold« werden aktuelle Ereignisse und Entwicklungen wie zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke und der Rechtspopulismus der AfD aufgegriffen, der Thriller erzählt aber auch von einem fiktiven Umsturzversuch der Reichsbürger-Szene. Wie die jüngsten Nachrichtenmeldungen über die groß angelegte Anti-Terror-Aktion gegen die Reichsbürger-Szene im Dezember 2022 zeigen, ist das von Peter Grandl in seinem Thriller »Turmgold« entworfene Szenario aktueller denn je und erschreckend real. Peter Grandl schreibt über rechten Terror in Deutschland und stellt die LeserInnen vor ein moralisches Dilemma: Ist ein Leben mehr wert als ein anderes? Exzellent recherchiert und spannend bis zur letzten Seite! »Peter Grandl legt gezielt den Finger in die Wunde der deutschen Gesellschaft. Mit großartigem Erzähltalent verbindet er fiktive Elemente mit einer Wirklichkeit, die davon leider nicht allzu weit entfernt bleibt; das alles aber auf jeder Seite spannend und niemals belehrend. ›Turmschatten‹ ist ein Zeugnis unserer Zeit, das am Leser – im besten Sinne – nicht spurlos vorübergeht.« Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern »Hammer-Buch. Kommt bei Erstlingen nicht allzu oft vor. Peter Grandl ist so ein Coup gelungen. ›Turmschatten‹ ist unfasslich spannend, ein Pageturner, bei dem sogar die Flashbacks (jede Figur hat ihren sinnvollen Hintergrund) interessant sind. Überall ist die aktuelle Zeitgeschichte eingewoben, eine chronique scandaleuse des rechtsradikalen Terrors in der Bundesrepublik.« Thomas Wörtche, Culturmag »Extrem fesselnder und sehr gut recherchierter Polit-Thriller. ›Turmschatten‹ hat mich auf Grund seines hohen Realismus bis zur letzten Seite nicht mehr losgelassen.« Heiner Lauterbach »Peter Grandl beherrscht es grandios, Realität und Fiktion zu verbinden.« literaturschock.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Turmgold« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Disclaimer: Dieser Roman ist ein fiktionales Werk. Jegliche Ähnlichkeit mit aktuellen Ereignissen und lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Originalausgabe
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Lars Zwickies
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: arcangel/Mario Curcio; FinePic®, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Die Maske des Bösen
Prolog – Der Turm I
Sonntag, 4. Januar 1942
Marie I
Freitag, 16. Oktober 2020
Lutz I
Köln-Seeberg, 2007
Samstag, 17. Oktober 2015
Fünf Jahre später
Samstag, 17. Oktober 2020
Samstag, 17. Oktober 2020
Behrens I
September 2008
Paul I
Samstag, 17. Oktober 2020
Dezember 2010
Samstag, 17. Oktober 2020
Behrens II
Samstag, 10. September 2011
Marie II
Samstag, 17. Oktober 2020
Shalhevet I
Sonntag, 18. Oktober 2020
Donnerstag, 26. September 2013
Siebzig Jahre zuvor, 1943, Boryslaw, Polen
Donnerstag, 26. September 2013
Sonntag, 18. Oktober 2020
Steiner I
Sonntag, 18. Oktober 2020
Marie III
Sonntag, 18. Oktober 2020
Sechzehn Monate zuvor
Juni 2019
Hessel I
Sonntag, 18. Oktober 2020
Der Turm II
Montag, 19. Oktober 2020, 6:45 Uhr
Lutz II
Montag, 19. Oktober 2020, 11:12 Uhr
Kucera I
19. Oktober 2020, 11:17 Uhr
Shalhevet II
19. Oktober 2020, 11:21 Uhr
BEHRENS III
19. Oktober 2020, 11:25 Uhr
Neun Monate zuvor
28. Januar 2020
Der Turm III
Montag, 19. Oktober 2020, 11:21 Uhr
Shalhevet III
19. Oktober 2020, 11:34 Uhr
Steiner II
Montag, 19. Oktober 2020, 11:45 Uhr
Kucera II
Montag, 19. Oktober 2020, 11:46 Uhr
Siebzehn Tage zuvor
Der Turm IV
Montag, 19. Oktober 2020, 11:55 Uhr
Stephanie I
19. Oktober 2020, 12:01 Uhr
Hessel II
19. Oktober 2020, 12:04 Uhr
Sechzehn Monate zuvor
Juni 2019
Gegenwart
19. Oktober 2020, 12:08 Uhr
Esra I
Montag, 19. Oktober 2020, 12:07 Uhr
Steiner III
Montag, 19. Oktober 2020, 12:11 Uhr
Schuster I
Montag, 19. Oktober 2020, 12:16 Uhr
Steiner IV
Montag, 19. Oktober 2020, 12:24 Uhr
Erdmann I
Montag, 19. Oktober 2020, 12:25 Uhr
Shalhevet IV
Montag, 19. Oktober 2020, 12:31 Uhr
Hessel III
Montag, 19. Oktober 2020, 12:35 Uhr
Marie IV
Montag, 19. Oktober 2020, 12:39 Uhr
Schuster II
Montag, 19. Oktober 2020, 12:45 Uhr
Paul II
Montag, 19. Oktober 2020, 13 Uhr
Maja
Montag, 19. Oktober 2020, 13:07 Uhr
Schuster III
Montag, 19. Oktober 2020, 13:34 Uhr
Karin Thaller I
Montag, 19. Oktober 2020, 13:58 Uhr
Marie V
Montag, 19. Oktober 2020, 14:24 Uhr
Steiner V
Montag, 19. Oktober 2020, 14 Uhr
Shalhevet V
Eine halbe Stunde zuvor
Der Turm V
Montag, 19. Oktober 2020, 14:53 Uhr
Otterbach
Montag, 19. Oktober 2020, 15:11 Uhr
Der Turm VI
Montag, 19. Oktober 2020, 15:32 Uhr
Fabienne
Montag, 19. Oktober 2020, 15:33 Uhr
Fünf Jahre zuvor
Lutz III
Montag, 19. Oktober 2020, 15:35 Uhr
Schuster IV
Montag, 19. Oktober 2020, 15:51 Uhr
Hessel IV
Montag, 19. Oktober 2020, 16 Uhr
Der Turm VII
Montag, 19. Oktober 2020, 16:05 Uhr
Hessel V
Montag, 19. Oktober 2020, 16:30 Uhr
Der Turm VIII
Montag, 19. Oktober 2020, 16:40 Uhr
Karin Thaller II
Montag, 19. Oktober 2020, 16:44 Uhr
Marie VI
Montag, 19. Oktober 2020, 16:48 Uhr
Shalhevet V
Dienstag, 20. Oktober 2020, 18:08 Uhr
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
DIE MASKE DES BÖSEN
An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk
Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack.
Mitfühlend sehe ich
Die geschwollenen Stirnadern, andeutend
Wie anstrengend es ist, böse zu sein.
Bertolt Brecht, September 1942
Prolog – Der Turm I
Sonntag, 4. Januar 1942
Der Himmel war wolkenverhangen. Das Dorf in der Nähe der Großstadt lag gespenstisch im Dunkeln. Obwohl es erst auf 19 Uhr zuging, drang aus keinem der Häuser auch nur ein einziger Lichtstrahl.
Wolfgang Danner, der gut beleibte Ortsgruppenleiter der NSDAP, fand trotzdem mit einer kleinen Taschenlampe seinen Weg durch die vertrauten Gassen der eingeschneiten Häuser.
Danner drehte Abend für Abend pflichtbesessen seine Runde, um die Verdunklungsvorschriften zu überwachen und gegebenenfalls Verstöße zu ahnden. Für ihn war es die einzige Möglichkeit, dem Großdeutschen Reich zu dienen. Er hatte sich erst vor einigen Wochen selbst zum örtlichen Luftschutzleiter ernannt, nachdem sein Vorgänger an die Ostfront berufen worden war. Die Eroberung Russlands war vor Moskau ins Stocken geraten, aber in seinen Augen war das nur eine Verschnaufpause für die tapfere Allianz aus brüderlichen Nationen, die im Frühjahr die bolschewistischen Horden sicher endgültig besiegen würden. Er bedauerte zutiefst, dass er nicht mit ihnen gegen die Feinde des Reiches marschieren durfte.
Mit knapp vierzig Jahren hätte auch Danner für Volk und Vaterland lieber an der Front gekämpft, um für den Führer die Stellung Deutschlands als Großmacht – nein, als Weltmacht – wiederherzustellen.
Nach den überraschenden Siegen der glorreichen Wehrmacht in Polen, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich und am Balkan stellte er sich den Krieg des überlegenen deutschen Landsers wie einen Wochenschaubeitrag vor, in dem sich der Feind schon beim Anblick der schneidigen deutschen Kameraden aus dem Staub machte und schleunigst das Weite suchte. Ein Abenteuer, das ihm leider verwehrt blieb – und das alles nur wegen seines eingedrehten linken Fußes, den sein Arzt auch abfällig als Klumpfuß bezeichnete. Seiner Ansicht nach war die Behinderung aber kaum zu bemerken, zumindest nicht so deutlich wie bei Reichsminister Goebbels, der für jeden sichtbar humpelte. Und trotzdem hatte man Danner als »arbeitsverwendungsfähig« der Fehlergruppe U zugeordnet, was so viel bedeutete wie: Heimatschutz statt Front.
Bald würde der Krieg vorbei sein, und er ahnte schon, wie er schließlich zur Zielscheibe für den Spott der heimkehrenden Helden werden würde. Er konnte in Gedanken bereits hören, wie sie witzelten: Der fette Wolfi war das Bollwerk an der Heimatfront.
Er hasste seinen Fuß.
Genau wie viele seiner Landsleute glaubte Danner bedingungslos an die Doktrin von der arischen Rasse, die allen anderen weit überlegen sei. Aber darin lag ein Problem, denn Danners Großmutter mütterlicherseits war Jüdin gewesen – was ihn nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 zum »Mischling zweiten Grades« machte oder, wie der Volksmund sagte, zum Vierteljuden.
Der Klumpfuß war sicher ein Erbe aus dieser absonderlichen Linie, dachte er oft und stellte sich dabei die Frage, ob er wohl ein reinrassiger Arier wäre, wenn er sich den Fuß einfach abhacken würde. Und obwohl er sich dessen ziemlich sicher war, fehlte ihm der Mut zu einer solchen Tat, die noch dazu im Reich als Selbstverstümmelung einen Strafbestand darstellte; seine Arbeitskraft, ja, selbst sein Leben gehörten schließlich Adolf Hitler. Also war es nur gut, dass außer ihm, dem Dorfpfarrer und einem tattrigen Standesbeamten niemand von seiner jüdischen Großmutter wusste. Damit das auch so blieb, hatte er den beiden Mitwissern je eine Sau zukommen lassen, woraufhin man die entsprechenden Einträge in den vergilbten Dokumenten schwärzte.
Danner hatte seine Runde fast beendet und sehnte sich nach der warmen Stube und Musik aus seinem nagelneuen Volksempfänger. Doch eines galt es am Ende jedes Kontrollgangs noch zu befriedigen: seine Neugier. Auch die eisige Kälte von minus zwölf Grad konnte ihn nicht davon abhalten, wie üblich einen Blick auf die Baustelle zu werfen, wo seit geraumer Zeit auch nachts rege Betriebsamkeit herrschte.
Danners Schäferhund Prinz war bereits vorausgeeilt und wartete am Dorfausgang auf sein Herrchen. Danner warf ihm wie gewohnt an dieser Stelle ein paar Stücke von einem abgehackten Schweineschwanz in den Schnee, die Prinz sofort gierig verschlang. Danner hingegen hatte nur Augen für den mächtigen Hügel vor sich. Er spürte Vibrationen unter seinen Füßen, als würde Luzifer sich persönlich aus der Hölle nach oben graben.
Wie auf ein geheimes Zeichen riss die Wolkendecke auf, und der Mond tauchte den Hügel in blaues Licht. Seit über einem Jahr wurde dort oben an einem Turm gebaut – oder besser gesagt an einem achteckigen Hochbunker, der eher einem mittelalterlichen Wehrturm ähnelte als einem Bollwerk zum Schutz der Zivilisten vor feindlichen Luftangriffen. Bereits kurz nach Kriegsbeginn hatte Danner den Bau eines ähnlichen Hochbunkers in einer angrenzenden Gemeinde miterlebt. Erstaunlicherweise war jener Turm innerhalb von sechs Monaten fertiggestellt worden. Die Baustelle war damals frei zugänglich gewesen, während der Bau dieses Bunkers unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Man hatte den gesamten Hügel mit einem meterhohen Sichtschutz eingezäunt, der am oberen Ende mit Stacheldraht abschloss. Vier Wachtürme, die durchgehend besetzt und mit jeweils einem Scheinwerfer bestückt waren, überragten den Zaun rund um die Baustelle. Am Zaun befanden sich zudem zahlreiche Schilder, die neugierige Zivilisten auf Abstand halten sollten.
MILITÄRISCHES SPERRGEBIET
UNBEFUGTES BETRETEN STRENGSTENS VERBOTEN
FOTOGRAFIEREN STRENGSTENS VERBOTEN
PAUSIEREN UND AUFENTHALT AM ZAUN VERBOTEN
WACHPERSONAL MACHT GEBRAUCH VON DER SCHUSSWAFFE
All das hatte ihn stutzig gemacht, und so hatte er vor Monaten begonnen, insgeheim Nachforschungen anzustellen. Er bestach Parteifreunde und erhielt dadurch Einsicht in Materiallisten der durchführenden Baufirma, deren bestellte Betonmenge sicher auch für zwei Türme ausgereicht hätte.
Am auffälligsten an den Listen waren aber Gerätschaften, die vor allem im Tiefbau Verwendung fanden, wie ihm ein greiser Mann aus dem Dorf bestätigte, der früher in einem Bergwerk gearbeitet hatte. Und schließlich wunderte ihn die nächtliche Festtagsbeleuchtung, die seine pflichtbewussten Kontrollgänge zur Einhaltung der Luftschutzbestimmungen geradezu verhöhnte. Zwar waren englische Bombardements auf deutsche Städte eher eine Seltenheit, aber es gab überall Spione, die nur darauf warteten, Informationen über lohnenswerte Ziele an den Feind zu übermitteln. Und wer solch ein Tamtam um einen Bunkerbau machte, der war für den Feind sicherlich von Interesse.
Ungeachtet der Verbotsschilder steckte Danner seine Taschenlampe in die Manteltasche und holte einen Cordonar-Feldstecher aus seiner ledernen Umhängetasche, den er einem Offizier beim Kartenspiel abgeluchst hatte. Von seinem Standpunkt aus konnte er damit nur in einem steilen Winkel über die Sichtschutzwände spähen, um das zuletzt gebaute Stockwerk des Turms zu erblicken, das seit Monaten im Rohbau die Baustelle überragte. Im Herbst hatte er sogar einen Jägerstand am angrenzenden Wald bestiegen, um erstaunt festzustellen, dass von dem Turm gerade mal zwei Stockwerke gebaut worden waren. Kurz darauf wäre er beinahe einer bewaffneten Streife in die Hände gelaufen, die regelmäßig auf dem Hügel patrouillierte. Einen Tag später war der Jägerstand demontiert worden.
Der leuchtende Mond verschwand wieder hinter der dichten Wolkendecke, da spitzte Prinz die Ohren, richtete sich auf und knurrte leise. Sofort hatte er Danners volle Aufmerksamkeit.
»Was ist, mein Guter?«
Prinz verharrte regungslos, aber angespannt. Er blickte den Zaun entlang, der sich schon nach wenigen Metern in der Dunkelheit verlor. Danner ging in die Hocke und steckte den Feldstecher zurück in die Ledertasche. Vergeblich folgte er dem Blick seines langjährigen Gefährten. Er konnte nichts Verdächtiges sehen oder hören.
Zeit zu verschwinden, dachte sich Danner, aber zu spät. Wie von einer Tarantel gestochen hetzte Prinz plötzlich auf und davon, bis er nicht mehr zu sehen war.
»Prinz?«, rief ihm Danner leise nach. Innerlich fluchte er. Hatte der Hund eine Streife gehört? Danners Puls ging schneller. So ein verdammter Mist!
»Prinz?«, rief er wagemutig ein wenig lauter, aber es kam nichts zurück. Trotz der eisigen Kälte begannen seine Hände zu schwitzen. Prinz war sein Ein und Alles, sein bester Freund, einen anderen hatte er nicht.
Vielleicht ein Reh oder ein Fuchs? Aber Prinz war ein ausgebildeter Jagdhund, der selbst bei der Witterung von Wild folgsam an der Seite seines Herrchens blieb.
Danner legte die Finger an den Mund und stieß einen durchdringenden Pfiff aus, der sicher meilenweit zu hören war. Der Pfiff verhallte in der Nacht und verschwand mit dem aufkommenden Wind irgendwo zwischen den Bäumen. Kein Zeichen von Prinz – und das war mehr als ungewöhnlich.
Danner rechnete fest damit, dass jeden Moment aus der Dunkelheit die Stimme einer Patrouille ertönen und er vom Lichtkegel eines Scheinwerfers erfasst werden würde, aber es passierte nichts. Was sollten sie ihm auch vorwerfen? Er machte lediglich seinen dienstlichen Rundgang und war nur kurz am Waldrand ausgetreten, um seine Blase zu entleeren.
Mach dich nicht verrückt, Prinz wird jeden Augenblick wiederauftauchen, beruhigte ihn seine innere Stimme. Aber Prinz blieb verschwunden. Mit etwas wackeligen Beinen richtete sich Danner auf. Die sollen von mir aus bauen, was sie wollen, ich will nur meinen Hund finden, dachte er.
Dann folgte er mit der Taschenlampe entschlossen den frischen Hundespuren im knirschenden Schnee.
Nach etwa zweihundert Metern am Sichtschutz entlang endete die Fährte an einer leichten Erhebung, auf der zwei Elemente des Zauns unsauber miteinander verbunden worden waren. Genau hier hatte Prinz sich ganz offensichtlich darunter durchgegraben. Die Schürfspuren seiner Vorderläufe reichten bis ins gefrorene Erdreich. Der weiße Schnee war ringsherum mit brauner Erde bedeckt. Aber das Loch unter dem Zaun war für Danners kräftige Figur viel zu klein.
Was zum Teufel ist bloß in den Hund gefahren?, fragte er sich erneut.
Verzweifelt blickte er sich um. Der nächste Wachturm war noch ein gutes Stück entfernt und in der Dunkelheit nicht zu sehen, aber wie sollte er dem Hund nur folgen? Er ging auf die Knie und versuchte, durch die Mulde, die Prinz hinterlassen hatte, einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Es fiel ihm schwer, sich so weit hinabzubeugen, also legte er sich auf den Bauch und schob den Kopf stöhnend unter dem Zaun hindurch. Vielleicht konnte er auf diese Weise Prinz entdecken und ihn wieder zu sich rufen, aber alles, was er zu sehen bekam, war ein Paar blank gewichste schwarze Militärstiefel.
Der Unteroffizier, der ihn in Gewahrsam genommen und ihm eine Binde über die Augen gezogen hatte, führte ihn den Hügel hinauf. Danner vernahm slawische Sprachfetzen von murrenden Arbeitern und scharfe Befehle von deutschen Vorarbeitern – und immer wieder die Geräusche von Spitzhacken, Maschinen und Waggons aus Metall, die auf Schienen geschoben wurden. Einmal stolperte er sogar fast über eine der Schienen am Boden, doch der Unteroffizier an seiner Seite hatte seinen Oberarm fest im Griff und verhinderte den Sturz. Nach einigen Minuten erreichten sie das Plateau des Hügels und blieben stehen. Der Unteroffizier erstattete Meldung.
»Obersturmbannführer Ollenhauer, wir haben diesen Mann in flagranti dabei ertappt, wie er durch die Absperrung kriechen wollte.«
Danner fuhr bei der Nennung des militärischen Rangs ein Schrecken in die Knochen. Die SS … Hier, bei einem Bunkerbau?
»Das muss aber ein sehr großes Loch gewesen sein«, antwortete der andere sarkastisch.
»Sein Kopf hat hindurchgepasst …«, versuchte sich der Unteroffizier zu rechtfertigen.
»Nehmen Sie ihm die Binde ab, Unteroffizier Raabe«, unterbrach ihn der SS-Mann.
Der Unteroffizier folgte dem Befehl, aber Danner zögerte, die Augen zu öffnen.
»Nur zu, wir werden Sie nicht gleich erschießen.«
Danner vernahm, wie Unteroffizier Raabe bei dieser Bemerkung kichern musste, konnte aber nichts Belustigendes an der Situation finden. Dann öffnete er zaghaft die Augen. Was er zu sehen bekam, raubte ihm den Atem.
»Ich wollte wirklich nur meinen Hund …«, stammelte er, wobei er den Blick nicht von dem regen Treiben um ihn herum abwenden konnte.
»Wie heißen Sie?«
»Danner, Wolfgang Danner.« Er blickte dem SS-Offizier, der in seiner schwarzen Uniform mit Schirmmütze und Totenkopfabzeichen ebenso eindrucksvoll wie beängstigend wirkte, in die Augen.
»Sind Sie ein Spion, Wolfgang Danner?« Der Mann verzog seine schmalen Lippen zu einem grässlichen Lächeln.
»Ich … Ich bin der Ortsgruppenleiter der Partei.« Danner steckte die Hand in die Innentasche seines Mantels, um seine Brieftasche hervorzuholen, aber noch bevor ihm das gelang, hatte der Unteroffizier schon die Mündung einer Pistole an seine Stirn gesetzt. Danners Augenlider zuckten panisch. Der SS-Mann hingegen lächelte und sagte mit beruhigender Stimme: »Das werden wir nicht brauchen, Unteroffizier Raabe.«
Daraufhin senkte Raabe die Waffe, steckte sie aber nicht zurück in das Halfter an seinem Gurt.
»Der Mann hier ist einer von uns. Korrekt, Herr Danner?«
Danner nickte, zog seine Brieftasche hervor und entnahm ihr seinen Mitgliedsausweis, den der SS-Mann sehr aufmerksam betrachtete und ihm dann wieder aushändigte. Sein Lächeln verschwand.
»Woher sollen wir wissen, dass der Ausweis nicht gefälscht ist? Vielleicht sind Sie ja nur ein dreckiger Jude, der hier spioniert.«
»Ich hasse Juden«, platzte es aus Danner heraus. »Ich war nur hier wegen der Verdunkelung, ich … Ich bin auch der verantwortliche Luftschutzleiter hier im Ort, und dann ist mir mein Hund …«
»Sie hassen also Juden?«
Danner nickte, aber die plötzliche Kehrtwende in der Fragestellung machte ihm noch mehr Angst, und so brachte er kein Wort mehr heraus.
»Beweisen Sie es«, befahl der Obersturmbannführer mit bedrohlicher Stimme.
»Kommen Sie, beweisen Sie es«, wiederholte er, blickte dabei kurz zu Unteroffizier Raabe und neigte den Kopf in Richtung einer Gruppe von Arbeitern, die gerade einen Lastwagen entluden. Raabe verstand sofort. Er wandte sich ab, verschwand für einen kurzen Augenblick aus Danners Blickfeld und kam kurz darauf mit einem ausgemergelten Mann in verschmutzter, blau-weiß gestreifter Häftlingskleidung zurück. Nun war es der SS-Mann, der seine Pistole aus dem Halfter zog. Sofort warf sich der Gefangene panisch vor ihm auf die Knie und flehte: »Prosse nje … prosse nje … prosse nje!«
Der Obersturmbannführer packte Danners Arm und drückte ihm die Luger in die zitternde Hand.
»Nur ein polnischer Jude. Ungeziefer. Na los!«
Danner schüttelte den Kopf. Die Waffe fühlte sich schwer an, so schwer, dass er keine Kraft fand, sie hochzuheben und damit auf den armen Mann zu zielen.
»Und Sie wollen einer von uns sein?«, blaffte ihn der SS-Mann an. »Na los, erledigen Sie die Kakerlake, wir haben Tausende davon.«
In dem Moment hörte Danner ein vertrautes Kläffen.
»Prinz?«, rief er laut, als er den Schäferhund sah, den ein Soldat an die Leine genommen hatte. Mann und Hund kamen nun direkt auf sie zu.
Es war tatsächlich sein Hund. Als Prinz Danner erblickte, riss er sich samt Leine los und rannte zu seinem Herrchen, das ihn schluchzend in die Arme nahm, während Prinz ihm hektisch das Gesicht abschleckte. Der Soldat eilte dazu und erstattete Meldung.
»Der Rüde hat sich über eine unserer läufigen Hündinnen hergemacht. Konnte die beiden kaum auseinanderbringen.«
Obersturmbannführer Ollenhauer verstand sich selbst als gerechter Mensch. Ganz offensichtlich hatte der dickliche Ortsgruppenleiter die Wahrheit gesagt. Ollenhauer griff nach seiner Luger und steckte sie wieder in das Halfter. Dem Juden gab er nur einen Wink. Sofort kroch der verängstigte Mann davon, stand dann nach einigen Metern auf und rannte zu seiner Arbeitsgruppe, die die Szene verängstigt beobachtet hatte.
»Nur noch eines, Parteigenosse Danner.«
Danner stand erleichtert auf, während Prinz sich fest an ihn drückte.
»Sie haben hier nichts gesehen und nichts gehört.«
Danner konnte sich zwar sowieso keinen Reim auf die Vorgänge auf dem Hügel machen, trotzdem wiederholte er unterwürfig: »Ich habe nichts gesehen und nichts gehört.«
»Schwören Sie auf unseren Führer, dass Sie nie, niemals, zu irgendeiner Menschenseele auch nur ein Wort darüber verlieren werden, was Sie heute hier gesehen haben. Und gnade Ihnen Gott, wenn Sie es doch tun sollten, denn ich werde Sie finden und töten, Ortsvorstand Danner. Haben wir uns verstanden?«
Danner starrte in die stechenden Augen des SS-Mannes und wusste, dass dieser es todernst meinte. Er nickte mehrmals.
»Schwören Sie es, und heben Sie dabei die Hand«, forderte Ollenhauer ihn erneut auf.
Danner erhob zitternd die rechte Hand und sagte: »Ich schwöre bei Adolf Hitler, dass ich niemandem von dem, was ich hier gesehen habe, jemals berichten werde.«
***
Wolfgang Danner nahm sein Geheimnis 1975 mit ins Grab. Seinen Schwur hatte er nicht gebrochen – nur seinem Tagebuch hatte er sich anvertraut, das erst viele Jahre später, 2012 bei einer Nachlassversteigerung, den Besitzer wechselte.
Marie I
Freitag, 16. Oktober 2020
Das Fadenkreuz des Zielfernrohrs schwenkte behutsam von Kopf zu Kopf der Gäste, die schwer atmend mit Mundschutz oben am Plateau des Hügels eintrafen, auf dem ein achteckiger Wehrturm stand.
Seit gut einer Stunde harrte der kräftige Mann mit dem Scharfschützengewehr an seiner Position aus. Eine kühle Brise wehte um seinen Kopf und linderte die Hitze, trotzdem musste er immer wieder kurz die Waffe absetzen, um zu verhindern, dass Schweißtropfen in die Optik liefen. Eine Augenbraue, die den Schweiß abgehalten hätte, besaß der Mann nicht.
Der Kiesweg vom provisorisch angelegten Parkplatz am Fuße des Hügels bis hinauf zum Plateau war relativ steil, was es ihm ermöglichte, jeden einzelnen Gast ausgiebig ins Visier zu nehmen. Von seiner Position aus könnte er mindestens ein Dutzend Personen niederstrecken, bis er selbst zur Zielscheibe werden würde, doch er zwang sich zur Geduld.
Die Sonne stand an ihrem höchsten Punkt, und so spendete das vierstöckige Bauwerk nur wenig Schatten, in dem sich trotz der Corona-Pandemie die ersten Besucher drängten und Erfrischungsgetränke reichen ließen. Für einen Herbsttag war es ungewöhnlich heiß geworden.
Zwar wirkte der beeindruckende Turm wie ein Bauwerk aus dem Mittelalter, doch hinter der historisch anmutenden achteckigen Fassade verbarg sich ein massiver Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der vor genau zehn Jahren Schauplatz einer schrecklichen Geiselnahme und eines unfassbaren Medienspektakels geworden war.
Die Gemeinde hatte lange diskutiert, ob der monströse Turm oder die neu erbaute Synagoge am Marktplatz der geeignetere Ort für den geplanten Gedenktag sein würde. Die Turmgegner im Komitee führten vor allem einen Grund an, der mit rationalen Argumenten nur schwer zu entkräften war; sie meinten, der Turm sei »ein böser Ort«.
Ungeachtet der Tatsache, dass das Gebäude inzwischen seit vielen Jahren einen jüdischen Kindergarten beherbergte und die spielenden Kinder dem Hügel eine lebendige Wärme verliehen, hatten viele sensationslüsterne Touristen, die den Hochbunker nach dem Geiseldrama besuchten, den Eindruck, dass von dem Turm eine unerklärliche Kälte ausging. Es gab sogar eine Website namens thetowerofevil.net, die abenteuerlustigen Usern empfahl, unbedingt eine Nacht in der Nähe zu verbringen, da man dort besonders grauenvolle Albträume haben würde. Die Jugendlichen, die hier wild campten, hatte die Gemeinde zunächst noch zähneknirschend hingenommen; nachdem aber eines Nachts die Polizei ein Treffen von Satanisten, deren brennendes Holzkreuz weithin zu sehen war, auflösen musste, wurde rund um den Hügel eine hohe Hecke errichtet. Sie verbarg einen massiven Doppelstabmattenzaun, der nur schwer zu überwinden war. Doch die unerklärliche Kälte, die von dem Turm ausging, war in den Köpfen vieler Bürger bis heute präsent.
Den Ausschlag zugunsten des Turms als Veranstaltungsort hatte schließlich der Spezialist einer Sicherheitsfirma gegeben, mit der Information, dass für die Überwachung des Marktplatzes im Ortskern doppelt so viel Personal notwendig werden würde als zur Sicherung des Plateaus. Die Kostenaufstellung hatte dann auch die letzten Zweifler im Gemeinderat zum Schweigen gebracht.
Im Fadenkreuz des Scharfschützen tauchte soeben eine hochgewachsene schlanke Frau auf, deren lange, dunkle Haare im Nacken lieblos von einem Haargummi zusammengehalten wurden. Marie Stresemann. Der Schütze erkannte die ehemalige Bewährungshelferin sofort. Wut stieg in ihm hoch, zusammen mit dem gnadenlosen Verlangen, jetzt den Abzug zu betätigen. Es wäre ihm eine Genugtuung, zu sehen, wie sie nach seinem gezielten Kopfschuss tot zwischen den Gästen zusammenbrechen würde. Aber noch hatte er sich unter Kontrolle.
Marie steuerte geradewegs auf Rabbi Shlomo Moshe zu, der in einem Rollstuhl saß und mit der ehemaligen Stadträtin Seligmann in ein Gespräch vertieft war. Sie lauschte seinen Worten und nickte sanft.
Ein Kellner in blau-weißer Livree und Atemmaske bot Marie auf einem Silbertablett Sekt und Orangensaft an, aber sie wich aus, ohne den jungen Mann eines Blickes zu würdigen.
Aus den Augenwinkeln entdeckte der greise Rabbi die Frau in den ausgewaschenen Jeans, unterbrach seinen Monolog und setzte ein breites Lächeln auf.
»Liebe Frau Seligmann, darf ich Ihnen Marie Stresemann vorstellen?«
Die Frau im dunklen Kostüm drehte sich zu Marie um und prüfte sie mit strengem Blick und einem angedeuteten Lächeln.
»Angenehm, Seligmann«, stellte sie sich vor.
Einem Reflex folgend, bot ihr Marie die rechte Hand an.
»Oh, lieber nicht, am besten, wir befolgen die AHA-Regeln«, erwiderte die Frau und wich einen Schritt zurück.
Marie hätte am liebsten die Augen verdreht, beherrschte sich aber. Dann wandte sie sich Rabbi Moshe zu und beugte sich zu ihm hinunter. Der Rabbi schloss sie in seine Arme und küsste sie auf die Wange, woraufhin die ehemalige Politikerin sich empört abwandte und auf die Suche nach einem neuen Gesprächspartner machte.
»Wie geht es Ihnen, meine Liebe?«, wollte der Rabbi von Marie wissen. »Gehört habe ich seit Jahren nichts mehr von Ihnen, und die schöne neue Synagoge haben Sie noch kein einziges Mal gesehen«, setzte er ein wenig vorwurfsvoll nach.
Marie hatte ein schlechtes Gewissen wegen des Rabbis. Nach den dramatischen Ereignissen vor zehn Jahren waren Michael Koch und der vollbärtige Rabbiner die einzigen beiden Menschen gewesen, die ihr Halt gegeben hatten. Der Kommissar, weil er annähernd dieselben schrecklichen Dinge durchlebt hatte, und der Rabbi, weil sie sich ihm geöffnet hatte, als sie Beistand suchte.
Marie war nie ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde gewesen. Die Begriffe Glaube und Gott hatten für sie keine tiefere Bedeutung. Eine anständige Therapie war ihrer Meinung nach der einzige Weg, mit den traumatischen Erlebnissen des Geiseldramas fertigzuwerden, aber der gewünschte Erfolg blieb aus. Schuld daran waren vor allem ihre Ungeduld und der Ehrgeiz, mit dem sie einen spürbaren Therapieerfolg förmlich erzwingen wollte. Wie schon so oft in ihrem Leben führte dieser Eifer jedoch zum Misserfolg. Einmal mehr resignierte sie, weil sie die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht hatte.
Es waren die immer wiederkehrenden Belehrungen ihrer Mutter gewesen, die sie schließlich dazu brachten, an einem Sabbat die alte Synagoge zu besuchen.
»Was du brauchst, ist kein Psychiater, Mädchen. Geh, sprich mit dem Rabbi. Ein Rabbi ist besser als ein Psychiater. Glaub deiner alten Mutter mal was … Geh zum Rabbi, er wird dir helfen.«
Und tatsächlich, es funktionierte. Marie hatte jedoch nicht den geringsten Zweifel daran, dass Glaube und Religion keinen Einfluss auf den Erfolg gehabt hatten. Vielmehr war es der Umstand gewesen, dass sie den Rabbi ohne irgendeine Erwartungshaltung besucht hatte.
Nach dem grauenvollen Mord an Esther Goldstein, der ehemaligen Haushälterin von Ephraim Zamir, empfand Shlomo Moshe seinerseits den Besuch von Marie wie eine Herausforderung Gottes. Aus dieser Aufgabe schöpfte er neue Kraft; sie brachte ihn zurück ins Leben.
Anfangs saß Marie nur schweigend bei ihm und hörte sich seine zweideutigen Geschichten an, die er mit blumigen Worten und tiefer Stimme vortrug. Sie waren wie Rätsel, die sie mit nach Hause nahm und deren Entschlüsselung sie bis in ihre Träume begleitete. Und je mehr sie verstanden zu haben glaubte, umso mehr neue Fragen taten sich auf.
Eines Tages begann sie schließlich zögerlich, eigene Geschichten beizutragen, erst von anderen, dann von sich selbst. Dabei schilderte sie die Erlebnisse oft in Form von Gleichnissen, selten aber so, wie sie sich tatsächlich zugetragen hatten. Es war wie ein Spiel zwischen ihr und dem Rabbi, das sich nach und nach wie ein kühler Verband über die geschundenen Seelen der beiden legte.
»Mein lieber Rabbi Moshe, Sie haben recht, es ist unverzeihlich, dass ich mich nicht früher gemeldet habe«, gestand sie jetzt mit aufrichtiger Reue. »Sie haben mir so sehr geholfen, und dann …«
»Ach was«, unterbrach sie der Rabbi. »Das ist der Lauf der Dinge. Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Ich habe unsere gemeinsame Zeit sehr genossen, aber sosehr wir es auch versuchen würden, eine Wiederholung wäre heute nur noch ein blasser Hauch aus Erinnerungen und Sentimentalität.«
Bei seinen Worten musste Marie lächeln; sie weckten in ihr den Wunsch, die Zeit zurückzudrehen. Doch das Lächeln war nur von kurzer Dauer, denn im Schatten des Turms, der mächtig über ihnen in den Himmel ragte, hatte die bittere Realität sie sofort wieder eingeholt. Nichts hatte sich geändert und schon gar nicht verbessert. Die Welt war zu einem noch schrecklicheren Ort verkommen, als sie immer befürchtet hatte. Der Rabbi erkannte, wie sich ein Schleier von Bitterkeit über ihre Augen legte, und nahm ihre Hand.
»Meine liebe Marie, was auch immer Sie bedrückt, es gibt Hoffnung. Gott ist stets bei uns.«
Marie zog bei dem Wort »Gott« instinktiv ihre Hand zurück und setzte ein künstliches Lächeln auf, da sie den alten Mann nicht verletzen wollte.
Gott ist tot, zitierte sie stumm Nietzsche.
»Nein«, sagte der Rabbi, als hätte er ihre Gedanken gelesen.
Eine schwarze Limousine hielt auf dem Parkplatz. Mehrere Leibwächter stiegen aus und sicherten die Umgebung, dann stieg Dr. Spaenle, der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, aus dem Wagen und trat den Weg nach oben an.
Der verborgene Schütze nahm den bekannten Politiker ins Visier. Wieder rann ein Schweißtropfen über sein vernarbtes Gesicht, doch diesmal ließ es der kahlköpfige Mann geschehen, denn eine weitere Person tauchte oben auf dem Plateau auf und gab seinem Hass neue Nahrung.
Michael Koch war in seinem maßgeschneiderten Anzug eine stattliche Erscheinung, nur das Sakko spannte ein wenig um seine muskulösen Oberarme. Immer wieder drehten sich Anwesende nach dem gut aussehenden Mann um, dessen grau melierte Haare einen starken Kontrast zu seiner dunklen Hautfarbe bildeten. Doch seine unnahbare Aura hielt die anderen Gäste davon ab, den ehemaligen Kriminalhauptkommissar zu begrüßen, während er gedankenverloren den Turm hinaufblickte.
Michael Koch hatte lange gezögert, die Einladung zur Gedenkfeier anzunehmen. Er war vor zehn Jahren eine der Schlüsselfiguren bei der Befreiung der Geiseln gewesen. Zwar hatte er die Geiseln retten können und war von der Presse als Held gefeiert worden; aufgrund verschiedener Verfehlungen, die mit der Geiselnahme einhergingen, war ihm jedoch von der Polizeidirektion nahegelegt worden, in den Vorruhestand zu gehen. Ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte, selbst wenn er gewollt hätte.
Kochs Augen ruhten auf dem Dach des Turms. Der Anblick von Ephraim Zamirs Festung schnürte ihm die Kehle zu. Zamir war damals von drei Neonazis in seinem Turm überfallen worden – und hatte diese seinerseits in Geiselhaft genommen, um ein Millionenpublikum im Internet über Leben oder Tod der drei Männer abstimmen zu lassen. Nach den spektakulären Ereignissen jener Nacht vor zehn Jahren war Zamir, der sich als ehemaliger Mossad-Agent entpuppt hatte, spurlos verschwunden.
Schon als Michael Koch den Turm bei seiner Anreise zum ersten Mal aus der Ferne wahrgenommen hatte, weckte dessen Anblick bittere Erinnerungen. Jetzt, in unmittelbarer Nähe des Bauwerks, konnte er förmlich einen physischen Schmerz spüren, der durch den Bunker ausgelöst wurde. Eine vertraute Stimme rief seinen Namen und brachte ihn zurück in die Gegenwart.
»Michael«, wiederholte sie etwas leiser.
Maries Stimme vertrieb augenblicklich alle düsteren Gedanken und erfüllte sein Herz mit Wärme. Ohne zu zögern oder eine Begrüßung abzuwarten, wandte er sich Marie zu und schloss sie fest in seine Arme.
Seit ihrer letzten Begegnung waren Jahre vergangen, aber einen Moment lang hatten beide das Gefühl, es wäre erst gestern gewesen. Der Streit, die Tränen, die unüberwindbaren Gegensätze, alles war vergessen – zumindest für einen Augenblick.
Sie lösten sich voneinander und sahen sich ein wenig wehmütig in die Augen.
»Ich bin froh, dass du es dir anders überlegt hast«, begann Marie zaghaft.
»Du siehst gut aus«, log er, denn ihre Augen waren dunkel umrandet, und ihre sowieso schon blasse Haut wirkte fahl.
»Danke«, gab sie zurück, denn weder wollte sie die Lüge entlarven noch war ihr zum Kokettieren zumute.
»Hey … Kein Wort über mich?«, versuchte er sie aufzuheitern, stemmte dabei die Hände in die Hüfte und lächelte, woraufhin auch Maries Gesicht kurz strahlte.
»Du … Du siehst toll aus, alter Mann!«
»Alt? Mit knapp sechzig? Zamir war zweiundsiebzig, als er die drei Neonazis in seine Gewalt brachte.«
Maries Züge nahmen wieder einen niedergeschlagenen Ausdruck an. Die Erinnerung an Ephraim Zamir schmerzte. Ob er noch lebte? Selbst bei einer internationalen Fahndung hatte man keine einzige Spur von Zamir gefunden.
»Ich … Sorry. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt erwähnt habe … Es tut mir leid«, sagte Michael.
Marie schüttelte den Kopf. »Kein Ding, alles gut.«
»Wirklich?«
»Wirklich«, antwortete sie, denn sie wollte nicht, dass Michael sich ihretwegen schlecht fühlte.
Dr. Spaenle und seine Sicherheitsbeamten hatten das Plateau erreicht. Ein zuvorkommender Kellner reichte Spaenle eine weiße Serviette, mit der er sich den Schweiß von der Stirn tupfte. Dann begrüßte er zunächst die ehemalige Stadträtin Seligmann und schließlich Rabbi Shlomo Moshe, während sich die anderen Gäste langsam um das Grüppchen scharten.
Ohne das Gewehr abzusetzen, griff der Scharfschütze zu seinem Handy und wählte. Er musste sich jetzt entscheiden. Durch das Zielfernrohr waren sie alle zum Greifen nahe. Leben und Tod lagen in seinen verschwitzten Händen, aber der eine, der, auf den er es eigentlich abgesehen hatte, war nicht gekommen. Seine Wut und Enttäuschung waren unermesslich. Er schmeckte Blut auf seiner wund gebissenen Zunge.
»Und?«, meldete sich eine Stimme am Telefon.
»Karl ist nicht gekommen … Dieser scheiß Hurensohn ist nicht gekommen«, antwortete er zornig.
»Habe ich dir gleich gesagt.«
Der Mann mit der vernarbten Gesichtshälfte nahm das Gewehr aus der Sonne und legte es im Schatten ab, wobei sich für den Bruchteil einer Sekunde das Sonnenlicht im Objektiv des Zielfernrohrs spiegelte.
Kochs geübtes Auge nahm eine kurze Lichtreflexion auf dem Kirchturm im Ort wahr. Sie kam direkt von dem überdachten, offenen Glockenturm – von einer Stelle, wo es keine Spiegelung geben durfte. Michael Koch zögerte nicht und nahm einen der Sicherheitsmänner auf die Seite, der dem überraschenden Griff des großen Mannes nichts entgegenzusetzen hatte.
»Haben Sie einen Ihrer Männer in dem Kirchturm platziert?« Koch gab dem Mann keine Gelegenheit zu antworten. »Denn wenn nicht, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller.«
Koch lockerte den Griff.
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte der Beamte.
»Eine winzige Spiegelung.«
Der Sicherheitsmann hatte sofort ein Dutzend Erklärungen im Kopf, was eine solche Reflexion ausgelöst haben könnte – und sei es nur die Uhr des Pfarrers, der vom Kirchturm aus seine Gemeinde betrachtete. Trotzdem reagierte er sofort, denn jedem Hinweis einer Bedrohung musste unverzüglich nachgegangen werden, war sie auch noch so unwahrscheinlich. Mit der Hand führte er das Mikrofon an seinem Revers zum Mund.
»Code Red. Verdächtige Spiegelung in der Spitze des Kirchturms wahrgenommen.«
»Code Red bestätigt«, kam es aus dem kleinen Kopfhörer.
Zwei der Leibwächter nahmen Spaenle in die Mitte und drückten seinen Oberkörper nach unten. Dann verschwanden sie mit ihm im Eingang des Turms, während vom Fuße des Hügels aus zwei Sicherheitsbeamte mit gezogenen Waffen auf die Kirche im Dorfzentrum zurannten.
Erschöpft lehnte sich der Mann mit dem Gewehr an die steinerne Wand des Glockenturms.
Lutz’ Stimme meldete sich wieder. »Knall einfach den Judenfreund ab, diesen Wichser …«
»Wen meinst du? Der ganze Haufen da oben, das sind doch alles Judenfreunde«, knurrte Gottfried Wegener, den seine Kameraden nur Steiner nannten.
»Na, diesen Politiker, der die Rede halten soll«, ergänzte Lutz.
»Scheiß drauf. Aus dem Winkel – auf diese Distanz, das wird nicht klappen.«
»Dann leg sie einfach alle um, ist scheißegal. Das sind alles Fotzen. Wenigstens vier oder fünf, bis die was checken, bist du längst über alle Berge«, stachelte Lutz ihn auf.
»Halt die Fresse, Lutz. Das ist nur Kinderkacke im Vergleich zu dem, was wir geplant haben.«
»Echt jetzt? Willst du das wirklich durchziehen?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang verunsichert, was Steiner wütend machte.
»Pisst du mich gerade an? Wir haben alles geplant, alles ist … Hey, Mann. Was ist los mit dir?«
»Passt schon, Mann. Und was ist mit Karl … Vielleicht kommt er noch?«
»Karl?« Steiner spuckte den Namen des ehemaligen Kameraden, der sie verraten hatte, förmlich aus.
»Scheiß auf Karl. Diese Ratte hat sich in irgendeinem dunklen Loch verkrochen und soll in der Hölle schmoren. Aber ich schwöre dir, eines Tages krieg ich ihn an den Eiern und nehm ihn aus wie ein geschlachtetes Schwein.«
Lutz lachte kreischend auf. Ihm gefiel die Vorstellung.
Inzwischen warf Steiner nochmals einen Blick über die gemauerte Brüstung des Glockenturms und sah auch ohne Zielfernrohr, wie mehrere Männer den Weg hinunter auf die Kirche zugerannt kamen.
»Scheiße, ich muss mich verpissen. Wir reden nachher, Lutz!«
Ohne eine Antwort abzuwarten, legte er auf, packte das Scharfschützengewehr und hastete die steile Treppe des Kirchturms hinunter.
Als kurz darauf die beiden Sicherheitsmänner bei der Kirche eintrafen, fanden sie nur einen toten Ministranten, der sich beim Sturz im Glockenturm das Genick gebrochen hatte. Von einem potenziellen Attentäter aber fehlte jede Spur.
***
Marie steuerte ihr offenes Mini-Cabriolet mit erhöhter Geschwindigkeit eine Landstraße entlang, die sie an grünen Hügeln und Wäldern in leuchtenden Herbstfarben vorbeiführte. Michael saß neben ihr und betrachtete heimlich ihre langen Haare, die der Wind verwirbelte.
Die Veranstaltung hatte länger gedauert als erwartet, da die Ansprache von Dr. Spaenle durch den Zwischenfall später begonnen hatte als ursprünglich geplant. Einige der Gäste hatten zwischenzeitlich aus Angst vor einem Attentat die Gedenkfeier überstürzt verlassen. Nur die Ruhe des Rabbis und seine Weigerung, die Veranstaltung abzubrechen, hatten schließlich doch noch dazu geführt, dass der Opfer gedacht werden konnte.
Als man sich verabschiedete, stand die Sonne bereits tief am Horizont, und Marie bot Michael an, ihn zu seinem Hotel in die Stadt zu fahren. Michael hatte insgeheim darauf gehofft und den Vorschlag erfreut angenommen, da sie während der Feierlichkeit kaum Gelegenheit gehabt hatten, sich auszutauschen. Nun saßen sie seit einer Viertelstunde nebeneinander in dem Wagen und wechselten kein Wort.
»Was ist aus Paris geworden?«, versuchte er ein Gespräch zu beginnen.
»Paris ist gestorben.«
Paris war Maries Labrador gewesen, den sie sich kurz nach dem Geiseldrama zugelegt hatte. Ein unkomplizierter, liebenswerter Hund, der selbst bei den Treffen mit dem Rabbi immer an ihrer Seite gewesen war.
»Paris ist tot?«, fragte er, ohne eine Antwort zu erwarten.
»Krebs«, sagte sie kurz angebunden und überholte vor einer engen Kurve einen Wohnwagen. Michael hielt kurz die Luft an.
»Wovon lebst du jetzt?«
»Von den Tantiemen meiner drei Bücher. Von Lesungen. Zumindest war das vor der Corona-Krise so. Und von meinem Ersparten. Ich brauch nicht viel.«
Vor zehn Jahren hätte Marie als Bewährungshelferin die Möglichkeit gehabt, das Geiseldrama zu verhindern – wenn sie zugelassen hätte, dass ihr Schützling, der Neonazi Karl Rieger, sich ihr rechtzeitig anvertraute. Doch das hatte sie nicht getan. All die Menschen, die verletzt oder getötet worden waren, auch unbeteiligte Menschen, all das Leid, das dieses Drama ausgelöst hatte – für all das gab Marie sich selbst die Schuld. Danach hatte sie ihren Job hingeschmissen und ihren ganzen Schmerz beim Schreiben eines Online-Blogs ausgelebt, der sich zu einem großen Erfolg entwickelte und schließlich auch in gedruckter Form bei einem großen Verlag als Buch erschien. Es folgten Auftritte in TV-Shows, die ihre Popularität noch steigerten, sodass ihr Buch zum Bestseller avancierte. Die Zuschauer liebten ihre ungeschminkte und offene Art, in Talkshows mit anderen Gästen oder den Moderatoren umzugehen. In einer Sendung schüttete sie einem AfD-Mitglied mit den Worten »Die Farbe steht Ihnen gut« Kaffee ins Gesicht. In einer anderen Show zeigte sie dem Moderator nach der Frage »Verstehen Sie sich als linke Feministin?« den Mittelfinger und verließ das Studio. Das Verrückte dabei: Je mehr sie diese Talkshows und das lachende Publikum verachtete, desto beliebter wurde sie. Bekannte aus der Branche erzählten ihr von Gesprächen, die zu dieser Zeit in den Fernsehredaktionen immer nach einem ähnlichen Schema abliefen: »Holen Sie mir die Stresemann in die Show«, sagte ein Programmdirektor.
»Marie Stresemann? Die ist unberechenbar!«, antwortete der Redakteur.
»Na hoffentlich, genau deshalb will ich sie ja haben. Und laden Sie ein paar Rechte dazu ein, damit die Fetzen fliegen!«
Es dauerte eine Weile, bis Marie das Prinzip durchschaute. Sie kehrte schließlich dem Fernsehen den Rücken. Noch Monate später hagelte es Angebote von Agenten, die sie unter Vertrag nehmen wollten. Man bot ihr eine eigene Sendung oder die Mitarbeit an einer Serie über das Geiseldrama an, doch Marie lehnte alles rigoros ab, verkroch sich mit Paris in ihrer kleinen Dachwohnung im Osten Berlins und brach alle Kontakte ab, auch die zu Michael Koch und dem Rabbi. Und irgendwann war Marie Stresemann auch für die Medien nur noch Schnee von gestern.
Michael startete einen neuen Versuch, ein Gespräch zu beginnen.
»Ich hab gehört, du lebst jetzt in Berlin?«
»Ich bin vor zwei Jahren hierher zurückgekommen, kurz nachdem ich Paris einschläfern lassen musste.«
Marie drosselte die Geschwindigkeit, denn die Landstraße führte nun direkt in die Großstadt auf den Stadtring, vorbei an Reihenhäusern und beeindruckenden Firmengebäuden, in deren Glasfassaden sich die Abendsonne spiegelte.
»Hatte sie Schmerzen?«, hakte Michael nach.
»Was glaubst du? Natürlich hatte sie Schmerzen.« Marie reagierte heftiger, als sie eigentlich wollte. »Ihr Därme waren voller Geschwüre, im ganzen Körper hatten sich Metastasen breit gemacht, sie ging elendig zugrunde, und ich konnte nichts tun, nichts.«
Marie biss sich auf die Unterlippe und kämpfte gegen die Tränen an. Ihre Wangen bebten, aber ihre Augen blieben trocken. Michael rückte ein wenig von ihr ab und richtete den Blick auf die Straße. Bis sie schließlich sein Hotel erreichten, sagte er kein Wort mehr.
Die Sonne war schnell untergegangen. Soeben hatten sich die Laternen über den Straßen automatisch angeschaltet und tauchten das Cabriolet am Straßenrand in kaltes, blaues Licht.
»Ist es das?«, fragte Marie und zeigte auf ein nobles Fünfsternehotel auf der anderen Straßenseite. Michael nickte nur.
Einen Moment lang saßen sie regungslos da und blickten hinüber zu der überdachten Einfahrt, die von einem Kronleuchter erhellt wurde. Zwei Pagen entluden gerade Koffer aus einer Luxuslimousine und packten sie auf einen goldenen Rollwagen.
»Du scheinst ja gut zu verdienen.«
Ihr Tonfall klang vorwurfsvoll, und Michael hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen.
»Ich … Also, seit ich nicht mehr bei der Polizei bin, arbeite ich für ein großes Sicherheitsunternehmen. Ich …«
Doch weiter kam er nicht.
»Soll ich noch mit hochkommen?«, unterbrach ihn Marie. Ihr Tonfall ließ keinen Zweifel daran, wie das Angebot gemeint war. Michael schluckte. Damals, nach den schrecklichen Ereignissen, war er oft mit zu ihr gegangen. Sie hatten stundenlang geredet oder einfach nur dagesessen und geschwiegen, während er sie schützend im Arm gehalten hatte. Aber damals waren sie einander als Freunde vertraut gewesen wie Seelenverwandte. Nun war sie ihm fremd. Fremd und begehrenswert. Als Michael heute darauf gehofft hatte, Marie wiederzusehen, hatte er nicht nach Sex gesucht. Er wollte nur seine Freundin wiederhaben, die ihm geholfen hatte, die schlimmste Zeit seines Lebens zu überwinden. Und damit war nicht das Geiseldrama gemeint, sondern der vorangegangene Verlust seiner Familie und vor allem der Tod seines Sohnes. Diese Freundin war ihm genommen worden. Als ihm das jetzt klar wurde, klammerte er sich an die kargen Überreste ihrer Beziehung und nickte Marie zu.
***
Über dem Schirm der Nachttischlampe hing Maries schwarzes T-Shirt. Nur spärlich beleuchtete die Lampe den abgedunkelten Raum. Während der langen, schlaflosen Nacht hatten sich Kondenstropfen an den Fensterscheiben gebildet. Michael lag nackt auf dem Rücken und atmete schwer. Sein Gefühl für Zeit hatte sich im Auf und Ab der Wogen von Sinnlichkeit und Ekstase verflüchtigt wie ein Wassertropfen im Ozean. Noch nie zuvor hatte er körperliche Lust so exzessiv und leidenschaftlich erlebt wie in dieser Nacht. Tausend Gedanken gingen ihm gleichzeitig durch den Kopf. Je mehr er versuchte, die Bilder zu ordnen, umso verschwommener wurden sie. Begierde, Verweigerung, Betörung, Erfüllung und auch Gewalt waren fließend ineinander übergegangen, bis zur körperlichen Erschöpfung, wenn beide Körper schlaff und in Schweiß gebadet zurück in die Laken sanken, bevor der Rausch der Sinne erneut von ihnen Besitz ergriff.
Jetzt fühlte er sich leer. Nur langsam senkte sich sein Puls, aber noch immer pochte ein dumpfer Rhythmus in seinen Ohren. Er spürte die Nähe von Marie, die neben ihm lag. Nur wenige Zentimeter würden ausreichen, um ihre nackte Haut zu berühren, ihren Körper zu liebkosen, bis die Lust von Neuem entfacht würde. Und so allumfassend und berauschend diese Nacht auch gewesen war, so sehr schmerzte ihn das Gefühl, dass nichts davon mit Liebe zu tun hatte.
Marie setzte sich wortlos auf die Bettkante. Ihre langen, schwarzen Haare klebten auf ihrem Rücken und auf der Brust, wo sie das feine Narbengewebe verdeckten, das den Verlauf ihrer Kindheit und Jugend entscheidend geprägt hatte. Achtlos wischte sie einige Strähnen aus dem Gesicht, stand auf und betätigte einen Schalter an der Wand. Mit einem leisen Summen glitten die Jalousien langsam nach oben und tauchten ihren Körper in warmes Licht.
Michael kniff die Augen zusammen, als die grellen Sonnenstrahlen unbarmherzig die Erinnerungen an die Nacht wegfegten.
»Ich brauch jetzt einen Kaffee. Gibt es Kaffee in dieser Luxushütte?« Marie warf die Frage achtlos in den Raum, dann ging sie am Bett vorbei, ohne Michael eines Blickes zu würdigen, und verschwand unter der Dusche.
Michael griff schwerfällig zum Telefon, um eine Kanne Kaffee zu ordern. Eine Servicekraft meldete sich mit greller Stimme und versuchte ihm das »Morning de luxe«-Frühstück schmackhaft zu machen. Kraftlos stimmte er zu und legte wieder auf.
Marie stand regungslos unter der Dusche und weinte. Der Zwang, Dinge kaputt zu machen, die sie liebte, war stärker als die Vernunft, die dazu führte, dass sie dieselbe Tat bereute. Michael war ihr vor Jahren ein echter Freund gewesen. Indessen war ihr alles, was sie je geliebt hatte, auf brutale Weise immer wieder entrissen worden.
Sie drehte die Dusche ab, atmete tief durch und stellte sich vor das Designerwaschbecken. Schwüler Wasserdampf hing in dem kleinen Raum. Mit der flachen Hand wischte sie eine Stelle auf dem beschlagenen Spiegel frei und betrachtete ihr Abbild. Die Narben auf ihrer rechten Brust waren durch das heiße Wasser rot angeschwollen. Vorsichtig berührte sie sie mit den Fingerspitzen. Sie waren ein vertrauter Teil von ihr geworden, die sie wie einen Schutzschild vor sich hertrug – vor allem, wenn sie nackt war, und vor allem, wenn andere sie sehen konnten. Die Zeit, als sie sich dafür geschämt hatte, war längst vergangen. Die Narben waren Teil ihres provokativen Selbstverständnisses geworden. Entfernt hörte sie ein Klopfen an der Hotelzimmertür. Sie band eines der Handtücher wie einen Turban um ihre Haare, wickelte sich ein weiteres um den Körper und verließ das Bad.
Der Page, der gerade eine Etagère voller Köstlichkeiten und zwei Cappuccini gebracht hatte, verließ soeben die Suite, ließ es sich aber nicht nehmen, einen frivolen Blick auf Maries Körper zu werfen. Michael, der inzwischen eine Jogginghose trug, warf daraufhin wütend die Tür hinter ihm zu.
»Was soll das werden?«, fauchte er Marie vorwurfsvoll an und wusste im selben Moment, dass es darauf keine Antwort geben konnte.
»Hat es dir nicht gefallen?«, antwortete sie fast beiläufig, während sie das Handtuch um den Körper fallen ließ und in ihre Jeans schlüpfte.
»Hast du dich verändert, oder ist mir früher nur nicht aufgefallen, wie … wie kalt du bist?«
»Ich habe mich nicht verändert. Ich bin immer noch derselbe Freak, der ich immer war. Du wolltest das nur nie wahrhaben«, sagte Marie ruhig und streifte sich das schwarze T-Shirt über.
Maries Eingeständnis raubte ihm jede Angriffsfläche. Er ging auf sie zu und umfasste vorsichtig ihre Schultern.
»Wir sind alle Freaks, Marie. Nur manche können das besser verbergen.«
Sie drehte sich aus seinen Armen, obwohl sie sich innerlich danach sehnte, dass er sie fest an sich drückte. Dabei fiel ihr Blick auf den kleinen Schreibtisch, auf dem ein Pass mit einem Flugticket lag.
»Du verreist?«
»Mein Flieger geht heute Abend. Wir könnten noch …«
»Wohin?«, unterbrach sie ihn, und es klang so, als wäre die Antwort von Bedeutung.
»Wie meinst du das?«
»Was ist denn daran so schwer zu verstehen?«
Sie zog das Ticket aus dem Pass und warf einen Blick darauf.
»First Class, Washington?«, fragte sie irritiert.
»Wird wohl stimmen, wenn es auf dem Ticket steht.«
Sie sah ihm in die Augen und wartete. Er zögerte kurz, entschloss sich dann aber, ihr die unausgesprochene Frage zu beantworten.
»Ich habe vor einiger Zeit ein Angebot von einer amerikanischen Security-Firma bekommen, das habe ich angenommen.«
»Um was zu tun?«, hakte sie nach.
»Ich … Ich bin Sicherheitsberater von Trumps Wahlkampfteam … Also einer davon.«
Marie lachte laut auf. Es war das erste Mal seit ihrem Wiedersehen gestern Nachmittag, dass er sie lachen sah, aber es war kein fröhliches Lachen.
»Du arbeitest für Trump?« Ihre Stimme überschlug sich.
»Nicht für ihn direkt, für sein Wahlkampfteam«, versuchte er sich zu rechtfertigen.
»Wie kannst du dich nur so weit herablassen und für diesen Narzissten, für diesen krankhaften Egomanen … Wie kannst du für diesen Wahnsinnigen auch nur einen Finger krümmen? Es sei denn, den Finger am Abzug einer Waffe, um die Menschheit ein für alle Mal von dieser Geißel zu befreien?«
Michael traute seinen Ohren nicht.
»Es ist ein Job.«
»Ein Blowjob, mein Lieber! Und du bist die Hure dabei!«
Michael kochte innerlich. Noch nie hatte jemand so schonungslos mit ihm gesprochen. Er war kurz davor, sie anzuschreien, behielt aber die Nerven.
»Es ist besser …«, hob er an, und wieder unterbrach sie ihn.
»… wenn ich jetzt gehe?«
Ein letztes Mal hielten die beiden inne und sahen sich tief in die Augen, als suchten sie nach einem Rest Zuneigung füreinander. Dann löste sich Marie, schlüpfte in ihre Schuhe, griff nach ihrer grauen Umhängetasche und warf das Handtuch, das gerade noch um ihre Haare gewickelt war, wütend durch die offene Badezimmertür.
»Männer wie Trump machen diese Welt kaputt, und ich werde dabei nicht tatenlos zusehen. Vergiss meine Nummer, vergiss, wer ich bin oder wer ich irgendwann einmal für dich war. Und komm mir bloß nie wieder in die Quere.«
Mit diesen Worten stürmte sie aus der Suite und ließ die Tür dabei weit offen stehen. Er zögerte eine Weile, dann eilte er ihr ein paar Schritte nach, konnte aber nur noch sehen, wie sich im Hotelflur die Aufzugtüren schlossen.
Er fragte sich, ob er Marie jemals wiedersehen würde – und sei es nur auf den Titelseiten der Boulevardpresse.
Zu diesem Zeitpunkt konnte Michael Koch noch nicht wissen, wie richtig er mit seinem Gedanken lag.
Lutz I
Köln-Seeberg, 2007
»Ich hab die Schnauze voll«, begann Jana Funk gerne ihre Hasstiraden gegen Geflüchtete im Speziellen und Ausländer im Allgemeinen. Wenn sie besonders in Rage war, ergänzte sie im typisch rheinländischen Dialekt gerne noch: »Und zwar so was von!«
Die alleinerziehende Mutter lebte mit ihrem siebenjährigen Sohn Lutz im Stadtteil Köln-Seeberg in einer Sozialwohnung. Sie finanzierte ihren Lebensunterhalt durch Hartz 4. Der Vater ihres Kindes, eine Karnevalsbekanntschaft, hatte sich noch vor der Geburt aus dem Staub gemacht. Nachforschungen waren erfolglos geblieben.
»Wenn ich den Scheißkerl wiedersehe, schieß ich ihm in die Eier und lass ihn dann langsam verrecken«, war ein weiterer Satz aus Janas umfangreichem Repertoire an Wutparolen. Inzwischen konnte sie sich nicht mal mehr an das Gesicht des Mannes erinnern. Den Job als Kassiererin in einem Supermarkt hatte sie verloren, weil sich irgendwann ihre Wut auch gegen ihre Vorgesetzte wendete, die afghanischer Herkunft war.
»Du hast mir hier gar nichts zu sagen«, schrie sie die Frau eines Tages an und fuchtelte dabei mit ihrem Zeigefinger vor deren Gesicht herum. »Du bist hier in meinem Land. Verstehst du? Ich zahl hier Steuern, damit du mit deiner Sippe in Deutschland leben kannst – und nun kommst du und machst mich an. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, du blöde Asylantin?«
Zunächst versuchte das Personalbüro das Problem durch eine Versetzung zu lösen, aber Jana Funk bestand darauf, dass nicht sie versetzt werden sollte, sondern ihre Vorgesetzte. Da die Personalleitung in diesem Punkt nicht einsichtig war, nahm Jana die Sache selbst in die Hand und bat den grobschlächtigen Sohn ihres verstorbenen Schwagers um Hilfe. Zu zweit passten sie die zierliche Filialleiterin auf dem Heimweg ab und drohten damit, ihr und ihrer Familie »die Hölle auf Erden« zu bereiten, sollte sie nicht freiwillig die Filiale wechseln.
Es war das erste Mal, dass der kleine Lutz seinem glatzköpfigen Cousin Gottfried Wegener begegnete, der mit seinen Muskeln wie die Superhelden aus dem Fernsehen mächtig Eindruck auf ihn machte.
Drei Tage lang genoss Jana ihren vermeintlichen Triumph, denn ihre Filialleiterin war nicht mehr zur Arbeit erschienen und hatte sich überraschend krankgemeldet. Als am Nachmittag des dritten Tages zwei Polizeibeamte im Supermarkt erschienen und Jana vor allen Augen abführten, war dies jedoch der beschämendste Tag ihres Lebens. Die Filialleiterin hatte die Drohungen heimlich mit ihrem Handy aufgezeichnet, dann allerdings zwei Tage lang mit sich gerungen, Anzeige zu erstatten, da sie das Leben der jungen Mutter Jana Funk nicht zerstören wollte. Am Ende ging schließlich ihr Mann mit der Audioaufnahme zur Polizei.
Fristlose Kündigung, drei Monate auf Bewährung, Übernahme aller Gerichtskosten sowie eine Geldstrafe: Das war die Folge des Überfalls auf die Filialleiterin. Jana blieb indessen unbelehrbar.
»Mir doch scheißegal. Tut mir nur leid, dass wir der Schlampe nicht gleich die Fresse eingeschlagen haben.«
Je mehr sich Jana von der Welt da draußen missverstanden und betrogen fühlte, desto stärker klammerte sie sich an ihren kleinen Engel Lutz. Als Kind hatte der Junge sehr schnell begriffen, dass Liebe und Zuneigung von Mama nur einen zeitlich begrenzten Rahmen hatten und dass sie nahtlos in Wut und Zorn übergehen konnten. Meist folgten danach Tränen, die Bitte um Vergebung und leere Versprechen. Trotz aller Gefühlsschwankungen war Jana Funk bemüht, ihrem Sohn ein behütetes Zuhause zu geben. Selbst in der größten Wut hätte sie es nie übers Herz gebracht, ihr Kind zu schlagen. Fast Food war tabu, die Fernsehzeiten streng geregelt, und Lutz’ regelmäßigem Training in einem Fußballverein ordnete sie alles andere unter. Im Herbst 2009 lernte sie schließlich bei einem Trainingsspiel Melanie kennen, eine athletische Frau in ihrem Alter und Mutter von zwei Jungs. Da sich die Söhne gut verstanden und die zwei Frauen gern gemeinsam über ihre Ex-Männer schimpften, wurden beide enge Freundinnen. Dies führte dazu, dass Melanie ihr schließlich einen Job als Empfangsdame in dem Fitnessstudio vermittelte, in dem sie selbst als Trainerin arbeitete. Für geraume Zeit sorgten das feste Einkommen, die Bestätigung im Job, Melanies Freundschaft und die Routine in ihrem Alltag für so etwas wie Glück in Janas Leben, auch wenn sie sich das selbst nur schwer eingestehen konnte.
Im Frühjahr 2011 erhielt ihr zerbrechliches Vertrauen in die Welt dann wieder einen herben Rückschlag. Lutz ging in die fünfte Klasse der Gustav-Heinemann-Mittelschule in Köln-Seeberg. Er war gerade zehn Jahre alt, hatte an der Schule einen kleinen Freundeskreis und gehörte zu den ruhigen Jungs, die kaum auffielen. Angesichts der vorherrschenden Gewalt an »der Heinemann« war dies ein probates Mittel, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Schlägereien und Mobbing auf dem Schulhof gehörten zum Alltag. Das Kollegium stand dieser Situation ohnmächtig gegenüber und verschloss davor eher die Augen, als tatkräftig nach Lösungen und Auswegen zu suchen.
Am 26. Mai eskalierte diese Nachlässigkeit in einem tragischen Vorfall, der es den Verantwortlichen unmöglich machte, einfach wegzusehen.
Der vierzehnjährige Hassan hatte bei Fahrversuchen mit einem Waveboard seinen Mitschüler Murat angerempelt. Die beiden waren schon öfter aneinandergeraten. Nur diesmal wollte Murat ein Exempel statuieren, um Hassan in seine Schranken zu weisen und von seinen Kumpels »gefeiert« zu werden. In der großen Pause entdeckte er auf dem Schulhof Hassan, der seine Kopfhörer trug und laut Musik hörte, weshalb ihn der brutale Angriff von hinten vollkommen überraschte. Der erste Schlag traf ihn im Nacken, dann wirbelte Murat seinen Rivalen herum und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht, bis Hassan blutend torkelte und zu Boden ging. Umstehende Schüler schrien auf Murat ein, er solle aufhören, doch Murat kannte keine Gnade und blendete jegliche Konsequenzen seiner Tat aus.
Er packte den bewusstlos am Boden liegenden Jungen an den Haaren, hob seinen Kopf gewaltsam einen halben Meter hoch und schlug ihm mit voller Wucht noch zweimal das Knie ins Gesicht. Erst dann ließ er von Hassan ab, dessen Kopf hart auf den Teerboden knallte. Von alldem bekam Hassan nichts mehr mit, denn zu diesem Zeitpunkt hing sein Leben nur noch an einem seidenen Faden.
Im nahe gelegenen Krankenhaus versuchten die Ärzte den Jungen zu retten. Seine Familie betete für ein Wunder, auch wenn man ihnen keine Hoffnung machte. Nach einer Woche versagten Hassans Organe, und sein Herz hörte auf zu schlagen. Der Junge, der laut Presseberichten ein guter Schüler gewesen war, hatte sich kurz zuvor in der Schule zum »Streitschlichter« ernennen lassen und dafür Kurse besucht.
Es hatte ihm nicht geholfen.
Jana verfolgte besorgt die Zeitungsberichte, Fernseh- und Radiosendungen, die täglich von der Tragödie berichteten. Doch nicht weil sie Mitleid mit dem toten Jungen hatte, sondern weil sie sich Sorgen um ihren Sohn machte.
Sie war fest davon überzeugt, dass die Gewalt an der Schule allein von den ausländischen Kindern ausging. Die kurdische und türkische Abstammung der beiden Kontrahenten bestätigte ihre Vorurteile. Je mehr Details zur Tat bekannt wurden, desto größer wurden ihre Angst und der erneut anschwellende Hass gegen alles, was für Jana ausländisch anmutete.
Als die Stadt Köln trotz der Tragödie zwei Monate später auch noch die Gemeinschaftshauptschule am Holzheimer Weg auflöste und in die Gustav-Heinemann-Mittelschule integrierte, wandte Jana sich in ihrer Verzweiflung erneut an Gottfried. Sie schluchzte dabei so laut ins Telefon, dass er kaum ein Wort verstand.
»Noch mehr Ausländer, noch mehr brutale Schläger, du musst mir helfen, Gottfried. Die gehen immer als Erstes auf die deutschen Kinder los. Du weißt, dass es so ist, du weißt es! Sie werden Lutz etwas antun. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was … Was mach ich bloß, wenn sie ihm wehtun? Wenn sie ihn auch umbringen?«
Gottfrieds tiefe Stimme klang überlegt und ließ keinen Zweifel daran, dass er die richtige Lösung für das Problem hatte.
»Dem Kleinen wird nichts passieren. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bring ihm bei, wie man sich behauptet. Ich bring ihm bei, wie man sich zur Wehr setzt, wie man kämpft. Jana, vertrau mir, ich bringe ihm bei, ein Mann zu sein.«
Für Jana klang das schlüssig. Warum sollte sie ihren Sohn in einer Welt aus Gewalt und voller gefährlicher Ausländer zu einem Duckmäuser erziehen?
»Lieber erschlägt er einen von diesen Kanaken, als selbst erschlagen zu werden«, erklärte sie zornig Melanie, die ihre Freundin noch nie so erlebt hatte.
»Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Jana. Gewalt wird immer Gewalt erzeugen. Das ist keine Lösung, glaub mir.«
»Doch, Melanie, das ist die einzige Lösung!«
Gottfried besuchte die Funks einmal pro Woche und brachte dem Jungen Kämpfen bei. Die Trainingsstunden beim Fußballverein wichen Übungen mit dem Schlagring, dem Stockkampf und dem Umgang mit einem Kampfmesser. Jana sah es gern, wenn der Kleine begeistert mit Gottfried übte und selbst dann die Zähne zusammenbiss, wenn der große Mann ihm ab und zu einen harten Schlag versetzte, der ihn unsanft zu Boden warf.
»Der Kleine hat’s drauf, ist wie ein Stehaufmännchen, kommt immer wieder hoch. Kannst stolz sein auf deinen Sohn, Jana.«
Jana war tatsächlich stolz auf ihn und merkte dabei nicht, wie sich Melanie immer mehr zurückzog und ihre Jungs von Lutz und ihr fernhielt.
Aus Lutz, dem unscheinbaren, stillen Schüler, wurde in den Folgejahren Lutz, der Schläger mit der frechen Schnauze. Kaum einer kassierte so viel Prügel wie der kleine Lutz, und kaum einer stand so oft wieder auf wie er, um am Ende einen Kampf doch noch für sich zu entscheiden. Dabei achtete er stets darauf, nicht zu weit zu gehen, auch wenn ihm das zunehmend schwerfiel. Gottfried hatte ihm eingebläut, im Kampf nie die Beherrschung zu verlieren und seine Gegner niemals krankenhausreif zu schlagen.
»Wenn du von dieser Schule fliegst, Kleiner«, drohte ihm Gottfried einmal, »dann brech ich dir beide Arme, das schwör ich.« Lutz wusste, dass Gottfried nicht scherzte.
Im September 2015 besuchte Lutz die neunte Klasse, er war inzwischen fast sechzehn Jahre alt. Zwar hatte er sich wortwörtlich den Respekt seiner Mitschüler erkämpft, die lieber einen großen Bogen um ihn machten, aber seine Noten erlaubten kein Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe.