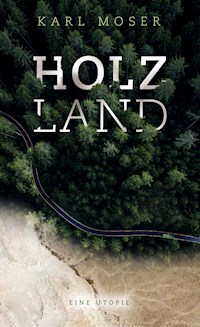
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie sähe der perfekte Staat aus? Hans Sieberath, ein deutscher Maschinenbauingenieur, will es herausfinden. Gemeinsam mit einigen Freunden und Experten macht er sich daran, die Technische Friedensdemokratie Holzland zu gründen. Dazu muss Sieberath nicht nur das technologisch Unmögliche möglich machen, sondern vor allem seine Familie für das Projekt Holzland begeistern. Und auch die internationalen Geheimdienste zeigen bald Interesse an Sieberaths bahnbrechenden Innovationen. Was als Gedankenspiel unter Gleichgesinnten beginnt, artet schnell zu einem hochkomplexen Mammutprojekt aus, an dessen Ende eine Utopie des menschlichen Zusammenlebens stehen kann - wenn da der Faktor Mensch nicht wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Beginn - Das war knapp!
Hans Sieberath und die Zeiten
Wie es so weit kam?
Warum Holzland? Die Ideengenese
Der Plan und seine Realisierung
Die Familie Sieberath und der Plan
Erklärung von Memo
Die Familie
Die Entscheidung
Die Ausreise
Tochter Renate
Sohn Georg
Karin Sieberath
Vorbereitungen
Die Einreise nach Holzland
Die Abschottung des Landes
Begrüßung durch Eugen Meister
Ankunft und erste Erklärungen
Wax
Die technische Friedensdemokratie
Flugverkehr, Fahrzeuge, Straßen
Verkehr, Hoch- und Tiefbau
Hollit, das Wundermaterial
Begrüßung und erste Eindrücke
Die ersten Aktivitäten
Prof. Stichlmair erklärt die Tunnelstory
Die Taiwanschächte
Der Tunnelkauf von Taiwan
Die Wasser- und Energieversorgung
Die gemeinsame Fahrt nach Baator
Hartwig Henne tritt auf
Erin zeigt Georg das Land
Die Geschwister besuchen das Land
Carla, Roman, Renate und Artwig in Baator
Das Grundgesetz, die Verfassung
Hartwig Henne, genannt Artwig
Forstwirtschaft und Dichtholz
Landesplanung
Artwig, der Erpresser
Energieverteilung
Artwig und Renate
Baustoff Hollit mit erweiterten Möglichkeiten
Artwig erhält ein PED
Stolz, das neue Dichtholzmaterial
PED: Möglichkeiten der Info-Visualisierung
Gespräch Hans und Roman Sieberath
Hans Sieberath wird erpresst
Das politisch schlechte Gewissen von Hans Sieberath
Zum kitschigen Schluss
Vorwort
Ein missglückter, vermeintlich wissenschaftlicher Beitrag für ein größeres Forschungsvorhaben war der Auslöser für dieses Buch. Es sollte eine wissenschaftlich erarbeitete Prognose für die Zukunft des deutschen Waldes werden, und ich sollte hierzu als Fachmann für den Holzbau und für die praktische Holzverwendung ein Kapitel beitragen. Meine zu Papier gebrachte erste, zugegebenermaßen etwas abenteuerliche Version fand bei den Mitautoren zwar interessierten, auch amüsierten Anklang, war aber für eine solch seriöse Forschungsarbeit nicht geeignet, so deren Ansicht.
Viel zu viel und noch dazu nicht fundierte Vision, viel zu viel Fantasie, keine Fakten, keine seriöse Wissenschaft. Schlussendlich wurde aus dem Ganzen dann zusammen mit den Beiträgen der renommierten Hauptautoren einer der üblichen Forschungsberichte, absolut korrekt, fundiert dargelegt und langweilig.
Das bei mir immer noch vorhandene ursprüngliche Skript mit all den Visionen und der Fantasie brachte mich auf die Idee, daraus einen kleinen holzaffinen Zukunftsroman zu machen. Wohlwissend, dass die darin enthaltene Überfülle von Technik jeden Normalleser nach spätestens 20 Seiten veranlassen würde, dieses Elaborat zur Seite zu legen. Dass zudem so manches technische Detail, so mancher Prozess einer kritischen
Funktionsprüfung nicht standhält, sei bereits hier vermerkt. Es ist dies der damals geschriebenen Vision geschuldet.
Ich versuchte also, in meinem Ingenieurdeutsch eine kleine Rahmenstory dazuzuschreiben, das Ganze lesbarer zu gestalten, um so zu einem einigermaßen spannenden und interessanten technischen Zukunftsroman zu kommen.
Der geneigte Leser möge mit Nachsicht für den Autor und mit etwas Humor, vielleicht auch mit Spaß an die Lektüre dieser Vision gehen.
Der Beginn
Das war knapp!
Carla hatte den gut 50 Meter breiten, unbewachsenen Grenzstreifen gerade überquert, als ihr Handy unbekannte, unangenehm laute Alarmsignale von sich gab und auf dem Display »Achtung: keine Verbindungen mehr!« erschien.
Sie rannte die kleine Anhöhe hinauf und fand sich auf der östlichen, der Grenze abgewandten Seite, in den Armen von Roman wieder. Er drückte seine Carla an sich, während hinter ihr mit einem Surren die elektronische Grenze wieder geschlossen wurde. Sie hatte es geschafft! Sie war in Holzland angekommen.
Beide waren so außer Atem, dass es nur für ein gegenseitiges »Endlich!« reichte, zumal Roman vehement und ohne jede Erklärung darauf drängte, sofort weiter in die dicht bewaldete, östlich der Grenze gelegene Ebene zu laufen. Es war ja nicht ganz ausgeschlossen, dass doch noch eine der im Normalfall nur recht selten patrouillierenden mobilen Grenzkontrollen daherkäme und sie verhaftete. Schon gar nicht heute, denn dies war einer der wenigen Tage, an denen die ansonsten hermetisch geschlossene Grenze für einige kurze Momente geöffnet worden war. Damit war auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Kontrollen gegeben.
Die Grenze bestand, wie bei fast allen Grenzen in der Welt, auch hier aus einem gut erkennbaren, von Pflanzen freigehaltenen Grenzstreifen mit einigen in großem Abstand angeordneten Grenzpfählen. Die wirkliche Grenzbarriere war jedoch ein komplexes Schutzsystem, bestehend aus einer Art elektronischem Zaun, der bis in die sphärischen Höhen von etwa 30 Kilometer reichte und auch in die Erde hinabging, wo er bis auf knapp 500 Meter Tiefe eine Unterminierung verhinderte.
Der Grund für die heutige außerordentliche Grenzöffnung war der Besuch, der erste übrigens, einer größeren Regierungsdelegation aus dem Nachbarstaat Russland. Sie bestand aus dem Naturminister, einem Diktatursekretär aus dem Moskauer Innovationsministerium und mehreren Mitarbeitern.
Mittlerweile hatte man in Moskau immer mehr von den kaum glaubhaften und phänomenalen Ergebnissen und Fortschritten bei der Urbarmachung der ursprünglichen Wüstengebiete gehört, auf denen sich Holzland breitgemacht hatte. Und endlich hatte man diesen achttägigen Besuch der Delegation vereinbaren können, nachdem die intensiven Kontaktaufnahmeversuche zu den maßgebenden Leuten in Holzland gefruchtet hatten.
Die ursprünglich gewünschte Anreise im eigenen Regierungsflugzeug war allerdings von den Behörden Holzlands kategorisch abgelehnt worden. Man fürchtete angeblich, dass das fremde Flugzeug beim Überqueren der Grenze Schaden an den elektronischen Steuerungseinrichtungen erleiden würde, besaß der elektronische Zaun doch eine neuartige, extrem kurzwellige Schutzkonzeption, die bei der kurzen Öffnungsdauer der Grenze möglicherweise – zumindest galt dies für fremde Flugzeuge – noch Restrisiken hätte beinhalten können. Nicht auszudenken, was passieren würde, würde jemand aus der Delegation verletzt werden. Mit dem Folgeproblem, dass man bei der dann notwendigen ärztlichen Behandlung in den Kliniken Holzlands den Patienten selbst oder auch Dritten zwangsläufig wichtige Details über die neuartige Grenzschutztechnologie hätte preisgeben müssen. Immerhin war es in den rund 20 Jahren, in denen die technische Friedensdemokratie Holzland existierte, niemandem gelungen, auch nur annähernd fundierte Informationen über das Grenzschutzsystem zu erhalten. Und selbstverständlich hatte niemand, nicht zu Fuß, in einem Auto oder Flugzeug, jemals die Grenzen Holzlands ohne Erlaubnis überquert.
Ein Grund hierfür lag in dem seit Anfang der Staatsgründung geltenden Prinzip der Nichtkontaktaufnahme mit Drittländern. Zwar hatte man bereits nach wenigen Jahren festgestellt, dass sich diese Beschränkung in dem ursprünglich geplanten Umfang insbesondere wegen des Austauschs von Grundlagenwissen nicht durchhalten ließ. Immer wieder wurde der Kontakt zu Wissenschaftlern auf der ganzen Welt notwendig, um die ambitionierten Projekte umzusetzen. Trotzdem konnte man zunächst auf allzu große Kontakte nach draußen verzichten. Auch die streng regulierten Einreiseregelungen wurden gelockert, vor allem für Fachpersonal und Experten. Oder es gab wichtige familiäre Hintergründe. Diese wurden jedoch, einhergehend mit der Entwicklung der Bevölkerung und dem zunehmenden Alter der Friedensdemokratie Holzland, immer seltener.
Wenn man so will, hatte das Zusammentreffen von Carla und Roman, auch wenn es zunächst als illegal war, familiäre Gründe. Denn auch wenn die beiden noch keine wirkliche Familie waren, sollte ihr schon seit Jahren bestehendes, enges Verhältnis später zu einer Familiengründung führen.
Roman war der älteste Sohn von Hans Sieberath, dem zukünftigen Präsidenten der technischen Friedensdemokratie Holzland. Vor Jahren waren er und seine Familie unter strengster Geheimhaltung von ihrem Zuhause in Deutschland nach Holzland gezogen. So überstürzt war ihre Abreise damals gewesen, dass er keine Möglichkeit gehabt hatte, sich mit seiner Carla in Verbindung zu setzen und sie zu informieren. Zudem hatte er es damals vermieden, seiner Familie von seiner erst recht kurzen, jedoch umso intensiveren Liebschaft zu erzählen. Hatte er doch, nicht ganz zu Unrecht, die Befürchtung, dass Carlas Elternhaus bei seinen eigenen Eltern, insbesondere bei seinem Vater, auf wenig Gegenliebe gestoßen wäre. Da er seine Carla in dieser ersten Zeit in Holzland aber nicht vergessen konnte, schaffte er es, einen Kontakt zu ihr im fernen Deutschland herzustellen und eine illegale Einreise zu ermöglichen.
Dass er den streng geheimen Zeitpunkt der kurzzeitigen Grenzöffnung in Erfahrung bringen konnte, war letztlich seinem immer noch geltenden Sonderstatus als Sohn des zukünftigen Holzlandpräsidenten geschuldet, den er zumindest in diesem für ihn, wie er meinte, lebensnotwendigen Fall ohne jeden Skrupel nutzte.
Hätte er zum damaligen Zeitpunkt bereits gewusst, was er mit dieser strafbaren Einreise später sich, Carla und seiner ganzen Familie für Schwierigkeiten bereiten würde, wäre er wohl anders an die Lösung des Problems herangegangen. Aber im Nachhinein ist man ja immer sehr viel klüger.
Diese späteren Ärgernisse hingen auch mit Jan Hinrich, einem weiteren Bürger Holzlands, zusammen. Der hatte auf weit weniger direkten Wegen von der kurzfristigen Grenzöffnung gehört und wollte die Gelegenheit nutzen, unerkannt das Land zu verlassen. Es wäre eine Flucht gewesen, immerhin war er wegen schwerer Energiesabotage angeklagt und auf der Flucht vor dem Gesetz. Außerdem war er der festen Überzeugung, dass Satan höchstpersönlich bald über Holzland herfallen würde. Auch deswegen hielt er es für nötig, das Land so schnell wie möglich zu verlassen.
Zu allem Überfluss hatte er sich für seine Flucht dasselbe Areal ausgesucht, in dem Roman auf Carla wartete. Es lag abseits von Städten und Dörfern, war aber von beiden Seiten der Grenze aus gut zu Fuß zu erreichen. Hinrich hatte sich auf die Lauer gelegt und beobachtete mit einem Fernrohr die Grenze. Als er Roman, der hinter einem Busch stand, entdeckte, erschrak er und nahm an, er sei ein Mitglied einer der befürchteten mobilen Grenzkontrollen. Hinrich wartete deshalb ab, hoffte, dass Roman irgendwann gehen würde. Die Zeit wurde knapp, und als er sich endlich auf den Weg hätte machen sollen, sah er Carlas illegalen Grenzübertritt. Sofort wusste er, dass er mit seinem Versuch, die Grenze ebenfalls zu queren, gescheitert war, denn das Fenster hatte sich bereits wieder geschlossen, die Sicherung war wieder eingeschaltet. Voller Enttäuschung und Wut ob der missglückten Flucht beobachtete er die davoneilenden Carla und Roman. Dabei erkannte er zufällig, dass es sich bei dem jungen Mann nicht um einen Grenzkontrolleur handelte. Es war wohl der Präsidentensohn Sieberath, den er aus diversen Presseveröffentlichungen kannte.
»Darauf komme ich sicher noch zurück«, schwor er sich und trat den traurigen Rückweg an.
Ein anderer junger Mann, Hartwig Henne, genannt Artwig, hatte vor geraumer Zeit ebenfalls die Grenze Holzlands überschritten, jedoch von außen nach innen. Ganz offiziell und legal als Mitglied einer chinesischen Expertengruppe, aber mit einem Auftrag des chinesischen Geheimdienstes in der Tasche. Allerdings wusste er damals noch nicht, dass für ihn eine Rückkehr nach China nicht vorgesehen war. Den Versuch, die Grenze unerkannt zu überqueren, so wie Jan Hinrich, hatte er ganz bewusst erst gar nicht unternommen, war ihm doch schon vorab klar geworden, dass ein solcher Versuch hoffnungslos wäre.
Carla und Roman liefen, so schnell sie konnten, in Richtung Osten bis zu einer winzigen, stark verfallenen Hütte aus Lehm. Dahinter stand ein kleiner Geländewagen mit der Aufschrift »Verkehrswegeplanung Holz«.
Roman zog Carla in die leere Hütte hinein, wo beide, noch vollkommen atemlos und überdreht, übereinander herfielen. Gleichzeitig versuchten sie vergeblich, dem anderen all das zu sagen, was ihnen wichtig erschien. Schließlich gewann Roman im Rededuell die Oberhand. Er vermittelte ihr die wohl oder übel notwendigen Verhaltensregeln für die bevorstehende weitere Einreise ins Land.
Carla wusste danach, dass sie, bis Roman die offizielle Klärung geschaffen haben würde, absolut unerkannt versteckt werden musste. Roman schilderte ihr auch kurz seinen Plan für die Zukunft, wobei sie ihm zwischendurch immer wieder den Mund mit einem tiefen Kuss verschloss.
»Wir werden zunächst ungefähr 200 Kilometer auf schlechten Wegen in ein nahezu verlassenes Dorf namens Baator fahren, wo du bei befreundeten Ureinwohnern untergebracht wirst. Sobald und sooft ich kann, werde ich dich besuchen. Du musst dich jedoch auf recht einfache Verhältnisse gefasst machen. Strom, fließendes Wasser und jegliche Art von modernen Kommunikationsmitteln, geschweige denn Fernsehen und Ähnliches, gibt es nicht. Auch wird dir vermutlich das Essen nicht unbedingt schmecken. Aber ich gebe mir redlich Mühe, dich da so bald wie möglich rauszuholen.«
»Und wie soll ich mich mit diesen Leuten unterhalten?«, fragte Carla.
»Zufällig wohnt dort seit geraumer Zeit ein junger Deutscher namens Artwig«, antwortete Roman, »der die Sprache der Einheimischen mittlerweile wohl versteht und der dir sicher gerne als Dolmetscher hilft.«
»Und was macht dieser Artwig dort?«, fragte Carla.
»So ganz genau weiß ich das momentan auch noch nicht. Etwas komisch kommt mir das Ganze schon vor. Aber was solls? Ich bin froh, dass es ihn gibt.«
Im Weiteren erhielt Carla noch diverse andere Vorgaben, bevor sie in den Wagen stiegen und Roman mit abenteuerlicher Geschwindigkeit, eine lange Staubwolke hinter sich herziehend, den Sandweg entlang brauste.
»Musst du so verrückt fahren? Da merkt doch jeder sofort, dass wir auf der Flucht sind.«
»Keine Sorge! Ganz im Gegenteil! Auf diesen Wegen und abgelegenen Straßen gibt es, anders als im Rest des Landes, keine Geschwindigkeitsbeschränkungen. Jeder, der die Möglichkeit hat, nutzt dies, um mal richtig aufs Gas drücken zu können. Wir würden nur auffallen, wenn ich die ansonsten vorgeschriebenen 80 km/h fahren würde.«
»Warum fahrt ihr denn so langsam? Die 100 km/h bei uns zu Hause sind schon ätzend langsam. Und hier ist doch kaum Verkehr?«
»Richtig«, antwortete Roman, »aber wir fahren hier dafür mit den erheblich besser ausgebauten Öffentlichen um einiges schneller. Keiner käme normalerweise auf die Idee, längere Strecken mit dem Auto zu fahren.«
Die Fahrt nach Baator verging dann wie im Flug, war doch von beiden Seiten unendlich viel zu erzählen, was nur von Berührungen und Umarmungen unterbrochen wurde, was die Fahrsicherheit nicht unbedingt steigerte.
Die Wege wurden immer schlechter, schmaler und einsamer, bis sie nach etwa zwei Stunden die Hütten und Zelte von Baator erreichten. Eine Reihe von Frauen und Männern samt einer Schar Kinder begrüßten die Ankömmlinge. Sie waren in recht bunte, ziemlich abenteuerlich aussehende Hosen und Umhänge gekleidet. Was sie sagten, konnten Carla und Roman nicht verstehen. Aber es klang zumindest recht freundlich.
Aus einer der Hütten kam dann der Dorfexot Hartwig Henne, genannt Artwig, auf die neuen Gäste zu und begrüßte vor allem Carla in bestem Hochdeutsch, was er offensichtlich trotz langem Auslandsaufenthalt nicht verlernt hatte. Auch schien er vom Aussehen des jungen weiblichen Gastes ausgesprochen positiv überrascht, um nicht zu sagen: begeistert zu sein. Damit würde die Betreuung der jungen Dame, um die ihn Roman vor einiger Zeit gebeten hatte, doch sicher Spaß machen.
Auch Carla war sowohl vom allgemeinen Empfang durch die Einwohner als auch vom Aussehen und Auftreten Artwigs angetan. Sie hatte einen alten Kauz erwartet.
Da Roman zwangsläufig in Eile war, war auch der Abschied von Carla recht kurz. Er hatte sich für diesen Tag mit vagen Gründen in seinem Amt entschuldigt. Auch sollte er am Abend zusammen mit seinem Vater als Mitgastgeber bei einem Empfang für die russische Delegation auftreten. Aber er versprach, dass er in wenigen Tagen wieder zu Besuch kommen werde, um dann auch für mehre Tage zu bleiben. Bis dahin, so hoffte er, könnte er vielleicht schon wissen, wie es weitergehen sollte.
Artwig befand für sich, dass dieses Weitergehen eigentlich gar nicht so eilig war, wenn sich sein erster Eindruck von Carla denn auch im Weiteren bestätigen sollte.
Der genannte russische Staatsbesuch, der von beiden Seiten weder als solcher deklariert noch öffentlich angekündigt worden war, hatte mehrere Gründe, die alle zum großen Nutzen beider Staaten dienen sollten. Die Einreise der Delegation hatte sich von den üblichen Abläufen solcher Treffen erheblich unterschieden. So wurden den Besuchern und Staatsgästen der genaue Ort und der Besuchstermin, insbesondere der Beginn der lediglich 10 Minuten dauernden Grenzöffnung, erst eine Stunde vor dem Transfer per verschlüsselter Mail mitgeteilt. Man bat sie deshalb, sich für den Übertritt unweit der Landesgrenze zu Land oder auch schon im Flugzeug bereitzuhalten.
Versuchte jemand die Grenzlinie und den elektronischen Zaun zu überqueren, dann generierte die Anlage automatisch eine Art von Sperrreaktion. Vergleichbar mit einem Magneten, bei dem sich zwei Pole abstoßen, wurde alles, gleichgültig ob Mensch, Tier oder Maschine, von der Grenze weggeschoben, und zwar mit steigender Energie, je näher Mensch oder Maschine dem elektronischen Grenzzaun kam. Eine gänzlich neue Technologie war hierfür im Einsatz. Dabei waren Schädigungen bei den betroffenen Menschen und Tieren ganz bewusst ausgeschlossen. Diese Vorgabe wurde auch, anders als in sehr vielen anderen Ländern, tatsächlich und in aller Konsequenz eingehalten.
Flugzeuge, Fahrzeuge, Maschinen und Apparate verloren jedoch mit Annäherung an den Grenzzaun ihre Betriebsfunktionen. Sie blieben ganz einfach stehen oder wurden abgelenkt. Das galt auch für Granaten, Raketen und ähnliche Objekte, die immer mal wieder von missgünstigen Nachbarn abgeschossen wurden. Auch Versuche, den Grenzzaun mit orbitalen Flugkörpern zu überwinden, waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Man hatte dazu die Überlegungen der USA im Zusammenhang mit dem »Krieg der Sterne« in sehr konkrete orbitale Schirme umgemünzt. Sie brachten von oben eindringende, nicht bemannte Objekte zum Verglühen und lenkten bemannte Flugkörper in ihrer Flugbahn ab. Diese folgten dann der Erdkrümmung wie auf einem Gleitfilm bis in Bereiche außerhalb des Staatsgebietes von Holzland. Der Orbitalschirm diente gleichzeitig auch einer gewissen, jedoch nicht absoluten Abschirmung gegen Einsichtnahme von oben. Dies mit der Konsequenz, dass es nur noch etwa 50 Jahre alte Aufnahmen des Landes gab, nämlich die wenigen Satellitenaufnahmen der Militärs und der einstigen Google-Earth-Version aus der Zeit vor dem Orbitalschirm. Selbst diese waren recht dürftig. Die Fläche von Holzland hatte früher nur aus Wüste bestanden und war deshalb damals für alle ausgesprochen uninteressant gewesen.
Schon Sven Hedin, der Entdecker, hatte eine Durchquerung des Landes als den Horror schlechthin beschrieben. Auch die diversen Reisemagazine, die in ihren Reportagen ohnehin lieber die inzwischen allgemein in Mode gekommenen Ziele behandelten, wurden müde, aus dem vermeintlichen Sandland zu berichten. Lediglich bei den internationalen Militärs führte die unbefriedigte Neugier, aber auch die Sorge vor überraschenden Angriffen aus diesem unbekannten Land zu immer neuen und immer wieder zum Scheitern verurteilten Ausspähversuchen. Es hatte in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe von Entlassungen bei Militärs und Geheimdiensten gegeben. Die Gründe waren die Unfähigkeit, verlässliche Einzelheiten aus dieser merkwürdigen, absolut nicht einschätzbaren Sandwüste zu bekommen. Und es gab auch immer wieder umfangreiche, im Endeffekt aber vergebliche Versuche, mit neuentwickelten militärischen Technologien den vorhandenen Schutzschild zu überwinden.
Insoweit war es nicht verwunderlich, dass inzwischen immer verrücktere Geschichten über Holzland die Runde machten. Allerdings war, wie bei solchen Geschichten fast immer, ein mehr oder weniger großes Körnchen Wahrheit dran. Meist waren es technische, eigentlich unwichtige, Einzelheiten, deren Weitergabe sich wegen des Austauschs von Grundlagenwissen zwischen den Ländern nicht ganz verhindern ließ. Aus diesen Körnchen entstanden dann in der Fantasie der Menschen, aber auch bei den staatlichen Propagandaabteilungen der Länder die verrücktesten Storys. Das gipfelte in der Vermutung, dass es sich bei den Bewohnern von Holzland nicht mehr um Menschen handeln würde. Es wären mutierte Roboter, die zwar wie Menschen aussähen, jedoch ungeahnte, eben künstlich programmierte und angelernte Fähigkeiten besäßen. Es gäbe (positive) Plus-Menschen und (negative) Minus-Menschen, die jedoch wie Mann und Frau in der restlichen Welt in der Lage wären, durch Aufeinanderlegen von im Normalfall verdeckten Elektrokontakten weitere Roboter/Menschenkinder zu erzeugen. Wie dann das weitere Wachstum vor sich gehen sollte, darüber schwiegen die staatlichen Märchenerzähler und förderten damit umso mehr die Fantasie ihrer Bürger.
Auch gab es die Horrorversion, dass sich bei den Holzland-Menschen eine Rückwärtsevolution entwickelt hätte, von der nur einige ganz wenige Alphamenschen ausgenommen wären. Die würden nun ein Land von unterentwickelten Kretins befehligen. Dabei entzögen sie im Zuge der Rückwärtsevolution den menschlichen Hirnen die ursprünglich vorhandene Intelligenz. Diese würde gebündelt und in einem zentralen Hochleistungsdatenspeicher abgelegt. Nur einige wenige hätten darauf dann Zugriff. Das Ganze würde durch ein infames Verfahren mittels angeblicher Zwangsimpfungen erfolgen.
Es war für den unwissenden Außenstehenden ganz einfach nicht nachvollziehbar, wie in einem Land, in dem es nur Sand gab, in einer absoluten Wüste, die dann doch bekannt gewordenen Erfolge in einer vergleichsweise kurzen Zeit auf natürlicher, menschlicher Basis, also ohne jeden Hokuspokus, realisiert werden konnten. Natürlich wirkte auch ein gutes Stück Neid oder Besserwisserei aus der Zeit der Gründung von Holzland mit. Die vielen ewig Gestrigen der ganzen Welt hatten den damaligen Gründern das Allerschlimmste für ihr Land prophezeit. Eben dieses Land, das seinerzeit von der weltumfassenden Staatengemeinschaft, insbesondere aber von China mehr oder weniger verschenkt worden war. Als völlig wertlos wurde dieses Wüstenland damals eintaxiert. Ein baldiges Verhungern und Verdursten war noch das Mindeste, was vorausgesagt wurde, bis hin zu tödlichen Halluzinationen, die der unendlich vorhandene Sand in Kombination mit den extremen Hitze- und Kälteschwankungen bewirken würde.
Nicht bekannt war damals allerdings, dass die späteren Holzlandgründer die Idee der für ihren Staat logischerweise nicht einfach so spontan entwickelt und sich dann einfach so aufgemacht hatten, ihr neues Land zu gründen. Man wusste nicht, dass dieser Gedanke, unbemerkt von der ganzen Welt, in sehr kleinen, sehr geheimen Zirkeln über nahezu drei Jahrzehnte generiert und ausgearbeitet worden war. Das Ganze basierte auf einem IT-Programm der übernächsten Generation, das in seiner virtuellen Form auf die üblichen Programm- und Hardwarestrukturen verzichten konnte. Auch war es nicht mehr notwendig, sich in irgendwelchen Hinterzimmern zu treffen. Vielmehr war auf der Basis der sich selbst weiterentwickelnden virtuellen Sprache »Holzland« eine weltweite, von Außenstehenden nicht wahrnehmbare Kommunikation möglich geworden. Das frühere Thema der künstliche Intelligenz oder KI hatte dabei anfänglich Pate gestanden.
Die Idee, das Themen nur virtuell zu bearbeiten, also ohne die übliche Sprachbrücke, trug auch dazu bei, dass niemand in den langen Jahren der Holzlandideengenese etwas davon bemerkte, geschweige denn im Detail etwas wusste.
Hans Sieberath und die Zeiten
Es waren hektische Zeiten damals um das Jahr 2050. Ungeachtet der in vielen Ländern immer wieder aufflammenden Kriege und Auseinandersetzungen entwickelte sich mehr und mehr auch ein Kampf um die noch vorhandenen natürlichen Ressourcen der Erde, insbesondere ein Kampf ums Trinkwasser. Dabei waren es meistens, wie eigentlich schon seit Menschengedenken, sehr greifbare Privatinteressen einiger weniger, die auf den Schultern und zulasten der Ärmsten ausgefochten wurden. Nahezu unversöhnliche Gruppierungen prallten mit ihren Ansichten aufeinander. Da waren einmal mehr die ewig Gestrigen, die aus leicht nachvollziehbaren Gründen nicht auf ihre in langen Jahrzehnten erarbeiteten oder ergaunerten Besitztümer und Ansprüche verzichten wollten. Und da war die ganz große Gruppe der anderen, die weniger oder nichts besaßen. Sie hatten die berechtigte Sorge, dass die nur noch spärlich vorhandenen Ressourcen der Erde von den wenigen Mächtigen allein genutzt werden würden.
Absurderweise konzentrierte sich dabei der Fokus der Interessen und Überlegungen immer wieder nur auf die Gebiete der Erde, die ohnehin als die ausbeutungsfähigen, mit natürlichen Ressourcen gesegneten angesehen wurden. Anscheinend war die Menschheit nach wie vor zu nichts anderem in der Lage. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie es seit Jahrhunderten nicht gewohnt war, außerhalb des Bekannten zu denken, und deshalb alles andere außer Acht ließ; nämlich auch die Gebiete dieser Erde, die bisher als quasi unnütz galten. Gleichgültig war dabei, ob es sich nun um die Tiefen der Ozeane, die Gebirgsregionen, die überschwemmungsgefährdeten Sumpfgebiete oder eben um die ausgedehnten Wüstenflächen handelte.
Bei den Wüsten stellte nur die Sahara eine Ausnahme dar, weil man sie mittlerweile in weiten Bereichen als preiswertes Gelände für Solarmodule nutzte, nicht zuletzt wegen der vergleichsweise geringen Entfernung zu den hauptsächlichen Energieverbrauchern in Europa.
Keiner, kein Forschungsinstitut und kein Land machte sich gänzlich frei von dem eingefahrenen Gedanken- und Ideengut der Vergangenheit. Niemand wagte den Schritt hin zu den vermeintlich nicht nutzbaren Bereichen der Erde, hin zu grundsätzlich vorstellbaren neuen Lebens- und Erlebens-bedingungen.
Hans Sieberath war die Ausnahme. Nach seinem Studium in München, mit dem er einer Familientradition folgte, war er zu einem hervorragenden Maschinenbauingenieur geworden. Er hatte schon von seinen Grundschulkameraden, dann aber auch später während des Studiums von seinen Kommilitonen den Beinamen »Tüftler« bekommen. Er war jedoch weit mehr als ein begnadeter Ingenieur.
Seine Arbeitsstelle hatte er bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, das Komponenten für leistungsfähige Pumpenaggregate herstellte. Bei der Geschäftsführung und den Kollegen galt er als ein begnadeter Techniker, der mühelos in die Geschäftsleitungsebene oder in weit einflussreichere Positionen in der Industrie hätte gelangen können, hätte er nur etwas mehr Ehrgeiz an den Tag gelegt. So jedenfalls meinten fälschlicherweise die meisten, weil sie die wirklichen Leistungen von Hans Sieberath nicht kannten.
Politisch war er in keiner der vielen Parteien aktiv, geschweige denn deren Mitglied, auch wenn er in seinem Heimatort Schrobenhausen immer wieder von den Vertretern der verschiedenen politischen Gruppierungen gebeten, ja teilweise bedrängt wurde, sich zu engagieren. Immerhin waren seine bekannt sachlichen und fundierten Kommentare über Projekte der Gemeinde und darüber hinaus außerordentlich geschätzt.
Was man aber in Schrobenhausen und auch anderswo nicht wusste und was Hans Sieberath über Jahrzehnte sogar seiner eigenen Frau und seiner Familie verheimlichte, war die Tatsache, dass er an das Nichtmögliche in anderen Ländern dieser Erde dachte. Er und einige Freunde erforschten und bauten die Wege zur Realisierung des Unmöglichen aus, und zwar in mühsamer Kleinarbeit.
Seine Familie, die inzwischen auf insgesamt fünf Mitglieder angewachsen war, informierte er erst, als es endgültig notwendig wurde, offen zu handeln.
Seinen Lieben, vor allem aber auch seinen vielen Berufskollegen und Freunden erzählte er immer wieder, dass seine Arbeit im stillen Kämmerlein der Entwicklung einer großen maschinenbautechnischen Neuerung gelte. Die erhofften späteren Erträge aus den daraus entstehenden Patenten sollten dann auch dazu dienen, seiner Familie und sich selbst bei der vorzeitigen Pensionierung die nötige finanzielle Sicherheit zu bieten.
Das alles war auch nicht ganz falsch, schaffte er es doch trotz seiner geheimen Hauptbetätigung, auch für das Unternehmen immer wieder Neuentwicklungen zu generieren und entsprechende Patente anzumelden, die ihm zusätzlich zu seinem ohnehin nicht niedrigen regulären Gehalt ganz erhebliche finanzielle Mittel einbrachten.
Dass dies schlussendlich in dieser Form möglich war, verdankte er unter anderem einem Vertrag, den er bereits in frühen Jahren mit seinem Chef ausgehandelt hatte. Der ließ Sieberath für die eigenständige Verwertung der von ihm entwickelten Patente absolut freie Hand. Die Unternehmensleitung war seinerzeit übrigens gerne auf diese Vereinbarung eingegangen, war sie doch mit einer Reduzierung der laufenden Bezüge Sieberaths verbunden. Außerdem konnte man sich nicht vorstellen, dass dieser junge Ingenieur eines Tages derartig Innovatives zustande brächte.
Insgesamt unternehmerisch also ein gravierender Fehler, den die damals Verantwortlichen erst sehr spät, ja teilweise nie erkannten. Denn letztendlich brachten die verschiedene Patente Hans Sieberaths extrem hohe Lizenzgebühren, wenn sie bei den großen Unternehmen der Welt und insbesondere beim Verteidigungsministerium der USA untergebracht wurden.
Dass Sieberath, um all diese Fakten zu verdecken, die Schutzrechtsanmeldungen unter dem Namen seines einzigen wirklichen Freundes Fritz Kreisl vornahm und dieser dann auch alle Einnahmen korrekt auf seinem eigenen Konto zur späteren Verfügung von Sieberath verbuchte, war von Anfang an vorgesehen. Es war ein Teil der Gesamtstrategie Sieberaths.
Ein Vorteil war zudem, dass sein Freund Kreisl bereits als junger Mann ganz legal auf die Insel Man vor England gezogen war und sich damit dort auch weitgehend legal der Besteuerung der Einnahmen entzog, was der exorbitant hohen Beträge wegen im Laufe der Zeit zu teilweise wütenden Steuerprotesten aus vielen Ländern der Erde führte. Auf Sieberath fiel plangemäß aufgrund dieser Konstellation keinerlei Verdacht.
Auf der Insel Man selbst wunderte man sich bei den zuständigen Behörden allerdings immer wieder sehr darüber, dass ein so gewöhnlicher Mann wie Fritz Kreisl über derartig hohe Einnahmen verfügte, die offensichtlich weitgehend aus seiner vermeintlich erfinderischen Tätigkeit stammten.
Wie es so weit kam?
Das Schrobenhausener Maschinenbauunternehmen, in dem Hans Sieberath beschäftigt war, wurde Anfang der Fünfzigerjahre von einem weltweit tätigen namhaften Explorationsunternehmen gebeten, sich an einem Projekt in der Wüste Gobi zu beteiligen. Man wollte einmal mehr den Versuch unternehmen, durch ausreichend tiefe Bohrungen auf sogenannte Tiefenwasser zu stoßen. Damit würden sich endlich die Wünsche der Politiker im benachbarten Russland und China erfüllen, dieses wertlose Wüstenland vielleicht doch noch zumindest geringfügig besiedeln zu können.
Die dabei im Untergrund erwarteten Hochtemperaturen sollten durch die Nutzung der Geothermietechnik auch für die zukünftige Energieversorgung dieser Gebiete dienen.
Die Schrobenhausener Pumpenspezialisten sollten mit ihren speziellen Aggregaten das vermutete Wasser aus mehreren Tausend Metern Tiefe fördern. So etwas war nur mit hochtemperaturbeständigen Höchstdruckpumpen mit mehreren 100 Bar Druck möglich. Die notwendige Rückkühlung des geförderten Wassers wurde von amerikanischen Spezialunternehmen vorgenommen.
Man hielt in Schrobenhausen von Anfang an nicht allzu viel von diesem Vorhaben, hatte man doch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in verschiedenen Wüstenregionen vergeblich versucht, derartige Wünsche zu erfüllen. Leider jedes Mal ohne Erfolg.
»Nichts außer Kosten und Ärger, vor allem mit der Bezahlung«, sagte Stefan Heckl, Sieberaths Chef. Da man sich aber wegen anderer, sehr viel erfolgreicherer Geschäfte mit dem Explorationsunternehmen nicht erlauben konnte, abzusagen, nahm man nolens volens den Auftrag an. Außerdem erhielt Heckl einmal mehr die Zusicherung für eine pünktliche Bezahlung.
Der Auftrag beinhaltete neben der Lieferung und Inbetriebnahme der Pumpenaggregate auch die Wartung der Geräte vor Ort, und zwar über eine Dauer von mindestens zwölf Monaten.
»Wen schicken wir denn da runter?«, fragte Heckl sich. »Es sollte ja schon ein vernünftiger Mann sein, aber auch jemand, den wir für ein Jahr einigermaßen entbehren können.«
»Da gibt’s doch seit Kurzem diesen jungen Maschinenbauer Sieberath bei der Forschung & Entwicklung in der Pumpenabteilung«, schlug ein Mitglied der Führungsrunde vor. »Er macht sich ganz ordentlich, auch wenn er nicht gerade der Fleißigste ist. Andererseits hat er alle möglichen verrückten Ideen und ist bei deren Realisierung dann doch recht schnell. Dumm ist er sicher nicht. Kürzlich kam er daher und fragte mich, ob er seine Ideen, wenn sie denn patentfähig wären, auch selbst vermarkten dürfe. Meine Antwort war: Ja, meinetwegen, aber natürlich nur dann, wenn es sich nicht um firmeneigene Themen handelt. Ich habe ihn einen entsprechenden Vertrag unterschreiben lassen und ihm dabei gleichzeitig sein Gehalt um 20 Prozent gekürzt, was er ohne Widerspruch akzeptiert hat.«
»Da muss er aber recht gute Patentideen haben, wenn er mit einer solchen Regelung einverstanden ist«, antwortete Heckl. »Haben Sie ihm auch gesagt, dass wir trotz seiner Spinnereien weiterhin auf seine volle Arbeitskraft Wert legen?«
»Habe ich und hab ihm gleichzeitig viel Glück gewünscht, mit seinen anscheinend so großen Ideen.«
»Na also, dann haben wir doch unseren Mann für die Wüste. Da kann er dann in trockener, heißer Umgebung seine eigenen Ideen generieren und daneben unsere Pumpen am Laufen halten. Meinetwegen kann er auch länger als die vorgesehenen zwölf Monate da unten bleiben. Ich habe beim Vertrag mit den Amerikanern einen für uns ausgesprochen lukrativen Kostensatz für die Wartung ausgehandelt.«
Hans Sieberath wurde also gefragt, ob er sich diese Auslandstätigkeit vorstellen könne, und er sagte nach kurzer Bedenkzeit zu.
Vor seiner alsbaldigen Abreise informierte er sich dann eingehend über alles, was ihn in der Wüste Gobi erwarten würde. Natürlich interessierten ihn die rein technischen Details, die für seinen Firmenauftrag wichtig waren. Aber er sammelte auch Informationen über Land und Leute, soweit es dort überhaupt welche gab, über Fauna und Flora und über die politischen Verhältnisse und die Geschichte des Landes. Er las diverse Reiseberichte von Sven Hedin, die jedoch mit der Moderne, das Klima ausgenommen, nicht mehr sehr viele Parallelen aufwiesen.
Es waren dann spannende Zeiten, die Sieberath in dieser Wüstenregion erlebte. Seine Hauptaufgabe, die verlässliche Pumpenwartung bei den diversen Bohrungen, erfüllte er zusammen mit seiner deutschen und teilweise mongolischen Crew zur absoluten Zufriedenheit seiner Auftraggeber.
Das Ziel des Projektes wurde jedoch leider nicht erreicht. Zwar konnte man eine ganze Reihe von Bohrungen erfolgreich niederbringen, auch bis in die vorgesehenen Tiefen. Gefördert wurde dann jedoch nur viel heißer Dampf, vermengt mit geringen Mengen Schlamm. Alles absolut nicht im Sinne der Explorationsfirma und wohl auch nicht im Sinne der Auftraggeber in den umliegenden Ländern. Sie konnten zwar viele technische Erkenntnisse sammeln, aber ihre geheimen Hoffnungen auf ein blühendes Land oder zumindest auf ein paar ertragreiche Gärten im Wüstensand mussten sie begraben. Auch die Energiegewinnung aus der Tiefe war nur Wunsch geblieben. Man verschloss also die Bohrlöcher mehr schlecht als recht und räumte die Baustellen.
»Es ist und bleibt eine verdammte Ödnis, eine für nichts verwertbare Wüste«, so ein mongolischer Staatsbeamter.
Sieberath nutzte damals die neben seiner Arbeit verbleibende Zeit intensiv, um das Land in all seinen Facetten kennenzulernen. Er kam dabei auch mit einigen Ureinwohnern zusammen. Die mongolischen Mitarbeiter in seiner Crew halfen ihm bei der Kommunikation.
Eine Sonderstellung nahm hier Hang Nu ein. Der dreißigjährige Maschinenbautechniker war vor Jahren im Rahmen eines Studentenaustauschprogramms von der mongolischen Regierung für mehrere Jahre nach Deutschland geschickt worden. Unter anderem war er auch für drei Monate in der Abteilung Forschung und Entwicklung der Schrobenhausener Maschinenbaufirma als Praktikant tätig gewesen. Hans Sieberath war in dieser Zeit sein von ihm sehr verehrter Chef gewesen. Die Freude beider war deshalb sehr groß, als sie sich bei dem Tiefbohrprojekt wiedersahen. Hang Nu war von der Regierung als sachkundiger Mitarbeiter für die Projektcrew zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund seiner hervorragenden Deutschkenntnisse sollte er vor allem auch als Dolmetscher agieren.
»Jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, wenn Sie mit von der Partie sind«, sagte Hang Nu voller Begeisterung, als er Sieberath vom Flughafen abholte.
»Aber nur, wenn Sie mir auch sagen, wo wir denn bohren sollen und ob sich das Ganze dann wohl auch lohnt«, gab Sieberath zurück.
»Vielleicht können uns ja die Bewohner des Örtchens Baator ein paar Tipps geben. Das liegt ganz in der Nähe. Ich bin übrigens angeblich sogar mit einigen von ihnen ganz weitläufig verwandt. Das hat mir zumindest mein Großvater gesagt, als ich ihm erzählte, dass ich für ein deutsches Unternehmen hier in dieser Gegend tätig sein werde.«
»Ich befürchte, dass unsere amerikanischen Explorationsknaben auf die Meinung von ein paar Dorfbewohnern wenig geben werden. Sie verlassen sich eher mehr auf ihre vermeintlich so tollen und sicheren Aufnahmen aus dem Weltraum. Aber ich würde mich gerne mal mit Ihren – darf ich Du sagen?«
»Das Du ist doch selbstverständlich«, gab Hang Nu zurück. »Aber nur wenn ich bei ihnen beim Sie bleiben darf.«
»Ich würde mich gerne mit deinen Verwandten unterhalten. Kannst du mich da mal hinführen?«
Hang Nu nickte eifrig.
»Und, was ich noch fragen wollte: Wie sieht es mit der Verständigung aus?«
»Mein Großvater hat noch recht gute Kenntnisse der alten Sprache dieser Leute, und ein bisschen hat er auch mir beigebracht. Gerne fahre ich mit Ihnen mal raus nach Baator. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Die Entwicklung ist dort schon vor fast mehreren Jahrhunderten stehen geblieben. Sagen Sie mir einfach, wann wir fahren sollen. Es sind gerade mal knapp 50 Kilometer durch die Wüste.«
Die Sprache dieser Ureinwohner hatte in der Tat nur wenig mit den aktuell in der Mongolei und China verwendeten Sprachen zu tun. Trotzdem erfuhr Hans Sieberath viel über das seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegebene Wissen über das Land, die Natur, die Witterungsverhältnisse und die Möglichkeiten, trotz dieser absoluten Öde überleben zu können.
Das für ihn wohl Spannendste, was sie bei ihren Besuchen vom Dorfältesten erfuhren – an den komplizierten Namen konnte er sich nicht mehr erinnern –, war eine langatmig erzählte Geschichte, die angeblich aus der ganz frühen Vorzeit stammte. Hang Nu übersetzte die immer wieder durch Sprechpausen des Alten unterbrochene Erzählung, so gut es eben mit seinen dann doch etwas defizitären Sprachkenntnissen möglich war.
»Er sagt, er erinnere sich ein wenig an meinen Großvater. Opa habe vor vielen Jahren, als er bei einer über Monate andauernden Extremdürre mit seinem Dienstfahrzeug des Weges kam, den Dorfbewohnern zehn Kannen – ich vermute, es waren Blechkanister – mit Trinkwasser dagelassen. So etwas wird nie vergessen. Und dann erzählt er auch, dass vor ewigen Zeiten das ganze Land bewaldet gewesen sei, mit weiten Busch- und Grasflächen dazwischen. Dass es auch vielerlei Tiere gegeben habe und Vögel dazu.«
»Und warum gibt es das alles nicht mehr? Warum nur überall diese öde Sandwüste, Sand und nichts als Sand?«, fragte Sieberath.
Hang Nu stellte dem Alten die Frage, und nach längerem Überlegen kam die Antwort.





























