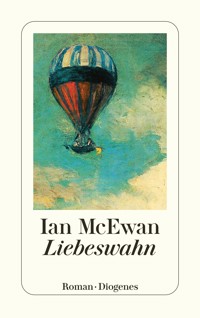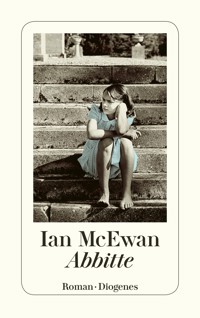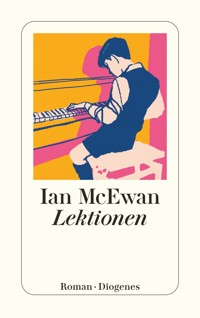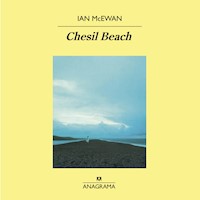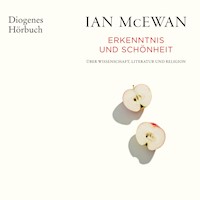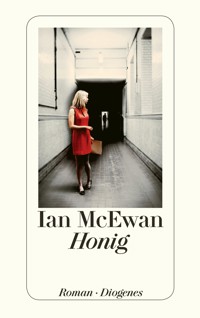
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sex, Spionage, Fiktion und die Siebziger: Serena arbeitet beim britischen Geheimdienst MI5. Weil sie auch eine passionierte Leserin ist, wird die junge Frau auf eine literarische Mission geschickt. Ian McEwan lockt uns mit gewohnter Brillanz in eine Intrige um Verrat, Liebe und die Erfindung der eigenen Identität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ian McEwan
Honig
Roman
Aus dem Englischen vonWerner Schmitz
Titel der 2012 bei
Jonathan Cape, London,
erschienenen Originalausgabe:
›Sweet Tooth‹
Copyright © Ian McEwan 2012
Die deutsche Erstausgabe erschien
2013 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Chris Frazer Smith
Copyright © Chris Frazer Smith
Die Handlung dieses Romans ist
frei erfunden. In einigen wenigen Fällen
treten reale Personen auf, doch
ihre Handlungen und Worte sind fiktional.
Alle anderen Figuren sind frei erfunden,
jede Ähnlichkeit mit realen Personen oder
Begebenheiten ist rein zufällig
und nicht beabsichtigt.
Für Christopher Hitchens
1949–2011
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24304 8 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60341 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Wenn ich doch bei dieser Suche auch nur einem einzigen unzweifelhaft bösen Menschen begegnet wäre.
Timothy Garton Ash,Die Akte ›Romeo‹
[7] 1
Ich heiße Serena Frome (reimt sich auf Ruhm), und vor knapp vierzig Jahren wurde ich vom britischen Nachrichtendienst auf eine geheime Mission geschickt. Sie ging nicht gut aus. Nach nur achtzehn Monaten wurde ich gefeuert, ich hatte mich blamiert und meinen Geliebten ins Unglück gestürzt, auch wenn er selbst daran wohl nicht ganz unschuldig war.
Über meine Kindheit und Jugend möchte ich nicht viele Worte verlieren. Ich bin die Tochter eines anglikanischen Bischofs und wuchs mit einer Schwester neben der Kathedrale einer hübschen Kleinstadt im Osten Englands auf. Mein Elternhaus war freundlich, kultiviert, penibel aufgeräumt und voller Bücher. Meine Eltern konnten sich ganz gut leiden und liebten mich, und ich liebte sie. Meine Schwester Lucy und ich waren anderthalb Jahre auseinander, und so lautstark wir in der Pubertät stritten, blieben doch keine dauerhaften Spuren davon zurück, und als Erwachsene kamen wir uns wieder näher. Der Glaube unseres Vaters an Gott war dezent und vernünftig, drängte sich nicht allzu sehr in unser Leben und reichte gerade aus, ihn stetig die Stufen der Kirchenhierarchie erklimmen zu lassen und uns zu einem behaglichen Queen-Anne-Haus zu verhelfen. Unser Haus stand in einem umfriedeten Garten mit [8] uralten Staudenrabatten, die bis zum heutigen Tag unter Gartenfreunden wohlbekannt sind. Kurz: alles solide, beneidenswert, wenn nicht gar idyllisch. Wir wuchsen hinter einer Gartenmauer auf, mit all den damit verbundenen Annehmlichkeiten und Einschränkungen.
Die späten Sechziger verliehen unserem Leben eine neue Leichtigkeit, erschütterten es aber nicht in seinen Grundfesten. Im Gymnasium fehlte ich nur, wenn ich krank war. Gegen Ende meiner Teenagerzeit begann sich allerlei über die Gartenmauer zu stehlen: Petting, wie man das damals nannte, Experimente mit Tabak, Alkohol und ein bisschen Haschisch, Rock-Platten, buntere Farben und insgesamt mehr Herzlichkeit. Mit siebzehn waren meine Freundinnen und ich begeistert, wenn auch verhalten rebellisch, aber wir machten unsere Hausaufgaben, lernten unregelmäßige Verben, Gleichungen und die Motivationen von Romanfiguren auswendig und spuckten sie auf Kommando wieder aus. Wir sahen uns gern als böse Mädchen, tatsächlich aber waren wir ziemlich brav. 1969 lag viel Aufregung in der Luft, und das gefiel uns. Untrennbar damit verbunden war die Erwartung, bald das Elternhaus zu verlassen und woanders zu studieren. In meinen ersten achtzehn Jahren passierte nichts Merkwürdiges oder Schlimmes, und deshalb überspringe ich sie.
Wäre es nur nach mir gegangen, hätte ich mich für ein gemächliches Englischstudium an einer Provinzuniversität im Norden oder Westen entschieden, weit weg von daheim. Romane las ich gern. Und schnell – zwei bis drei die Woche. Drei Jahre lang nichts anderes zu tun, hätte mir gut gefallen. Aber damals hielt man mich für so etwas wie ein [9] Monstrum – ich war ein Mädchen mit Talent für Mathematik. Das Fach interessierte mich zwar nicht und machte mir keine Freude, aber ich genoss es, die Beste zu sein, und das ohne große Mühe. Ich kannte die Ergebnisse, noch ehe mir klar war, wie ich darauf kam. Während meine Freundinnen krampfhaft herumrechneten, gelangte ich mit ein paar schwebenden, teils augenfälligen und teils intuitiven Schritten zu einer Lösung. Es war schwer zu erklären, woher ich wusste, was ich wusste. So brauchte ich für eine Matheprüfung natürlich viel weniger zu lernen als für eine in englischer Literatur. Außerdem war ich im letzten Schuljahr Kapitän unserer Schachmannschaft. Man muss ein wenig historische Phantasie walten lassen, um zu verstehen, was es damals für ein Mädchen bedeutete, in der Schule einer Nachbarstadt anzutreten und irgendeinen überheblich grinsenden Klugscheißer vom Brett zu fegen. Trotzdem waren Mathe und Schach für mich nur Schulzeugs, genau wie Hockey, Faltenröcke und Kirchenlieder. Als ich über meine Studienwahl nachdachte, wollte ich mit diesem Kinderkram nichts mehr zu tun haben. Aber meine Mutter sah das anders.
Sie war der Inbegriff beziehungsweise die Parodie einer Pfarrers- und später dann Bischofsgattin: ein beeindruckendes Gedächtnis für Namen, Gesichter und Wehwehchen der Gemeindemitglieder; eine unverkennbare Erscheinung, wenn sie mit ihrem Hermès-Schal die Straße hinuntersegelte; im Umgang mit Putzfrau und Gärtner freundlich, aber bestimmt. Ihre Manieren waren tadellos gegenüber jedermann, in jeder Tonlage. Wie verständnisvoll sie bei den Treffen des Mutter-Kind-Clubs in der Krypta auf die [10] verkniffenen, kettenrauchenden Frauen aus den Mietskasernen einging. Wie fesselnd sie die Weihnachtsgeschichte den Waisenhauskindern vorlas, die sich in unserem Wohnzimmer um ihre Füße scharten. Mit welch natürlicher Autorität sie dem Erzbischof von Canterbury die Befangenheit nahm, als er einmal nach der Einsegnung des restaurierten Domtaufbeckens zu Tee und Jaffa-Keksen bei uns vorbeikam. Lucy und ich wurden für die Dauer des Besuchs in den ersten Stock verbannt. Das alles – und jetzt kommt der problematische Teil – verbunden mit völliger Hingabe und Unterordnung zur Sache meines Vaters. Sie setzte sich für ihn ein, diente ihm auf Schritt und Tritt und hielt ihm den Rücken frei. Zu Quadraten gefaltete Socken paarweise in speziellen kleinen Schachteln und gebügelte Chorhemden im Kleiderschrank, kein Staubkorn in seinem Arbeitszimmer, tiefste Samstagsruhe im Haus, wenn er seine Predigt schrieb. Als Gegenleistung erwartete sie lediglich – das ist natürlich nur meine Vermutung –, dass er sie liebte oder zumindest nie verlassen würde.
Dabei war mir jedoch entgangen, dass unter dieser konventionellen Schale der robuste Keim einer Feministin verborgen lag. Dieses Wort ist ihr nie über die Lippen gekommen, aber das ist unerheblich. Ihre Entschiedenheit machte mir Angst. Sie sagte, es sei meine Pflicht als Frau, nach Cambridge zu gehen und Mathematik zu studieren. Als Frau? So sprach kein Mensch in jenen Tagen, nicht in unserem Milieu. Keine Frau tat etwas »als Frau«. Sie sagte mir, sie werde nicht zulassen, dass ich mein Talent vergeude. Ich solle glänzen und mich hervortun. Ich müsse als Physikerin, Ingenieurin oder in der Wirtschaft Karriere machen. [11] Sie gestattete sich das Klischee von der Welt, die mir zu Füßen liege. Es sei unfair gegenüber meiner Schwester, dass ich sowohl klug als auch schön sei, sie dagegen weder noch. Da wäre es noch ungerechter, wenn ich nicht nach Höherem strebte. Ich konnte dieser Logik nicht folgen, sagte aber nichts. Meine Mutter erklärte, sie würde es mir und sich selbst nie verzeihen, wenn ich Englisch studierte und am Ende bloß eine etwas gebildetere Hausfrau würde als sie. Ich riskierte, mein Leben zu vergeuden, das waren ihre Worte, und sie kamen einem Eingeständnis gleich. Es war das einzige Mal, dass sie Unzufriedenheit mit ihrem Los ausdrückte oder andeutete.
Dann spannte sie meinen Vater ein – den »Bischof«, wie meine Schwester und ich ihn nannten. Als ich eines Nachmittags aus der Schule kam, sagte meine Mutter, er erwarte mich in seinem Arbeitszimmer. In meinem grünen Blazer mit dem Wappen und dem aufgestickten Motto – Nisi Dominus Vanum (ohne den Herrn ist alles eitel) – lümmelte ich mürrisch in seinem tiefen Ledersessel, während er hinter dem Schreibtisch thronte, Papiere verschob und vor sich hin summend seine Gedanken ordnete. Ich nahm an, er werde mir mit dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten kommen, doch er war dann überraschend sachlich. Er habe Erkundigungen eingeholt. Cambridge liege sehr daran, als »aufgeschlossen für die moderne, egalitäre Welt« zu gelten. Mit meiner dreifachen Benachteiligung – staatliches Gymnasium, Mädchen, eine reine Männerdomäne als Studienfach – würde ich garantiert angenommen. Sollte ich mich dort hingegen für einen Englisch-Studienplatz bewerben (was nie meine Absicht war; der Bischof hatte es [12] nicht so mit Einzelheiten), würde ich es sehr viel schwerer haben. Binnen einer Woche hatte meine Mutter mit dem Schuldirektor gesprochen. Etliche Lehrer wurden mobilisiert, sie tischten mir alle Argumente meiner Eltern auf und ein paar eigene noch dazu, und natürlich musste ich mich fügen.
Also begrub ich meinen Traum von einem Englischstudium in Durham oder Aberystwyth, wo ich bestimmt glücklich gewesen wäre, und ging stattdessen nach Cambridge, aufs Newnham College. Gleich im ersten Kurs, der im Trinity College stattfand, wurde mir klargemacht, was für ein kleines Licht ich in Mathematik war. Das Herbsttrimester deprimierte mich, fast hätte ich das Studium geschmissen. Linkische Jungen ohne jeglichen Charme, ganz zu schweigen von menschlichen Vorzügen wie Einfühlungsvermögen oder generativer Grammatik – schlauere Vetter der Trottel, die ich beim Schach deklassiert hatte –, grinsten hämisch, während ich mit Begriffen rang, die sich für sie von selbst verstanden. »Ah, die abgeklärte Miss Frome«, rief einer der Dozenten jeden Dienstagmorgen sarkastisch aus, wenn ich den Raum betrat. »Serenissima. Blauäugige! Erleuchten Sie uns!« Für meine Dozenten und Kommilitonen stand fest, dass ich deswegen scheitern musste, weil ich ein gutaussehendes Mädchen in einem Minirock und mit schulterlangen blonden Locken war. In Wirklichkeit musste ich scheitern, weil ich so war wie praktisch der ganze Rest der Menschheit – nämlich nicht besonders gut in Mathe, jedenfalls nicht auf Cambridge-Niveau. Ich versuchte, das Studienfach zu wechseln, mich für Englisch oder Französisch oder gar Anthropologie einzuschreiben, aber niemand [13] wollte mich. Damals hielt man sich strikt an die Regeln. Um eine lange, unerquickliche Geschichte abzukürzen: Ich hielt durch und schaffte mit Ach und Krach meinen Abschluss.
Wenn ich schon durch meine Kindheit und Jugend gestürmt bin, werde ich meine Studentenzeit erst recht raffen. Weder habe ich an Bootsfahrten teilgenommen (egal ob mit oder ohne Aufziehgrammophon), noch jemals das Footlights besucht – Theater ist mir peinlich –, noch mich bei den Garden-House-Krawallen festnehmen lassen. Immerhin habe ich im ersten Semester meine Unschuld verloren, mehrmals hintereinander, wie es schien, so wortlos und linkisch ging es dabei zu, und hatte über die neun Trimester eine ganz schöne Reihe von Liebhabern, sechs oder sieben oder acht, je nachdem, wie man Liebhaber definiert. Unter den Newnham-Frauen fand ich eine Handvoll gute Freundinnen. Ich spielte Tennis und las Bücher. Dank meiner Mutter studierte ich das falsche Fach, aber ich hörte nicht auf zu lesen. Gedichte und Theaterstücke hatte ich in der Schule links liegenlassen, aber ich glaube, Romane bereiteten mir mehr Vergnügen als meinen Unifreunden, die sich wöchentlich an Aufsätzen über George Eliots Middlemarch oder Thackerays Jahrmarkt der Eitelkeiten abrackern mussten. Ich las dieselben Bücher, im Eiltempo, plauderte zuweilen mit Leuten darüber, die mein niedriges Diskussionsniveau tolerierten, und las weiter. Lesen war meine Methode, nicht über Mathe nachzudenken. Vielmehr (oder weniger?), es war meine Methode, überhaupt nicht zu denken.
Wie gesagt, ich war schnell. Trollopes The Way We Live [14] Now verschlang ich in vier Nachmittagen auf dem Bett! Ich erfasste ganze Textblöcke und Absätze auf einen Blick. Ich brauchte meine Augen und Gedanken nur weich wie Wachs werden zu lassen, um den Eindruck frisch von der Seite aufzunehmen. Alle paar Sekunden schlug ich zur Irritation meiner Umgebung mit einer ungeduldigen Handbewegung eine Seite um. Meine Bedürfnisse waren schlicht. Themenkomplexe oder gelungene Wendungen interessierten mich nicht, und Beschreibungen von Wetter, Landschaften und Interieurs überblätterte ich sowieso. Ich wollte Figuren, an die ich glauben konnte, ich wollte neugierig darauf gemacht werden, wie es mit ihnen weiterging. Am liebsten las ich von Menschen, die sich ver- oder entliebten, aber es störte mich auch nicht, wenn sie sich zwischendurch mit anderen Dingen befassten. Selbst wenn es banal war, ich mochte es, wenn am Ende jemand sagte: »Heirate mich!« Romane ohne weibliche Figuren waren eine tote Wüste. Conrad kam deshalb für mich nicht in Frage, die meisten Erzählungen von Kipling und Hemingway ebenso wenig. Überhaupt machten große Namen keinen Eindruck auf mich. Ich las alles, was mir in die Finger kam. Groschenhefte, Hochliteratur und alles dazwischen – ich verschlang sie unterschiedslos.
Welcher berühmte Roman beginnt mit dem markigen Satz: Am Tag ihrer Ankunft zeigte die Quecksilbersäule dreiunddreißig Grad. Ist das nicht knackig? Das kennen Sie nicht? Die Literaturstudenten am Newnham College, mit denen ich befreundet war, reagierten belustigt auf meine Bemerkung, Das Tal der Puppen könne sich mühelos mit allem messen, was Jane Austen je geschrieben habe. Sie [15] lachten und zogen mich monatelang damit auf. Dabei hatten sie keine Zeile von Jacqueline Susanns Roman gelesen. Doch wen kümmerte das? Wen interessierten schon die halbgaren Meinungen einer drittklassigen Mathematikerin? Mich nicht, meine Freundinnen nicht. Wenigstens in dieser Hinsicht war ich frei.
Meine studentischen Lesegewohnheiten sind keine Abschweifung. Diese Bücher trugen mir meine Geheimdienstkarriere ein. In meinem letzten Studienjahr gründete meine Freundin Rona Kemp eine Wochenzeitschrift, die sie ?Quis? nannte. Solche Projekte entstanden und starben damals zu Dutzenden, ihres aber war mit einer Mischung aus E und U seiner Zeit voraus. Poesie und Popmusik, politische Theorie und Klatsch, Streichquartette und Studentenmode, nouvelle vague und Fußball. Zehn Jahre später gab es das überall. Rona hatte das Rezept vielleicht nicht erfunden, aber sie war eine der Ersten, die das Reizvolle daran sah. Später gelangte sie über das Times Literary Supplement zu Vogue, dann folgte ein fiebriges Auf und Ab mit Magazin-Neugründungen in Manhattan und Rio. Die zwei Fragezeichen im Titel ihrer ersten Zeitschrift waren eine Innovation, mit der sie es auf immerhin elf Ausgaben brachte. Sie hatte die Susann-Episode nicht vergessen und bat mich, eine regelmäßige Kolumne zu schreiben: ›Was ich letzte Woche gelesen habe‹. Und zwar »im Plauderton und quer durchs Gemüsebeet«. Kinderspiel! Ich schrieb, wie ich redete, lieferte nicht viel mehr als Zusammenfassungen der Bücher, die ich gerade verschlungen hatte, und pointierte meine Urteile in bewusster Selbstparodie mit zahlreichen Ausrufezeichen. Meine lockere alliterierende Prosa kam [16] gut an. Gelegentlich sprachen mich Fremde auf der Straße an und machten mir Komplimente dazu. Sogar mein spöttischer Mathedozent ließ sich zu einer lobenden Bemerkung herab. Es war das einzige Mal, dass ich ein wenig von jenem berauschenden Elixier namens Campus-Ruhm zu kosten bekam.
Nach einem halben Dutzend dieser kessen Kolumnen ging etwas schief. Wie so viele Autoren, die ein wenig Beifall finden, nahm ich mich auf einmal zu ernst. Ich war eine junge Frau mit ungeschultem Geschmack, ein unbeschriebenes Blatt. Ich war reif zur Übernahme. Ich wartete, wie es in manchen Romanen hieß, auf den »Richtigen«, der mein Herz im Sturm erobern würde. Mein »Richtiger« war ein ernster Russe. Ich entdeckte einen Schriftsteller und ein Thema und wurde zur Schwärmerin. Plötzlich hatte ich ein Anliegen, hatte ich eine Mission zu erfüllen. Ich fing an, meine Texte endlos zu überarbeiten. Statt direkt aufs Papier zu plappern, schrieb ich die Texte um, zweimal, dreimal. Meiner bescheidenen Ansicht nach hatte sich meine Kolumne zu einer unentbehrlichen öffentlichen Institution entwickelt. Manchmal stand ich mitten in der Nacht auf, strich ganze Absätze und überzog die Seiten mit Pfeilen und Kreisen. Ich ging mit bedeutungsschwerer Miene spazieren. Mir war klar, meine Popularität würde darunter leiden, aber das kümmerte mich nicht. Es bewies nur, dass ich recht hatte, es war der Preis, den eine Heldin wie ich zu zahlen hatte. Bis dahin hatte ich die falschen Leser gehabt. Es kümmerte mich auch nicht, als Rona mir Vorhaltungen machte. Tatsächlich fühlte ich mich dadurch bestätigt. »Das ist nicht gerade im Plauderton«, sagte sie kühl, als sie mir [17] eines Nachmittags im Copper Kettle meinen Artikel zurückgab. »So war das nicht abgemacht.« Sie hatte recht. Von meiner Unbeschwertheit und den Ausrufezeichen war nichts mehr übrig, Zorn und Pathos hatten meine Interessen verengt und meinen Stil kaputtgemacht.
Mein Abstieg hatte mit den fünfzig Minuten begonnen, die ich mit Alexander Solschenizyns Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch in der neuen Übersetzung von Gillon Aitken verbrachte. Ich las das Buch unmittelbar nach Ian Flemings Octopussy. Ein harter Übergang. Ich wusste nichts von den sowjetischen Arbeitslagern und hatte das Wort »Gulag« noch nie gehört. Nach einer Jugend im Kathedralenviertel, was wusste ich da schon von den grausamen Absurditäten des Kommunismus, von den öden und weit abgelegenen Strafkolonien, in denen mutige Männer und Frauen gezwungen waren, Tag für Tag an nichts anderes zu denken als an ihr eigenes Überleben? Hunderttausende, in die sibirische Einöde verschleppt, weil sie in der Fremde für ihr Land gekämpft hatten, weil sie Kriegsgefangene gewesen waren, weil sie einen Parteifunktionär verärgert hatten, weil sie selbst Parteifunktionäre waren, weil sie eine Brille trugen, weil sie Juden waren, homosexuell, Bauern, die eine Kuh besaßen, Dichter. Wer erhob seine Stimme für all diese verlorenen Menschenleben? Bis dahin hatte ich mich nicht mit Politik abgegeben. Ich wusste nichts von den Diskursen und Enttäuschungen der älteren Generation. Auch nichts von der »linken Opposition«. Abgesehen von der Schule beschränkte sich meine Bildung auf ein bisschen zusätzliche Mathematik und Stapel von Taschenbuchromanen. Ich hatte keine Ahnung, und meine Empörung [18] war moralisch. Der Ausdruck »totalitäres System« gehörte nicht zu meinem Wortschatz. Wahrscheinlich hätte ich das für etwas Medizinisches gehalten. Mir war, als erreichten mich Nachrichten von einer unbekannten Front, als lüftete ich einen Schleier und beträte Neuland.
Für Solschenizyns Der erste Kreis der Hölle brauchte ich eine Woche. Der Titel bezog sich auf Dante. Sein erster Höllenkreis war griechischen Philosophen vorbehalten und, welch ein Zufall, ein angenehmer ummauerter Garten inmitten schrecklicher Höllenqualen, ein Garten, aus dem es kein Entkommen und keinen Weg ins Paradies gab. Ich machte den typischen Fehler aller Schwärmer, ich nahm an, der Rest der Menschheit sei ebenso ahnungslos, wie ich es zuvor gewesen war. Meine Kolumne wurde zur Tirade. Wusste man im blasierten Cambridge nicht, was dreitausend Meilen weiter östlich passiert war und immer noch passierte, hatte man nicht mitbekommen, wie verheerend sich diese gescheiterte Utopie mit ihren Schlangen vor den Geschäften, der hässlichen Kleidung und den Reisebeschränkungen auf den Geist der Menschen auswirkte? Wie sollte man dagegen angehen?
?Quis? akzeptierte vier Salven meines Antikommunismus. Nun las ich Koestlers Sonnenfinsternis, Nabokovs Das Bastardzeichen und Miloszs großartige Abhandlung Verführtes Denken. Ich war auch der erste Mensch auf Erden, der Orwells 1984 verstand. Aber mit dem Herzen blieb ich immer bei meiner ersten Liebe, Alexander. Diese Stirn, die sich wie eine orthodoxe Kirchenkuppel erhob, der eckige Bart eines Landpfarrers, die grimmige, vom Gulag verliehene Autorität, seine unbeugsame Haltung gegenüber [19] Politikern. Nicht einmal seine religiösen Überzeugungen konnten mich abschrecken. Ich sah es ihm nach, wenn er sagte, die Menschen hätten Gott vergessen. Er war Gott. Wer konnte sich mit ihm messen? Wer ihm seinen Nobelpreis verweigern? Ich starrte sein Foto an und wollte seine Geliebte sein. Ich hätte ihm gedient, wie meine Mutter meinem Vater diente. Seine Socken paarweise in kleine Schachteln legen? Ich hätte mich auf die Knie geworfen und ihm die Füße gewaschen. Mit meiner Zunge!
Die Niedertracht des Sowjetsystems war für westliche Politiker und die Leitartikler der meisten Zeitungen in jenen Jahren ein Standardthema. Im Kontext von Uni-Leben und studentischer Politik indes galt es als ein wenig geschmacklos. Wenn die CIA dagegen war, musste doch etwas für den Kommunismus sprechen. Teile der Labour Party hielten den alternden Betonköpfen im Kreml und ihrem gespenstischen Projekt noch immer die Stange, sangen noch immer auf der Jahresversammlung die Internationale, schickten noch immer Studenten zu Freundschaftsbesuchen. Im Kalten Krieg, in dieser Zeit des Schwarzweißdenkens, ging es nicht an, mit einem amerikanischen Präsidenten, der in Vietnam Krieg führte, über die Sowjetunion einer Meinung zu sein. Aber bei jenem Rendezvous zur Teestunde im Copper Kettle erklärte mir Rona, schon damals parfümiert, präzise und perfekt, es sei nicht die politische Ausrichtung meiner Kolumne, die ihr Sorgen mache. Meine Sünde sei die Ernsthaftigkeit. In der nächsten Ausgabe ihrer Zeitschrift stand kein Wort von mir. Anstelle meiner Kolumne erschien ein Interview mit der Incredible String Band. Danach war Schluss mit ?Quis?.
[20] Wenige Tage nach meinem Rausschmiss geriet ich in eine Colette-Phase, die mich monatelang in Bann hielt. Dazu kamen andere Sorgen. Die Abschlussprüfungen waren nur noch Wochen entfernt, und ich hatte einen neuen Freund, einen Historiker namens Jeremy Mott. Er hatte etwas Altmodisches – schlaksig, große Nase, überdimensionierter Adamsapfel. Er wirkte leicht verlottert, war auf unaufdringliche Weise clever und außerordentlich höflich. Mir waren an der Uni schon etliche von seinem Schlag aufgefallen. Sie schienen aus einer einzigen Familie zu stammen und allesamt Internate im Norden Englands besucht zu haben, wo man sie mit derselben Kleidung ausgestattet hatte. Sie waren die letzten Männer auf Erden, die noch Harris-Tweedjacken mit Lederflicken an den Ellbogen und Bordüren an den Ärmeln trugen. Ich erfuhr, allerdings nicht von Jeremy selbst, dass man von ihm einen erstklassigen Abschluss erwartete und dass er bereits einen Artikel in einer Fachzeitschrift für Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts veröffentlicht hatte.
Er stellte sich als zärtlicher und rücksichtsvoller Liebhaber heraus, trotz seines beklagenswert scharfkantigen Schambeins, das mir beim ersten Mal teuflische Schmerzen bereitete. Er entschuldigte sich dafür, wie man sich für einen verrückten, aber entfernten Verwandten entschuldigen mag. Womit ich sagen will, dass es ihm nicht besonders peinlich war. Wir lösten das Problem, indem wir beim Sex ein gefaltetes Handtuch zwischen uns legten, wobei mir schien, dass er zu diesem Hilfsmittel schon oft gegriffen hatte. Er war sehr aufmerksam und geschickt und konnte so lange durchhalten, wie ich wollte, und darüber hinaus, [21] bis ich es nicht mehr aushielt. Er selbst jedoch kam trotz meiner Bemühungen nur selten zum Orgasmus, und ich begann zu argwöhnen, dass er etwas Bestimmtes von mir erwartete. Nur was? Er wollte es mir nicht sagen. Oder genauer, er beharrte darauf, es gebe da nichts zu sagen. Ich glaubte ihm nicht. Am liebsten wäre mir gewesen, er hätte heimliche, schmutzige Wünsche gehabt, die nur ich befriedigen konnte. Dieser stolze und höfliche Mann sollte mir ganz verfallen. Sehnte er sich danach, mir den Hintern zu versohlen, oder dass ich ihm den Hintern versohlte? Wollte er meine Unterwäsche anziehen? Dieses Rätsel verfolgte mich, wenn ich nicht mit ihm zusammen war, und machte es mir umso schwerer, nicht an ihn zu denken und mich auf meine Mathematik zu konzentrieren. Colette war meine Rettung.
Eines Nachmittags Anfang April, nach einer Runde mit dem gefalteten Handtuch in Jeremys Wohnung, überquerten wir beim alten Corn Exchange die Straße, ich noch benommen vor Wonne und dem Schmerz einer damit zusammenhängenden Muskelzerrung im Kreuz, und er – na ja, ich wusste nicht recht. Im Gehen überlegte ich, ob ich das Thema noch einmal zur Sprache bringen sollte. Er gab sich liebevoll, sein Arm lag schwer auf meinen Schultern, während er mir von seinem Aufsatz über die Star Chamber erzählte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er richtig befriedigt war. Ich glaubte das an seiner angespannten Stimme zu erkennen, an seinem nervösen Tempo. Seit Tagen hatte er keinen einzigen Orgasmus gehabt. Ich wollte ihm helfen, und ich war aufrichtig neugierig. Außerdem beunruhigte mich der Gedanke, dass er womöglich enttäuscht von mir [22] war. Ich erregte ihn, so viel stand fest, aber vielleicht begehrte er mich nicht genug. Wir gingen in der frostigen Dämmerung eines feuchten Frühlingstages am Corn Exchange vorbei, der Arm meines Liebhabers wärmte mich wie ein Fuchspelzkragen, und mein Glücksgefühl war nur leicht beeinträchtigt von einem stechenden Schmerz im Rücken und eine Spur mehr von der Frage nach Jeremys geheimen Wünschen.
Plötzlich kam uns aus einer schlechtbeleuchteten Seitenstraße Tony Canning entgegen, Jeremys Geschichtstutor. Wir wurden einander vorgestellt, er schüttelte mir die Hand und hielt sie, wie ich fand, viel zu lange fest. Er war Anfang fünfzig – etwa so alt wie mein Vater –, und ich wusste von ihm nur, was Jeremy mir erzählt hatte. Er war Professor und ein ehemaliger Freund des Innenministers Reggie Maudling, der auch schon in sein College zum Dinner gekommen war. Eines Abends hatten die beiden Männer sich im Suff über die Politik der Internierungen ohne Gerichtsverfahren in Nordirland zerstritten. Professor Canning war Vorsitzender einer Denkmalschutz-Kommission gewesen, saß in diversen Beratungsausschüssen und im Aufsichtsrat des British Museum und hatte ein allseits gelobtes Buch über den Wiener Kongress geschrieben.
Er war einer von den Großen und Guten, ein Typ, der mir vage vertraut war. Männer wie er kamen gelegentlich zu uns nach Hause, um den Bischof zu besuchen. Jedem unter fünfundzwanzig gingen sie in dieser Nachsechzigerzeit natürlich auf die Nerven, aber ich mochte sie eigentlich auch. Sie konnten charmant sein, sogar geistreich, und die Wolke aus Zigarrenrauch und Kognakdunst, die sie [23] hinter sich herzogen, ließ die Welt wohlgeordnet und reich erscheinen. Sie hatten eine hohe Meinung von sich selbst, wirkten aber nicht unehrlich, und sie besaßen ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein gegenüber dem Staat, zumindest vermittelten sie diesen Eindruck. Sie nahmen ihre Vergnügungen ernst (Wein, Essen, Angeln, Bridge etc.), und manche hatten offenbar in interessanten Kriegen gekämpft. Ich hatte Kindheitserinnerungen, wie der eine oder andere von ihnen meiner Schwester und mir an Weihnachten eine Zehn-Shilling-Note zusteckte. Von mir aus konnten diese Männer die Welt regieren. Es gab viel schlimmere.
Cannings Auftreten war von einer vergleichsweise gedämpften Grandeur, vielleicht passend zu den bescheidenen Rollen, die er in der Öffentlichkeit spielte. Ich bemerkte das wellige, akkurat gescheitelte Haar, die feuchten fleischigen Lippen und eine kleine Kerbe in der Mitte seines Kinns, die mir liebenswert vorkam, denn selbst bei dem schlechten Licht sah ich, dass er Mühe hatte, sich dort sauber zu rasieren. Aus der senkrechten kleinen Mulde ragten widerborstige dunkle Stoppeln. Er war ein gutaussehender Mann.
Nach der Begrüßung stellte Canning mir einige Fragen. Höflich und harmlos – zu meinem Abschluss, dem Newnham College, dem Rektor, der ein guter Freund von ihm war, zu meiner Heimatstadt, zur Kathedrale. Jeremy schaltete sich mit ein wenig Smalltalk ein, und dann unterbrach Canning wiederum ihn und bedankte sich dafür, dass er ihm meine letzten drei Artikel für ?Quis? gezeigt habe.
Er wandte sich wieder an mich. »Verdammt gute Texte. Sie haben echtes Talent, meine Liebe. Wollen Sie Journalistin werden?«
[24] ?Quis? war ein Studentenblatt, nichts für ernsthafte Leser. Ich freute mich über das Lob, aber jung, wie ich war, wusste ich Komplimente nicht anzunehmen. Mein bescheidenes Gemurmel kam etwas abschätzig heraus, und bei dem Versuch, mich zu korrigieren, verhaspelte ich mich. Der Professor erbarmte sich meiner und lud uns zum Tee ein; wir nahmen die Einladung an, das heißt, Jeremy nahm sie an. Und so folgten wir Canning zurück über den Markt zu seinem College.
Seine Wohnung war kleiner, schäbiger und chaotischer, als ich erwartet hatte, und beim Teekochen stellte er sich überraschend nachlässig an, spülte die klobigen braunfleckigen Becher nur flüchtig aus, ließ heißes Wasser aus einem schmutzigen Elektrokocher auf Papiere und Bücher tropfen. Nichts davon passte zu dem Bild, das ich mir später von ihm machen sollte. Er nahm hinter seinem Schreibtisch Platz, wir ließen uns in die Sessel sinken, und er stellte mir noch mehr Fragen. Fast wie im Seminar. Jetzt, da ich an seinen Fortnum-&-Mason-Schokoladenkeksen knabberte, fühlte ich mich verpflichtet, etwas ausführlicher zu antworten. Jeremy ermunterte mich, indem er stupide zu allem nickte, was ich sagte. Der Professor fragte nach meinen Eltern, wie es sei, »im Schatten einer Kathedrale« aufzuwachsen – ich erwiderte, recht geistreich, wie mir schien, da sei kein Schatten, weil die Kathedrale nördlich von unserem Haus stehe. Beide Männer lachten, und ich fragte mich, ob mein Scherz eine tiefere Bedeutung habe, die mir entging. Dann kamen wir auf Atomwaffen und Forderungen in der Labour Party nach einseitiger Abrüstung zu sprechen. Dazu spulte ich einen Satz ab, den ich irgendwo [25] gelesen hatte – ein Klischee, wie mir später klarwurde. Es sei unmöglich, »den Geist in die Flasche zurückzuzaubern«. Atomwaffen könne man nur unter Kontrolle halten, nicht abschaffen. So viel zu jugendlichem Idealismus. In Wirklichkeit hatte ich keine spezielle Meinung zu diesem Thema. In einem anderen Zusammenhang wäre ich vielleicht für nukleare Abrüstung gewesen. Ich suchte – auch wenn ich das bestritten hätte – zu gefallen, die richtigen Antworten zu geben, mich interessant zu machen. Ich mochte es, wie Tony Canning sich vorbeugte, wenn ich etwas sagte, ich fühlte mich angespornt von seinem knappen zustimmenden Lächeln, das seine dicken Lippen in die Breite zog, ohne sie zu öffnen, und von seiner Art, »Verstehe« oder »Genau …« zu sagen, wenn ich eine Pause einlegte.
Vielleicht hätte mir klar sein müssen, worauf das hinauslief. Ich hatte mich im winzigen Treibhaus der Studentenpresse als Kalte Kriegerin zu erkennen gegeben. Aus heutiger Sicht ist es sonnenklar. Wir waren schließlich in Cambridge. Warum sonst würde ich von diesem Gespräch erzählen? Damals hatte das Treffen für mich keinerlei Bedeutung. Wir waren auf dem Weg zu einer Buchhandlung gewesen und stattdessen bei Jeremys Tutor zum Tee eingekehrt. Nichts besonders Merkwürdiges. Die Rekrutierungsmethoden waren damals im Wandel, aber nur allmählich. Die westliche Welt mochte stetigen Veränderungen unterliegen, die Jungen mochten denken, sie hätten eine neue Art der Kommunikation miteinander entdeckt, die alten Mauern zerbröckelten angeblich von den Fundamenten her. Aber die berühmte »Hand auf der Schulter« wurde immer noch aufgelegt, vielleicht nicht mehr so oft, vielleicht [26] mit weniger Druck. An den Universitäten hielten manche Dozenten weiterhin Ausschau nach vielversprechendem Nachwuchs und gaben die Namen für Sondierungsgespräche weiter. Nach dem Examen für die Staatsbeamtenlaufbahn wurde der eine oder andere immer noch beiseitegenommen und gefragt, ob er je daran gedacht hätte, für eine »andere« Abteilung zu arbeiten. Normalerweise trat man unauffällig an die Leute heran, wenn sie sich schon ein paar Jahre lang draußen in der Welt getummelt hatten. Niemand brauchte das auszusprechen, aber Herkunft blieb wichtig, und ein Bischof in meiner Familie war nicht von Nachteil. Es hat lange gedauert – darauf ist oft hingewiesen worden –, bis Fälle wie die von Burgess, Maclean und Philby die Auffassung ins Wanken brachten, Personen einer bestimmten Klasse verhielten sich ihrem Land gegenüber eher loyal als andere. In den Siebzigern waren diese berühmten Verräter noch nicht vergessen, aber die alten Anwerbemethoden hielten sich hartnäckig.
In der Regel gehörten sowohl Hand als auch Schulter einem Mann. Eine Frau auf diese oft beschriebene, altehrwürdige Weise anzusprechen, war ungewöhnlich. Es ist nicht zu bestreiten, dass Tony Canning mich am Ende für den MI5 rekrutierte, aber seine Motive waren kompliziert, und er hatte keine offizielle Genehmigung. Dass ich jung und attraktiv war, hat für ihn wohl eine Rolle gespielt, auch wenn es seine Zeit dauerte, bis das in seinem ganzen Pathos offenbar wurde. (Heute, wo der Spiegel etwas anderes sagt, kann ich es aussprechen und hinter mich bringen. Ich war wirklich hübsch. Mehr als das. Wie Jeremy einmal im Überschwang eines seiner seltenen Briefe schrieb, war ich »sogar [27] ziemlich umwerfend«.) Auch die hochrangigen Graubärte im fünften Stock, die ich niemals kennengelernt und in meiner kurzen Dienstzeit kaum zu Gesicht bekommen habe, hatten keine Ahnung, warum man mich zu ihnen geschickt hatte. Sie rätselten herum, kamen aber nie darauf, dass Professor Canning, selbst ein alter MI5-Haudegen, ihnen ein Geschenk zu machen glaubte, im Geiste der Wiedergutmachung. Sein Fall war komplexer und trauriger, als irgendjemand ahnte. Der Mann veränderte mein Leben, er agierte mit selbstloser Härte und begab sich auf eine Reise ohne Hoffnung auf Wiederkehr. Dass ich auch jetzt noch so wenig von ihm weiß, liegt daran, dass ich ihn nur ein sehr kurzes Stück auf seinem Weg begleitet habe.
[28] 2
Meine Affäre mit Tony Canning währte nur wenige Monate. Anfangs traf ich mich auch noch mit Jeremy, aber nach den Abschlussprüfungen Ende Juni zog er nach Edinburgh, um dort seinen Doktor zu machen. Das erleichterte mir das Leben, auch wenn es mich immer noch wurmte, dass ich nicht hinter sein Geheimnis gekommen war und ihm keine Befriedigung hatte verschaffen können. Er hatte sich nie beklagt oder einen unglücklichen Eindruck gemacht. Ein paar Wochen später schrieb er mir in einem zärtlichen, reumütigen Brief, er habe sich in einen jungen Deutschen aus Düsseldorf verliebt, den er bei einem Violinkonzert von Max Bruch in der Usher Hall spielen gehört habe, einen Geiger mit vorzüglicher Intonation, insbesondere im langsamen Satz. Sein Name sei Manfred. Aber natürlich. Hätte ich nur etwas altmodischer gedacht, wäre ich von selbst darauf gekommen, denn es gab einmal Zeiten, als die sexuellen Probleme aller Männer immer nur eine Ursache hatten.
Wie praktisch. Das Rätsel war gelöst, ich brauchte mich nicht mehr um Jeremys Glück zu sorgen. Er bemühte sich rührend, mich zu trösten, bot sogar an, mich zu besuchen und mir alles zu erklären. In meinem Antwortbrief gratulierte ich ihm, übertrieb ein wenig, wie sehr ich mich für [29] ihn freute, und kam mir dabei sehr reif vor. Solche Liebschaften waren erst seit fünf Jahren legal und für mich noch etwas Neues. Ich schrieb, die weite Reise nach Cambridge sei nicht nötig, ich werde ihn immer in bester Erinnerung behalten, er sei ein ganz wunderbarer Mann, ich freue mich schon, Manfred eines Tages kennenzulernen, lass uns bitte in Verbindung bleiben, leb wohl! Ich hätte ihm gern dafür gedankt, dass er mir Tony vorgestellt hatte, wollte aber nicht unnötig Verdacht erregen. Auch Tony erzählte ich nichts von seinem ehemaligen Studenten. Jeder wusste so viel, wie er zu seinem Glück zu wissen brauchte.
Und wir waren glücklich. Jedes Wochenende trafen wir uns in einem abgeschiedenen Cottage unweit von Bury St.Edmunds in Suffolk. Man bog von einem stillen Sträßchen auf einen kaum erkennbaren Feldweg ein, hielt am Saum eines Waldes mit uralten Kopfweiden und erblickte dort, versteckt hinter Weißdorngestrüpp, ein kleines weißes Gattertor. Ein Plattenweg schlängelte sich durch einen verwilderten Bauerngarten (Lupinen, Malven, hoher Klatschmohn) zu einer schweren, mit Nieten oder Nägeln beschlagenen Eichentür. Durch diese Tür gelangte man ins Esszimmer, einen Raum mit riesigen Bodenplatten und halb von Putz bedeckten, wurmstichigen Deckenbalken. An der Stirnwand hing eine heitere mediterrane Szene, weißgetünchte Häuser und Bettlaken an einer Wäscheleine. Das Aquarell stammte von Winston Churchill, er hatte es 1943 in Marrakesch während einer Konferenzpause gemalt. Wie es in Tonys Besitz gelangt war, habe ich nie erfahren.
Frieda Canning, eine Kunsthändlerin, die oft im Ausland unterwegs war, kam nicht gern hierher. Sie störte sich an [30] der Feuchtigkeit und dem Schimmelgeruch und der vielen Arbeit, die ein Zweithaus mit sich brachte. Aber der Geruch verflog, sobald das Haus geheizt wurde, und die Arbeiten wurden allesamt von ihrem Mann erledigt. Man brauchte dazu besondere Fähigkeiten und Kenntnisse: wie man den störrischen Rayburn-Ofen anmachte, das klemmende Küchenfenster öffnete, die Klospülung zum Laufen brachte, die erschlagenen Mäuse in den Fallen aus dem Haus beförderte. Ich musste nicht einmal groß kochen. Nach jener nachlässigen Teestunde hätte man ihm gar nicht zugetraut, dass er sich in der Küche so viel Mühe gab. Manchmal durfte ich ihm assistieren, und er brachte mir eine Menge bei. Er kochte italienisch, das hatte er in seinen vier Jahren als Dozent an einem Institut in Siena gelernt. Da er es am Rücken hatte, musste ich bei jedem unserer Besuche erst einmal Säcke mit Nahrungsmitteln und Wein von seinem alten MGA, der auf dem Acker parkte, durch den Garten schleppen.
Für englische Verhältnisse war es ein recht guter Sommer, und Tony gab ein gemächliches Tempo vor. Mittags aßen wir oft im Schatten einer alten Zwergmispel im Garten. Nach seinem Mittagsschläfchen nahm Tony meist ein Bad, und bei warmem Wetter legte er sich anschließend in eine zwischen zwei Birken aufgespannte Hängematte und las. Wenn es jedoch richtig heiß war, bekam er manchmal Nasenbluten und musste sich drinnen hinlegen, einen Waschlappen mit Eiswürfeln aufs Gesicht gepresst. Abends machten wir gelegentlich ein Picknick im Wald, mit einer Flasche Weißwein, in ein frisches Geschirrtuch gewickelt, Weingläsern aus einem Zedernholz-Kästchen und einer [31] Thermoskanne Kaffee. Ein Galadinner sur l’herbe. Es gab Tassen und Untertassen, eine Damasttischdecke, Porzellanteller, Silberbesteck und einen mit Leinwand bespannten Klappstuhl aus Aluminium – ich schleppte alles, ohne zu murren. Später im Sommer machten wir keine weiten Spaziergänge mehr, denn Tony sagte, das Gehen bereite ihm Schmerzen und mache ihn schnell müde. Abends spielte er auf einem alten Grammophon gern Opern, aber so eindringlich er mir die Protagonisten und Intrigen in Aida, Così fan tutte und L’elisir d’amore erklärte, ich konnte mit diesen schrillen, schmachtenden Stimmen nicht viel anfangen. Das altmodische Knistern und Knacken der stumpfen Nadel, die auf der verzogenen Platte auf und ab schwankte, hörte sich an wie der Äther, aus dem die Toten verzweifelt nach uns riefen.
Er erzählte mir gern von seiner Kindheit. Sein Vater war Marineoffizier im Ersten Weltkrieg gewesen und ein erfahrener Segler. Ende der zwanziger Jahre verbrachte die Familie die Ferien meist auf der Ostsee, wo man von Insel zu Insel kreuzte. So kam es, dass seine Eltern auf dem entlegenen Eiland Kumlinge ein Steinhäuschen entdeckten und kauften. Ein von wehmütigen Erinnerungen verklärtes Kindheitsparadies. Tony und sein älterer Bruder streunten frei umher, machten Lagerfeuer und schliefen am Strand, ruderten zu einer unbewohnten kleinen Nachbarinsel hinüber und stahlen Vogeleier. Zum Beweis, dass dieser Traum Wirklichkeit gewesen war, zeigte er mir rissige Boxkamera-Schnappschüsse.
Eines Nachmittags Ende August gingen wir in den Wald, wie so oft. Diesmal aber bog Tony vom Weg ab, und ich [32] tappte blindlings hinterdrein. Wir trampelten durchs Unterholz, und ich nahm an, wir würden uns an einem Ort lieben, den nur er kannte. Das Laub war trocken genug. Aber er hatte nur Pilze im Kopf, Steinpilze. Ich verbarg meine Enttäuschung und erfuhr, woran man die Dinger erkannte – Röhren statt Lamellen, ein filigranes Netz am Stiel, keine Verfärbung, wenn man das Fleisch mit dem Daumen eindrückt. Am Abend bereitete er eine große Pfanne Porcini zu, wie er sie nannte, mit Olivenöl, Pfeffer, Salz und Pancetta, dazu gab es gegrillte Polenta, Salat und Rotwein, einen Barolo. In den Siebzigern ein exotisches Mahl. Ich erinnere mich an alles – an den geschrubbten Kiefernholztisch mit den ramponierten, in einem hellen Türkiston gestrichenen Beinen, an die weite Fayenceschüssel voller glibberiger Steinpilze, die Scheibe Polenta, die wie eine Miniatursonne auf dem blassgrünen Teller mit der gesprungenen Glasur leuchtete, die staubige schwarze Weinflasche, die alte weiße Schüssel mit dem würzigen Rucola, und daran, wie Tony in Sekunden den Salat anmachte, mit Öl und einer halben Zitrone, die er, so kam es mir jedenfalls vor, wie beiläufig in seiner Faust ausdrückte, während er den Salat zum Tisch trug. (Meine Mutter braute ihre Salatsaucen auf Augenhöhe zusammen wie ein Industriechemiker.) Tony und ich nahmen an diesem Tisch viele ähnliche Mahlzeiten ein, aber diese kann für alle anderen stehen. Welche Schlichtheit, was für ein Geschmack, was für ein Mann von Welt! Es war stürmisch an diesem Abend, und der Ast einer Esche pochte und kratzte auf dem Strohdach. Nach dem Essen wurde gelesen, dann natürlich geredet, aber erst nach dem Sex, und dies erst nach einem weiteren Glas Wein.
[33] Als Liebhaber? Na ja, naturgemäß nicht so kraftvoll und unermüdlich wie Jeremy. Und obwohl Tony ganz gut in Form war für sein Alter, war ich beim ersten Mal doch ein wenig schockiert zu sehen, was vierundfünfzig Jahre mit einem Körper anrichten können. Er saß nach vorn gebeugt auf der Bettkante und zog eine Socke aus. Sein armer nackter Fuß sah aus wie ein abgetragener alter Schuh. Ich bemerkte Fleischfalten an den unmöglichsten Stellen, sogar unter seinen Armen. Wie seltsam, dass mir in meiner sofort unterdrückten Überraschung nicht der Gedanke kam, dass ich meine eigene Zukunft vor Augen hatte. Ich war einundzwanzig. Was ich für die Norm hielt – straff, glatt, geschmeidig –, war der kurzlebige Spezialfall der Jugend. Die Alten waren für mich eine eigene Spezies, wie Spatzen oder Füchse. Und was würde ich heute dafür geben, noch einmal vierundfünfzig zu sein! Das größte Organ des Körpers trägt die Hauptlast – die Alten passen nicht mehr in ihre Haut. Sie hängt von ihnen, von uns herab, wie ein auf Zuwachs gekaufter Schulblazer. Oder ein Pyjama. In einem gewissen Licht, es mag freilich auch an den Schlafzimmervorhängen gelegen haben, hatte Tony etwas Vergilbtes, wie ein altes Taschenbuch, in dem man von diversen Kalamitäten lesen konnte – zu üppigem Essen, Narben von Knie- und Blinddarmoperationen, von einem Hundebiss, einem Sturz beim Bergsteigen und einem Unfall mit einer Bratpfanne als Kind, der eine kleine kahle Stelle in seinem Schamhaar hinterließ. Rechts auf seiner Brust zog sich eine weiße, zehn Zentimeter lange Narbe Richtung Hals, über deren Geschichte er sich konsequent ausschwieg. Gewiss, er war ein wenig… stockfleckig, und zuweilen ähnelte er [34] dem verschlissenen Teddybär meiner Kindheit im Kathedralenviertel, aber als Liebhaber war er weltmännisch und aufmerksam. Geradezu galant. Ich fand Gefallen an der Art, wie er mich auszog und sich meine Sachen wie ein Bademeister über den Arm legte, und an seiner Aufforderung, mich auf sein Gesicht zu setzen – für mich ebenso neu wie der Rucola, diese Nummer.
Ich hatte auch Vorbehalte. Manchmal war er hastig, wollte zu schnell zu anderem übergehen – seine wahren Leidenschaften waren Trinken und Reden. Später hielt ich ihn mitunter für egoistisch, für reaktionär, wenn er eilig auf seinen Höhepunkt zustürmte, den er jedes Mal mit einem keuchenden Schrei erreichte. Und für zu besessen von meinen Brüsten, die damals bestimmt sehr hübsch waren, aber dass ein Mann im Alter des Bischofs fast wie ein Säugling darauf fixiert war und wimmernd daran nuckelte, kam mir irgendwie nicht richtig vor. Er war einer dieser Engländer, die man mit sieben ihrer Mama entrissen und ins abstumpfende Exil einer Internatsschule geschickt hatte. Die armen Kerle gestehen den Schaden niemals ein, sie leben notgedrungen damit. Aber das waren unwesentliche Kritikpunkte. Für mich war das alles neu, ein Abenteuer, das meine eigene Reife unter Beweis stellte. Ein erfahrener, älterer Mann war in mich vernarrt. Ich verzieh ihm alles. Und ich liebte diese weichen Lippen. Er küsste wunderbar.
Trotzdem, am liebsten war er mir, wenn er wieder in seiner Kleidung steckte und seinen akkuraten Scheitel nachgezogen hatte (er benutzte Haaröl und einen Stahlkamm), wenn er wieder groß und gut war, mich in einen Sessel setzte, mit flinken Fingern einen Pinot Grigio entkorkte [35] und mir Lektüreempfehlungen gab. Das ist mir seither, über die Jahre, immer wieder aufgefallen – der gewaltige Unterschied zwischen dem nackten und dem bekleideten Mann. Zwei Männer mit demselben Pass. Aber auch das war unerheblich, es gehörte alles zusammen – Sex und Kochen, Wein und kurze Spaziergänge, Gespräche. Und fleißig waren wir auch. Zu Beginn, im Frühling und Frühsommer dieses Jahres, bereitete ich mich auf die Abschlussprüfungen vor. Tony konnte mir dabei nicht helfen. Er saß mir gegenüber und schrieb an seiner Monographie über John Dee.
Tony hatte jede Menge Freunde, aber natürlich lud er nie jemanden ein, wenn ich da war. Besuch hatten wir nur ein einziges Mal. Eines Nachmittags kamen sie in einem Wagen mit Chauffeur, zwei Männer in dunklen Anzügen, beide in den Vierzigern, schätzte ich. Tony fragte reichlich schroff, ob ich nicht einen längeren Spaziergang im Wald machen wolle. Als ich anderthalb Stunden später zurückkam, waren die Männer nicht mehr da. Tony gab mir keine Erklärung, doch am selben Abend fuhren wir nach Cambridge zurück.
Wir trafen uns ausschließlich in diesem Cottage. In Cambridge – praktisch ein Dorf – war Tony zu bekannt. Ich musste immer mit meiner Reisetasche zu einer Wohnsiedlung am äußersten Stadtrand marschieren und an einer Bushaltestelle warten, bis er mich mit seinem maroden Sportwagen abholte. Der war eigentlich ein Cabrio, aber die Mechanik, die das Leinwandverdeck wie eine Ziehharmonika zurückfalten sollte, war völlig eingerostet. Dieses alte MGA-Modell hatte noch einen Suchscheinwerfer an einer Chromstange und einen Tacho mit zitternder Nadel. Es roch nach Motoröl und Reibungshitze, ähnlich vielleicht [36] wie in einer Spitfire aus den Vierzigern. Man spürte das Vibrieren des warmen Blechbodens unter den Füßen. Ich fand es aufregend, unter den missbilligenden Blicken der normalen Passagiere aus der Warteschlange zu treten, vom Frosch zur Prinzessin zu werden und mich gebückt auf den Beifahrersitz gleiten zu lassen, neben den Professor. Es war, als steige man in aller Öffentlichkeit ins Bett. Ich schob meine Tasche in den schmalen Raum hinter mir und spürte, wie meine Seidenbluse – die hatte er mir bei Liberty’s gekauft – sich an dem rissigen Ledersitz rieb, während ich mich zu ihm hinüberbeugte, um mir meinen Kuss abzuholen.
Kaum waren die Abschlussprüfungen vorbei, erklärte Tony, er werde sich jetzt meiner Lektüre annehmen. Genug Romane! Er war entsetzt, wie wenig ich von unserer »Inselgeschichte« wusste, so nannte er das. Und er hatte ja recht. Nach meinem vierzehnten Lebensjahr hatte ich auf der Schule keinen Geschichtsunterricht mehr gehabt. Jetzt war ich einundzwanzig und hatte eine privilegierte Ausbildung genossen, aber Agincourt, das Gottesgnadentum und der Hundertjährige Krieg waren für mich bloß nichtssagende Wörter. Bei »Geschichte« dachte ich nur an eine langweilige Abfolge von Königen und mörderisches Gerangel unter Kirchenleuten. Aber ich unterwarf mich Tonys Lehrplan. Der Stoff war interessanter als Mathe, und die Lektüreliste war kurz – Winston Churchill und G. M. Trevelyan. Den Rest wollte mein Professor mündlich mit mir durchnehmen.
Die erste Lektion fand unter der Zwergmispel im Garten statt. Ich erfuhr, dass die englische und dann britische Europapolitik seit dem sechzehnten Jahrhundert auf ein [37] Gleichgewicht der Kräfte abzielte. Ich wurde aufgefordert, mich über den Wiener Kongress von 1815 kundig zu machen. Tony erklärte nachdrücklich, ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis sei das Fundament eines rechtmäßigen Systems friedfertiger Diplomatie. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass Nationen sich gegenseitig in Schach hielten.
Meist las ich nach dem Mittagessen, wenn Tony sein Nickerchen machte – er schlief immer länger, je weiter der Sommer voranschritt, und das hätte mir auffallen sollen. Anfangs beeindruckte ich ihn mit meinem Lesetempo. Zweihundert Seiten in zwei Stunden! Dann enttäuschte ich ihn. Ich konnte seine Fragen nicht präzise beantworten, ich konnte Informationen nicht behalten. Er ließ mich Churchills Darstellung der Glorreichen Revolution wiederkäuen, fragte mich ab, stöhnte theatralisch – du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb! –, ließ mich das Ganze noch einmal lesen und stellte noch mehr Fragen. Diese mündlichen Examina wurden auf Spaziergängen im Wald abgehalten oder beim Wein nach dem Abendessen, das er für uns gekocht hatte. Ich nahm ihm seine Hartnäckigkeit übel. Ich wollte seine Geliebte sein, nicht seine Schülerin. Ich ärgerte mich über ihn und gleichzeitig über mich, wenn ich ihm eine Antwort schuldig blieb. Doch dann, ein paar missmutige Lektionen später, begann ich ein wenig Stolz zu empfinden, und nicht nur, weil ich besser wurde. Allmählich interessierte mich auch die Geschichte selbst. Ich war auf etwas Kostbares gestoßen, und das, wie mir schien, ganz von allein, genau wie ehedem auf die Unterdrückung in der Sowjetunion. War England gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts nicht die freieste und wissbegierigste [38] Gesellschaft, die es je auf Erden gegeben hatte? War die englische Aufklärung nicht folgenreicher als die französische? War es nicht richtig, dass England sich abgesondert hatte, um gegen den katholischen Despotismus auf dem Kontinent zu kämpfen? Wir waren jedenfalls die Erben dieser Freiheit.
Ich war leicht zu führen. Er bereitete mich auf das erste Vorstellungsgespräch vor, das im September stattfinden sollte. Er wusste, was für eine Art von Engländerin sie einstellen würden, oder er eingestellt hätte, und sorgte sich, dass meine einseitige Ausbildung mir zum Nachteil gereichen könnte. Er ging – irrtümlicherweise, wie sich zeigte – davon aus, dass einer seiner ehemaligen Studenten bei dem Gespräch dabei sein würde. Er bestand darauf, dass ich täglich die Zeitung las, worunter er natürlich die Times verstand, damals noch die unangefochtene Referenz. Bis dahin hatte ich mich nicht sonderlich für die Presse interessiert und noch nie einen Leitartikel gelesen. Anscheinend handelte es sich dabei um das »pulsierende Herz« einer Zeitung. Auf den ersten Blick glich die Prosa einem Schachproblem. Schon war ich Feuer und Flamme. Ich bewunderte diese pompösen, gebieterischen Verlautbarungen zu öffentlichen Angelegenheiten. Die Meinungen waren oft etwas undurchsichtig, dafür aber gerne mit Tacitus- und Vergil-Zitaten untermauert. Wie erwachsen! Ich fand, dass jeder dieser anonymen Autoren das Zeug zum Weltherrscher hatte.
Und worum ging es aktuell? In den Leitartikeln kreisten prachtvolle Nebensätze elliptisch um die Fixsterne der Hauptverben, aber auf den Leserbriefseiten wurde Klartext geredet. Die Planeten waren in Schieflage, und die [39] Briefschreiber wussten es tief in ihren verängstigten Herzen: Das Land versank in Verzweiflung, Tobsucht und hoffnungsloser Selbstzerfleischung. Das Vereinigte Königreich, verkündete ein Leserbrief, habe sich dem Rausch der Akrasie ergeben – das griechische Wort, erklärte mir Tony, für Handeln wider besseres Wissen. (Hatte ich denn Platons Protagoras nicht gelesen?) Ein nützliches Wort. Ich merkte es mir. Aber es gab kein besseres Wissen, nichts, dem man zuwiderhandeln konnte. Alle waren durchgedreht, behaupteten jedenfalls alle. Das archaische Wort »Zwietracht« war groß in Mode in diesen stürmischen Zeiten: Inflation schürte Streiks, Tarifabschlüsse schürten die Inflation, dumpfe Spesenritter hatten in der Wirtschaft das Sagen, sture Gewerkschaften träumten von Revolution, die Regierung war schwach, dazu kamen Energiekrisen und Stromausfälle, Skinheads, verdreckte Straßen, der Nordirlandkonflikt, Atomwaffen. Dekadenz, Verfall, Niedergang, Schlendrian und Apokalypse…
Beliebte Themen der Leserbriefe an die Times waren die Kumpels in den Minen, »ein Arbeiterstaat«, die bipolare Welt von Enoch Powell und Tony Benn, mobile Streikposten und der Kampf um Saltley. Ein Konteradmiral im Ruhestand schrieb, das Land gleiche einem rostigen Schlachtschiff mit Lecks unterhalb der Wasserlinie. Tony las den Brief beim Frühstück und wedelte geräuschvoll mit der Zeitung – damals knitterte Zeitungspapier noch und raschelte laut.
»Schlachtschiff?«, schäumte er. »Von wegen! Noch nicht mal eine Korvette. Ein verdammtes Ruderboot, das gerade absäuft!«
[40] 1972 war erst der Anfang. Als ich die Zeitung zu lesen begann, lagen die Dreitagewoche, die nächsten Stromausfälle und die Erklärung des fünften Ausnahmezustands durch die Regierung nicht mehr in allzu großer Ferne. Ich glaubte, was ich las, aber es schien wenig mit mir zu tun zu haben. Cambridge war ziemlich unverändert, ebenso der Wald um Cannings Cottage. Trotz meiner Geschichtslektionen glaubte ich nicht, dass das Schicksal der Nation mich unmittelbar betraf. Meine Klamotten passten bequem in einen Koffer, ich besaß weniger als fünfzig Bücher, ein paar Kindersachen in meinem Zimmer zu Hause. Ich hatte einen Liebhaber, der mich vergötterte und für mich kochte und nie damit drohte, seine Frau zu verlassen. Meine einzige Verpflichtung war ein Vorstellungsgespräch – und bis dahin waren es noch Wochen. Ich war frei. Was wollte ich also mit meiner Bewerbung beim Geheimdienst? Den maroden britischen Staat, diesen kranken Mann von Europa, vorm Untergang bewahren? Nichts, ich wollte nichts. Ich wusste es nicht. Eine Gelegenheit hatte sich ergeben, und ich ergriff sie. Tony wollte es, also wollte ich es auch, und sonst hatte ich ja nichts vor. Also, warum nicht?
Im Übrigen fühlte ich mich meinen Eltern gegenüber noch immer zu Rechenschaft verpflichtet, und sie waren erfreut zu hören, dass ich mich in einem angesehenen Sektor des öffentlichen Dienstes, beim Gesundheits- und Sozialministerium, bewarb. Dort würde ich zwar keine Atome zertrümmern, wie meine Mutter es gehofft hatte, aber die Stabilität dieser Institution in turbulenten Zeiten schien sie darüber hinwegzutrösten. Sie wollte wissen, warum ich nach dem Examen nicht nach Hause zurückgekommen war, [41] und ich konnte ihr sagen, dass ein älterer Dozent so freundlich war, mich auf meinen »Auftritt« vorzubereiten. Da sei es sicherlich sinnvoll, ein billiges kleines Zimmer am Jesus-Green-Park zu mieten und »richtig ranzuklotzen«, auch an den Wochenenden.
Meine Mutter hätte hier vielleicht Bedenken äußern können, aber die Schwierigkeiten, in die meine Schwester in diesem Sommer geriet, lenkten sie ab. Lucy war schon immer lauter, quirliger und waghalsiger als ich gewesen und eine viel begeistertere Anhängerin der befreienden Sechziger, die sich jetzt in die nächste Dekade schleppten. Auch war sie nochmals fünf Zentimeter gewachsen und der erste Mensch, den ich je in abgeschnittenen Jeans gesehen hatte. Mach dich locker, Serena, sei frei! Lass uns verreisen! Sie wurde zum Hippie, gerade als das aus der Mode kam, aber so war das eben in provinziellen Kleinstädten. Außerdem verkündete sie aller Welt, ihr einziges Ziel im Leben sei, Ärztin zu werden, Allgemeinmedizinerin oder vielleicht Kinderärztin.
Dieses Ziel verfolgte sie auf Umwegen. Im Juli kam sie mit der Fähre von Calais nach Dover zurück und wurde von einem Zollbeamten aufgehalten, oder genauer, von dessen Hund, einem bellenden Bluthund, den der Geruch ihres Rucksacks in helle Aufregung versetzte. Im Innern des Rucksacks befand sich, eingewickelt in ungewaschene T-Shirts und hundesichere Plastiktüten, ein halbes Pfund türkisches Haschisch. Und in Lucys Innerem befand sich, ebenso wenig deklariert, ein heranwachsender Embryo. Die Identität des Vaters war ungewiss.
In den nächsten Monaten widmete meine Mutter einen [42] Großteil ihrer Zeit einer vierfachen Mission. Erstens galt es Lucy vor dem Gefängnis zu bewahren, zweitens die Sache aus den Zeitungen herauszuhalten, drittens den Rauswurf von der Uni Manchester zu verhindern, wo sie im zweiten Jahr Medizin studierte, und viertens, da wurde nicht lange gefackelt, musste die Abtreibung organisiert werden. Soweit ich das nach meinem Krisenbesuch zu Hause beurteilen konnte (Lucy roch nach Patschuli und schlang unter Tränen ihre sonnengebräunten Arme um mich), war der Bischof bereit, das Haupt zu senken und alles auf sich zu nehmen, was der Himmel ihm zugedacht hatte. Aber da hatte meine Mutter schon das Heft in die Hand genommen und entschlossen die Netzwerke aktiviert, die jede neunhundert Jahre alte Kathedrale in ihrer Umgebung und über das ganze Land ausgespannt hat. Zum Beispiel war der Polizeipräsident unserer Grafschaft nicht nur Laienprediger, sondern auch ein alter Bekannter des Polizeipräsidenten von Kent. Ein Freund vom konservativen Oxforder Studentenverband hatte Beziehungen zu dem Richter in Dover, vor dem Lucy zu erscheinen hatte. Dem Herausgeber unserer Lokalzeitung lag daran, dass seine vollkommen unmusikalischen Zwillingssöhne in den Chor der Kathedrale aufgenommen wurden. Tonhöhe ist natürlich etwas Relatives, aber man konnte ja nie wissen, und es war, wie meine Mutter mir versicherte, alles »ganz schön harte Arbeit« – nicht zuletzt die Abtreibung, für die Ärzte ein Routineeingriff, für Lucy zu ihrer Überraschung jedoch zutiefst verstörend. Am Ende bekam sie sechs Monate auf Bewährung, die Presse hielt still, und mein Vater sicherte einem Rektor oder sonstigen Granden der Universität Manchester seine [43] Unterstützung in einer obskuren Angelegenheit bei der nächsten Synode zu. Im September nahm meine Schwester ihr Studium wieder auf. Zwei Monate später brach sie es ab.
Im Juli und August hatte ich also viel Muße, im Jesus Green herumzulungern. Ich las Churchill, langweilte mich und wartete aufs Wochenende und den Marsch zur Bushaltestelle am Stadtrand. Bald schon sollte mir der Sommer 72 als goldenes Zeitalter erscheinen, als kostbares Idyll, dabei war das Vergnügen immer nur auf die Zeit von Freitag bis Sonntagabend beschränkt. Diese Wochenenden waren Kompaktkurse in Lebenskunst: wie und was man essen und trinken sollte, wie man Zeitung las, wie man sich in einer Diskussion behauptete, wie man ein Buch fachgerecht »ausweidete«. Ich wusste, bald hatte ich ein Vorstellungsgespräch, aber ich kam nie auf die Idee, mich zu fragen, warum Tony sich diese Mühe machte. Und wenn, hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass derlei Aufmerksamkeiten eben dazugehörten, wenn man eine Affäre mit einem älteren Mann hatte.
Natürlich konnte das nicht ewig so weitergehen, und innerhalb einer stürmischen halben Stunde neben einer lauten Hauptstraße, zwei Tage vor meinem Vorstellungstermin in London, brach alles in sich zusammen. Die genaue Abfolge der Ereignisse ist es wert, überliefert zu werden. Da gab es die Seidenbluse, die ich bereits erwähnt habe und die mir Tony Anfang Juli gekauft hatte. Sie war gut ausgesucht. Ich genoss es, wie kostbar sie sich an einem warmen Abend anfühlte, und Tony sagte mir mehr als einmal, wie sehr ihm der schlichte weite Schnitt an mir gefiel. Ich war gerührt. Er war der erste Mann in meinem Leben, der mir etwas zum [44] Anziehen kaufte. Ein älterer Liebhaber, der mich aushielt. (Ich glaube nicht, dass der Bischof jemals einen Fuß in einen Laden gesetzt hatte.) Es war altmodisch, dieses Geschenk, eine Spur kitschig und schrecklich mädchenhaft, aber ich mochte es sehr. Ich fühlte mich von Tony umarmt, wenn ich es trug. Die Wörter auf dem Etikett, in hellblauer Schnörkelschrift, kamen mir ausgesprochen erotisch vor – »Wildseide. Handwäsche«. Ausschnitt und Ärmelaufschläge waren mit broderie anglaise verziert, die zwei Falten an den Schultern hatten ihr Gegenstück in zwei kleinen Abnähern am Rücken. Dieses Geschenk war ein Sinnbild, nehme ich an. Jedes Mal wenn es Zeit war zurückzufahren, nahm ich die Bluse wieder mit in mein möbliertes Zimmer, wusch sie im Waschbecken, bügelte und faltete sie, und schon war sie bereit für den nächsten Besuch. Wie ich.
Aber an diesem Septembertag waren wir im Schlafzimmer, und ich packte gerade meine Sachen, als Tony seinen Vortrag unterbrach – er sprach von Idi Amin und Uganda – und sagte, ich solle die Bluse zusammen mit einem seiner Hemden in den Wäschekorb tun. Das klang vernünftig. Wir wären ja bald wieder hier, und die Haushälterin, Mrs.Travers, würde am nächsten Tag kommen und sich um alles kümmern. Mrs.Canning war für zehn Tage nach Wien gereist. Ich erinnerte mich gut an diesen Moment, weil ich mich sehr darüber freute. Der Gedanke, dass unsere Liebe Routine war, etwas Selbstverständliches, mit einer unmittelbaren, immer nur drei oder vier Tage entfernten Zukunft, war Balsam für mich. In Cambridge war ich oft einsam und wartete auf Tonys Anruf über das Münztelefon im Flur. In einer Anwandlung von so etwas wie ehefraulicher [45] Berechtigung hob ich den Korbdeckel, warf die Bluse auf sein Hemd und dachte nicht weiter daran. Sarah Travers kam dreimal die Woche aus dem Nachbardorf. Einmal hatten wir eine angenehme halbe Stunde zusammen am Küchentisch verbracht und Erbsen geschält, dabei erzählte sie mir von ihrem Sohn, der sich als Hippie nach Afghanistan aufgemacht hatte. Sie sagte das voller Stolz, als sei er zur Armee gegangen, um in einem notwendigen und gefährlichen Krieg zu kämpfen. Ich wollte nicht allzu genau darüber nachdenken, nahm aber an, dass sie schon etliche Freundinnen von Tony in dem Cottage hatte ein und aus gehen sehen. Vermutlich störte sie sich nicht daran, solange sie ihr Geld bekam.
Zurück in meinem Zimmer am Jesus Green vergingen vier Tage, ohne dass ich etwas hörte. Gehorsam verschaffte ich mir einen Überblick über die historische Entwicklung von Arbeiterschutz und Getreideeinfuhrzöllen und studierte die Zeitung. Ich traf mich mit ein paar Freunden, die auf Durchreise waren, entfernte mich aber nie sehr weit vom Telefon. Am fünften Tag ging ich zu Tonys College, hinterließ eine Nachricht beim Pförtner und eilte nach Hause, voller Sorge, ich könnte in der Zwischenzeit einen Anruf von ihm verpasst haben. Ich selbst konnte ihn nicht anrufen – mein Geliebter hatte seine Privatnummer geflissentlich für sich behalten. Am Abend rief er an. Er sprach mit belegter Stimme. Nächsten Morgen um zehn an der Bushaltestelle, teilte er mir grußlos mit. In meine klagende Nachfrage hinein legte er auf. Natürlich habe ich in dieser Nacht kaum ein Auge zugetan. Erstaunlich ist jedoch, dass mir die Sorge um ihn den Schlaf raubte, wo ich dumme [46] Gans doch hätte wissen müssen, dass ich reif fürs Schlachtbeil war.
Im Morgengrauen nahm ich ein Bad und hüllte mich in Düfte. Um sieben war ich bereit. Eine närrische Träumerin, im Gepäck die Unterwäsche, die er so mochte (schwarz natürlich, und violett), und Turnschuhe für Waldspaziergänge. Fünf vor halb zehn war ich an der Bushaltestelle, voller Sorge, dass er früher kommen und enttäuscht sein könnte, wenn er mich nicht dort sah. Er kam um Viertel nach zehn. Er stieß die Beifahrertür auf, ich ließ mich hineingleiten, bekam aber keinen Kuss. Er behielt beide Hände am Steuer und brauste sofort los. Wir fuhren ungefähr zehn Meilen, ohne dass er mit mir sprach. Seine Fingerknöchel traten vor Anspannung weiß hervor, er sah stur geradeaus. Was hatte er nur? Er wollte es mir nicht sagen. Ich war verzweifelt und bekam es mit der Angst zu tun, so hektisch wechselte er in seinem kleinen Auto immer wieder die Spur, so waghalsig überholte er an Steigungen und in Kurven – wie um mich vor dem aufziehenden Sturm zu warnen.
An einem Kreisel wendete er, fuhr Richtung Cambridge zurück und bog dann auf einen Rastplatz an der A45 ein. Öliger Rasen, mit Unrat übersät, auf der zertrampelten Erde daneben ein Kiosk, der Hotdogs und Hamburger an LKW-Fahrer verkaufte. So früh am Vormittag hatte die Bude noch geschlossen, die Rollläden waren heruntergelassen, die Parkplätze leer. Wir stiegen aus. Es war ein denkbar unangenehmer Tag am Ende des Sommers – sonnig, windig, staubig. Rechts zog sich eine Reihe weit auseinanderstehender, verdorrter Ahornbäumchen hin, jenseits davon donnerte der Verkehr. Man kam sich vor wie am Rand einer [47] Rennstrecke. Der Rastplatz war ein paar hundert Meter lang. Tony marschierte los, und ich versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Zum Reden mussten wir fast schreien.
Als Erstes sagte er: »Dein kleiner Trick hat jedenfalls nicht funktioniert.«
»Was für ein Trick?«
Ich kramte hastig in der jüngeren Vergangenheit. Da war kein Trick zu finden, und so schöpfte ich plötzlich Hoffnung, es gehe um irgendeine Kleinigkeit, die wir rasch beilegen könnten. Wir würden gleich darüber lachen, dachte ich sogar. Wir könnten noch vor Mittag zusammen im Bett liegen.
Wir kamen zu der Stelle, wo der Rastplatz in die Straße mündete. »Merk dir eins«, sagte er, und wir blieben stehen. »Du wirst Frieda und mich nie auseinanderbringen.«
»Tony, was für ein Trick