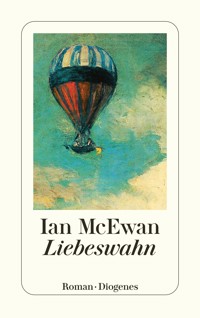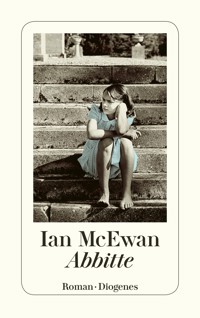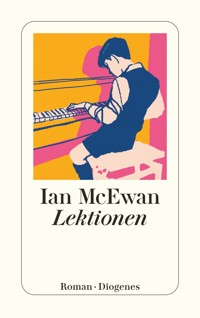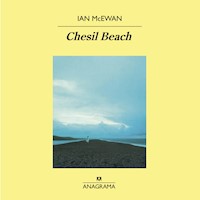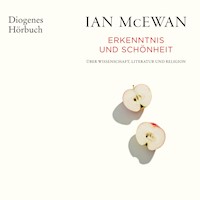16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für Ian McEwan ist die Geschichte der Wissenschaft eine faszinierende Saga voller intellektuellem Mut, harter Arbeit, tausendfachem Scheitern und kurzen Momenten der Inspiration. Sie ist auch eine Einladung, sich zu wundern und zu freuen. Anhand von Figuren wie Darwin, Einstein oder Turing erforscht Ian McEwan in diesen brillanten Essays das Verhältnis von Wissenschaft und Literatur, Ratio und Glauben und ihren Bezug zu unserer menschlichen Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ian McEwan
Erkenntnis und Schönheit
Über Wissenschaft, Literatur und Religion
Aus dem Englischen von Bernhard Robbenund Hainer Kober
Diogenes
Literatur, Wissenschaft und die menschliche Natur
Größe in der Literatur ist für die meisten von uns verständlicher und nachvollziehbarer als Größe in der Wissenschaft. Wir haben alle unsere eigene oder doch eine überkommene Vorstellung davon, was es heißt, ein großer Schriftsteller zu sein. Lesen wir Anna Karenina oder Madame Bovary, verstehen wir auf Anhieb, ob nun ehrfürchtig und begeistert oder pflichtbewusst und voller Skepsis, was gemeint ist, wenn man von Größe redet. Wir verfügen über das Privileg eines unmittelbaren Zugangs. Schon beim ersten Satz spüren wir die Präsenz, die Eigenart eines besonderen Geistes; und in wenigen Minuten lesen wir das Ergebnis lang vergangener Stunden, die Früchte der einsamen Arbeit eines Nachmittags vor über hundertfünfzig Jahren. Und was ehedem ein persönliches Geheimnis war, das sich nach und nach offenbarte, wird jetzt zu unserem Geheimnis. Erdachte Menschen erscheinen vor unseren Augen, ihre historischen wie häuslichen Lebensumstände werden genau beschrieben, ebenso ihre Charaktere. Wir bezeugen und beurteilen das Geschick, mit dem sie heraufbeschworen werden. Dank einer unausgesprochenen Übereinkunft, einer Art Pakt zwischen Schriftsteller und Leser, gehen wir davon aus, dass wir diese Menschen, so fremd sie uns anfangs auch vorkommen mögen, schon bald verstehen werden und ihre Eigenart schätzen lernen. Das gelingt, indem wir auf unser eigenes Verständnis vom Menschsein zurückgreifen. Wir besitzen, um es mit einem Begriff aus der kognitiven Psychologie zu benennen, eine Theorie des Geistes, ein mehr oder minder unmittelbares Verständnis dafür, was es heißt, jemand anderes zu sein. Ohne ein solches Verständnis wäre es uns, wie die Psychopathologie beweist, praktisch unmöglich, Beziehungen aufzubauen und zu halten, ein Mienenspiel zu deuten, Absichten zu erkennen oder auch nur zu erahnen, wie wir selbst wahrgenommen werden. Dem besonderen Geschehen, das uns ein Roman aufblättert, begegnen wir mit diesem tiefen, umfassenden Verständnis. Als Saul Bellows Herzog vor einem Spiegel steht, was Figuren in Romanen so gern und zweckdienlicherweise tun, trägt er nur Badehose und einen kürzlich gekauften Strohhut. Seine Mutter wollte, dass er Rabbi wird, er aber kam sich in
»… Badehose und dem Strohhut, mit dem von schwerer Traurigkeit gezeichneten Gesicht und der törichten Sehnsucht des Herzens, von der ihn ein religiöses Leben vielleicht gereinigt hätte, grauslich unrabbinerhaft vor. Dieser Mund! – belastet von Begehren und unversöhnlichem Zorn, die manchmal grimmig aussehende gerade Nase, die dunklen Augen! Und diese Figur! Die langen Adern, die sich durch seine Arme wanden und die hängenden Hände zogen, Teil des Kreislaufs, eines alten Systems, das von noch höherem Alter als das der Juden war … Barbeinig sah er aus wie ein Hindu.«1
Mag sein, dass der Leser nicht jede Besonderheit der Verfassung Herzogs zuinnerst nachvollziehen kann – Amerikaner Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, Jude, Stadtbewohner und geschiedener Mann, ein introvertierter Intellektueller –, noch mögen jüngere Leser Verständnis für die Reumütigkeiten des frühen mittleren Alters aufbringen, doch eine Selbstprüfung, die geradezu einer Abrechnung mit der eigenen Person gleichkommt, ist von allgemeiner Gültigkeit, ebenso die drollige, fälschliche und naive Wahrnehmung, laut der die eigene Biologie – das Kreislaufsystem – älter als die eigene Religion sei und folglich mehr über das Wesen des Menschseins verrate. Gleichsam am Wegesrand jener bereits erwähnten, unausgesprochenen Übereinkunft zwischen Schriftsteller und Leser erblüht die Literatur und offeriert uns eine geistige Karte, deren Nord und Süd das Spezifische und das Allgemeine sind. Im besten Fall ist Literatur universell und erhellt die menschliche Natur eben dort, wo sie regionaler und spezifischer kaum sein kann.
Größe in der Wissenschaft ist für die meisten von uns schwerer nachzuvollziehen. Wir könnten zwar eine Liste mit den Namen von angeblich großen Wissenschaftlern erstellen, doch sind nur die wenigsten von uns mit ihnen derart vertraut, dass wir das Besondere ihrer Leistung erklären könnten. Zum einen liegt das am Werk selbst – es ist nicht gerade leicht zugänglich –, es objektiviert, distanziert, erschwert die Lektüre durch schwierige oder scheinbar irrelevante Details. Die Mathematik ist eine weitere Barriere. Zudem zirkulieren wissenschaftliche Ideen ganz unabhängig von ihren Schöpfern. Wissenschaftler können durchaus die klassischen Bewegungsgesetze kennen, ohne sich je mit den entsprechen Texten von Newton selbst vertraut gemacht zu haben; sie eignen sich die Relativitätstheorie aus Lehrbüchern an, ohne Einsteins Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie zu lesen, oder sie verstehen die Struktur der DNA, ohne Cricks und Watsons Abhandlung von 1953 zu kennen – oder kennen zu müssen.
Und Letztere liefern uns ein Paradebeispiel. Ihr kaum zwei Seiten langer und in der Zeitschrift Nature veröffentlichter Aufsatz endet mit der berühmten bescheidenen Formulierung: »Es ist unserer Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass die spezifische Paarung, die wir postuliert haben, direkt auf einen möglichen Kopiermechanismus für genetisches Material schließen lässt.«2 Was sich ungefähr übersetzen ließe mit: »Hört alle her! Wir haben den Mechanismus entschlüsselt, wie sich das Leben auf der Erde repliziert; vor Freude sind wir außer Rand und Band und können kein Auge mehr zutun.« Es ist unserer Aufmerksamkeit nicht entgangen verrät jenen vertrauten Umgang, den ich meine. Ihn aus erster Hand erleben zu können ist nicht ganz einfach.
Allerdings gibt es einen herausragenden Wissenschaftler, der in dieser Hinsicht beinahe so zugänglich ist wie ein Romancier. Selbst Nichtwissenschaftler können anhand von Darwins Werk nachvollziehen, was ihn groß und einzigartig macht. Teils liegt das an der Abfolge günstiger Zufälle, die ihn seinen Weg finden ließen, jeder einzelne Schritt stets an der endgültigen Leistung gemessen. Teils liegt es auch am Thema selbst. Die Naturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, vielmehr die ganze damalige Biologie, war eine beschreibende Wissenschaft. Und die Theorie der natürlichen Selektion ist in ihren Grundzügen nicht schwer zu verstehen, obwohl ihre Auswirkungen ungeheuer, ihre Anwendungsmöglichkeiten beachtlich und die Konsequenzen in wissenschaftlicher Hinsicht ziemlich komplex sind – wie dies etwa die Theoretische Biologie von Bill Hamilton zeigt. Darwins Werk ist darüber hinaus so zugänglich, weil er, wenn auch kaum der größte Prosaschriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts, so überaus mitteilsam war, warmherzig, ehrlich und direkt. Er schrieb viele Briefe und hat manch ein Notizbuch gefüllt.
Lesen wir sein Leben wie einen Roman, wie Bellows Herzog, wie eine große Abrechnung. Charles kommt mit sechzehn Jahren an die Universität von Edinburgh, zeigt sich aber vom Studium der Medizin bald enttäuscht. Seinen Schwestern schreibt er: »Von einem Mohren lerne ich, wie man Vögel ausstopft.«3 Bei einem gewissen John Edmonstone, einem freigelassenen Sklaven, den er »sehr sympathisch und intelligent« findet, nimmt Charles Stunden in Tierpräparation. Edmonstone erzählt dem jungen Darwin von seinem Leben als Sklave und beschreibt ihm die Wunder des tropischen Regenwaldes. Sein Leben lang sollte Darwin die Sklaverei verabscheuen, und vielleicht hat diese frühe Bekanntschaft einigen Einfluss auf das vergleichsweise vernachlässigte Buch Darwins gehabt, über das ich im Weiteren reden möchte. Ein Jahr später lernt Darwin die Ideen von Lamarck kennen und lauscht in Edinburghs Debattierklubs ebenso hitzig vorgebrachten wie gottlosen Argumenten für den wissenschaftlichen Materialismus. Auf der Suche nach Meeresgeschöpfen wandert er tagelang die Ufer des Firth of Forth ab und berichtet in seinem Notizbuch von 1827 ausführlich über seine Untersuchungen zweier wirbelloser Meerestiere.
Da Charles sich mit dem Gedanken einer ärztlichen Laufbahn nicht anfreunden kann, schlägt sein Vater ihm vor, es doch mit dem Priesteramt zu versuchen. »Er war vehement dagegen, dass ich ein Mann der Muße werde, worauf mein Leben damals hinauszulaufen schien.« Also beginnt Charles mit achtzehn Jahren ein Studium in Cambridge, wo aus seiner Vorliebe für Naturgeschichte wahre Leidenschaft wird. »Was werden wir für einen Spaß haben«, schreibt er seinem Vetter William Darwin Fox, »und was werden wir viele Käfer fangen! Es wird meiner Seele guttun, noch einmal unsere alten Jagdplätze aufzusuchen … wir wollen regelrechte Feldzüge in die Fens unternehmen; der Himmel stehe den Käfern bei.« Und in einem weiteren Brief: »Ich verkümmere regelrecht, weil ich niemanden habe, mit dem ich über Insekten reden kann.« Während der letzten beiden Trimester überredet ihn sein Mentor Henslowe, Professor für Botanik, zusätzlich Geologie zu belegen.
Nach dem Studium vermittelt Henslowe ihm die Möglichkeit, als Naturforscher und Begleiter des Kapitäns an Bord der Beagle zu gehen, um im Auftrag der Regierung eine Vermessungsfahrt nach Südamerika zu unternehmen. Anhand der Argumente, mit deren Hilfe Darwin versucht – unterstützt von seinem Onkel Josiah Wedgwood –, die Zustimmung des Vaters zu gewinnen, können wir sein Ringen um diese Fahrt nachvollziehen. »Ich muss noch einmal betonen«, bekniet er ihn in ernstem Ton, »dass ich nicht sehe, wie mich die Fahrt für ein geregeltes Leben ungeeignet machen sollte.« Nach wochenlangem Aufschub und zwei abgesagten Aufbruchterminen setzt die Beagle am 27. Dezember 1831 endlich die Segel. Erst plagt ihn tagelang die Seekrankheit, dann verhindern Quarantänemaßnahmen die Landung in La Palma, aber Charles wirft am Heck des Schiffes ein Netz aus; das Wetter ist prächtig, und er fängt »eine Vielzahl eigentümlicher Tiere, die mich jede freie Minute in meiner Kabine beschäftigen«. Endlich legen sie in St. Jago auf den Kapverdischen Inseln an, und der junge Mann ist wie im Rausch. »Die Insel hat mich so begeistert und so viel gelehrt«, schreibt er seinem Vater, »aber einem Menschen, der Europa nie verlassen hat, den Anblick der Insel, diese völlige Unvergleichbarkeit einer tropischen Welt zu beschreiben, wäre sinnlos, käme das doch dem Versuch gleich, einem Blinden erklären zu wollen, was Farben sind … Wenn immer mir etwas gefällt, freue ich mich darauf, darüber schreiben zu können … Also entschuldige bitte meine – zudem noch schlecht formulierten – Ausbrüche der Ekstase.«
Er genießt es, in seiner vollgestopften Kabine zu arbeiten, zu zeichnen und seine Gesteinsexemplare, die gesammelten Pflanzen und Tiere zu beschreiben, um sie dann zu verpacken und nach England zu Henslowe zu schicken. Die Begeisterung lässt auch im weiteren Verlauf der Expedition nicht nach, darüber hinaus gewinnt Charles zunehmend an wissenschaftlichem Selbstvertrauen. Henslowe schreibt er:
»… nichts hat mich so sehr begeistert, wie zwei elegant gefärbte, den tropischen Trockenwald bevölkernde Spezies der Planariidae zu finden! Die vermeintliche Verwandtschaft, die sie mit Schnecken aufweisen, ist das Faszinierendste, was mir je untergekommen ist … manche Meeresarten besitzen eine so wunderbare Organisation, dass ich meinen Augen kaum zu glauben vermag … Heute war ich unterwegs und musste bei der Rückkehr an die Arche Noah denken, so viele Tiere unterschiedlichster Art hatte ich dabei … Ich entdeckte eine überaus seltsame Schnecke und jede Menge Spinnen, Käfer, Schlangen und Skorpione. Zu guter Letzt schoss ich noch ein Schwein, das gut und gern einen Zentner wog …«
Mit riesigen Mengen konservierter, vorausgeschickter und bereits klassifizierter Exemplare sowie einer Theorie über die Entstehung der Erde und der Korallenriffe, die allmählich in seinem Kopf Gestalt annahm, galt der siebenundzwanzigjährige Darwin bei seiner Rückkehr nach England, fünf Jahre später, bereits als ein geachteter Wissenschaftler. Es erinnert ein wenig an die Faszination und Einsicht, die uns große Literatur bietet, wenn Darwin mit neunundzwanzig, nur zwei Jahre nach seiner Reise mit der Beagle und einundzwanzig Jahre, ehe er Über die Entstehung der Arten veröffentlichen sollte, seinem Taschennotizbuch einen ersten Hinweis auf die so schlichte wie schöne Idee anvertraut: »Abstammung des Menschen jetzt bewiesen … Wer den Pavian versteht, würde mehr zur Metaphysik beitragen als John Locke.«4
Und doch bietet Über die Entstehung der Arten keinen leichten Zugang zum Verständnis der Größe Darwins. Liest man sein Werk als Literatur und nicht als Theorie, kann es den fachfremden Leser mit seiner Vielfalt an Beispielen überwältigen – Resultat von Darwins Warten und Zaudern –; und es ist auch wohl kein Zufall, dass die am häufigsten zitierte Passage aus dem letzten Absatz des Buches stammt.
Darwin war ein Wissenschaftler jenes Schlags, für den Leben und Arbeit untrennbar miteinander verbunden sind. Sein Studium der Erdwürmer im Garten im Dorf Downe ist allgemein bekannt. Er besuchte Märkte auf dem Land, um Pferde-, Hunde- oder Schweinezüchter zu befragen; und auf Pflanzmärkten fachsimpelte er mit den Züchtern preisgekrönter Gemüsesorten. Er war ein hingebungsvoller Vater und hielt in seinem Notizbuch fest: »Mein erstes Kind wurde am 27. Dezember 1839 geboren; und ich begann gleich, mir Notizen über seine vielfältige Mimik zu machen …« Lang ehe eine angeborene Theory of Mind, eine Theorie des Geistes, postuliert wurde, experimentierte Charles Darwin mit William, seinem Erstgeborenen, und zog seine eigenen Schlüsse:
»Als es wenige Tage über sechs Monate alt war, that seine Wärterin so, als weinte sie; und hier sah ich, wie sein Gesicht augenblicklich einen melancholischen Ausdruck annahm mit stark herabgezogenen Mundwinkeln … Es scheint mir aber, dass ihm ein angeborenes Gefühl gesagt haben muss, das vermeintliche Weinen der Wärterin drücke Kummer aus; und dies erregte durch den Instinkt der Sympathie in ihm Kummer.«5
Bei einem Ausritt hält er an, um mit einer Frau zu reden, und bemerkt, wie sie die Brauen zusammenzieht, als sie gegen die Sonne zu ihm aufschaut. Daheim geht er mit seinen drei Kindern in den Garten und lässt sie zu einem hellen Himmelsflecken aufblicken. Der Grund? »Bei allen dreien wurden die kreisförmigen Muskeln, die Augenbrauenrunzler und die Pyramidenmuskeln energisch durch Reflexthätigkeit … zusammengezogen.«6
Über viele Jahre, in denen Darwin vorwiegend anderen Projekten nachging, hat er für Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren recherchiert, seinem ungewöhnlichsten und zugänglichsten Buch, reich an beobachteten Details sowie brillanten Spekulationen und zudem wunderschön illustriert – eines der ersten wissenschaftlichen Bücher mit Fotografien, darunter auch einige von seinem eigenen schmollenden und lachenden Baby –, inzwischen in dritter Ausgabe verfügbar, überarbeitet und annotiert von Paul Ekman, dem großen amerikanischen Gefühlspsychologen. Darwin bemühte sich nicht nur, die Mimik von Menschen oder von Hunden und Katzen zu beschreiben – wie wir, wenn wir uns ärgern, die Muskeln um die Augen zusammenziehen und unsere Eckzähne fletschen oder wie wir, mit Ekmans Worten, jene, die wir lieben, mit dem Gesicht berühren wollen, nein, er stellte auch die schwierige Frage nach dem Warum. Warum werden wir vor Verlegenheit rot und nicht blass? Warum heben sich im Kummer die inneren Enden der Brauen, warum hebt sich nicht die ganze Braue? Warum buckeln Katzen, wenn sie jemanden mögen? Ein Gefühl, so argumentierte Darwin, sei ein physiologischer Zustand, ein direkter Ausdruck eines physiologischen Vorgangs. Auf der Suche nach Antworten macht er allerhand amüsante Abschweifungen und Beobachtungen: etwa, wie Billardspieler, vor allem Anfänger, versuchen, den Ball mit einer Bewegung des Kopfes, oft auch des ganzen Körpers ans Ziel zu lenken. Wie ein eingeschnapptes Kind auf den Knien seiner Mutter sitzt, eine Schulter anhebt und diese dann mit ablehnender Miene rückwärts stößt oder wie wir bei einem heiklen oder schwierigen Vorgang den Mund fest zusammenpressen.
Diesem Reichtum an Details liegen fundamentalere Fragen zugrunde. Lernen wir zu lächeln, wenn wir glücklich sind, oder ist Lächeln angeboren? Mit anderen Worten: Sind Gesichtsausdrücke universell, für alle Kulturen und Ethnien gleich? Oder sind sie kulturspezifisch? Darwin schrieb Menschen in abgelegenen Gegenden des britischen Weltreiches Briefe und bat sie, die Mimik der indigenen Bevölkerung zu beobachten. In England zeigte er Fotografien unterschiedlicher Gesichtsausdrücke herum und bat um einen Kommentar. Er berief sich auf eigene Erfahrungen. Das Buch ist anekdotisch verfasst, unwissenschaftlich und überaus hellsichtig. Gefühlsausdrücke sind das Ergebnis von Evolution, schloss Darwin, folglich universell. Er widersprach damit der Ansicht des einflussreichen Anatomen Sir Charles Bell, dem zufolge gewisse, einzigartige Muskeln, für die es im Tierreich keinerlei Äquivalent gebe, von Gott im Gesicht des Menschen geschaffen wurden, damit es ihm möglich sei, Gefühle mit anderen Menschen auszutauschen. In einer Fußnote zitiert Ekman aus Bells Buch: »Der bemerkenswerteste Muskel im menschlichen Gesicht ist der corrugator supercilii, der die Brauen zusammenzieht, was eine enigmatische Wirkung hervorruft, die so unerklärlich wie unabweisbar die Idee eines Verstandes nahelegt.« In Darwins Exemplar von Bells Buch sind diese Zeilen unterstrichen und mit den Worten kommentiert: »Ich fürchte, er hat nie einen Affen seziert.« Wie Darwin gezeigt hat, gibt es diese Muskeln natürlich auch in anderen Primaten.
Indem er aufzeigte, dass für die Mimik bei Menschen wie Primaten dieselben Prinzipien gelten, trat Darwin für Kontinuität und Fortentwicklung der Spezies ein – ein gewichtiges Argument für seine Theorie der Evolution und für die Widerlegung christlicher Ansichten, denen zufolge der Mensch eine besondere Schöpfung ist, die sich grundsätzlich von allen anderen Tieren unterscheidet. Darwin war zudem fest entschlossen, mittels Universalität eine gemeinsame Abstammung aller menschlichen Rassen nachzuweisen. Damit stellte er sich in deutlichen Widerspruch zu rassistischen Ansichten von Wissenschaftlern wie Louis Agassiz, die behaupteten, Afrikaner seien Europäern unterlegen, weil sie von anderer, minderwertiger Herkunft seien. In einem Brief an Hooker erwähnt Darwin, dass Agassiz die Doktrin »mehrerer Spezies« (des Menschen) postuliere, »wohl sehr, wie ich denke, zum Gefallen der Sklavenhalter in den Südstaaten«. Moderne Paläontologie und Molekularbiologie beweisen, dass Darwin recht hatte und Agassiz sich irrte: Wir stammen von einer gemeinsamen Stammform anatomisch moderner Menschen ab, die vor vermutlich kaum zweihunderttausend Jahren aus Ostafrika auswanderten, um sich über die Erde zu verbreiten. Örtliche Klimaunterschiede ließen Varianten der Spezies entstehen, deren Unterschiede buchstäblich nur gerade mal bis unter die Haut gehen. Zur Rechtfertigung von Eroberungen und Unterwerfungen haben wir diese Unterschiede dann zu einem unhinterfragbaren Dogma erhoben. Darwin schrieb:
»… dass alle die hauptsächlichsten Ausdrucksweisen, welche der Mensch darbietet, über die ganze Erde dieselben sind. Diese Thatsache ist interessant, da sie ein neues Argument zu Gunsten der Annahme beibringt, dass die verschiedenen Rassen von einer einzigen Stammform ausgegangen sind, welche vor der Zeit, in welcher die Rassen von einander abzuweichen begannen, beinahe vollständig menschlich in ihrem Baue und in hohem Grade so in ihrer geistigen Entwickelung gewesen sein muss.«7
Wir sollten uns darüber im Klaren sein, was mit dem universellen Ausdruck von Gefühlen gemeint ist. Schnecken zu essen oder ein Stück Cheddar mag in der einen Kultur Anlass zu Genuss geben, in einer anderen Abscheu hervorrufen. Abscheu aber wird, ganz unabhängig vom Auslöser, universell auf dieselbe Weise ausgedrückt. Mit Darwins Worten: »Der Mund wird weit geöffnet, die Oberlippe stark zurückgezogen, welches die Seiten der Nase in starke Falten bringt.«8 Gesichtsausdruck und Physiologie sind Produkte der Evolution. Gefühle aber werden natürlich von der Kultur geprägt. Unsere Art, mit Gefühlen umzugehen, unsere Einstellung dazu, die Art, wie wir sie beschreiben, all das ist angeeignet und unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. Dennoch, die Vorstellung von einem gemeinsamen Reservoir an Gefühlen basiert auf der von einer universellen menschlichen Natur, bis vor kurzem und während eines Großteils des zwanzigsten Jahrhunderts ein verpönter Gedanke. Darwins Buch fiel nach seinem Tod für lange Zeit in Ungnade. Heute hat sich das vorherrschende Meinungsklima geändert, und Ekmans hervorragende, enthusiastisch begrüßte Neuausgabe war ein großes Publikationsereignis.