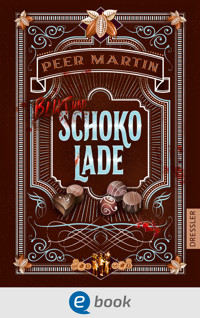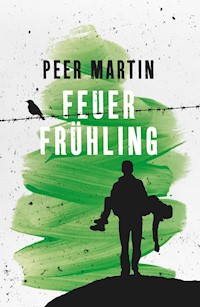12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Du hast nichts zu verlieren, wenn dir alles genommen wurde! Der 19-jährige Kanadier Mathis begleitet Hope, einen elf Jahre alten Somali, auf dessen abenteuerlicher Flucht quer durch Südamerika. Kaum gestartet, heften sich zwei zwielichtige Typen an ihre Fersen. Nicht die einzige Bedrohung, der sich Hope und Mathis unterwegs stellen müssen. Auf ihrem atemberaubenden Trip über den Amazonas, die Panamericana und auf dem Dach eines rasenden Güterzugs lauert der Tod überall. Mehr als einmal können sie ihm nur knapp entkommen. Werden die beiden es in die Freiheit schaffen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch
Natürlich war es verrückt. Das ganze Projekt. Sie hatten alle geglaubt, dass ich scheitern würde, meine Eltern, meine Freunde. Dass niemand mit mir über die Wahrheit reden würde. Niemand mich mitnehmen würde auf diese Flucht in die USA. Aber ich war entschlossen: Ich würde der Erste sein. Oh Mann, was wusste ich damals schon? Nichts. Nicht, wie man auf einen Baum im Amazonasdschungel klettert, und nicht, dass man sich auf den Zugdächern in Mexiko festbinden muss, wenn man schläft. Nicht einmal, dass es Hope gab. Ein Kind, dessen kleine Hand in meiner alles veränderte. Ein Kind, das ein tödliches Geheimnis mit sich trug.
Eine abenteuerliche Reise von Südafrika bis in die USA – atemberaubend, schonungslos und brandaktuell
SÜDAFRIKA
1. Johannesburg
BRASILIEN
2. Porto de São Raimundo
3. São Gabriel da Cachoeira
4. Yanomami-Dorf
5. Iauraté
KOLUMBIEN
6. Mitú
7. Bogotá
8. Medellín
9. Turbo
10. Capurganá
PANAMA
11. Yaviza
COSTARICA
12. Puerto Limón
NICARAGUA
13. Küstenort
14. Dorf in Nicaragua
15. Zwischenstopp El Salvador
16. Todos Santos Cuchumatán
GUATEMALA
17. Guatemala City
18. La Mesilla
MEXIKO
19. Tapachula
20. Lechería, Mexiko-Stadt
21. Jimena und Pedro
MEXIKO
22. Nuevo Laredo
USA
23. Brooks County
24. San Antonio
25. Dallas
26. Pine-Ridge-Reservat
27. Duluth, Lake Superior
28. Grand Portage
KANADA
29. Pigeon Bay
30. Québec
0
Vorspann
Bildersuche Internet:
Südafrika Somalis Gewalt
Johannesburg Rooftop Bar
Sie haben es von Anfang an alle gesagt: Die Idee war vollkommen verrückt.
Das ganze Projekt.
Und zu gefährlich.
Florence hat nur den Kopf geschüttelt, ihren hübschen Kopf, den die vielen langen, dunklen Löckchen umrahmen. Dann hat sie aus dem Fenster gesehen und zum Horizont über der Stadt gesagt: »Du machst das sowieso nicht«, und in diesem Moment wusste ich, dass ich es tun würde.
Es war ein Tag in Johannesburg, Ende Juli, und das Fenster, an dem wir standen, war das Fenster eines heruntergekommenen, staubigen Hotels, fünfter Stock.
Der Stacheldraht und die Glasscherben auf der Mauer, die das Hotel umgab, blitzten in der Sonne, sodass man die Augen zukneifen musste: Stacheldraht gegen die Welt da draußen, gegen die, die nichts haben und dich vielleicht überfallen. Stacheldraht und Wale an der Küste, that’s South Africa for you.
Aber ich war nicht wegen der Wale gekommen.
Ich war gekommen, weil dies der Startpunkt einer Reise war, über die ich schreiben wollte.
Ich, Mathis Martin, Kanadier, neunzehn, Möchtegernjournalist.
Die Reise sollte nach Südamerika führen, wo man Einreisevisa leichter bekommt, vor allem gefälschte, und dann die ganze Panamericana hoch, jene lange, berüchtigte Straße, die die Amerikas verbindet: den armen Süden mit dem reichen Norden, die Favelas und Slums mit dem Traumland der Einkaufszentren und der unbegrenzten Möglichkeiten.
Eine Menge Leute hatten diese Reise gemacht. Mit dem Motorrad, mit dem VW-Bus, mit dem Fahrrad. Niemand hatte sie bisher mit Flüchtlingen gemacht.
Ich würde der Erste sein.
Seit drei Wochen suchte ich, vergeblich, einen Kontakt.
Ich hatte so viel recherchiert und wusste, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so wenig. Ich hatte all diese ausgedruckten Zettel bei mir, zusammengeschriebene Informationen mit Fakten und Notizen, falls der Laptop es nicht mehr machte, oder vielleicht hatte ich die Zettel auch eher als Glücksbringer im Rucksack. Aber was wusste ich? Ich wusste nicht einmal etwas von Hope. Davon, dass eine Person mit diesem Namen in Johannesburg existierte. Es ist merkwürdig, zu denken, dass es eine Zeit vor Hope gab, eine Zeit, in der ich dieses nachdenkliche Gesicht nicht kannte, die Fragen nicht im Ohr hatte, die Hope stellte, den prüfenden Blick dieser Augen nicht spürte.
Nein, wirklich, ich wusste nichts.
Natürlich war es verrückt. Florence hatte recht, sie hatten alle recht, meine Eltern, meine Freunde zu Hause. Ich würde scheitern, niemand würde mit mir reden wollen, am wenigsten über die Wahrheit. Ich würde von irgendjemandem um mein Geld erleichtert werden und ohne Story zurückkehren.
Niemand, am allerwenigsten ich selbst (Mathis, neunzehn, Kind zurückhaltender, postmoderner Juden in Québec, Bildungselite, stets leicht verstrubbeltes Haar, Linkshänder) – niemand konnte ahnen, dass ich an jenem Tag, jenem eigentlich ersten Tag der ganzen Geschichte, in Johannesburg diese Bilder schießen würde.
Bilder im Feuer.
Bilder von Männerarmen, die Flaschen schleuderten, Bilder von reiner Wut, Bilder von einem gelben Lodern, das aus der Mitte der Welt kam, die die Mitte eines kleinen Gemischtwarenladens war. An jenem Tag wurde der kleine Laden zur Welt, einer Welt aus Hass, und diese Welt verschluckte sich selbst, zerstörte sich.
Das war der Punkt, an dem ich aufhörte, Bilder zu machen.
Und der Punkt, an dem meine Reise begann.
Ich hatte den Kontakt vom Nachtwächter unseres Hotels.
Dies war der fünfzehnte oder sechzehnte Versuch, einen Afrikaner zu finden, der rüberwollte nach Amerika. Einen, mit dem ich reisen konnte. Sie kamen aus den Ländern nördlich von Südafrika, manche waren schon eine Weile hier und versuchten, Geld zu verdienen für die Weiterreise: Sudanesen, Jemeniten, Malier, Somalis.
Alle, die ich getroffen hatte, hatten ausweichend geantwortet. Ein paar hatten gesagt, sie würden sich überlegen, mit mir zu reisen, und dann waren sie verschwunden, ihre Handynummern plötzlich nicht mehr existent. Sie hatten Angst.
Der Nachtwächter, der das Hoteltor auf- und zuschloss, ein kleiner Mann mit grauem Haar, grauer Uniform und einem nervösen Zwinkern, hatte gesagt, ich sollte es im Laden seines Freundes versuchen. Der wäre schon lange da, aus Somalia, der könnte mir helfen. Der würde sie alle kennen, alle Geflohenen, Vertriebenen, Glückssucher und Unglücksfinder, die hier in Johannesburg untergekrochen waren.
Der Laden, eine halbe Stunde Taxifahrt von unserem Hotel entfernt, war eine jener schattigen Höhlen, die Kühle, Dosentomaten, Fladenbrot und dünne grüne Plastiktüten versprechen. Orte, an denen Menschen mit der gleichen Sprache ein und aus gehen und sich über Damals und Zuhause unterhalten.
Es war voll in dem kleinen Laden, staubig und voll. Ich dachte, ich könnte eine Melone kaufen und mit dem alten Herrn an der Kasse ins Gespräch kommen.
Ja, und dann stand ich da mit meiner Melone, um mich Gespräche in einer Sprache, die ich nicht verstand, im Fernsehen ein Fußballspiel – und das war die Sekunde, ehe alles sich änderte.
Ich kam nie dazu, die Melone zu bezahlen.
Ich weiß nicht, was mit ihr geschah, ich nehme an, ich ließ sie fallen, ich nehme an, jemand zertrat die Reste zu Matsch.
Zuerst war da das Krachen, dann das Klirren. Der alte Herr hinter seiner winzigen Ladentheke sah auf. Die Frau, die vor mir stand, schrie. Sie versuchte, an mir vorbeizukommen., weg, es war eine korpulente Frau, ich erinnere mich an das leuchtende Blau ihrer Bluse, das mir für einen Moment den Blick versperrte. Und an ihren Geruch nach Koriander und Zimt. Dann lag ich auf dem Boden, etwas hatte mich an der Stirn getroffen, ein Stein vielleicht, und die Fenster waren zerbrochen, und draußen waren drei vermummte Gestalten.
Nein, sie waren drinnen. Sie hatten Tücher vor Nase und Mund, nicht so, als wollten sie nicht erkannt werden, mehr, als sei dies ein Schutz oder eine Uniform, und ich begriff nichts, während ich versuchte, auf die Beine zu kommen. Während die Gestalten in die Regale griffen, Dosen und Packungen herausrissen und zu Boden schleuderten. Regale umwarfen.
Es ging alles zu schnell.
Ich kroch zur Seite, kam aber nicht auf die Beine. Der Boden war glitschig vom Inhalt der zerstörten Päckchen und Dosen, über mir ein Chaos aus Menschen und Dingen, die geworfen wurden, und weiteren Schreien, und ich sah, wie einer der Vermummten den alten Mann hinter der Theke hervorzog. Der andere zerrte ihn auf die Beine, und ich weiß, dass ich Angst hatte, eine Wahnsinnsangst, und dennoch oder gerade deswegen riss ich die Kamera hoch und drückte ab. Dann kroch ich weiter rückwärts, in einen Haufen aus zersplitterten Holzregalen und zermatschten Tomaten hinein, während ich weiter Bilder schoss. Ich sah, was ich sah, nur durch den Sucher: eine Faust, die in einem Gesicht landete. Eine Hand mit einem Stein darin. Eine andere Hand mit einer Flasche, die auf den Schädel des Alten niedersauste. Einen Regen aus Zeitschriften. Hände, die wahllos irgendwelche Gegenstände griffen und in Taschen steckten. Ein Hosenbein mit einem Schuh daran, reglos, auf dem Boden.
Augen, die mich aus halb vermummten Gesichtern heraus anstarrten. Die mich entdeckt hatten, mich und die Kamera.
Das war der Moment, in dem ich mich zusammenkrümmte und die Kamera mit meinem Körper schützte.
Ich lag da und wartete darauf, dass mich jemand hochzerrte und fertigmachte und die Kamera zertrat. Wartete auf den Schmerz.
Doch nichts geschah. Der Plan war geändert worden.
Plötzlich entfernten sich Schritte, etwas knisterte. Brandgeruch stieg mir in die Nase, Erinnerung an den Geruch der Müllhalden Südafrikas.
Dies war ein Laden gewesen, aber jemand hatte entschieden, ihn in eine Müllhalde zu verwandeln.
Ich unterdrückte den Husten, und ich schaffte es endlich, hochzukommen.
Sie hatten die Zeitschriften auf einen Haufen geworfen und angezündet, die Flammen griffen rasend schnell um sich, jemand musste Benzin über die zerstörten Regale gekippt haben.
Ab diesem Punkt ist meine Erinnerung verworren, ich weiß nur noch, dass ich versuchte, dorthin durchzukommen, wo der Schuh und das Hosenbein lagen, und dass ich sehr wenig Luft bekam, und dann lag ich auf einmal draußen, auf der Straße, und jemand drückte mich hinunter. »Bleib da.«
Direkt vor meinen Augen lag ein Kugelschreiber, so ein dünner weißer Drittweltkugelschreiber mit blauer Kappe.
In der Ferne, im Lärm der Stadt, hörte ich Sirenen. Als der über mir mich schließlich so weit losließ, dass ich den Kopf heben konnte, sah ich es zum ersten Mal in seiner ganzen Pracht: das Feuer. Es blühte dort, wo der Laden gewesen war, eine wunderschöne orange-gelbe Blume.
Die Straße war bedeckt mit Scherben, Dosen, Flaschen. Die Autos fuhren darum herum, ungeduldig hupend.
»Ist die Kamera okay?«, fragte der Mensch, der mich auf den Boden gedrückt hatte.
Und so sah ich ihn zum ersten Mal.
Sein fadenscheiniges gelbes T-Shirt mit der verblichenen Schrift war bespritzt mit etwas, das Blut oder der Saft von Tomaten sein konnte. Seine Hände waren rußig. Sein Gesicht lächelte.
Es war ein schmales Gesicht. Das Gesicht eines Kindes. Eines kleinen Jungen.
Vielleicht acht Jahre alt.
Die Kraft, mit der er mich zu Boden gedrückt hatte, war für einen kleinen Jungen erstaunlich. Sein Kopf war bedeckt mit einer Flut von verfilzten schwarzen Locken, sie reichte ihm bis über die Ohren. Weiße Flocken hatten sich darin verfangen, Ascheflocken wie Schnee.
Das Weiß in den Augen des Jungen war sehr hell und das dunkle Braun seiner Iris schien zu glühen.
»Ist die Kamera okay?«
Ich nickte langsam. »Ich glaube. Aber der Alte … er ist noch da drin … im Feuer.« Und ich kam halb auf die Beine, doch der Junge hielt mich am Ärmel fest.
»Du kannst ihm nicht mehr helfen.«
»Er ist tot«, sagte ich.
Der Junge nickte. Ich nickte auch.
»Du … hast mich da rausgeschleift. Oder?«
Er wischte sich das Blut von den aufgeplatzten Lippen, auch er hatte Schläge eingesteckt.
»Mhm-m. Ich meine, wolltest du drin bleiben?«
»Nein«, sagte ich. »Scheiße, Mann, wer … waren die?«
»Leute«, sagte er und zuckte die Schultern. »Sie mögen keine Somalis. Sagen, wir nehmen ihnen die Jobs weg.« Und erst in diesem Moment begriff ich, dass dieser achtjährige Junge Englisch sprach. Ziemlich gutes Englisch. »Ich hab da gearbeitet«, sagte er. »Sachen nach Hause getragen, zu den Kunden.« Er klopfte sich den Ruß von den Händen. »Ich bleib hier sowieso nicht. Sie sagen, du suchst jemanden, der die Reise mit dir zusammen macht. In die Vereinigten Staaten.«
»Sagen sie das?«
Er nickte, und dann sagte er, mit einer großmütigen Handbewegung: »Du kannst mit mir gehen.«
Ich sah ihn an. Sah in das schmale, kleine, ernste Gesicht.
»Klar«, sagte ich sarkastisch, um uns noch immer Rauch, Chaos und eine sich vergrößernde Menge Schaulustiger. »Wie alt bist du?«
»Meine Familie ist drüben«, sagte er. »Brasilien. Die warten auf mich. Aber es ist schwer, alleine rüberzukommen.«
»Die haben dich … zurückgelassen?«
Er schüttelte vehement den Kopf. »Dinge passieren. Leute verlieren sich auf der Flucht. Es ist chaotisch. Aber ich weiß, dass sie in Brasilien sind. Manaus. So heißt die Stadt. Und sie wissen, dass ich hier bin. Sie warten, dass ich rüberkomme. Weißt du, man kann auch fliegen. Das geht schneller.«
»Ja, geht es«, sagte ich. »Aber du brauchst Papiere, oder? Und ich … hör mal, es tut mir leid, aber ich bin der schlechteste Babysitter der Welt.«
Er sah mich an, mit angewinkeltem Kopf. Wie ich da auf der Straße saß, die Kamera im Arm haltend. »Den Babysitter brauchst wohl eher du«, meinte er.
In diesem Moment hielt ein Feuerwehrauto neben uns und direkt dahinter ein Wagen der Polizei. Da kam der Junge mit einem Satz auf die Beine, tauchte in eine Seitenstraße ein und war fort.
Florence schlug die Hände vor den Mund, als ich vier Stunden später vor der Tür unseres Hotelzimmers stand.
»Shit«, flüsterte sie. »Was ist passiert?«
»Es ist okay«, sagte ich und nahm sie in die Arme, ich, verschwitzt, dreckig, aufgeregt wie ein Grundschüler. »Es sind nur Dosentomaten. Es ist nur Ruß. Es ist okay.«
Ich ließ sie los und drängte mich an ihr vorbei in das winzige Hotelzimmer, setzte mich aufs Bett schloss die Kamera an den Laptop an.
»Krass«, sagte ich. »Guck dir das an. Diese Bilder … Die Polizei will sie auch haben … Fucking hell, guck dir das an, guck dir den Typen an … Ich hab ihn in dem Moment, in dem er die Flasche hebt, um dem Alten damit auf den Kopf zu schlagen, das ist so krass, das ist …«
»Mathis«, sagte Florence.
»Ja«, sagte ich und klickte weiter durch die Bilder.
Ich hatte eine Story. Mehr als das. Adrenalin schoss durch meine Adern, ich war wie auf Droge.
»Sie waren plötzlich da«, flüsterte ich. »Und ich war mittendrin. Dieser Hass in ihren Augen. Ich hab so was noch nie gesehen. Wie sie die Regale ausgeräumt haben, und dann das Feuer! Es ist ein paar Mal vorgekommen in letzter Zeit, haben sie bei der Polizei gesagt. Die Somalier sind zu erfolgreich hier, die müssen weg, wie die deutschen Juden, die waren auch zu erfolgreich, guck dir das an, das Gesicht.«
»Mathis«, sagte Florence noch einmal, und diesmal sah ich auf.
»Ich habe gewartet«, sagte sie leise. »Es kam in den Nachrichten. Im Radio. Ich hatte Angst.«
Ich nickte. »Tut mir leid. Hat ewig gedauert auf der Polizeiwache.«
»Ich habe dich angerufen. Du hast es nicht mal gemerkt.«
»Ich – nein. Tut mir leid.« Ich zog sie auf mein Knie. »Ich liebe dich.«
Da lachte sie, kurz und rau. »Mich? Nein. Du liebst das hier. Deine Story. Du wärst nicht mal ins Hotel gekommen, wenn der Laptop hier nicht stehen würde, oder?«
Ich sah sie nicht an.
»Geh mit mir essen«, flüsterte sie. »Heute Abend. Ich fliege morgen früh nach Hause.«
»Klar«, sagte ich lahm. »Gehen wir essen.«
»Ich dachte bis vorhin, dass du mitfliegst. Nach Hause.« Sie sah mich eine Weile an, und ich dachte wieder darüber nach, wie schön sie war, doch alles in mir wollte zu den Bildern zurückkehren.
»Ich habe vielleicht jemanden, mit dem ich reisen kann«, hörte ich mich sagen, und wir lauschten beide den Worten nach, wie sie in dem kleinen, staubigen Hotelzimmer aufstiegen und im hektisch sirrenden Ventilator zerhackt wurden.
»Wen?«, fragte Florence »Der Besitzer von dem Laden, den sie angezündet haben?«
»Nein«, sagte ich. Und ich dachte an das Hosenbein und den Schuh und daran, dass der Ladenbesitzer nicht mehr lebte.
»Den Botenjungen. Na ja, und seine Familie. Ich meine, falls ich den Jungen wiederfinde. Wie findet man in Johannesburg einen achtjährigen Jungen?«
»Gar nicht«, sagte Florence.
Und ich ahnte, dass sie recht hatte. Wenn überhaupt, würde er mich wiederfinden.
Der letzte Abend mit Florence: Wie unwirklich er später wurde, wie seltsam … Ich verbrachte jenen letzten Abend auf einer Dachterrasse, an einem Tisch zwischen Topfpalmen und Kerzenschein, unter uns die Großstadt mit ihren tausend Lichterarmen: die Hochhäuser in der näheren Umgebung makellose, glitzernde Stalagmiten und in der Ferne, unsichtbar und doch vorhanden, die Slums. Der Tisch war aus absichtlich verrostetem Eisen, hip und modern, die Cocktails aus dem Bilderbuch. Die Menschen auch.
Florence hatte darauf bestanden, dass ich das einzige gute Hemd anzog, das ich im Rucksack hatte, es war zerknittert, aber immerhin. »Und rasier dich vielleicht«, hatte sie gesagt.
Und da saß ich, gekämmt und im weißen Hemd, zwischen Menschen in besseren Hemden und mit besseren Frisuren. Ich hätte lieber irgendwas an einer Straßenbude gegessen, mich mit Florence auf eine Mauer gesetzt, mit einer Flasche Wein, wie vor zwei Jahren, als wir uns kennengelernt hatten und quer durch Kanada gefahren waren. Siebzehn. Die Florence, die jetzt vor mir saß, war eine junge Frau, kein Mädchen mehr. Wann war sie so erwachsen geworden?
»Es ist nur der Unterschied«, sagte sie und fuhr mit dem kleinen Finger den Rand ihres Cocktailglases entlang. »Du bist immer noch fünf. Du denkst, du kannst dein ganzes Leben lang rumrennen und Abenteuer erleben und Höhlen und Flöße bauen.«
»Aber es gibt Menschen, die das tun. Rumrennen jedenfalls«, sagte ich. »Ich glaube, man nennt sie Journalisten. Manche sind berühmt.« Ich legte eine Hand auf ihre. Zwinkerte ihr zu. »Die Welt wird von mir hören.«
Wir lachten zusammen. »Natürlich«, meinte sie. »Krieg ich dann ein Autogramm?«
»Das … hört sich so an, als würden wir uns nicht mehr kennen, wenn es so weit ist.«
»Mathis«, sagte Florence, und das Essen kam und sah wunderbar aus, Kunstwerke auf quadratischen Tellern, und keiner von uns rührte es an. »Mathis, ich werde nicht auf dich warten, in Kanada. Ich bin nicht das liebe kleine Mädchen, das sich jeden Tag die Augen ausweint und hofft, dass du bald nach Hause kommst, und jeden Tag den Blog verfolgt, den du möglicherweise schreibst. Ich werde den Rest der Ferien jobben und im September anfangen zu studieren. Ich …« Sie schüttelte den Kopf, sah weg. »Wenn du dich unbedingt auf einer so irren Reise kaputt machen willst, tu das«, sagte sie. »Zehn Prozent, Mathis, zehn Prozent von denen, die in Südamerika losgehen, schaffen es in die Staaten. Der Rest …« Sie räusperte sich. »Du kannst dir aussuchen, ob du dich im Urwald von einer Giftschlange beißen oder von einer mexikanischen Gang abschlachten lässt.«
Plötzlich sah sie mich wieder an.
»Flieg mit mir nach Hause. Schreib dich an der Uni für Journalismus ein. Wir können eine Wohnung zusammen suchen.«
Ich nahm die Hand. Drückte sie. Und schüttelte langsam den Kopf. »Tut mir leid.«
»Dann musst du damit leben, dass ich jemand anderen finde.«
»Ich liebe dich«, sagte ich wieder. Aber ich hörte, dass es hohl klang.
Der Stuhl war zu durchdesignt, um bequem zu sein, ich rutschte unbehaglich darauf herum, sie hatte recht: wie ein Kind. Ich wollte nicht auf diesem Stuhl sitzen, zwischen den Cocktailtrinkern in ihren feinen Kleidern, im Angesicht der glitzernden Wolkenkratzer von Shoppingmalls und Hotels.
Ich wollte da unten sein, da unten in den Straßen, im Staub, im Dreck, mit meiner Kamera, und Geschichten einsammeln. Und eines Tages einen Namen haben, den niemand so schnell wieder vergaß: Es würde der Name eines Abenteurers sein, der keine Hemden zu tragen brauchte, damit die Welt ihm lauschte.
Allein der Gedanke, eine Wohnung zu suchen, bereitete mir Bauchschmerzen.
»Ich liebe dich, aber ich werde nicht mit nach Hause kommen«, sagte ich. »Ich … bin kein Zu-Hause-Typ.«
Florence nickte. »Ich schon«, sagte sie. »Ich möchte irgendwann ein eigenes Zu Hause haben, für mich. Später. Und dazu muss ich ein Studium abschließen, einen handfesten Job finden, mich absichern … verstehst du das nicht? Ich meine, du hast wunderbare Eltern, du hattest diese ganze Geborgenheit. Die perfekte Kindheit. Und genug Geld im Hintergrund, es war nie … ein Problem. Bei mir … Du kennst die Geschichte. Verdammt, ich habe hart genug gearbeitet, um das Stipendium fürs Studium zu kriegen, das lasse ich nicht sausen, um … was weiß ich. Abenteuer zu erleben.« Sie seufzte, und ich kannte die Geschichte, sie hatte recht. Florences’ Mutter war immer ein Problem gewesen, psychisch, sie hatte irgendwann angefangen zu trinken, und dann hatten ihre Eltern nur noch gestritten und Geld war sowieso nie irgendwo gewesen. »Ich möchte ein Zuhause haben, in dem ich mich wohlfühle. Und irgendwann, später, in zehn Jahren oder was, möchte ich Kinder. Denen ich eine bessere Kindheit geben kann. So eine, wie du sie hattest. Ich möchte zusehen, wie sie durch einen Garten rennen, im Sonnenschein, und lachen. Mich darum kümmern, dass es ihnen gut geht. Eine Zukunft aufbauen.«
»Ich wäre der schlechteste Babysitter der Welt«, sagte ich ernst.
»Du willst keine Kinder? Kein Zuhause? Auch in zehn Jahren nicht? … Nie?«
»Es tut mir leid«, sagte ich.
Sie nickte nur. Und dann nahm sie die Gabel, inspizierte das wunderschön arrangierte Gemüse und begann zu essen. Ich hatte die Kamera bei mir, und dies ist das letzte Foto, das ich von Florence habe: wie sie auf dieser Dachterrasse voller Kerzen sitzt, vor sich einen Teller mit einem Kunstwerk und ein Cocktailglas. Sie lächelt auf dem Foto. Doch ihr Lächeln ist an den Rändern schon ein Stück Vergangenheit: ein Abschiedslächeln, das sie mir geschenkt hat, nur für das Bild.
Und dann saß ich in unserem Hotelzimmer auf dem Bett und versuchte zum x-ten Mal, die Bilder in meine Cloud zu laden, das Netz war zu schwach.
Flammen auf dem Bildschirm des Laptops, die erhobene Hand mit der Flasche, die Wut auf den Gesichtern, ein umgekipptes Regal. Der alte Somali auf dem Boden, der Hass in den Augen der Angreifer.
Vielleicht hatte Florence recht.
Vielleicht war es Wahnsinn, was ich vorhatte.
Sie hassten die somalischen Flüchtlinge schon hier, in Südafrika, obwohl sie nicht einmal eine andere Hautfarbe hatten. Überall auf der Welt wartet der Hass auf Flüchtlinge, wer vor dem Tod zu Hause davonläuft, findet tausend neue Tode in der Fremde.
Zehn Prozent, hatte Florence gesagt, und ich wusste, dass sie recht hatte: Zehn Prozent schaffen es in die Staaten.
Aber dann sprang ich plötzlich auf.
Genau das, dachte ich. Genau das wollte ich dokumentieren.
»Florence?« Sie war im Bad, ich hörte die Dusche. »Ich dreh noch eine Runde draußen, ja?«
»Nimm den Hund mit«, rief Florence. Es war so ein Witz zwischen uns, so zu tun, als hätten wir einen Hund oder ein Kind oder einen Balkon (»Gieß die Geranien!«), und erst jetzt ging mir auf, dass wir den Witz unterschiedlich verstanden hatten. Für sie war es der Traum gewesen. Die Zukunft: Hund, Kind, Mann, Haus.
Für mich war es eine Art gewesen, mich über solche Spießigkeit lustig zu machen.
Ich war versucht, statt des inexistenten Hundes die Kamera mitzunehmen, aber dann ließ ich es. In meiner Jeanstasche steckten das Reiseportemonnaie mit ein bisschen Kleingeld, das Handy und eine Ersatzkarte für die Kamera, weil ich es für überflüssig hielt, sie herauszupulen.
Die Straßen waren dunkel. Es war eine schöne Nacht, die Luft warm und schmeichelnd auf der Haut. Es roch nach Diesel und nach Blumen, die irgendwo im Verborgenen blühten.
Die Sterne über mir waren unsichtbar, der Lichtsmog der Stadt fraß sie auf.
Der Mensch macht alles kaputt, dachte ich, sogar das Sternenlicht, aber irgendwie findet die Natur doch einen Weg.
»Vielleicht«, flüsterte ich, »wird es nicht so bleiben. Wir zerstören das Klima, wir zerstören die Welt, und dann wundern wir uns, warum eine ganze Masse von Menschen ihre Länder verlässt, in denen es nichts mehr gibt, und sich auf den Weg in unsere schöne, vollautomatische Zivilisation macht.« Das wäre, dachte ich, ein guter Anfang für meine Story.
Dann sah ich, woher der Duft kam. Unweit von mir wuchsen die Ranken eines Geißblatts über eine Mauer, aus einem Garten heraus, unbeeindruckt von Stacheldraht und Glasscherben auf der Mauerkrone. Ich ging näher, atmete tief den Duft ein … Und dann legte sich ein Arm um mich.
Nahm mich in den Schwitzkasten.
Vor mir materialisierten sich zwei weitere Männer aus dem Nichts, einer hatte ein Klappmesser, der andere hatte einen Blick, in dem ich den gleichen Hass sah wie in den Augen der Plünderer.
»Keep your mouth shut, okay!«, sagte er.
Ich wehrte mich, was dumm war, bekam eine Faust in die Magengrube, krümmte mich und spürte etwas Kaltes an meinem Hals: die Messerklinge. Einer der drei hielt mich fest, während die anderen blitzschnell meine Taschen durchsuchten. Sie fanden das Portemonnaie und fluchten, enttäuscht vom Inhalt, fanden auch das Handy und die Ersatzkarte für die Kamera.
»Bitte!«, hörte ich mich keuchen, »kann ich die Karte wiederhaben? Sie ist leer, aber sie ist sehr prakt…«
Der zweite Schlag landete in meinem Gesicht, ich schmeckte Blut, merkte, dass ich jetzt auf dem Boden lag, kassierte noch ein paar Tritte. Dann entfernten sich Schritte.
Ich roch wieder den süßen Duft des Geißblatts.
Schließlich setzte ich mich auf und tastete nach meinen Zähnen. Sie schienen alle intakt zu sein. Ich zitterte, und mir war schlecht, aber vielleicht vor Erleichterung. Leute wurden in südafrikanischen Großstädten für weniger als ein Handy und ein bisschen Kleingeld umgebracht.
Natürlich, dies war ein entwickeltes, modernes Land. Aber Gewalt war nicht an der Tagesordnung.
Sie gehörte zur Ordnung der Nacht.
Lange saß ich einfach nur so da, die Knie angezogen, den Kopf an die Mauer hinter mir gelehnt.
Irgendwo lag Florence, geduscht, sauber, zwischen dem Duft von Hautcreme und Shampoo auf einem weißen Bettlaken. Und hier saß ich, zum zweiten Mal innerhalb von vierundzwanzig Stunden dreckig und blutverschmiert.
Sie hatte recht. Unsere Lebensentwürfe passten nicht zusammen.
Ich spürte, wie sich ein dummes Grinsen auf mein Gesicht stahl. Immerhin hatte ich es geschafft, überfallen zu werden, sodass ich davon berichten konnte.
Als ich das dachte, tauchte in der Ferne wieder ein Schatten auf. Zuerst erschrak ich. Aber es war nur ein kleiner Schatten. Ein Kind. Es rannte.
Und dann blieb es vor mir stehen, nach Atem ringend, und streckte die Hand aus. Darin lag die Karte für meine Kamera. »Ich dachte, du brauchst das hier vielleicht? Deine … Bilder?«
»Du«, sagte ich. Denn natürlich war er es. »Wie kommst du hierher?«
»Ich hab doch gesagt, du brauchst einen Babysitter.« Der Kleine zuckte die Schultern. Ich nahm die Karte. Ich besaß nicht das Herz, ihm zu sagen, dass sie leer war und die Bilder längst in Sicherheit.
Ich nickte nur. »Danke. Haben sie das Ding weggeworfen?«
»Nicht direkt«, sagte der Junge und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, und jetzt sah ich, dass seine Nase blutete. »Sie hatten erst was dagegen, es herzugeben. Aber ich kann beißen. Und sehr schnell rennen. Das Handy konnte ich nicht zurückklauen. Tut mir leid.«
»Nein, das … das Handy ist unwichtig«, sagte ich schnell. Himmel, was hätten sie alles mit ihm anstellen können, diesem mageren kleinen Jungen?
»Also«, sagte er und ließ sich neben mich auf den Boden fallen, »fliegen wir? Ich kann dich zu einem Typen bringen, der sich um die Papiere kümmert. Ich kenne den besten.«
»Ich wette, den kennst du, ja«, sagte ich. »Wo schläfst du eigentlich?«
»Ich hab im Laden geschlafen. Zwischen den Regalen. Mal sehen, wo ich jetzt unterkomme. Bei irgendwem aus dem Clan. Johannesburg ist voll von Somalis. Und wenn nicht – ich kenne Plätze in der Stadt.«
Ich nickte. Natürlich. Er kannte alles, und er konnte alles. Außer alleine an Bord eines Flugs nach Brasilien kommen.
»Was kostet mich der Spaß? Papiere für dich, damit du nach Brasilien kommst? Weißt du das auch?«
»Hundert Dollar, oder zweihundert«, sagte er. »Oder eine Million. Ungefähr.«
»Irgendwas zwischen hundert Dollar und einer Million«, sagte ich. »Alles klar.«
Afrikaner und Zahlen. Nein, sagte ich mir, das war ein Vorurteil, er war einfach nur ein Kind.
»Okay«, sagte ich.
»Okay«, sagte er. Wir schüttelten uns die Hände, eine sehr erwachsene Geste.
»Mathis«, sagte ich.
»Wie?«
»Ich heiße so. Mathis.«
Er nickte. »Das lässt sich nicht ändern.«
»Und … du? Hast du einen Namen?«
»Oh, massenhaft«, sagte er. »Somalis haben alle massenhaft Namen. Den eigenen und den des Vaters und des Vaters des Vaters des Vaters, ich kann das auswendig, bis in die fünfzehnte Generation, man muss das.«
»Mir würde ein Name reichen.«
»Tadalesh«, sagte er. »Es bedeutet Glück. Ich bin jemand, der immer Glück hat.«
»Deshalb bist du hier«, sagte ich. »Allein, und deine Familie ist in Brasilien. Geflohen. Bist du doch, oder?«
»Klar«, sagte er. »Mogadischu ist kaputt.«
Er sagte es mit einer so wegwerfenden Handbewegung, als wäre es unwichtig.
»Ich meine, es war dabei, besser zu werden«, sagte er nach einer Weile. »Wir dachten das. Blöd. Dann ist alles wieder vor die Hunde gegangen.« Er spuckte aus, wie ein alter Mann.
»Und warum sprichst du so verdammt gutes Englisch? Ich meine, wie alt bist du, acht?«
»Elf«, sagte er. »Wir sehen uns.«
Und er stand auf, ging ein paar Schritte rückwärts, wischte sich noch einmal über die blutige Nase – drehte sich um und ging die Straße hinunter, bis seine magere kleine Gestalt mit der Dunkelheit jenseits der Straßenbeleuchtung verschmolz.
Glückskind.
Florence schlief, als ich zurück ins Hotelzimmer kam.
Ich fiel angezogen aufs Bett und legte einen Arm um sie, doch sie schüttelte ihn ab, ohne aufzuwachen.
Als ich die Augen wieder öffnete, lag ich allein auf dem Bett.
Der Wecker stand auf zehn Minuten vor neun.
Ich fühlte mich gerädert, versuchte, nicht an die Typen zu denken, die mich überfallen hatten, dachte an sie. Versuchte, nicht daran zu denken, dass das Handy weg war. Dachte daran. Versuchte, nicht an den toten alten Somali zu denken …
Und dann dämmerte mir, dass Florence weg war.
Auf dem Fußboden fand ich, beschwert mit meinen Wanderschuhen, einen Zettel.
Mach’s gut, Mathis.
Mehr stand da nicht. Nicht »Wir sehen uns in Québec«. Nicht einmal »Pass auf dich auf«.
Dies war der Beginn meiner Reise.
»Reportage über die Reise einer somalischen Familie ins gelobte Land Amerika«, flüsterte ich dem Deckenventilator zu. »Der Exodus Afrikas oder die Entstehung einer neuen Weltenordnung. Bild und Text: Mathis Martin.«
Großartige Worte in meinem Mund. Aber die Unterlippe war noch immer taub von dem Fausthieb.
Somalia entstand aus den Staatsgebieten von Britisch- und Italienisch-Somaliland und wurde 1960 unabhängig.
Die somalische Gesellschaft besteht aus den großen Clans Darod, Dir, Isaaq, Hawiye – die als Nomaden lebten – sowie den sesshaften Rahanweyn, die von den übrigen Clans als minderwertig betrachtet werden. Unterclans Hawiye: Karanle/Abgaal/Habar Gidir, A. und H. kämpfen in Mogadischu um die Macht
Seit dem Sturz von Diktator Siad Barré 1991 existiert in Somalia keine Regierung mehr. Die siegreichen Rebellen der Hawiye konnten sich auf keine Nachfolge einigen und der Fall des Regimes in der Hauptstadt Mogadischu führte zu Morden und Plünderungen an Mitgliedern anderer Clans. Rivalisierende Warlords kämpfen seitdem um das ganze Land.
Seit 2000 gibt es eine international unterstützte Regierung in Mogadischu, die jedoch zeitweise kaum die eigene Stadt halten konnte. Mitte 2006 eroberte die Union Islamischer Gerichte Mogadischu und führte eine Ordnung nach der muslimischen Scharia ein, wurde jedoch von eingreifenden äthiopischen Truppen wieder vertrieben.
Piraterie!
Der militante Arm der Union, »al-Shabaab« (»Die Jugend«), kämpft noch immer in Somalia und ist größtenteils um Mogadischu herum aktiv.
Somaliland und Puntland im Norden sind praktisch autonom, ihre Regierungen international aber nicht anerkannt.
Nach der Rückkehr einer fragilen Normalität in der Hauptstadt wurden bei einem Bombenanschlag im Herbst 2017 über 500 Menschen durch al-Shabaab getötet.
Dürren und Hungerkrisen sorgen immer wieder für einen Zustrom verarmter Viehhirten in die Städte und tragen zur Unruhe bei.
Heute leben geschätzt 1010000 Somalis außerhalb ihres Landes. 300000 davon leben auf dem afrikanischen Kontinent, 250000 in Nordamerika und etwa gleich viele in Europa.
Trotz fehlender Regierung tritt im Land teilweise wieder ein Zustand des Gleichgewichts ein, Geflohene kehren zurück und eröffnen Geschäfte oder sogar Restaurants. Seit 2015 gibt es in Mogadischu wieder eine Buchmesse.
Ende 2016 waren insgesamt ca. 65,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Viele von ihnen fliehen vor Krieg und Verfolgung, die meisten jedoch vor den Folgen des Klimawandels, der wiederum die politische Stabilität beeinflusst und Kriege nach sich zieht.
Traumländer für ein besseres Leben sind die USA, Kanada und Europa.
Nachdem Europa seine Grenzen zunehmend schließt, fliehen immer mehr Menschen auch aus weit entfernten Ländern über die alternative Route der Panamericana nach Norden.
Der Druck der Flüchtlingsmasse auf den Nordwesten Amerikas nimmt zu. Mauern werden irgendwann nicht mehr helfen, die Menschen zurückzuhalten. Es ist der Anfang einer Völkerwanderung von Menschen, zu viele, um sie wegzudiskutieren.
INTOTHEGREEN
»Was ich gar nicht mag, ist der Geruch in den Städten. Es stinkt nach Maschinen und Autos. Bei uns im Wald riecht es nach Blumen.«
Davi Kopenawa Yanomami[1]
1
o homem
der Mensch
Bildersuche Internet:
Regenwald von oben
Sojaplantagen Brasilien
Theater Manaus
Slum Manaus
Amazonas Boot
Ich werde nie vergessen.
Ich werde nie vergessen, wie ich in diesem Büro saß, im dritten Stock eines Vororts von Johannesburg. Papiere stapelten sich auf dem Schreibtisch, der Kommode, dem Fensterbrett, den Stühlen.
»Setzen Sie sich«, sagte der Mann hinter dem Schreibtisch. Er hatte eine kleine Sammlung von Smartphones vor sich liegen und war damit beschäftigt, bei einem von ihnen ein Teil mit einem Brillenschraubenzieher auszuwechseln.
Ich nahm einen Papierstapel von einem Stuhl und setzte mich.
»Ich brauche Papiere«, sagte ich, was sehr dumm klang, da ich ja einen ganzen Stapel Papiere in der Hand hielt. Ich legte ihn auf den Boden. »Ich … brauche Papiere für einen elfjährigen Jungen aus Somalia, der mit mir nach Brasilien reisen wird. Jemand hat mir gesagt, Sie könnten …«
Und wenn er die Polizei rief?
Als Tadalesh mir die Adresse genannt hatte, war ich davon ausgegangen, einen dunklen, zwielichtigen Schuppen in einem Hinterhof zu finden, nicht dieses helle Büro. Vielleicht streute jemand absichtlich Falschinformationen.
Der Mann hinter dem Schreibtisch, ein ordentlich gekleideter, untersetzter Mann mit fast kahl geschorenem Schädel, legte den Schraubenzieher hin und musterte mich eine Weile. In seinen Augen standen die Worte: männlich, weiß, Geld, jung, zerzaust.
»Brasilien«, sagte er schließlich. »Ein Junge.«
»Ja. Seine Familie wartet dort, sie wollen in die Staaten, sie sind geflohen, und ich …«
Er wischte meine Erklärung mit einer Handbewegung weg. »Adoption?«, fragte er knapp.
»Wie?«
Er seufzte. »Holen Sie das Kind für jemanden in Amerika ab, der ein Kind adoptieren will?«
Ich schüttelte verblüfft den Kopf.
»Es geht mich nichts an«, sagte er. »Aber eins sag ich Ihnen: Wenn ein einziger Somali gegen die Adoption dieses Jungen ist, haben Sie den ganzen Clan am Hals. Und Somalis sind überall. Es wird immer jemand vom Clan in der Nähe sein. Ich weiß nicht, ob das Risiko den Preis wert ist, den die Adoptiveltern Ihnen zahlen. Name?«
Ich merkte, wie ich lächelte. »Das heißt, Sie stellen die Papiere aus?«
»Selbstverständlich«, sagte er steif. »Pass und Visum. Es kostet natürlich. Geld regiert die Welt.« Es klang traurig. Er holte einen kleinen Taschenrechner aus einer Schublade, tippte und schob ihn mir über das Chaos auf dem Schreibtisch hin. 2125, sagte das Display.
»Das ist … eine Jahreszahl?«
»Das ist der Preis in Dollar. Mit Bearbeitungsgebühr und Papierkosten.«
Beinahe hätte ich gelacht.
Ich hatte ein Budget für das Projekt, ich hatte Geld, mühsam verdient in einem Nebenjob in einer Keksfabrik in den letzten Schulferien meines Lebens. Ich sah noch vor mir, wie meine Mutter den Kopf geschüttelt hatte, wenn ich nach der Schule hingefahren war. Meine Mutter in ihrem leisen Kleid aus Besorgnis, mit den hübschen Fältchen um die Augen, meine Mutter, die Mathematikerin, die alles ständig berechnete, Atemzüge, Herzschläge, das Volumen von Schneeflocken, die wir zusammen am Fenster beobachtet hatten, als ich klein gewesen war. Sie hatte mir gesagt, wie viele Stunden, wie viele Minuten, wie viele Sekunden sie damit zugebracht hatte, mich in die Welt zu bringen und großzuziehen – ich hatte die abnorm hohe Zahl wieder vergessen –, und wie wenig Zeit ich benötigen würde, um dieses Leben auf einer so irrsinnigen Reise zu zerstören.
Wenn sie gewusst hätte, dass ich jetzt hier saß, vor einer feindlichen Zahl, bei deren Überwindung sie mir nicht helfen konnte!
Wenn ich mein ganzes Budget zu Anfang ausgab, blieb zu wenig für die Weiterreise.
Aber dann war es, als fühlte ich wieder die kleine, magere Kinderhand in meiner. Und hörte wieder die ernsthafte, kleine Stimme.
»Okay. Tausend«, sagte ich. Der Mann lachte.
»Wir sind hier nicht auf dem Basar. Und ich brauche ein Bild des Jungen und seinen vollen Namen, wir lassen den ersten Namen weg, falls die Person unter diesem Namen als vermisst gemeldet ist. Sie erhalten von uns Visum, Flugticket und ein Schreiben der Eltern des Jungen, das Sie bevollmächtigt, mit ihm zu fliegen.« Er seufzte, ein wenig wie mein alter Spanischlehrer, der mich im Kurs immer lange angesehen und dann auf diese Weise geseufzt hatte, wenn ich wieder träumte und nicht zuhörte.
»Express wären noch mal fünfzig Dollar. Dann fliegen Sie schon diese Woche. Ohne Express dauert es durchschnittlich zwei Monate.«
Ich kniff die Augen zusammen und wünschte meinem Gegenüber die Pest an den Hals.
»Express«, knurrte ich und schob ihm den Zettel hin, den Tadalesh mir gegeben hatte, einen kleinen, schmierigen Zettel mit einem Namen, lang wie ein Roman. Und ein Bild, das ich mit meiner Kamera gemacht hatte, ausgedruckt am Farbdrucker eines Copyshops: das erste Bild, das ich von ihm hatte, das allererste.
Er sah ernst in die Kamera, die aufgesprungene Lippe war deutlich zu erkennen, und um seinen Hals lag eine zerfaserte Schnur mit einem Anhänger, der verborgen unter dem zu großen, verwaschenen gelben T-Shirt hing. Man sah seine Ohren nicht, das verfilzte Haar war zu lang. Der Mann nahm das Bild nur und nickte.
»Morgen bringen Sie mir das Geld vorbei. Sie bekommen eine Bescheinigung. Ihr Handy.«
Er streckte die Hand aus.
»Wozu brauchen Sie mein Handy?«
»Um die Bilder zu löschen, die Sie hier gemacht haben«, sagte er.
»Ich habe keine Bilder gemacht!«
Der Mann wartete mit ausgestreckter Hand und ich seufzte, entsperrte das Telefon und händigte es ihm aus. Er hatte die Macht, ich hatte nichts.
Das Handy war neu. Die einzigen Bilder darauf waren die von diesem Gebäude: der Treppe, der Tür des Büros. Der Mann löschte sie. Dann gab er mir das Telefon zurück und ließ mich gehen.
So viel zu meiner Reportage.
Tadalesh saß draußen vor dem Gebäude auf dem Bürgersteig, das gelbe T-Shirt leuchtete mir entgegen wie ein Stückchen Sonne. Er umfasste mit einer Hand den Anhänger, den er an der Schnur trug, doch als er mich sah, ließ er ihn zurück unters T-Shirt gleiten und sprang auf.
»Wie zum Teufel kommst du hierher?«, fragte ich. »Ich weiß, dass ich allein mit dem Taxi hergekommen bin. Und es ist weit.«
Er zuckte die Schultern und sah auf seine Füße. Sie waren nackt, und als er einen Fuß hob, sah ich Zehen voller Schwielen und Blasen, die Sohle mit einer dicken Schicht Hornhaut versehen. Dies waren nicht die Füße eines Kindes, es waren die Füße eines Wanderers durch Welten.
»Wir haben die Papiere«, sagte ich. »Fast.«
Er strahlte.
Glückskind.
Ich war mir sicher, dass ich überfallen werden würde, wenn ich mit zweitausend Dollar in der Tasche noch einmal in diese Gegend fuhr. Ich steckte das Geld in meine Socken, obwohl es zu warm für Socken war. Hier wurde ein Spiel gespielt, das ich erst lernte.
Aber niemand überfiel mich, nicht einmal der Taxifahrer.
Während wir auf die Papiere warteten, machte ich eine Woche lang Fotos von Wolkenkratzern, Slums und südafrikanischen Bierflaschen, auf denen Dinge wie CITYPOISON stand. Nette, harmlose Bilder.
Und dann saßen wir in einem Taxi zum Flughafen O.R. Tambo raus, das Glückskind und die Kamera und ich. Die Kamera in ihrer großen schwarzen Tasche lag zwischen uns auf dem Rücksitz. Tadalesh legte eine Hand darauf, vorsichtig, als wäre die Kamera ein lebendiges Wesen, verletzlich und bissig zugleich.
»Und du willst einen Roman über alles schreiben«, sagte er.
»Keinen Roman. Eine Reportage. Ich schreibe es so auf, wie es passiert. Ich möchte deine Geschichte aufschreiben und die der Menschen, die wir treffen, auf dem Weg nach Norden.«
Er schüttelte den Kopf. »Aber die Leute erzählen ihre Geschichten nicht so, wie sie passiert sind.«
»Nein?«
»Leute, die fliehen, nicht«, sagte er. »Wenn sie sie so erzählen würden, wie sie passiert sind, würde niemand sie glauben. Schreib doch einen Roman, das ist besser, dann kannst du alles so machen, wie du es willst. Er hat gesagt, Bücher sind keine Lügen, sie geben der Wahrheit nur Beine, damit sie zu den Menschen kommen kann.« Er seufzte. »Ich habe immer am liebsten zwischen den Büchern geschlafen. Die Regale waren wahnsinnig hoch, er hat auch gesagt, man kann darauf in den Himmel klettern.« Tadalesh sprach jetzt sehr leise.
»Wer ist er?«
Tadalesh legte den Finger auf die Lippen und sah zu dem Taxifahrer hin. »Er ist nicht mehr da«, flüsterte er.
»Warum glaubst du, dass sich ein südafrikanischer Taxifahrer dafür interessiert, ob es in eurem Haus Bücher gab?«, fragte ich und lachte.
»Er ist Somali«, wisperte Tadalesh.
»Woher weißt du das?«
»Das sieht man doch«, sagte Tadalesh. Aber ich sah nichts, ich war blind, ein blinder Kanadier mit einem Kameraauge. »Vielleicht ist das überhaupt kein Zufall«, flüsterte Tadalesh. »Vielleicht wissen sie genau, wo ich bin.«
»Sie?«, fragte ich. »Wer sind sie?«
Aber er antwortete nicht.
Die Passkontrolle war nervenzerreißend.
Ich war mir sicher, dass sie uns rausziehen würden.
Was haben Sie denn mit diesem Kind vor? Der Brief der Eltern ist gefälscht, genau wie das Visum, das sieht doch jeder.
Mit jedem Vorrücken der Schlange fühlte ich, wie das Adrenalin durch meine Adern schoss. Tadalesh, vor mir, war ruhig. Äußerlich.
Treten Sie bitte aus der Schlange und folgen Sie mir. Unser Computer erkennt die ID auf diesem Papier nicht.
Ich sah mich um und fragte mich, ob noch jemand in dieser Schlange ein gefälschtes Visum hatte. Die Leute sahen alle ziemlich normal aus. Tadalesh sah auch ziemlich normal aus. Ich hatte ihm Turnschuhe und neue Shorts besorgt, das gelbe T-Shirt hatte er nicht wechseln wollen. Und seine Haare waren ein bisschen zu lang und zu verfilzt.
Jetzt waren wir an der Reihe. Die übergewichtige Frau mit den geglätteten Haaren nahm unsere Pässe. Sah das Glückskind an. Sah mich an. Und winkte uns durch.
Und die Kamera ging durch die Sicherheitskontrolle und war keine Waffe.
Ich atmete auf.
»Hey!«, sagte ich im Bus, der über das Rollfeld fuhr, und legte eine Hand auf die schmale Schulter vor mir. »Alles klar?«
»Alles klar«, sagte Tadalesh.
Ich sah uns im Spiegelbild der Scheibe: den großen, breitschultrigen Typen mit der tarnfarbenen, schnell trocknenden Travellerkleidung und der Kamera, mit dem verstrubbelten Haar und dem leichten Bartanflug – und das schmächtige Kind neben ihm, in seinem Sonnen-T-Shirt. Ohne Gepäck. Ich dachte an Florence.
Ich hatte ihr ein Bild geschickt, von Tadalesh und mir.
Sie hatte nicht geantwortet.
Als das Flugzeug startete, schloss Tadalesh die Augen. Ich stieß ihn an und hielt ihm einen Kaugummi hin. »Kauen und schlucken! Für den Druckausgleich.«
Er gehorchte und öffnete die Augen wieder. Und diesmal wurden sie groß und rund, als sie aus dem Fenster sahen.
»Schau dir das an!«, flüsterte er. »Die Wolken! Da unten! Wir sind über den Wolken! Und jetzt sieht man das Land da durch … Es ist wie auf dem Bildschirm … es ist wie im Internet.«
»Google Earth«, sagte ich.
»Fliegen ist schön. Aber er hat gesagt, es ist nicht gut für die Erde.«
»Nein«, sagte ich. »Nicht wirklich. Die CO2-Emissionen. Und Flugzeuge produzieren Kondensstreifen und Zirruswolken, die zur Erderwärmung beitragen.«
Er sah mich nachdenklich an, und ich seufzte, weil er natürlich kein Wort verstand.
»Ich bin ein mieser Babysitter und ein mieser Lehrer«, sagte ich. »Dein Vater kann dir erklären, was die Erderwärmung ist. Oder deine Mutter.«
»Können sie nicht«, sagte er.
»Aber sie warten doch? In Manaus?«
»Das sind andere Verwandte«, sagte er vage. Und dann: »Ich weiß, was CO2 ist. Ich hab was darüber gelesen, in einem Buch, aber es war für Erwachsene, und ich habe nicht so viel verstanden. Was ist mit den Leuten hier, die fliegen? Lesen die nicht?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich denke, die wissen Bescheid. Aber es interessiert sie nicht. Und wir fliegen ja auch. Auf einem Schiff hätte es ewig gedauert. Man kann nicht immer die richtigen Dinge tun.«
»Warum nicht?«, fragte er.
Ich wich seinem Blick aus. »Guck dir diese Wolken an«, sagte ich. »Wie das Licht sich darin fängt.« Und ich hob die Kamera und versuchte, die Wolken und das Licht festzuhalten. Als ich nach einer Weile wieder zu Tadalesh hinübersah, hatte er die Augen geschlossen und lag halb auf seinem Sitz, eingerollt wie ein Embryo, und war eingeschlafen, den Kopf auf einem Arm.
Das war der Moment, in dem ich das Ohr sah.
Bisher hatte das etwas zu lange, staubverklebte Haar immer seine Ohren verdeckt, ich glaube, er achtete darauf. Aber jetzt war das Haar zur Seite gerutscht.
Darunter sah man auf der rechten Seite etwas Dunkles. Eine Öffnung. Ich begriff erst nach einem Moment. Was ich da sah, war der Gehörgang. Wo die Ohrmuschel hätte sein sollen, befand sich ein mondsichelförmiger Wulst, ein Rest, eine Narbe. Tadalesh hatte rechts keine Ohrmuschel.
Er zuckte leicht. Er träumte.
Vielleicht von einer Welt, in der man immer das Richtige tun konnte. Wie niemals zu fliegen.
Vielleicht von Geschichten, die nicht erzählt werden konnten, oder nicht so, wie sie passiert waren.
Ich hätte seine Träume gerne fotografiert. Aber ich hatte auch Angst vor ihnen.
Brasilien von oben ist grün.
Unglaublich grün. Ich wusste, dass dieses Grün dabei war, zu verschwinden, aber von hier oben waren die Narben darin kaum sichtbar, die Städte an der Küste glichen silbern glitzernden Streifen. »Schau es dir an«, sagte ich. »Wie grün es ist.«
Tadalesh schüttelte sich und sah aus dem Fenster.
»Aber es hat Löcher«, sagte er.
Er hatte recht, wir waren jetzt weiter unten, und man sah sie, die Löcher: hellgrüne Flecken im Dunkelgrün des Regenwaldes. Sojaplantagen. Ich hing mit der Kamera am Fenster und fotografierte.
»Das … das ist schon verrückt, oder?«, murmelte ich. »Je weiter du weggehst, desto gesünder sieht sie aus, die alte Erde.«
»Ist sie denn sehr krank?«, fragte er, ehrlich besorgt.
Ich schloss kurz die Augen. Ich hätte aus dem Stegreif einen Kurzvortrag über den Klimawandel halten können, über die Zerstörung des Primärwaldes, den CO2-Haushalt der Plantagen, die Veränderung des Regenkreislaufs, die Tilgung der Artenvielfalt … Ich hatte das alles gelesen.
Neben mir saß ein elfjähriger Junge. Ich räusperte mich.
»Wir zerstören die Erde«, sagte ich. »Nicht nur mit Flugzeugen.«
»Erklär es mir«, bat er.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht gut im Erklären, nicht für Kinder. Es ist der Kernpunkt meiner Reportage: Flucht und Klimawandel, geografische, soziale und politische Auswirkungen der Erderwärmung. Aber du musst es nicht verstehen.«
»Warum nicht?«, fragte er.
»Wir landen gleich«, sagte ich. »Schnall dich an, okay?«
In São Paulo warteten wir ewig in der Schlange vor der Passkontrolle. Mein Herz schlug wieder zu schnell. Ich vergaß sämtliche Probleme des Regenwaldes.
Ich hatte nur ein Problem: die brasilianische Polizei.
»Tourist?«, fragte der Typ in seinem Kontrollhäuschen. »Anschlussflug nach Manaus? Was machen Sie da?«
»Wir … haben eine Woche in einer … Dschungel-Lodge gebucht. Die Natur ansehen, so was.« Ich spürte, wie er den kleinen Jungen an meiner Seite ansah. »Wir treffen seinen Onkel da.«
Unsinn. Niemand kommt aus Somalia nach Brasilien, um in einer Dschungel-Lodge zu übernachten. Der Mann sah die Kamera an. Tadalesh interessierte ihn nicht, ihn interessierte, ob ich die Löcher im Regenwald ablichten würde.
»Wozu die Kamera? So eine große Kamera?«
»Na, um die Tiere zu fotografieren. Ein Hobby von mir. Die Tierwelt hier in Brasilien ist unglaublich …«
»Journalist?«
»Ich? Nein. Ich bin neunzehn.« Als wäre das ein Beruf.
»Hm«, sagte er und nickte. »Dann gute Reise.«
Die Art, mit der er es sagte, hatte etwas Fatales, es klang, als wäre es eine Reise, von der ich nicht zurückkommen würde. So, wie man den Toten eine gute letzte Reise wünscht.
Wie findet man eine somalische Familie in einer brasilianischen Großstadt?
Florence hätte gesagt: Gar nicht. Aber das hatte sie auch über Tadalesh gesagt, das Glückskind, und hier stand ich, auf dem Theaterplatz von Manaus, der Metropole mitten im Regenwald, neben eben jenem Kind.
»Es ist ganz einfach«, sagte das Kind. »Sie haben gesagt, wir treffen uns hier, beim Theater. Hier ist die Mitte.«
Ich sah mich um. Der Platz war quadratisch, gepflastert, von Bäumen umrandet – überraschend aufgeräumt. An einer Seite ragte das Theater auf, dessen goldene Kuppel über die Stadt strahlte wie eine Sonne.
Der Rest von Manaus war schäbiger, verbrauchter, die Stadt war einmal schön gewesen, bestimmt. Jetzt, zu schnell gewachsen, glich sie einer vorgealterten Hure, oder jedenfalls hätte das einer der südamerikanischen Schriftsteller gesagt, die ich gelesen hatte. Die Ufer des Rio Negro in ihrer Mitte waren wie schlaffe, ausgetrocknete Brüste, ihre kolonialen Kleider schäbig geworden, was sie mit mehr bunten Farben zu übertünchen versuchte: rosa, lila, gelbe, leuchtend blaue Häuser strahlten zwischen leer stehenden Villen, durch deren Fenster Ranken wuchsen. Der Regenwald holte sich zurück, was ihm gehörte. Damals hatten die Kautschukbarone ihm das Land abgetrotzt, schnell reich geworden durch das schwarze Gold aus den Bäumen.
Ich hatte etwas darüber gelesen. Sie hatten eine Menge Indios versklavt für ihren Kautschuk, und während sie hier das Theater besuchten, waren draußen auf ihren Fazendas die Indios gestorben wie die Fliegen. So viele Geschichten, die nicht erzählt werden würden. Und natürlich durfte man nicht Indios sagen, natürlich musste man politisch korrekte Umständlichkeiten benutzen, aber es nützte ihnen gar nichts, dachte ich, dass man sie mit korrekten Namen ansprach, man sah immer noch auf sie herab.
Und eigentlich hatte sich nichts geändert im Vergleich zu damals: Heute hatte Manaus ein neues Fußballstadion, nur für eine Weltmeisterschaft erbaut, während Millionen Brasilianer hungerten.
Und hier saßen die Touristen in den Restaurants rings um den Theaterplatz, fotografierten die weißen Säulen und tranken Cocktails.
Tadalesh hatte sich auf eine steinerne Bank gesetzt und ließ seinen Blick über den Platz schweifen und ich setzte mich neben ihn. Meine Beine waren schwer vor Müdigkeit.
Der Abend dämmerte bereits heran und wir waren seit dem frühen Morgen unterwegs.
»Lass uns noch mal um den Platz gehen. Sie haben gesagt, sie sind hier. Sie müssen hier sein.«
Ich nickte, und wir gingen, ich weiß nicht, zum wievielten Mal, um das Karree, an den Restaurants vorbei, an einer Imbissbude, einem hungrigen Straßengeiger und einem Luftballons verkaufenden Clown.
Zwischen den Restaurantstühlen lief eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm auf und ab: eine hübsche, hochschwangere, tödlich magere junge Frau mit europäischen Gesichtszügen und hellem Haar, und bettelte die Essenden an.
Noch mehr nicht erzählte Geschichten.
Schließlich waren wir wieder bei der Bank, ich ließ mich fallen wie ein alter Mann, und Tadalesh sagte: »Sie sind nicht hier, aber sie waren vielleicht hier. Ich frag die mal. Bleib du hier.«
Ich sah ihn auf die junge Frau mit dem Baby zugehen, eine Weile mit ihr sprechen, sah sie lächeln.
Und dann kam er zurück und sagte: »Die da, die hat sie gekannt! Sie waren hier, sagt sie, oft. Sie haben auf mich gewartet. Aber sie haben aufgegeben.« Er legte die Arme um den dünnen Körper, wippte auf und ab, plötzlich frierend, der Abend wurde kühl. »Sie sind los. Ohne mich. Den Fluss rauf. Sie sind wahrscheinlich in einem Ort namens … warte … São Gabriel … da … Irgendwas.«
»Was wollen sie da?«
»Das ist die gerade Strecke nach Kolumbien«, sagte Tadalesh mit einem Achselzucken.
»Ich glaube nicht, dass man die gerade Strecke gehen kann«, sagte ich. »Menschen sind keine Vögel.«
»Die Flüsse entlang«, meinte er. »Ich hab es mir angeguckt. Im Atlas. Es geht.«
»Nicht alles, was im Atlas zu sehen ist, geht in der Realität.« Ich fluchte innerlich, aber ich verfluchte auch mich selbst. Ich hätte es mir denken können, warum sonst hatte seine Familie in Manaus gewartet und nicht unten in Rio?
»Okay, hör zu«, sagte ich. »Die Fluchtroute geht über die Panamericana, die Straße an der Westküste des Kontinents. Rüber nach Peru und dann rauf nach Norden. Da fahren die Überlandbusse, in denen die Flüchtlinge sind.«
»Und da rechnet jeder mit ihnen«, sagte Tadalesh und grinste. »Kapierst du nicht? Die werden dauernd überfallen und an jeder Grenze will jemand Geld. Ich kenne die Geschichten. Ist es nicht klüger, einen Weg zu nehmen, den keiner nimmt?«
Ich schüttelte den Kopf. »Durch den Dschungel? Ohne Straßen?«
»Heute kommen wir sowieso nirgends mehr hin«, sagte er. »São Gabriel. Es fahren Schiffe dahin. Wenn du deine Story haben willst …«
Und dann, nach einem Abendessen an der Straße, lag ich im Bett des Hostel Manaus, einer niedlichen kleinen Eco Lodge, deren Wände bedeckt waren mit liebevoll geschnitzten Reliefs vom Regenwald: Papagei auf Palme. Faultier und hübsches braunes Waldmädchen bei Mondschein. Brüllaffe mit Orchidee. Alles schreiend bunt bemalt.
In einer Ecke des Innenhofs, wo ein großer Mangobaum seine Blätter verstreute, gab es ein kleines Büro, das Amazonas-Dschungeltouren organisierte: Schwimmen mit den rosa Delfinen! Besichtigung der Encontro das águas, wo sich der schwarze Rio Negro und der weiße Rio Solimões treffen! Klettern auf Baumriesen!
Wir waren mitten im Regenwald, mitten im Herzen der Erde. Ein komisches Gefühl.
Ich lag auf meinem Bett in dem winzigen stickigen Raum und fand keinen Schlaf. Durchs Moskitogitter am Fenster sah der Mond herein und auf dem zweiten Bett lag ein schlafendes Kind. Müde, zerzaust, vielleicht seit Längerem mal wieder satt.
Ein Kind mit Weltenwandererhornhaut unter den Füßen, das sehr weit gekommen war und noch weiter wollte.
Den Amazonas hoch nach Kolumbien.
Ich hatte noch mal im Netz nachgesehen, auf dem Handy. Da war nichts. Nur Urwald.
Der Weg, den ich hatte gehen wollen, war gefährlich genug. Aber das?
»Sei mir nicht böse«, flüsterte ich und wusste, dass Tadalesh es nicht hörte. »Aber du musst deine Familie ohne mich finden. Ich fahre zurück nach Rio, ich suche mir jemanden, der den richtigen Weg geht. Du musst jemand anderen finden, der sich um dich kümmert. Ich bin kein Kümmerer.«
Und ich drehte mich zur Wand und schloss die Augen. Morgen zurück nach Süden, Richtung Rio.
Ich wachte auf und es war immer noch Nacht. Und es war immer noch zu warm. Vielleicht, dachte ich noch im Halbschlaf, gehe ich hinaus und setze mich in diesen Innenhof, er ist schön und ich hole den Laptop raus und schreibe an Florence oder endlich an meine Eltern.
Irgendwo im Flur draußen brannte eine kahle weiße Birne, die ganze Nacht lang, so viel zur energiesparenden Eco Lodge. Ihr Licht fiel auf ein leeres Bett.
Ein leeres Bett? Ich war mit einem Schlag ganz wach.
Da war kein Kind mehr.
Ich trat ans Fenster – und da sah ich ihn. Er stand unten im Innenhof, unter dem Mangobaum, und sah in die Äste empor, als säße dort jemand. Aber es war niemand zu sehen. Nur die hellen Früchte hingen zwischen den dunklen Blättern des Mangobaums.
»Ich wünschte, du könntest hier sein«, sagte Tadalesh.
»Aber ich bin doch hier.« Die Stimme ähnelte seiner, war nur ein wenig höher. Sanfter.
»Ich meine, tagsüber«, sagte Tadalesh. »Wir könnten alles zu zweit machen. Mathis … ich glaube, er geht. Ich muss alleine weiter. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe.«
»Hope«, sagte die andere Stimme, »weißt du noch, was er zu dir gesagt hat? Über das Weggehen?«
»Ja …« Zögernd: »Er hat gesagt: Hope, versprich mir, dass du gehst, wenn mir etwas passiert. Wenn sie mich umbringen, wenn der Traum stirbt, den wir geträumt haben … dann musst du in die Staaten gehen. Und bis du da bist, darfst du niemandem sagen, wer du bist. Wenn sie meinen Tod wollen, wollen sie auch deinen Tod.«
»Ja. Es ist deine Bestimmung, diesen Weg zu gehen, Hope«, sagte die andere Stimme, mit einer seltsam unpassenden Feierlichkeit, denn es war eine Kinderstimme. »Allah hat es bestimmt. Er bestimmt alles vorher. Sagen sie doch, oder?«
»Ich kann Allah manchmal gar nicht leiden«, sagte Tadalesh.
»Sag so was nicht! Dann kommst du in die Hölle!«
»Da war ich doch schon«, sagte er. »Und du auch.«
Eine Weile war es still, dann sagte Hope: »Außerdem, weißt du, dann war immer alles Sünde. Die Bücher. Und das mit den Geheimnamen. Ich meine, Namen aus Amerika!«
Die sanfte Stimme lachte. »Das war nur ein Spiel. Weißt du noch, wie wir das gelesen haben, im Computer? Die häufigsten Namen für Zwillinge: Hope und Faith! Es war lustig. Als ob wir Amerikaner werden, wenn wir uns so nennen.«
»Faith, meine amerikanische Zwillingsschwester«, sagte der Junge unter dem Mangobaum, der jetzt zwei Namen besaß.
»Hope«, sagte Faith. Und dann: »Hab keine Angst. Wenn sie hinter dir her sind, wenn sie dich kriegen … hab keine Angst. Er hat gesagt, dass Allah uns … na, dass er uns zu sich holt, wenn er es für richtig hält.«
»Allah scheint Somalis zu mögen, was? Er umgibt sich mit ihnen, in seinem Paradies«, sagte Tadalesh.
Dann drehte er sich um, und ich machte, dass ich die Treppe hinaufkam.
Als er den Raum wieder betrat, stellte ich mich schlafend. Ich wusste, dass das dumm war, ich hätte ihn zur Rede stellen sollen, aber ich war zu verwirrt.
Nach einer Weile hörte ich seine gleichmäßigen Atemzüge und ich öffnete die Augen und sah zu dem schmächtigen Körper auf dem anderen Bett hinüber. Er umklammerte mit einer Hand den Anhänger an seinem Hals.
Da draußen war jemand unterwegs, der ihn lieber tot sehen würde.
Er war elf Jahre alt und weit fort von zu Hause und ganz allein.
Draußen im Baum, zwischen den Blättern und Früchten der Mango, saß niemand.
Würden sich andere Menschen aus seinem Clan um ihn kümmern? Ihn zu seiner Familie bringen, den Fluss hinauf? Um ehrlich zu sein: Manaus sah nicht aus, als wimmle es vor Somalis.
Morgen nach Westen. Richtung São Gabriel da Cachoeira.
Acht Uhr morgens in Manaus: wackelige, plastikbespannte Tische auf einer Dachterrasse, noch leer.
Auf dem großen Tisch in der Mitte das Frühstück: pinke Wassermelonenscheiben, orangefarbene Papayastücke, gelbe Ananasräder. Der Kaffee in der Thermoskanne war ungenießbar, aber ich genoss ihn trotzdem.
Auf dem fliederblättrigen Mimosenbaum neben der Dachterrasse saß ein Pärchen leuchtend grüner Papageien. Hinter den Dächern der Stadt begann irgendwo eine wahrere, ursprünglichere Welt: der Amazonas.
Auf der Plastikflasche mit importiertem Honig aus den Staaten war ein kleiner blauer Schmetterling gelandet.
Der Laptop lag aufgeklappt neben meiner Tasse, auf dem Bildschirm war das Gewirr der Flüsse im Amazonasgebiet zu sehen. Ich notierte, schrieb ab, verglich. Zwischendurch Pflicht-E-Mails:
Macht euch keine Sorgen. Liebe Grüße aus Brasilien, Mathis.
Tatsächlich fuhren an diesem Tag, wenn der Plan stimmte, sogar zwei Schiffe los in Richtung São Gabriel da Cachoeira: ein langsames und ein schnelles, teures Schiff. Man brauchte Hängematten für die Nächte; die Fahrt dauerte drei Tage.
Endlich geht es los, schrieb ich, und meine erste Station ist eine Hängematte auf einem Regenwalddampfer.
Ich hatte keine Angst. Damals, auf der Dachterrasse in Manaus, zwischen grünen Papageien und Papaya auf meinem Teller, war ich zu naiv, um Angst zu haben.
Die nächste Person, die auftauchte, war eine bildhübsche Spanierin mit winzigen Sommersprossen über den Wangenknochen, die haufenweise Melone in sich hineinschaufelte und sagte, der weiße Saft wäre furchtbar, irgendein Fruchtzeug ohne Zucker, sie hätte das versehentlich gestern in ihren Kaffee gegossen, weil sie es für Milch gehalten hatte.
»Was machst du hier?«, fragte sie und nahm noch mehr Melone.
»Eine Reportage.«
»Oh«, sagte sie. »Ich war an der Küste, im Osten. Straßenkinderprojekt. Jetzt habe ich noch ein paar Tage hier. Urlaub. Manaus ist toll, ich muss unbedingt die Delfine sehen. Wo ich war, ist alles nur trocken, da war mal Urwald, Mata Atlântica, jetzt ist es Kleinholz, ein Flickenteppich, wenn man drüberfliegt. Gibst du mir mal den Teller mit der Melone?«
Und sie erzählte von ihren Straßenkindern, von Prostitution, Drogen und Tischtennisclubs gegen Armut und aß noch mehr Melone und ich lauschte höflich. Und ich dachte: Wie schön sie ist. Und: Eigentlich interessiert sie mich kein bisschen. Als Frau. Wie komisch.
Schließlich kam ein kleiner, schmaler Mensch die Betontreppe herauf, blieb stehen und schien nicht zu wissen, ob er näher kommen sollte oder ob ich mit diesem wunderschönen Mädchen allein sein wollte. Ich winkte.
Er trat an den Tisch, und ich sagte: »Guten Morgen, Hope.« Er machte seine Augen schmal und sah mich an, misstrauisch. »Wir nehmen das Slow Boat«, sagte ich. »Zweiundsiebzig Stunden bis São Gabriel da Cachoeira. Wir brauchen Hängematten und Proviant.«
Da breitete sich langsam ein Lächeln über sein Gesicht aus.