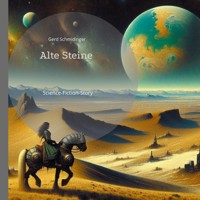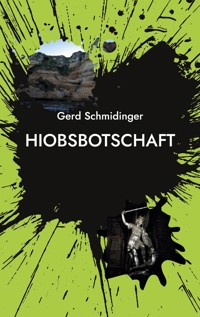Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mári, eine junge Frau von der Erde in ferner Zukunft, kämpft, unterstützt von ihrer großen Liebe Sara, gegen die übermächtige Priesterschaft und fordert sogar die strafenden Götter heraus. Lichtjahre von ihr entfernt, ringt Anatok auf dem Planeten Aa'nurk nicht nur mit seiner dunklen Vergangenheit. Er kämpft um fundamentale moralische Fragen im Umgang der Bewohner Aa'nurks mit anderen Zivilisationen - und letztlich um das Überleben der Menschheit. Österreichische Science Fiction für romantische Weltverbesserer mit einem Faible für außerirdische Geschichtsphilosophie, Berge, flauschige Nager, das Weltall und Liebe zwischen Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Mári
Anatok
Quelle des Ri
Die Nuz
Mensch ohne Furcht
Pa'nan
Epilog
Mári
An den Tag, an dem Mári zum Liebling der Götter wurde, konnte sie sich als erwachsene Frau nur mehr wie durch einen Schleier erinnern. Doch irgendwo, in den düstersten Winkeln dessen, was sie später ihr Leben nannte, war da der Schrei ihrer Mutter, verschwommen und unklar, aber von einer Eindringlichkeit, die mit den Jahren nicht nachließ. Auf gewisse Weise, so dachte sie, hatte dieser Schrei ihr ganzes Leben begleitet.
Dabei hatte sie ihn damals, als neunjähriges Mädchen, kaum wahrgenommen. Sie waren zum Opfer gegangen, wie jeden Sonntag. Ihr Vater, dessen langes blondes Haar im Wind wehte, in dem wollenen Mantel, den er im Winter trug, ihre Mutter in ihrem groben Kleid aus Leinen und den kleinen Jo auf dem Arm, und sie selbst hüpfend und singend in ihrem braunen Gewand aus Hirschleder, das sie im Winter besser wärmte als ihr dünnes Leinenkleid. Ihre Kleidung roch intensiv nach Rauch, wie häufig im Winter. Mári mochte das. Sie mochte auch, dass der ganze Ort zusammenkam, um das Opfer gemeinsam zu feiern. Kurz bevor sie den Opferplatz erreichten, trat Liv, die Bäckerin, eine stämmige Frau mit roten Backen, die immer ein freundliches Wort für sie übrig hatte, auf die enge, mit unregelmäßig großen Kalksteinen gepflasterte Straße. Kris, ihr ebenso kräftiger Mann, begleitete sie. Er war etwas wortkarg, aber Mári mochte ihn auch. Sara und Micha, zwei Kinder in ihrem Alter, mit denen sie häufig spielte, winkten ihr zu, als sie auf den Platz traten. Besonders mit Sara verstand sie sich oft ohne Worte, und ihre Gegenwart rief ein warmes Gefühl in ihr wach. Mári winkte zurück. Die Erwachsenen unterhielten sich leise untereinander, bis der Priester kam. Mári ging ein paar Schritte zur Seite und ließ ihren Blick schweifen. Graue Wolken verdeckten die hohen Berge, doch das Tiefland, das sich gen Norden hin erstreckte, flankiert von niedrigerer werdenden Bergrücken, wirkte merkwürdig klar und zum Greifen nahe. Fast schien es ihr, als könne sie die einzelnen sonnenverbrannten Büsche wahrnehmen, die die Ebene bedeckten. Mári liebte den Blick ins Tal. Sie wusste, und auf dieses Wissen war sie mächtig stolz, dass er deswegen so gut war, weil Elpele selbst auf einem Berg erbaut worden war. Und je höher man selbst stand, umso weiter konnte man ins Tal blicken. Ja, heute konnte sie sogar den großen See erahnen, der die Ebene im Norden begrenzte. Dort musste Pregatz liegen, die große Stadt, in der die Hohepriester lebten. So jedenfalls hatte es ihr ihre Patin Landa erklärt. In Gedanken bei ihrem neu erworbenen Wissen, hatte Mári gar nicht gemerkt, dass die Zeremonie schon begonnen hatte. Auf den großen Opferaltar im Zentrum von Elpele legten die Bewohner des Ortes ihre Gaben: eine Hand voll Weizen, ein paar Orangen, Eier oder was man sonst entbehren konnte. Aber da jeder Einzelne etwas opfern sollte, kam doch einiges zusammen. Schließlich sprach der Priester, der eine schwarze Robe mit dem Zeichen der Götter trug, weihevoll klingende Worte, von denen Mári nur die Hälfte verstand, während die Bauern Feuerholz um die Gaben herum aufschichteten. Der Priester, ein kräftiger dunkelhaariger Mann mit dichtem gepflegtem Bart, kantigem Kinn und dunkler Haut, setzte schließlich den unter dem Holz liegenden Zunder mit Hilfe einer Fackel in Brand, ein besonders feierlicher Moment, wie Mári wusste. Den durfte man keinesfalls verpassen, genau so wenig wie man vergessen durfte, sein Opfer auf den Stein zu legen. Mári hatte ein paar Früchte des Erdbeerbaumes in ihrer Hand, und die betrachtete sie gedankenverloren, während sie etwas abseits stand. Es waren runde, rot-orangene Früchte mit Noppen dran, etwas mehlig zwar aber nicht schlecht, und die Büsche wuchsen überall, deshalb genehmigte sie sich fast täglich ein paar davon. Máris Blick folgte einem kleinen Vogel mit roter Brust und schnellen Flügelschlägen. Sie sog tief die milde Winterluft ein. Rauch wehte vom qualmenden Opfertisch her. Rauch? Irgendetwas stimmte hier nicht. Wieso hatte sie immer noch die roten Früchte in der Hand? Wieso hatte sie sie nicht auf den Opfertisch gelegt? Wieso hatte sie niemand daran erinnert, ihr Opfer darzubringen? Das konnte nicht sein, das durfte nicht passieren. Hilfesuchend blickte sie um sich und fand das helle, von aschblonden Locken umspielte Gesicht ihrer Mutter. Ihre Blicke trafen sich. Der ihrer Mutter wanderte zu den Früchten in Máris Hand, und plötzlich loderte Angst in diesen Augen, abgrundtiefe Angst in diesen Augen, die doch beruhigen sollten. Und der offene zuckende Mund, wie eine endlos tiefe Höhle. Erst später musste Mári den Schrei wahrgenommen haben, der aus ihm drang.
Mári blickte an sich, an diesem kleinen neunjährigen Körper hinab. Etwa zehn Schritte gepflasterten Steins lagen zwischen ihr und den anderen Dorfbewohnern, die um den brennenden Gabenstoß herum standen, zehn Schritte, die plötzlich wirkten wie eine unüberwindliche Schlucht. Konnte das sein? Sollte so alles enden? Der Priester hatte die Zeremonie unterbrochen, doch das Feuer brannte weiter, und das Knistern klang entsetzlich laut. Und alle Augen auf sie gerichtet, still und ausdruckslos, als warteten sie auf etwas. Mama! Mári spürte, wie die roten Früchte durch ihre geöffneten Finger glitten. Dann fühlte sie nichts mehr.
Ich lebe! Das war der erste verwirrte Gedanke, als Mári auf dem kalten Steinboden liegend zu sich kam. Der zweite galt ihrer Mutter, denn diese rannte wie eine Verrückte vor und zurück, umarmte sie kurz, netzte sie dabei mit ihren Tränen, ließ sie wieder los, um den notwendigen Abstand wieder herzustellen, kam wieder her, umarmte sie abermals und schniefte dabei nass in ihre Halsbeuge. Als sie bemerkte, dass ihre Tochter sich rührte, brach sie in ein Schluchzen aus, in dem sich Schmerz und Erleichterung zu einer endlos wirkenden Kaskade vermengten. Mein Kind, mein Kind! Sie überschüttete das Mädchen mit tränenreichen Küssen. Mári stieß sie von sich fort. Wie konnte sich ihre Mutter nur so gehen lassen und sie beide derart gefährden! Beschämt blieb diese einige Schritte entfernt stehen und schluchzte: “Es tut mir leid, es tut mir so leid!" Mári zwang sich zu einem beruhigenden Lächeln. Es war ja nichts passiert. Die Götter hatten offenbar verstanden, dass es ihre Mutter nur aus Erleichterung so übertrieben hatte mit der Umarmung. Und ihre Erleichterung war verständlich. Nach allem, was sie wusste, hätte Mári tot sein müssen - aber die Götter hatten sie verschont! Sie konnte sich nicht erinnern, dass das schon einmal passiert war. Schließlich lernte man, sobald man sprechen konnte, dass die Strafe auf den Fuß folgte, wenn man die Gesetze der Götter missachtete. Und das erste Gesetz hieß nun mal: Du sollst den Tag der Götter heiligen.
Auch wenn das etwas schwammig formuliert war, jeder wusste genau, was das hieß: sobald ein Kind laufen konnte, musste es an jedem Sonntag sein Opfer darbringen, und zwar bevor der Priester den Opferstoß in Flammen setzte. Tat man das nicht, wurde man bestraft, so wie man bestraft wurde, wenn man eines der anderen göttlichen Gesetze missachtete. Denn die Götter sahen alles. Und sie kannten nur eine Strafe: den Tod.
Außer bei Mári. Da kam keine Strafe, gar keine. Die Götter ließen sie laufen. Mári konnte immer noch kaum glauben, dass sie davon gekommen war. Doch wie zuvor war es irgendwie auch nicht mehr. Der Abend mit ihren Eltern war sehr schön gewesen, ihre Mutter hatte sich wieder beruhigt, ihr aber die besten Stücke Hammelfleisch gegeben. Sogar vom Wein ihres Vaters durfte sie nippen, und das durfte sie sonst nie. Aber Antworten hatten ihre Eltern keine gewusst. Mári war noch lange wach gelegen in ihrer kleinen Schlafkammer im Obergeschoss des Hauses und hatte versucht, eine Erklärung zu finden. Wieso hatten die Götter sie verschont? War an ihr etwas Besonderes? Oder hatte sie einfach Glück gehabt? Vielleicht waren die Götter ja abgelenkt gewesen von irgend jemand anderem, der ihre Gesetze übertrat, vielleicht in Pregatz oder in Bazora, dem Nachbardorf jenseits des Mühlbaches. Hatte derjenige mit dem Leben bezahlt? War jemand anders für sie gestorben? Entsetzen kroch in Mári hoch, lange lag sie noch wach und wusste nicht, ob sie sich freuen oder ob sie erschaudern sollte angesichts der Ereignisse.
Am nächsten Morgen wurde es nicht besser. Als Mári zu Kris und Liv ins Backhaus ging, um ein neues Brot zu holen, wirkte Liv, die heute einen besonders bunten Rock trug, irgendwie ganz aufgeregt, nicht so gemütlich und beruhigend wie sonst. "Na, wer kommt denn da?" japste sie. "Der Liebling der Götter!" Es sollte wohl freundlich klingen, was Liv, diese dicke gut duftende Frau, die ihr immer wieder mal ein Stück Süßbrot zusteckte, da sagte. Aber irgendwie glaubte sie ihr ihre Freundlichkeit heute nicht, da schwang noch etwas anderes mit, etwas, das Mári nicht verstand. Verlegen gab sie ihr die sechs Eier, die Liv für das Brot nahm. Diesmal kniff sie Liv nicht in die Backe, sondern schaute ihr tief in die Augen: "Du musst etwas ganz Besonderes sein, Mári" sagte sie mit feierlicher Stimme. Und wieder dieses komische Gefühl, dass es Liv nicht ernst meinte, oder doch ernst aber dass sie ihr etwas verschwieg, eine Gefühlsregung, für die sie sich selbst schämte. Als sie unter dem niedrigen Türstock wieder hinaus auf den Opferplatz trat, atmete Mári auf. Sie würde nicht den schnellsten Weg zurück nehmen. Sie überquerte den Opferplatz und stand schließlich vor dem Haus des Priesters. Sába wohnte im größten Haus des Dorfes. Es sah nicht wirklich anders aus als die Häuser der Bauern, schließlich waren alle Häuser Elpeles in mühsamer Arbeit aus den Steinen des dorfeigenen Steinbruchs unten am Mühlbach errichtet worden. Ein Stock zur ebenen Erde, in dem man wohnte und arbeitete, und einer darüber, in dem man schlief, das war die Regel. Doch das Haus des Priesters überragte die Nachbarhäuser, das des Töpfers und jenes ihrer Patin Landa, der Schneiderin, um mindestens drei Schritte. Woran das wohl lag? Mári war das noch nie so aufgefallen. Hatte das Haus ein weiteres Stockwerk? Mári schaute auf die Reihen der kleinen Fenster, welche die aus Kalksteinen zusammengesetzte Fassade unterbrachen. Nein, kein weiteres Stockwerk. Ein Licht ging ihr auf. Ja, das musste es sein! Die Zimmer waren höher als die der anderen Häuser. Sonderbar. Sába war auch nicht größer als andere Männer. Und Gerald, der Müller, der größte Mann, den sie kannte, wohnte auch in einem ganz normalen Haus. Wozu brauchte der Priester so hohe Räume? Mári zögerte. Niemand war auf dem Opferplatz zu sehen. Sie mochte Sába nicht besonders. Irgendwie war ihr immer vorgekommen, als fühle er sich in ihrer Gegenwart nicht wohl. Und das war nichts, was sie besonders angenehm fand. Doch sie hatte das Gefühl, dass er ihr vielleicht weiterhelfen konnte. Mári betrachtete das Symbol der Götter, das auf dem Türstock eingraviert war. Ein Kreis und eine Reihe von Punkten, die den Kreis umschwirrten wie Vögel einen Baum. Mári wusste, dass der Kreis in Wirklichkeit eine Kugel darstellte, die Kugel, auf der sie lebte und die sie Erde nannte. Und die Punkte standen für die Götter, die um die Erde herumflogen und sie beschützten. Vorausgesetzt, man tat alles so, wie die Götter das vorgesehen hatten. Vorausgesetzt, man opferte ihnen jeden Sonntag. Und hatte jenen ausgedehnten wonnevollen Körperkontakt nur mit seinem Ehemann oder seiner Ehefrau. Und man log nicht und stahl nicht und tötete niemanden. Mári nahm sich ein Herz. Wenn jemand eine Antwort auf ihre Fragen haben würde, dann doch der Priester. Er musste wissen, wieso die Götter keine Blitze auf sie geschleudert hatten. Er musste wissen, wieso Liv sie den Liebling der Götter genannt hatte. Irgendwie klang es ja auch ganz gut, dachte sie, und sprach es aus, murmelte es halblaut vor sich hin: Liebling der Götter, Liebling der Götter. Bevor sie anklopfte, blickte sie nach oben. Dort mussten die Götter sein, diese sonderbaren strafenden Götter, deren Liebling sie nun anscheinend war. Warum nur? Doch alles, was sie sah, war ein Adler, der weit oben seine Kreise zog. Und die Wintersonne, die gerade ein paar Hand breit über den hohen Bergen im Osten stand. Die höchsten von ihnen glänzten weiß vom Schnee.
Máris Klopfen hallte über den ganzen Platz. Ein Rumpeln ertönte aus dem Inneren des Priesterhauses. Die Tür flog auf und das rote Gesicht des Priesters erschien. „Mári!" entfuhr es ihm erstaunt. „Was gibt es?"
Mári nahm all ihren Mut zusammen. „Ich hab' ein paar Fragen an dich."
„Ach, wirklich?" Der Priester machte ein ziemlich dummes Gesicht, wie Mári fand, und er kratzte sich am bärtigen Kinn. „Also gut," sagte er schließlich, aber er machte keine Anstalten, sie ins Haus zu bitten. „Was willst du wissen?"
Mári kam sich etwas blöd vor, wie sie da mit ihrem Brot vor dem dunkel behaarten Mann stand, aber sie holte tief Luft und fragte: „Bin ich wirklich der Liebling der Götter?"
Ein nervöses Lachen. „Der Liebling der Götter? Wie kommst du denn darauf?" Mári erzählte ihm, was Liv zu ihr gesagt hatte. Sába blickte gehetzt um sich. „Mári," sagte er schließlich und blickte ihr eindringlich in die Augen, „glaub ja nicht, dass du etwas Besonderes bist. Ja, vielleicht mögen dich die Götter, vielleicht bist du zu etwas Großem ausersehen, wer weiß. Aber mach das nicht nochmal. Glaub mir, ein weiteres Mal werden dich die Götter nicht verschonen. Gehorche den Gesetzen, das ist alles, was ich dir sagen kann." Und schon war der Moment vorbei, in dem Mári echte Anteilnahme in seinem Gesicht lesen konnte. „So, und jetzt geh nach Hause und mach dir keine Sorgen."
Mári ging nach Hause, aber Sorgen machte sie sich trotzdem. Irgendwie war es traurig, vor den Göttern Angst haben zu müssen. War das wirklich notwendig? Sie beschloss, ihre Patin Landa danach zu fragen.
Diesmal nahm Mári den Weg zwischen dem Haus der Heilerin Magda und dem Werkzeugmacher Jon. Hinter Jons Tür hörte sie leises Hämmern. Einem Instinkt folgend, drehte sie sich nochmals um und blickte zum Opferplatz zurück. Sie sah gerade noch, wie Livs bunter Rock im Haus des Priesters verschwand.
Hinter Magdas Haus bog Mári rechts ab. Nun, da der Opferplatz hinter ihr lag, öffnete sich das Dorf und die gedrungenen Steinhäuser standen in großem Abstand zueinander. Kein Wunder, schließlich hatte jede Familie ihren Garten, der sie ganzjährig mit Feldfrüchten versorgte. Fast alle hatten auch noch ein paar Schafe zwischen ihren Obst- und Olivenbäumen stehen. Damit diese vor den Wölfen geschützt waren, umgaben sich die verschiedenen Weidegärten mit Mauern aus Stein, was dazu führte, dass auch die Wege des Dorfes von Steinmauern begrenzt wurden. Mári mochte diese Mäuerchen. In ihren Ritzen ließ sich jedes Mal etwas Neues entdecken: Farne, die sich die winzigen Erdklümpchen zwischen den Steinen zu Nutze machten, Moos, allerlei Insekten und Spinnen - und überall die schönsten unterschiedlich gefärbten Eidechsen. Bis vor kurzem waren Mári die Mäuerchen noch unglaublich hoch vorgekommen. Doch seit einigen Monaten konnte sie über sie hinweg blicken, und das Dorf hatte dadurch an Übersichtlichkeit gewonnen. Ja, ihr kam vor, als hätte sie jetzt erst richtig verstanden, wie Elpele aufgebaut war. Und das erfüllte sie mit einem neuen Selbstbewusstsein. So grüßte sie denn auch ohne Zögern den alten weißbärtigen Johann, der auf dem Bänkchen vor seinem Haus saß und hinaus in seinen Garten blickte. Seine Orangenbäume trugen besonders schöne Früchte. Johann kniff die Augen zusammen. Als er Mári schließlich erkannte, huschte ein Lächeln übers Gesicht. „Na, wenn das nicht der neue Liebling der Götter ist!" Mári lächelte zurück. Johann meinte es auf jeden Fall nett. Und vielleicht war ja auch wirklich nichts dabei, so genannt zu werden. Leo, der sich bei allem unglaublich ungeschickt anstellte, nannten alle nur "den Tölpel", und der beschwerte sich auch nicht. "Liebling der Götter" war sicher der bessere Spitzname. Von Johanns freundlicher Art getragen, hüpfte Mári die letzten Schritte zu ihrem Elternhaus.
„Na, endlich bist du da!" tadelte ihre Mutter, die gerade einen Salatkopf im Garten vor dem Haus erntete. Doch es umspielte ein Lächeln ihr weiches Gesicht.
„Ich musste noch mit dem Priester reden," erwiderte Mári und drückte ihr den dicken Laib Brot in die noch freie Hand.
„Ach so!" Gespielte Ehrfurcht in der Stimme ihrer Mutter. „Der Liebling der Götter musste mit dem Priester reden! Und was hat Sába gesagt?"
„Nicht viel Nützliches," erwiderte Mári. „Aber er hatte sowieso nicht viel Zeit, er war dann noch mit Liv verabredet."
Ihre Mutter zog eine Augenbraue hoch. „Mit Liv? Bist du da sicher?" Mári nickte. Irgendwie schien die Nachricht ihre Mutter zu beunruhigen. Wieso nur? Der Priester war doch für alle da. Weshalb sollte er sich nicht mit Liv verabreden?
„Wo waren sie denn verabredet?" fragte ihre Mutter, und der Salatkopf und das Brot zitterten ein wenig.
„Liv ging in sein Haus, gerade als ich gegangen war. Ich hab nur ihren bunten Rock gesehen," gab Mári Auskunft. Ein Brummen war die Antwort. Es kam Mári nicht sehr zufrieden vor. Was hatte Mutter nur?
„Nun geh schon rein," sagte sie schließlich. „Deine Patin ist schon da. Sie will mit dir sprechen."
Das konnte ja heiter werden. Mári mochte Landa, sie wusste viel und hatte ihr, so wie es ihre Aufgabe war, schon ganz viele spannende Dinge über Elpele, die Natur und die Welt beigebracht. Und eigentlich wollte sie sie ja auch noch einiges zu den Göttern fragen. Aber wenn Landa ankündigte, mit ihr reden zu wollen, gab es meistens eine strenge Moralpredigt.
Doch als Mári über die Schwelle trat und in die Stube blickte, erlebte sie eine Überraschung. Landa, die am großen Eichentisch saß und sich angeregt mit ihrem Vater zu unterhalten schien, der ein lecker duftendes Gericht an der Feuerstelle zubereitete, erhob sich, als sie sie sah, stürzte auf sie zu und drückte sie fest. Wenn auch nur ganz kurz, damit sie die Götter nicht missverstanden. Aber es hatte gereicht, um Mári einen wohligen Schauer über den Körper zu jagen. Landa hatte sie noch nie umarmt.
„Schön, dass es dir gut geht," strahlte ihre Patin sie schließlich an, verlegen ihr Leinenhemd zurecht streifend. Einladend deutete sie zum Tisch. „Komm, setz dich zu mir." Mári setzte sich zu ihr, den notwendigen Abstand von etwa einer Armlänge wahrend.
Das blonde Haar, das Máris Vater heute zu einem Zopf zusammengebunden hatte, baumelte ein wenig hin und her, als sich der kräftige Mann mit den weichen Gesichtszügen zu Mári umdrehte und ihr freudig zulächelte. Dann wandte er sich wieder dem Herd zu. Mári blickte in die Augen ihrer Patin. Dunkel waren sie, ähnlich den ihren, und auch ihr Gesicht hatte viel mit Máris dunklen kantigen Zügen gemein.
„Nun erzähl mal in Ruhe, Mári," fing ihre Patin an, „wie konnte das denn gestern passieren, dass du dein Opfer vergessen hast?"
Mári berichtete, wie sie in Gedanken die Berge und die Ebene betrachtet hatte, wie sie abseits gestanden hatte und einfach nicht gemerkt hatte, dass alle schon ihre Opfergaben auf dem Tisch dargebracht hatten.
„Und ansonsten war nichts ungewöhnlich?" hakte Landa nach. Mári überlegte.
„Nein," sagte sie schließlich, „nicht dass ich wüsste."
„Vielleicht hast du einfach Glück gehabt," sagte Landa schließlich.
„Glück? Wieso Glück? Wie kann ich Glück gehabt haben? Die Götter sehen doch alles! Das hast du mir selbst beigebracht!"
Mári merkte, wie Landa einen kurzen fragenden Blick in Richtung ihres Vaters schickte. Ja natürlich, er hörte alles mit. Doch das war in Ordnung, Mári hatte volles Vertrauen zu dem Mann, der in seiner ruhigen Art immer das Beste für alle zu wollen schien. Fast unmerklich nickte er.
Landa seufzte. „Hör zu," sagte sie schließlich, nahm unsicher Máris Hand und ließ sie gleich darauf wieder los. „Es ist doch so: die Gesetze der Götter sind ja nicht nur dazu da, damit wir sie befolgen wie kleine Kinder. Nein, sie haben einen Sinn. Sie machen uns besser, und wenn wir sie befolgen, funktioniert unsere Gemeinschaft besser. Nimm das Gebot: 'Du sollst nicht stehlen.' Das ist ein gutes Gebot. Es führt zu Frieden im Dorf. Oder das Gebot: 'Du sollst nicht töten.' Stell dir mal vor, dieses Gebot gäbe es nicht. Es wäre furchtbar, wenn wir ohne zu zögern jeden umbringen würden, der uns ärgert, denn dann gäbe es irgendwann keine Menschen mehr."
Landa machte eine Pause. Mári wartete. Soweit wusste sie das schon, das hatte ihr Landa schon vor Jahren erklärt. Ihr war es immer wichtig gewesen, dass Mári einsah, warum sie die Gesetze der Götter befolgen sollte. Damit sie am Leben blieb, klar, aber eben nicht nur deshalb. Die Pause wurde immer länger. „Aber wieso sprichst du von Glück?" fragte sie schließlich. „Die Götter wissen doch alles, deshalb sind sie die Götter. Da kann doch Glück keine Rolle spielen!"
Landa seufzte nochmal. „Die Götter sind unerbittlich. Meistens. Und wir wollen unsere Kinder schützen, Kinder wie dich, Mári. Deshalb lehren wir alle Kinder, die Gesetze der Götter zu achten. Ohne Ausnahme. Weil die Götter allwissend sind." Wieder eine schmerzhaft lange Pause. Diesmal wartete Mári darauf, dass Landa weitersprach.
„Aber um die Wahrheit zu sagen: wir wissen nicht, was die Götter wissen. Wir wissen, dass sie gute Gesetze erlassen haben und dass sie sie bei Todesstrafe durchsetzen, aber sie tun es nicht immer."
„Was?" Mári fuhr von ihrem Stuhl hoch und Landa fort: „Du kennst doch die fünf göttlichen Gesetze: Das erste Gesetz: Du sollst den Tag der Götter ehren. Das zweite Gesetz: Du sollst nicht töten. Das dritte Gesetz: Du sollst keine Unzucht treiben. Das vierte Gesetz: Du sollst nicht stehlen. Das fünfte Gesetz: Du sollst nicht lügen."
Mári kannte die Gesetze. Sie blickte in Landas fragendes Gesicht. Was wollte sie von ihr? Plötzlich schien ihr, als wankte der Boden unter ihr. Erinnerungen an kleine Notlügen, an aus fremden Gärten gemopste Mandarinen. Wie konnte es sein, dass ihr das nie aufgefallen war?
„Wie kann das sein?" flüsterte sie schließlich. „Wieso habe ich das nie bemerkt?" Landa lächelte, Mári vermeinte etwas wie Stolz in ihrem Blick wahrzunehmen. „Was hast du nicht bemerkt?" fragte ihre Patin.
„Die Götter bestrafen nur diejenigen, die die ersten drei Gesetze missachten! Die andern beiden sind ihnen egal!"
Landa grinste. „Nun, ob sie ihnen egal sind, wissen wir nicht. Aber du hast völlig recht: man kann gegen sie verstoßen, und es passiert - nichts, rein gar nichts. Nur du, du bist die eine große Ausnahme. Du hast gegen das erste Gesetz verstoßen, und zwar ganz und gar eindeutig, und die Götter haben dich verschont. Ich freue mich darüber, mehr als du dir vorstellen kannst, aber ich würde auch zu gerne wissen, warum." Mári hätte das auch gerne gewusst. Und noch etwas wollte sie wissen: „Landa, wieso bestrafen uns die Götter so grausam - mit dem Tod?" Mári flüsterte ihre Frage, gegen Schluss immer leiser werdend. Sie hatte fast das Gefühl, über die Götter zu lästern. Erstaunt und traurig zugleich blickte sie Landa an. „Auch das weiß leider niemand, wirklich niemand. Aber auch ich habe mich das schon oft gefragt.“
Mári behielt ihren Spitznamen, den manche mit Ehrfurcht und andere mit kaum verhohlenem Neid aussprachen. Mári gewöhnte sich daran, und nach und nach verlor auch der besondere Tag, der ihn ihr gebracht hatte, an Bedeutung. Doch irgendwie war etwas in ihr gekeimt, das ihr keine Ruhe ließ: sie wollte wissen, weshalb die Götter handelten, wie sie handelten, und sie wollte wissen, warum alles so war, wie es war.
*
Fünf Winter waren vergangen, seit Mári zum Liebling der Götter geworden war, und aus dem kleinen Mädchen war ein größeres Mädchen geworden, das immer mehr in die Arbeiten des Hofes mit eingebunden wurde. Schließlich würden nur noch ein paar Jahre ins Land gehen, bis sie einen eigenen Hausstand gründen würde. Und dann musste sie wissen, wie man ein Huhn tötete, wie man eine Marmelade aus Zitronen oder Baumerdbeeren kochte, wie man die Schafe scherte und vieles mehr.
Dass man jedes Jahr ein paar Schafe mehr haben sollte als man selbst brauchte, hatte sie schon gelernt. Jedes Jahr zum Fest des Gottes Eelon, der die Reisenden beschützte, kamen die Ritter des Hohepriesters von Pregatz, um den Zehnt einzutreiben. Dies taten sie der Einfachheit halber, indem sie aus jedem Hausstand zwei bis vier Schafe mitnahmen, je nach Laune und Bedarf des Hohepriesters - oder der Soldaten, so genau wusste das in Elpele niemand. Sie hatten immer auch zwei große Hunde dabei, die ihnen halfen, die Schafherde nach Pregatz zu bringen - oder die Bauern einzuschüchtern, wenn sie über die Anzahl der Schafe diskutieren wollten. Und Sába, der Priester, war immer an ihrer Seite, so, als wolle er die Dorfbevölkerung daran erinnern, dass sie auf sein Wohlwollen angewiesen waren. Eelons Fest fiel genau auf den Tag der Tag- und Nachtgleiche, es war die Zeit, in der die erbarmungslose Hitze des Sommers nachließ, aber die winterlichen Regengüsse noch nicht eingesetzt hatten. Eine angenehme Zeit, um längere Reisen vorzunehmen. Mári hatte damit gerechnet, dieses Jahr - so wie auch die beiden letzten Jahre - bei der Übergabe des Zehnts dabei zu sein, aber ihr Vater ließ sie laufen. Sie hatte in den letzten Jahren die Felsberge, die hinter Elpele in schwindelerregenden Formationen gen Himmel wuchsen, für sich entdeckt, und ihre Eltern hatten nichts dagegen, wenn sie dort herumstreifte, solange sie ihre Pflichten nicht vernachlässigte. Meist hatte sie auch einen guten Grund dort hinzugehen, denn an den steilen Hängen zwischen den Felsen wuchsen die schmackhaften blauen Heidelbeeren, aus denen man Mus und Marmelade machen konnte, und Mári hatte einen so sicheren Tritt, dass sie sie auch noch in den unmöglichsten Lagen ernten konnte.
Das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, da die Heidelbeeren auch weiter unten wuchsen, dort, wo sich der Bergrücken sanft von Elpele ausgehend nach Süden emporschwang, von dichtem Wald bedeckt. Im Dickicht zwischen den Bäumen wuchsen nicht nur große Farne und Brombeeren, sondern eben auch Unmengen von Heidelbeeren. Aber am Allerliebsten durchschritt Mári diesen Wald aus Stein- und Korkeichen, Föhren und Erdbeerbäumen schnellen Schrittes, um auf den Felsen oberhalb des Waldes herumzuklettern. Sie wusste gar nicht genau, was sie dabei so liebte. War es das Gefühl, jede Faser ihres Körpers zu fühlen, wenn sie angespannt und trotzdem Herrin ihrer selbst am Fels hing? Waren es die Tiere, die es hier oben gab, die Felsziegen, die Murmeltiere und die großen Adler? Oder war es die Weite des Blicks, der sich mehr und mehr öffnete, je höher sie stieg? Ganz oben, auf dem höchsten Felsen, den sie nur erreichte, wenn sie eine etwa fünfzehn Menschenlängen hohe senkrechte Wand durchstieg, kam sie sich vor wie eine Königin, und nicht selten drang ihr triumphierender Schrei bis hinab nach Elpele. Es war interessant: wenn sie in Elpele stand, hatte sie das Gefühl, auf einem Berg zu stehen, und das war ja auch nicht falsch so. Aber wenn sie oben auf dem höchsten Felsen stand, der den Namen „großer Bär" trug, dann kam es ihr fast vor, als läge Elpele weit unten im Tal. Auch heute war sie bis ganz nach oben geklettert. Ihre genagelten Schuhe hatte sie am Fuß der Wand gelassen. Hier brauchte sie das volle Gefühl ihrer Sohlen - und vor allem die Biegsamkeit und Kraft ihrer Füße, die sich auch noch an die kleinsten Felsvorsprünge klammern konnten. Wenn sie nackt waren. Oben angekommen, setzte sich Mári auf die höchste Stelle des Felsens und sog tief die kühle Luft ein. Sie ließ den Blick schweifen. Im Süden sich endlos aneinanderreihende Bergketten, im Osten das Mühlbachtal, dahinter die gegenüberliegenden Berge mit dem Nachbarort Bazora. Auch er wirkte klein und tief unten, obwohl auch Bazora auf einem Bergsporn erbaut war. Im Westen und Norden die große Ebene, die vom großen See im Norden begrenzt wurde. Fast schien es ihr, als könne sie die Türme von Pregatz sehen. Plötzlich waren ihre Gedanken bei den Rittern. Jetzt holten sie wohl gerade überall im Dorf ihre Schafe ab. Und Sába, der Priester, lief ihnen gewiss hinterher, kroch ihnen in den Allerwertesten und half ihnen, auch noch die letzte Hütte im Dorf zu finden, damit sie ja alles bekämen, was ihnen angeblich zustünde. Mári fand das ungerecht. Was hatten sie mit diesem Hohepriester zu schaffen? Das einzige, was er von ihnen wollte, waren die Schafe. Sonst hörten sie das ganze Jahr nichts von ihm, aber pünktlich zu Eelons Fest kamen seine Schergen.
Bewaffnet, damit ihnen ja niemand dumm kam. Dabei durften sie ja gar niemanden töten. Aber Mári wusste, dass es Möglichkeiten gab, die Schwerter einzusetzen, ohne von den Göttern bestraft zu werden. Der Mensch konnte leider sehr große Schmerzen aushalten, bevor er starb.
Ihre gute Laune war verschwunden. Sollte sie noch ein paar Heidelbeeren pflücken? Sie nahm den Korb von ihrem Rücken, den sie dort mit zwei Ledergurten, die über ihre Schultern liefen, befestigte. Er war länglich und hoch, damit er sich gut an ihren Rücken anpasste. Seitlich war eine Halterung angebracht, in der eine mit Wasser gefüllte Glasflasche streckte. Mári hatte sie letztes Jahr zu ihrem Geburtsfest bekommen. Sie war überaus nützlich auf ihren ausgedehnten Erkundungstouren. Der Korb war etwa zu einem Viertel voll. Aber sie hatte keine Lust, noch mehr zu pflücken, ein viertel Korb war schließlich gar nicht mal so schlecht. Sie genehmigte sich ein paar Beeren und trank ein paar Schlucke Wasser. Dann schwang sie den Korb wieder auf ihren Rücken und sich selbst hinab in die Wand. Konzentriert suchte sie nach der Route, die sie schon unzählige Male durchstiegen hatte. Mitten in der Wand, auf einem kleinen Felssims, machte sie eine Pause, schüttelte ihre Arme aus, blickte hinab in den Garten aus großen und kleinen Felsen, die fast wie Figuren aus einer anderen Welt wirkten. Da fiel ihr etwas auf. Was war das für ein dunkler Strich? Es sah fast wie ein Seil aus und führte zwischen zwei Felsköpfen hindurch. Neugierig geworden, kletterte Mári aufmerksam tiefer. Sie wusste, dass sie auf ihre nackten Füße aufpassen musste. Eine Verletzung konnte hier oben lebensgefährlich werden. Am Fuße der Wand angekommen, zog sie ihre Schuhe wieder an und hangelte sich über unebenes felsiges Terrain in Richtung der Felsköpfe. Sie umrundete den ihr näher stehenden, der wie ein Hund aussah - und siehe da, hier war wirklich ein Seil, und es war völlig verrostet. Das hieß, dass es sich um ein Seil aus Metall handeln musste. Vorsichtig griff Mári danach. Definitiv Metall, kalt und hart. Es war mit Schrauben am Fels befestigt worden, in etwa in der Höhe ihrer Schultern, wenn sie davor stand. Wer um alles in der Welt hatte hier ein Seil angebracht? Wozu? Und auch noch aus kostbarem Eisen! Mári fiel auf, dass die Schrauben nur noch an einer Stelle hielten, am anderen Ende schrammte das Seil lose am Felsen. Aufregung erfasste sie. Wie lange hing das schon hier? Sie beschloss, ihre Eltern zu fragen, ob sie etwas über ein metallenes Seil bei den Bärenköpfen wussten.
Außer Atem kam sie rechtzeitig zum Abendessen zurück. Die Stimmung war gedrückt. Fünf Schafe hatten die Soldaten des Hohepriesters von jedem Hof mitgenommen! Das hatten die Ritter noch nie gewagt. Und alles Bitten und Betteln hatte nichts genutzt. Kris, der Bäcker, der sich das nicht gefallen lassen wollte, hatte einen teuren Preis für seine Aufmüpfigkeit bezahlt. Einer der Ritter hatte sein Schwert genommen und es ihm einfach in den Oberschenkel gesteckt. Kris lag nun im Haus der Heilerin Magda und wurde mit Salben und Tinkturen behandelt. Magda beteuerte, er hätte wohl Glück gehabt und die Chancen wären gut, dass er in einigen Wochen wieder würde laufen können. Aber die ganze Geschichte belastete die Gemüter sehr. Fünf Schafe waren eine Menge, sie würden es sich nicht so bald wieder leisten können, zu schlachten. Kein Fleisch in den nächsten Monaten! Außer vielleicht Mal ein Huhn, das war auch nicht schlecht. Aber trotzdem, das war nicht in Ordnung so.
Mári spürte Zorn über diese Soldaten. Kris hatte sich nur beschwert und sie hatten ihn schwer verletzt. Das war nicht gerecht. Wieso unternahmen hier die Götter nichts? Wieso schauten sie einfach zu, wenn so etwas geschah? Mári verstand es nicht. Erst als sie am Abend in ihrem Bett lag und sich mit der strohgefüllten warmen Decke zudeckte, fiel ihr das Seil wieder ein, das sie entdeckt hatte. Na ja, es musste wohl warten.
Ein paar Tage später traf sich Mári mit ihrer Freundin Sara zum Heidelbeerpflücken. Sara war schon äußerlich anders als Mári. Während Mári ein dunkles Gesicht mit kräftigen Kieferknochen und schwarzen Haaren hatte, war Sara blond, hatte ein rundes, recht helles Gesicht, das jedoch in der Sonne häufig rot wurde, und blaugrüne Augen. Sara war zurückhaltender und ruhiger als Mári, und sie zögerte bei Neuem oft eine Weile, bis sie sich darauf einließ. Doch wenn sie sich für etwas entschieden hatte, dann konnte man sich auf Sara, ihren Mut und ihre Tatkraft verlassen. Und Sara hatte sich schon seit langem dazu entschieden, Máris Freundin zu sein, eine Tatsache, die Mári überglücklich machte. In letzter Zeit hatte Sara auch noch beschlossen, Mári öfter Mal in die Berge zu begleiten. Das machte den Aufenthalt auf und zwischen den Felsen noch schöner. Und da die Stimmung im Dorf seit dem Eelonstag ziemlich gedrückt war, waren die beiden besonders froh, einen Tag fern von Elpele zu verbringen. Schon auf dem Weg durch den Wald erzählte Mári ihrer Freundin von dem Seil, das sie entdeckt hatte. Sara hatte noch nie von so etwas gehört: warum sollte jemand ein Seil aus Eisen dort oben an den Felsen anschrauben? Das ergab keinen Sinn. Um ihre Körbe möglichst schnell zu füllen, hielten sie beim Übergang zwischen Wand und Fels an; dort wuchsen besonders viele Sträucher mit den blauen Beeren. Als die Sonne den Zenit überschritten hatte und beide ihre Körbe mehr als zur Hälfte gefüllt hatten, beschlossen die Mädchen, ihre Sammlerpflichten ausreichend erfüllt zu haben. Nun ging es ans Erkunden: Mári zeigte Sara die Stelle zwischen den beiden Felsköpfen, wo sie das Seil gesehen hatte. Es hing immer noch da. An einer Stelle steckte das Seil, zur Schleife zusammengebunden, in einer metallenen Klemme, die ihrerseits in den Fels geschraubt worden war. Sara ließ das Seil vorsichtig durch die Hand gleiten. Weshalb hatte man es hier angebracht? Sie war nicht ganz so sicher beim Klettern wie Mári, dennoch wollte sie auch das Ende untersuchen, das lose am Felsen baumelte. Um dort hinzugelangen, musste sie einen steilen Felshang queren, nicht hoch über flacherem Gebiet, aber es erforderte ein gewisses Geschick. Sara hielt sich an den guten Griffen im Fels fest, doch an einer Stelle wurde der Fels sehr glatt. Sara griff nach dem Seil, um sich festzuhalten, stellte aber fest, dass es ihr zu wenig Halt gab, da es nach unten rutschte, sobald sie Druck darauf ausübte. Vorsichtig wie sie war, schaffte sie die Passage trotzdem, auch die kleineren Griffe nutzend. Mári war dagestanden und hatte sie beim Klettern beobachtet. Sie mochte Sara sehr, und jedes Mal, wenn sie sie betrachtete, durchströmte sie ein besonderes Glücksgefühl. Sie hätte nichts dagegen, hier oben zwischen den Felsen zu bleiben, mit Sara, dachte sie. Doch dann verdrängte ein Gedanke ihre Träumerei. Mit behenden Bewegungen kletterte sie zu Sara hoch, die eben das lose Ende des Seils erreicht hatte. Auch hier gab es eine kleine Metallplatte, doch drei der vier Schrauben hatten nachgegeben, und Metallplatte wie Seil baumelten lose an der Wand. Mári ergriff das Seil und hob es hoch, schob es unter die Metallplatte und drückte drauf.
„Tu mir einen Gefallen," sagte sie keuchend zu Sara, „klettere nochmal ein paar Schritte zurück und halte dich dabei am Seil. Aber häng dich nicht zu sehr dran," fügte sie hinzu, „ich weiß nicht, wie gut ich dich halten kann."
Sara sah ihre Freundin mit großen Augen an und kletterte am Seil entlang zurück. An der anderen Seite angekommen, kehrte sie um und stand bald wieder neben Mári. „Das ging viel leichter," sagte sie verblüfft. Mári lächelte verschmitzt. „Vielleicht haben wir gerade herausgefunden, wozu das Seil da war," sagte sie. „Um sich festhalten zu können!"
Saras Gesicht zeigte Verwunderung und Aufregung zugleich. „Das könnte sein! Aber - wozu der Aufwand? Und - wer kam hier hoch? Und weshalb? Was gibt es hier außer Felsen, Bergkräutern und Heidelbeeren?"
Mári zuckte die Schultern, doch abermals umspielte ein verschmitztes Lächeln ihr kleines sonnengebräuntes Gesicht. „Was hältst du davon, dass wir es herausfinden?"
Mári und Sara kletterten suchend umher, Sara langsam, konzentriert und vorsichtig und Mári mit der Gewissheit eines jungen Zickleins, immer die richtigen Tritte zu finden. Dabei wussten sie beide nicht, was sie suchten, und irgendwann blieben sie schnaufend stehen, glücklich über die gemeinsame Suche und doch auch ein bisschen ratlos. „Lass uns nachdenken," sagte Sara schließlich. „Was könnten Menschen hier oben wollen?"
„Nun, wir pflücken Heidelbeeren und klettern über die Felsen," grinste Mári. „Aber dazu braucht man kein Seil," ergänzte sie, bevor Sara erwidern konnte.
„Genau." Auf Saras Stirn zeigte sich die Falte, die sich immer zeigte, wenn Sara scharf nachdachte. Mári liebte diese Falte.
„Vielleicht brauchte man das Seil, um sich festzuhalten, weil man etwas Schweres getragen hat," sagte Sara schließlich. Mári nickte. „Was könnte man denn hier oben tragen wollen, außer Heidelbeeren?"
Sara deutete um sich. "Steine."
„Aah, ja, das könnte sein. Aber..." Mári stutzte. „Wir haben doch schon einen Steinbruch, unten am Mühlbach."
Sara blickte ihr in die Augen, und ihre braunen Pupillen steckten voller Geheimnis. „Vielleicht," sagte Sara, „vielleicht waren das nicht wir. Vielleicht stammt dieses Seil aus einer Zeit, als es Elpele noch nicht gab."
Mári blickte sie mit offenem Mund an. Sollte das Seil so alt sein? Es mussten Jahrhunderte vergangen sein seit der Gründung Elpeles. Von dieser Zeit hatte nichts als Geschichten überdauert, Geschichten, die von Generation zu Generation weitererzählt wurden. Mári hatte sie oft gehört, die Geschichte vom ersten Priester Harald, der diejenigen, die an die Götter glaubten, hinauf nach Elpele geführt hatte, dorthin, wo sie sicher waren vor Krieg und Verwüstung. Niemand wusste, weshalb es Krieg gegeben hatte, aber es war wohl eine Zeit großen Unglücks gewesen und großen Unglaubens. Mári hatte zwar den Verdacht, dass dieser Priester Harald fast ein bisschen zu gut wirkte, um echt zu sein, aber es war eine Tatsache, dass Elpele seit undenkbaren Zeiten in Frieden lebte.
„Du meinst..." flüsterte Mári, „das Seil stammt aus der Zeit vor dem Krieg?"
„Es könnte sein," antwortete Sara. „Lass uns weitersuchen. Vielleicht finden wir noch einen Hinweis." Mári ging - einer Eingebung folgend - nochmals zurück zum Seil. Dann kletterte sie in der Richtung der Seilführung weiter nach Süden. Schließlich erreichte sie den oberen Rand eines Hochkares, das von der tiefstehenden Sonne warm angeleuchtet wurde. Hier war sie noch nie gewesen. Sie saß auf einem kleinen Übergang zwischen zwei Felsköpfen und hatte freie Sicht. Ein paar Latschenkiefern wuchsen auf dem Grund des Kares, ansonsten gab es nur Stein - und einen weiten Blick über das Kar hinaus auf die große Ebene. Fast schien es ihr, als hinge das von bizarren Felskegeln umringte Hochkar über die Ebene hinaus, die tausend Menschenlängen unter ihr lag. Silbern glänzte das winzig wirkende Band des mächtigen Flusses Ri, der im Norden in den großen See mündete.
Mári musterte die Felsen, die das Kar umgaben. Irgend etwas Geheimnisvolles umgab diesen Ort. Und dann - plötzlich - sah sie es, und sie konnte nicht verstehen, warum es ihr nicht gleich aufgefallen war. Dort, wenige Schritte unter ihr, steckte eine Metallklammer im Boden. Dann noch eine - und noch eine. Hastig folgte sie den Klammern, traute sich jedoch nicht, diese als Halt zu benutzen. Es waren genug gute Griffe da. Die verrosteten Klammern führten eindeutig ins Kar hinab. Und dann, als sie den Boden des Hochtals schon fast erreicht hatte, sah sie, wohin die Klammern führten. Hier, am Fuße eines Felsens, der ein bisschen aussah wie ein alter Mann mit einer Kutte, klaffte ein Loch im Berg, groß und schwarz. Eine Höhle! Sie hatte noch nie so eine große Höhle gesehen! Felsspalten ja, Kuhlen, in die man sich kauern konnte bei Regen, Felsüberhänge, die ein wenig an eine Höhle erinnerten - aber so etwas! Der Eingang der Höhle überragte sie um ihre eigene Körperlänge, und wenn sie hineinblickte, schien der Gang kein Ende nehmen zu wollen.
Er war eindeutig von Menschenhand gehauen worden, das sah man an den Schlagspuren an den Wänden - und am beinah ebenen Boden. Doch allzu weit konnte Mári - noch geblendet vom hellen Licht der Sonne - nicht sehen. Es war, als blicke sie in ein schwarzes Loch.
„Sara!" rief sie schließlich aufgeregt und stolperte schon an den Klammern entlang zurück zum Rand des Kares.
Oben angekommen, hörte sie die rufende Stimme ihrer Freundin. Sara hatte sie offenbar auch schon gesucht. „Hier bin ich!" antwortete sie voller Inbrunst. Bald erschien Saras von der Sonne gerötetes Gesicht hinter einem Felsen.
„Ich hab's gefunden!" rief ihr Mári stolz entgegen, und Sara beschleunigte ihre Schritte.
„Wahnsinn!" Sara war mindestens so beeindruckt wie Mári. „Die ist ja riesig! Und dunkel!"
„Ich würde sie ja gerne ein wenig erkunden," fing Mári an, „nur ein paar Schritte, so lange wir etwas sehen können..."
Sara sah sie skeptisch an. „Hast du bemerkt, wie tief die Sonne schon steht?"
Mári war hin- und hergerissen, aber sie wusste, dass heute Saras Vernunft siegen sollte. Sie machte es ihr leicht: „Na gut. Aber wir kommen mit Fackeln zurück und erkunden die Höhle. Sobald es irgendwie geht." Sara nickte erleichtert. Mári hatte plötzlich das Bedürfnis, Saras schlanke Arme zu berühren, hielt sich aber zurück. Sie wollte die Götter nicht auf dumme Gedanken bringen.
Als die beiden Mädchen schnellen Schrittes durch den immer dunkler werdenden Wald liefen, schworen sie sich, so wie sie es früher oft gemacht hatten, das „Geheimnis" für sich zu behalten. Irgendwie kamen sie sich ein bisschen albern vor, aber sie waren sich einig, dass - wenn dieser Schwur jemals angebracht war - nun diese Zeit gekommen war. Niemand sollte das mit der Höhle erfahren, bevor sie es gemeinsam beschlossen. Was sie hingegen tun wollten, war ganz genau hinzuhören, wenn künftig Geschichten über die Zeit vor dem großen Krieg erzählt würden. Wobei das tatsächlich