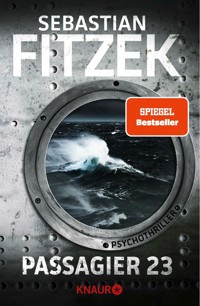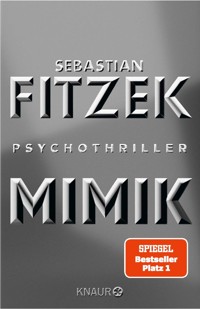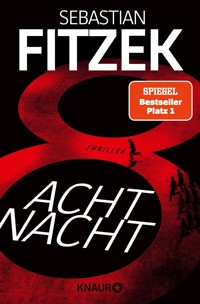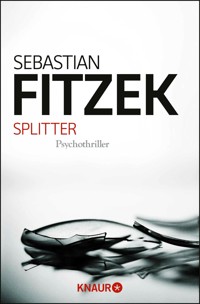12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Denk an das schlimmste Date deines Lebens - und du bist noch nicht einmal nahe dran! Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hat seinen dritten Roman geschrieben: »Horror-Date«. Kein Thriller - obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft! Ein ebenso humorvoller wie lebenskluger Roman, eine grandiose Mischung aus Humor und existentiellen Fragen. »The Walking Date« ist keine normale Dating-Plattform: Hier können sich Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, noch ein letztes Mal verlieben. Deshalb hat sich auch Patient Raphael bei TWD angemeldet, und tatsächlich funkt es zwischen ihm und der ebenfalls erkrankten Nala. Doch am Tag ihres ersten Blind Dates geht es Raphael nicht gut. Kurzerhand überredet er seinen besten Freund, den erfolgsverwöhnten Start-up-Gründer Julius, an seiner Stelle zu dem Treffen zu gehen. Raphael zuliebe spielt Julius widerwillig den Schwerkranken - und das schlimmste Date seines Lebens beginnt. Schon nach wenigen Minuten ist Nala schwer enttäuscht von dem attraktiven, aber furchtbar oberflächlichen Kerl, der in seinen Mails doch so tiefgründig gewirkt hat. Als sie ihn auf seine protzigen Statussymbole anspricht, flüchtet er sich in die nächste Lüge: Julius gibt vor, sein gesamtes Hab und Gut in den letzten Tagen seines Lebens verschenken zu wollen. Eine Idee, die Nala begeistert. Und damit nimmt das Unheil endgültig seinen Lauf. Bald muss Julius alles verschenken, um nicht alles zu verlieren … Der dritte »Keinthriller« von Sebastian Fitzek nach »Der erste letzte Tag« und dem Jahresbestseller »Elternabend« Der Bestseller-Autor begeistert nicht nur mit seinen düsteren Thrillern Millionen Leser*innen: Auch Sebastian Fitzeks humorvolle Romane mit Tiefgang standen wochenlang auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die Fans sind sich einig: Sebastian Fitzek kann einfach gnadenlos gut erzählen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Horror-Date
Kein Thriller (Obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft)
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Mit Illustrationen von Jörn Stollmann
Über dieses Buch
»The Walking Date« ist keine normale Dating-Plattform: Hier können sich Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, noch ein letztes Mal verlieben. Deshalb hat sich auch Patient Raphael bei TWD angemeldet, und tatsächlich funkt es zwischen ihm und der ebenfalls erkrankten Nala. Doch am Tag ihres ersten Blind Dates geht es Raphael nicht gut. Kurzerhand überredet er seinen besten Freund, den erfolgsverwöhnten Start-up-Gründer Julius, an seiner Stelle zu dem Treffen zu gehen.
Raphael zuliebe spielt Julius widerwillig den Schwerkranken – und das schlimmste Date seines Lebens beginnt. Schon nach wenigen Minuten ist Nala schwer enttäuscht von dem attraktiven, aber furchtbar oberflächlichen Kerl, der in seinen Mails doch so tiefgründig gewirkt hat. Als sie ihn auf seine protzigen Statussymbole anspricht, flüchtet er sich in die nächste Lüge: Julius gibt vor, sein gesamtes Hab und Gut in den letzten Tagen seines Lebens verschenken zu wollen. Eine Idee, die Nala begeistert. Und damit nimmt das Unheil endgültig seinen Lauf. Bald muss Julius alles verschenken, um nicht alles zu verlieren …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30.Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Zum Buch und Danksagung
Jeder Mensch hat zwei Leben.
Das zweite beginnt in dem Moment, in dem dir klar wird, dass du nur eins hast.
1. Kapitel
Könnt ihr einfach mal die Fresse halten?«
Erstaunlich, welch unterschiedliche Reaktionen dieser doch recht unmissverständliche Satz hervorrufen kann, je nachdem, in welcher Gesellschaft man ihn äußert. Vom schallenden Gelächter (auf der Grillparty, wenn die Freundinnen sich gefühlt seit Stunden über die missglückte Frisur lustig machen) über komplette Ignoranz (streitende Eltern am Frühstückstisch) bis hin zu offener Androhung von Gewalt, sollte es einem in Gegenwart einer jugendlichen Möchtegern-Gangsta-Rapper-Truppe rausrutschen, die ohne Text- und Taktgefühl schlechte Reime in ein überfülltes U-Bahn-Abteil brüllt.
Bei dem Pärchen auf dem Praxissofa gab es sogar eine körperliche Reaktion: Beiden klappte die Kinnlade herunter. Was Nala gut nachvollziehen konnte, hatten Franziska und Thorben Seligmann doch bestimmt nicht damit gerechnet, dass ihre gewöhnlich so sanft und verständnisvoll kommentierende Eheberaterin beim elften Termin auf einmal rumschnauzen würde wie ein Berliner Busfahrer.
»Ehrlich, ihr wohlstandsverwahrlosten Nichtsnutze! Ihr kotzt mich so an mit euren Erste-Welt-Problemen!«
Als spezialisierter Paartherapeutin war Nala bewusst, dass sie sich mit Wutausbrüchen zurückhalten sollte, wenn sie an der Aufrechterhaltung einer gesunden Therapeutin-Patienten-Beziehung interessiert war. Selbst dann, wenn die beiden Mittvierziger sich vor ihr wieder einmal wegen eines vor dem Spülen nicht heruntergeklappten Klodeckels anmotzten.
Thorben: »Dir mag es ja egal sein, Franziska, dass die E.-coli-Bakterien durchs ganze Badezimmer fliegen, aber ich will mir mit einer Zahn- und nicht mit einer Klobürste die Zähne putzen.«
Franziska: »Sagt der, der seine Lunge mit einem Aschenbecher verwechselt. Du rauchst am Tag mehr Zigaretten als Helmut Schmidt in seinem gesamten Leben.«
Thorben: »Nikotin macht körperlich abhängig. Welche Entschuldigung hast du für deine Online-Shopping-Sucht? Wenn ich dir dein Handy wegnehme, hast du schlimmere Entzugserscheinungen als ein Crack-Junkie.«
»Echt jetzt? Klodeckel und Online-Shopping? Das sind eure Probleme?« Nala zog sich an den hölzernen Lehnen ihres Sessels so weit nach vorne, bis ihr Po kaum noch die Polsterkante berührte, womit sie bei dem Ehepaar, das unwillkürlich vor ihr zurückwich, den Eindruck hinterlassen musste, als machte sie Trockenübungen für die nächste Skisprungsaison.
»Ihr nichtsnutzigen, von Geburt an auf den Beruf ›Erbe‹ vorbereiteten Privatschulschnösel habt einen Tross von Haushaltshilfen, Köchen, Gärtnern und Nannys, die euch von morgens bis abends in eurer Grunewald-Villa den Arsch hinterhertragen. Mann, ihr habt so viel Kohle! Dass ihr zu viel shoppt, merkt ihr doch nicht am Kontostand, sondern allenfalls an dem röchelnden DHL-Boten, der in eurem Vorgarten unter der Last der zu liefernden Pakete zusammengebrochen ist. Und, verdammte Hacke, es wird in eurer 450-Quadratmeter-Villa doch wohl ein zweites Bad geben, in dem deine Frau allein kacken gehen kann?«
Auch hier wusste Nala als studierte Psychologin sehr wohl, dass derartige Sätze nur selten zur Auflockerung einer angespannten Gesprächsatmosphäre beitrugen. Doch als vierunddreißigjährige, alleinstehende Frau mit einer maximalen Lebenserwartung von vielleicht noch fünf Monaten war ihr das in diesem Moment herzlich egal.
Scheiße.
Der Schmerz durchzuckte ihre linke Schläfe. Die Augen tränten. Sie legte den Kopf in den Nacken und blinzelte die stuckverzierte Decke des Praxiszimmers in ihrer Charlottenburger Altbauwohnung an.
Die Symptome kannte sie. So fing es an. Unzumutbar wie eine Migräne. Tödlich wie Rattengift, nur schleichender.
Sie griff nach der Kleenexbox, die für ihre Klienten parat stand, und trocknete sich die Augen. Die Seligmanns starrten sie weiterhin mit offenem Mund an.
Zugegeben. Die beiden hatten Pech. Hätte Nala das finale Gespräch mit ihrem Arzt nicht unmittelbar vor diesem Termin geführt, wäre sie vermutlich nicht so von der Rolle gewesen. Simon Schultz, ihr Ex-Freund, Neuroradiologe und so etwas wie der Hausarzt der Familie, hatte nur betroffen ihre Entscheidung zur Kenntnis genommen und gar nicht erst versucht, sie umzustimmen. Wahrscheinlich hatte er gewusst, dass er es nicht geschafft hätte, sie zu überreden, doch noch einmal eine Chemo zu starten. Die Nebenwirkungen hatten sie beim ersten Mal schon fast umgebracht.
Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen – das las sich so harmlos auf den Beipackzetteln, verglichen mit der Möglichkeit eines verlängerten Überlebens. Doch wenn man monatelang Symptome aushalten musste, gegen die die Lebensmittelvergiftung nach dem Fischrestaurantbesuch wie eine Spa-Behandlung wirkte, dann war »Nie wieder« ein willkommener Gedanke.
Und das hatte Nala sich geschworen.
Nie wieder.
Keine Tabletten mehr. Keine Spritzen, keine Bestrahlung.
Zweieinhalb Jahre lang hatte es den Anschein gehabt, als wäre das nicht mehr nötig. Doch dann hatte das besiegt geglaubte Drecksding in ihrem Kopf wieder zu wachsen begonnen.
Verdammte Kontrolltermine.
Die schlimmsten Prüfungen der Welt. Obwohl von ihnen das gesamte restliche Leben abhing, konnte man sich nicht auf sie vorbereiten. Hilflos war man dem ärztlichen Examenskomitee ausgeliefert und konnte nichts anderes tun als bangen und hoffen, bis die Noten verkündet wurden. Blutwerte und Kernspinergebnisse, die darüber entschieden, ob man ins nächste Lebensjahr versetzt wurde, die Schmerzklasse wiederholen oder die Schule des Lebens ohne Abschluss verlassen musste.
Simon hatte bei der Notenverkündung vor drei Wochen nichts sagen müssen. Sie kannte ihren besten Freund so gut, dass sie es von seiner Miene ablesen konnte. Wie er auf den Monitor mit den MRT-Aufnahmen blickte, die er gerade von ihrem Schädel gemacht hatte. Die Trauer und die Angst in seinen Augen waren womöglich noch intensiver gewesen als die, die sie in diesem Moment selbst gefühlt hatte.
Blöde Kuh, wieso bist du nur zu ihm gegangen?
Weshalb hatte sie Simon damit belastet und für die Kontrolluntersuchungen keinen neutralen Arzt gewählt?, waren ihre ersten, sich selbst verfluchenden Gedanken gewesen. Ihr Ex – und heute noch guter Freund – hatte sie vor fast drei Jahren überredet, wegen ihrer Taubheitsgefühle im rechten Arm in seine Praxis in Berlin-Steglitz zu kommen. Dort hatte er das cerebrale Lymphom entdeckt. Ohne ihn und seine fürsorgliche Betreuung hätte sie die anschließende Behandlung nicht durchgestanden, bei der er in seinem Kummer fast genauso viel abgenommen hatte wie sie während der Einnahme ihrer Zytostatika-Tabletten.
Nun belastete sie ihn mit ihrer Entscheidung, dieses Mal nichts dagegen zu unternehmen.
»Nein, Simon, das stehe ich nicht noch einmal durch. Mein Entschluss steht fest. Du hast selbst gesagt: Der neue Tumor wächst aggressiver als der erste. Die Erfolgsaussichten sind also sehr viel schlechter als beim letzten Mal. Zudem: Jetzt geht es mir gut. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird mir bis zum finalen Stadium ein halbwegs normales Leben möglich sein. Deshalb: nein, keine weitere Chemo. Ich will die wenige mir noch verbleibende Zeit nicht mit einem Behandlungs- und Nebenwirkungsmarathon verbringen.«
Das hatte sie ihm direkt vor der Sitzung am Telefon noch einmal endgültig bestätigt. Entsprechend aufgewühlt war sie zu den Seligmanns in die Paartherapiestunde gegangen.
»Dann bleiben dir maximal noch vier erträgliche Monate. Vielleicht weniger!«, hatte Simon traurig festgestellt. Worte, die ihr wieder und wieder durch den Kopf gegangen waren, während die Seligmanns sich benahmen, als wäre Zeit ein nachwachsender Rohstoff.
»Ich höre euch nun schon seit Monaten einmal die Woche zu, und außer den ständig wechselnden Luxusklamotten an eurem Leib kann ich keine Veränderung feststellen. Das ist Lebenszeitverschwendung und damit sinnlos für uns alle.«
»Was soll das heißen?«, fragte Franziska, die als Erste ihre Stimme wiedergefunden hatte.
Nala lächelte ihr zu. »›Tschüs dann‹, soll das heißen.« Sie stand aus ihrem Sessel auf und ließ die beiden Backsteine glotzend auf dem Sofa sitzen, während sie sich zur Tür aufmachte.
»Äh, wir haben noch vierzig Minuten!«, rief Thorben ihr schüchtern hinterher.
Was etwa 0,02 Prozent des mir noch verbleibenden Lebens wären.
Nala drehte sich zu ihnen herum. Sprach jetzt wieder mit ihrer freundlichen Therapeutinnenstimme: »Na, dann nutzt die Zeit. Keift weiter rum. Ruft eure Scheidungsanwälte an. Oder bestellt was Schönes. Einen abschließbaren Klodeckel vielleicht. Ich für meinen Teil hab jetzt Besseres zu tun.«
Sie schmetterte die Tür ins Schloss, kurz nachdem sie die beiden noch hatte wissen lassen: »Ich geh jetzt auf ein Date!«
2. Kapitel
Ich fasse den Irrsinn noch mal zusammen«, sagte ich und setzte die Sonnenbrille ab, um im Gesicht meines besten Freundes nach Anzeichen suchen zu können, dass er nun auch noch sein letztes bisschen Verstand verloren hatte.
Wir lagen nebeneinander auf unbequemen Plastikliegen vor einem himmelblauen Baumarkt-Swimmingpool im Hintergarten eines Reihenendhauses in Zehlendorf, nahe Mexikoplatz. Es war Mitte Mai. Berlin hatte gerade erst eine Starkregenperiode überstanden, die nun von einer drückenden Hitzewelle abgelöst wurde, weswegen Raphael und ich Shorts und T-Shirts trugen. Bestes Badewetter, hätte es da nicht das klitzekleine Problem gegeben, dass der halb eingesunkene Planenpool vor uns leer war; die langsam verdunstenden Regenpfützen darin einmal ausgenommen.
»Du hast eine Frau im Internet kennengelernt und dich zum Blind Date verabredet. Und jetzt soll ich mich statt deiner mit ihr treffen?«
Die Idee, die mir Raphael gerade unterbreitet hatte, klang in meinen Ohren in etwa so attraktiv, wie wenn er mich aufgefordert hätte, mein gesamtes Vermögen in einen Verleih für gebrauchte Ohrenstäbchen zu stecken.
»Tu es mir zuliebe«, sagte er grinsend. Wobei ich vermutlich der einzige Mensch auf dem Planeten war, der Raphaels herabgezogene Mundwinkel als Grinsen deuten konnte. Die meisten anderen würden darin eine schmerzverzerrte Grimasse sehen.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der sein Spitzname (Spargel) Menschen mit albernem Humor (wie mir) ein Lächeln hatte abringen können. Letztes Jahr noch, als er hundertfünfundzwanzig Kilo auf die Waage gebracht hatte und der Aktienkurs von Dr. Oetker in die Knie ging, weil der Umsatz an Tiefkühlpizza einbrach, sobald er im Urlaub war. (Nicht mein Spruch, sondern seiner. Anwaltshumor vermutlich.)
Heute wünschte ich mir die Tage zurück, in denen er wegen seines Gewichts gehänselt worden war. Die Momente, als er den dummen Idioten, die meinten, ihn wegen seines Äußeren in der Öffentlichkeit beleidigen zu müssen, mit seiner Schlagfertigkeit verbal eins vor den Latz ballerte. Wie etwa dem Kellner, der Raphael im Schnitzelrestaurant fragte: »Du brauchst keine Karte, oder? So, wie du aussiehst, bestellst du eh alles auf einmal!«
Während ich noch darüber nachdachte, ob ich das wirklich gehört hatte, hatte Spargel mir bereits die Pranke auf die Schulter geklatscht und mich mit seiner allerbesten Knochenbrecher-Imitationsstimme gefragt: »Julius? Was errr gesagt?«
Worauf ich ihm antwortete: »Lass dich nicht ärgern, Sergei. Wir sind hier, um zu feiern, dass der Kronzeuge in deinem Mordprozess ganz plötzlich verschwunden ist.«
Okay, unsere Mafiosi-Impro-Show war vielleicht keine kreative Meisterleistung gewesen, zeigte jedoch Wirkung. Sie hätten sehen sollen, wie dem Kellner, der sich schon mit Betonschuhen am Grund des Landwehrkanals sah, das Blut aus dem Gesicht schoss. Womit er an jenem Tag in etwa so blass ausgesehen hatte wie Raphael heute. Sechzig Kilo leichter, nur noch ein Schatten seiner selbst.
Erwähnte ich bereits, dass mein bester Freund nicht nur auf einer unbequemen Gartenliege, sondern im Sterben lag?
Tut mir leid, aber wieso sollte ich es Ihnen schonend beibringen? Das Leben ist das Gegenteil von fair. Wer zur Untermauerung dieser These noch nach einem Beweis suchte, hatte ihn mit Raphaels Schicksal gefunden. Es gab Menschen, bei denen man lange nachdenken musste, wenn man sie im Nachruf in einem guten Licht zeichnen wollte, ohne von der Trauergemeinde als heuchlerischer Lügner entlarvt zu werden. Bei Raphael würde es umgekehrt sein. Hier würde man aufpassen müssen, nicht die eingeplante Rededauer um zweieinhalb Stunden zu überschreiten, weil man all seine Vorzüge aufzählen wollte. Keine Bange, ich will es an dieser Stelle kurz halten: Mir war kein großzügigerer, offenherzigerer und klügerer Mann bekannt als er. Raphael Nader, der zeit seines Lebens wieder und wieder grundlos gedemütigt wurde, ließ die Wut und Verzweiflung, die er darüber empfunden haben muss, nie an anderen aus. Nicht an seinem kleinen Bruder, der ihm körperlich unterlegen gewesen wäre; nicht an seiner ersten und einzigen großen Liebe Kathrin, mit der er meines Wissens nie einen nennenswerten Streit hatte, selbst an dem Tag nicht, an dem sie ihn für ihre Kosmetikerin verließ. Und nicht einmal im Gerichtssaal, wo er selbst bei seinen pointierten Plädoyers nie die Grenze des Anstands überschritt.
Manchmal war ich versucht, ihm vor seiner Strafrechtskanzlei aufzulauern, um zu überprüfen, ob Raphael wirklich nach getaner Arbeit nach Hause ging oder nicht vielleicht wie Dexter 2.0, mit Knochensäge und Schweißerhaube ausgestattet, jenen Klienten einen Besuch abstattete, von denen er wusste, dass sie schuldig waren. Ich meine, irgendwo musste er doch mal seine Verzweiflung darüber rauslassen, dass er schon zu Schulzeiten gemobbt worden war. Warum nicht in einer schalldicht isolierten Garage eines verlassenen Industriekomplexes? Ja, richtig erkannt, ich schaue gerne True-Crime-Serien.
»Es ist doch nur ein Treffen«, sagte er, während ich in meinen Shorts vergeblich nach einem Taschentuch suchte. Verdammter Heuschnupfen!
Ich fragte ihn: »Weshalb schreibst du ihr nicht einfach die Wahrheit, die da lautet: ›Tut mir leid. Ich muss unser Date absagen, mir geht es heute zu schlecht.‹«
»Heute?« Raphael sah mich mit Augen an, deren Äpfel einst weiß gewesen waren, nun aber die Farbe von geronnenem Eigelb hatten. Eine der Spätfolgen seiner Krankheit. Was für eine Ironie des Schicksals. Er, dem es nie in den Sinn gekommen wäre, Spinnen mit dem Staubsauger einzusaugen (wie seine Mutter es getan hatte), sondern der die Achtbeiner stets mithilfe eines Stücks Papier und einem Glas einsammelte, um sie im Garten in die Freiheit zu lassen, war zum Dank von exakt so einem Spinnentier getötet worden. Einer Zecke, genauer gesagt, deren Biss Raphael zuerst nicht einmal bemerkt hatte. Vielleicht hatte er eine Hautrötung festgestellt und später einsetzende Glieder- und Kopfschmerzen als harmlose Erkältung abgetan. Möglicherweise hatte er eine Ibu mehr als sonst eingeworfen. Bis er fünf Jahre später mit einem Mal nicht mehr die Augen bewegen konnte, wenn er nicht wollte, dass ihm die Schädeldecke wegflog. Da zu dieser Zeit gerade wieder eine Corona-Welle im Anmarsch war, tippte der erste Arzt auf Covid. Der nächste Mediziner vermutete Migräne, da waren seine Sprachstörungen schon kaum mehr zu überhören. Als die Symptome so qualvoll wurden, dass er mir gegenüber das Wort »Suizid« aussprach, zwang ich ihn zum wiederholten Mal in die Notaufnahme, wo er dann endlich an einen fähigen Neurologen geriet, der den richtigen Riecher hatte: Borreliose. Bakterielle Hirnhautentzündung.
Drei Monate lang wurde er im Krankenhaus mit allem beschossen, was die Intensivmedizin so im Köcher hat, und irgendwann schlug eines der Antibiotika auch an, doch da war es leider bereits zu spät. Zwar waren die Schmerzen mittlerweile wieder auszuhalten, doch wegen der verzögerten Behandlung waren seine Organe bereits irreversibel geschädigt. Operationen wurden nicht mehr durchgeführt, da das angegriffene Herz diese nicht mehr durchhalten würde. Weswegen Raphael, mein fünfunddreißigjähriger bester Freund, der nach dem Verlust seiner ersten und einzigen großen Liebe nun schon seit zehn Jahren Single war, das einzig Richtige getan hatte. Er hatte sich auf einem Datingportal angemeldet.
»Du selbst hast mir doch TWD empfohlen«, sagte er, während ich mir die juckenden Augen rieb. Normalerweise reagierte ich erst Anfang Juni auf Gräser und Pollenflug, aber anscheinend hatte der Klimawandel auch meine Allergieuhr durcheinandergebracht.
»Ja. Damit du auf andere Gedanken kommst. Nicht, damit ich deine Dates für dich wahrnehme.«
TWD war die Abkürzung für »The Walking Date«, eine Datingplattform für Menschen mit begrenzter Lebenserwartung, was in meinen Augen eine ebenso simple wie geniale Idee war. Die meisten Portale fokussierten sich auf eher junge Kundinnen und Kunden, die es verlernt hatten, von ihrem Handy aufzuschauen, um so etwas Verrücktes zu tun, wie sich für die Menschen in ihrer näheren Umgebung zu interessieren, ihr noch unbekanntes Gegenüber anzulächeln, mit ihm Augenkontakt zu halten und – jetzt wird’s völlig absurd – eventuell sogar ein Gespräch anzufangen.
Tatsächlich gab es eine überwältigende Anzahl von Menschen, die zu einem Flirt im realen Leben nicht mehr in der Lage waren, sich aber von den Datingportal-Werbespots wenig angesprochen fühlten, die eng umschlungene, in einem Berliner Szeneclub tanzende Fitnessmodels zeigten. Schafften sie es doch als fünfundachtzigjähriger Witwer mit Rollator nicht einmal mehr bis in den Zuweg zum Berghain, geschweige denn bis zum Türsteher. Bei TWD meldeten sich ältere Semester an, allerdings auch Menschen, die wussten, dass sie wegen einer schweren Krankheit in absehbarer Zeit nicht mehr am Leben sein würden. Leute wie Raphael, die nur noch einen großen Wunsch hatten, nämlich den, sich ein letztes Mal zu verlieben, ohne sich Sorgen darüber machen zu müssen, dass sie im Erfolgsfall jemanden in tiefster Trauer zurückließen. Denn bei TWD trafen sie ausschließlich auf Schicksalsgenossen.
Das Datingportal, das anfangs von den Medien als Rentner-Tinder belächelt worden war, hatte im Netz eingeschlagen wie eine Bombe, was mich persönlich aus mehreren Gründen freute. Zum einen, weil mein bester Freund darüber tatsächlich eine Seelenverwandte gefunden hatte. Eine bislang rein platonische Brieffreundschaft, die ihm in seinen dunkelsten Stunden Trost und in seinen hellen Momenten Hoffnung spendete. Zudem sicherte TWD mir mein Auskommen, war ich doch einer von zwei Eigentümern der Plattform. Ja, okay, ich gebe es zu: Vor diesem Hintergrund ist meine oben getätigte Bewertung »simple, geniale Idee« nicht ganz unvoreingenommen, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich bin ein Online-Unternehmer, der sich auf ungewöhnliche Start-up-Ideen spezialisiert hat. Das Portal TWD hatte ich bereits vor drei Jahren gegründet, nachdem ich eine Reportage über Altenheime gesehen hatte. Darin waren die Bewohner gefragt worden, was sie an ihrem Lebensabend gerne noch einmal erleben würden, wenn sie einen einzigen Wunsch frei hätten. Tatsächlich waren sich viele Witwen und Witwer einig: Sie wollten sich noch einmal verlieben. Eine Woche später hatte ich bereits das erste Seitenlayout von TWD. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass es Jahre später von meinem besten Freund genutzt werden würde.
»Lass es mich dir erklären«, sagte nun Raphael und erklärte es mir, nachdem einer seiner obligatorischen Hustenanfälle vorbei war. »Exupéria hat eine symptomfreie Phase. Ihr Lymphom wächst, aber momentan geht es ihr gut.«
»Du nennst sie noch immer Exupéria?«, hakte ich nach.
Er nickte. »Wir haben noch nicht unsere Klarnamen ausgetauscht. Auch nicht unsere Fotos. Sie kennt mich nur als PetitPrince35.« Er lächelte, zumindest glaubte ich das in dem Blecken seiner Zähne zu erkennen. Auch ich musste schmunzeln, denn ich wusste, woran er dachte. Er hatte es mir schon oft erzählt. Wie sie beide schon vor dem Austausch der ersten Privatnachricht erkannt hatten, dass sie ein Match waren. Allein an ihren Profilnamen, die auf ihr Lieblingsbuch zurückzuführen waren: »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry.
»Deswegen wird unser Tausch klappen«, sagte er. »Sie weiß nicht, wie du heißt und wie du aussiehst. Du kannst dich ihr als Julius Leineweber vorstellen und musst dir nichts aus den Fingern saugen.«
»Abgesehen davon, dass ich kerngesund bin«, rutschte es mir heraus. Einen Atemzug später musste ich mehrfach niesen.
»Auch darüber musst du dir keine Sorgen machen. Ich hab ihr nichts von meinem Zeckenbiss erzählt.«
»Sondern?«
Seine ohnehin schon brüchige Stimme wurde traurig.
»Mann, ich wusste doch, dass ich ihr nie unter die Augen treten kann. Aber ich wollte es so sehr. Sie sehen, mit ihr persönlich sprechen. Real, nicht über einen Bildschirm. Ganz am Anfang unseres Nachrichtenaustauschs hat sie mir von ihrer Diagnose erzählt und dass sie deshalb schon einmal bei TWD angemeldet gewesen war, ihren Account dann allerdings zwei Jahre lang stillgelegt hatte, weil sie dachte, der Tumor wäre besiegt. Doch dann kam er zurück, und jetzt lehnt sie eine weitere Chemo ab. Weil sie nicht ihre Tage auf Erden verlängern, sondern die wenigen Tage intensivieren will, verstehst du?«
Ich nickte, enthielt mich aber jedes Kommentars, weil ich als Nichtbetroffener gelernt hatte, dass auch das ausgeprägteste Einfühlungsvermögen mich niemals in die Lage versetzen würde, das zu verstehen, was mein bester Freund gerade durchlitt. Tränen traten ihm in die Augen, während er weitersprach. »Exupéria ist nicht naiv. Sie weiß, wie unwahrscheinlich es ist, dass aus einer Brieffreundschaft mehr wird als nur ein netter Nachmittag. Aber genau darum geht es ihr. Das hat sie von Anfang an klargemacht. Sie will ein reales Treffen. Ihrem Gegenüber beim Reden in die Augen sehen. Gemeinsam lachen, vielleicht, wenn es richtig gut läuft, etwas flirten. Ich hab gewusst, wenn ich ihr sage, dass ich dazu nicht in der Lage bin, weil ich ja schon für den Weg in den Garten eine halbe Stunde brauche, wird sie weiterscrollen. Zu einem nächsten Match, weil sie einfach nicht die Zeit hat, sich mit mir abzugeben.« Er zog die Nase hoch. »Deswegen habe ich sie angelogen. Ihr gesagt, ich hätte dasselbe wie sie. Ein cerebrales Lymphom. Wäre auch in einer Phase ohne Symptome. Und könnte mit ihr gemeinsam die letzten Tage genießen.«
Ich griff nach seiner Hand, die sich wie ein Stück trockenes Holz anfühlte. »Hör mal, Spargel. Ich glaube, du irrst dich. Wenn sie ein guter Mensch ist, wird sie es verstehen. Sie wird sich trotzdem freuen, dich zu sehen. Mit dir zu reden, anstatt nur zu schreiben.«
»Ich schaff das nicht.«
Ich dachte nach. »Wo soll das Date denn steigen?«
»In Halensee. Sie hat das Restaurant ausgesucht.«
»Ich fahre dich hin, okay? Meinetwegen bin ich am Nebentisch die Anstandsdame. Wovor hast du Angst?«
»Vor ihrem Blick.«
»Du hast Angst, dass sie dich zurückweist?«
Raphael hob müde zwei Finger der rechten Hand, was wohl eine abwinkende Geste darstellen sollte. »Es geht hier nicht um mich.«
Und wie sollte es auch anders sein? Er, der sich zeit seines Lebens mehr um andere als um sich selbst gekümmert hatte, war natürlich auch im Sterben nicht egoistisch. »Ich fürchte mich davor, ihre Hoffnung zu zerstören. Auch wenn wir nicht ständig über den Elefanten im Raum sprechen, wissen wir doch, dass unsere Tage gezählt sind. Aber wir wissen auch, dass ein ehrlich empfundenes, tiefes Glücksgefühl die beste Medizin ist, während negative Emotionen unsere Lebenszeit verkürzen. Und mein Anblick ist nun mal die sicherste Methode, einem Menschen vor Augen zu führen, dass das Ende schneller kommen kann, als man denkt.
Als Gesunder hältst du das aus, Julius. Du schaffst es, mich und mein Elend zu verdrängen, sobald du hier raus und wieder unter den Lebenden bist. Aber eine Krebspatientin wie Exupéria hat keine Wohlfühlzone mehr, in die sie sich zurückziehen könnte. Jede Stunde, ach was, jede Minute jedes verdammten Tages dreht sich nur noch um den Tod. Um Tabletten, Untersuchungen, Testamente, Patientenverfügungen, Lebensversicherungen. Die Trigger-Liste ist unendlich: Zigarettenwerbung, küssende Pärchen, der Reisepass, den es sich nicht zu verlängern lohnt. Du bist froh, wenn du den Tod wenigstens kurz verdrängen kannst, weil du dich auf ein erstes letztes Date freust. Und dann stehe ich vor ihr. Und sie denkt: Scheiße, so ende ich auch bald.
Das zerstört alles. Das verkürzt ihr Leben. Das will ich ihr nicht antun. Und halt!«, sagte er, als er sah, dass ich den Mund öffnete. »Bevor du jetzt wieder sagst, du verstehst … was du wirklich tust, Julius, das sehe ich dir an, und das liebe ich so an dir, dein Mitgefühl und deine Empathie. Aber bevor du mich unterbrichst und ich wieder husten muss, lass dir gesagt sein, dass Absagen keine Lösung ist.«
Er hustete, aber nur kurz. »Sie freut sich schon so lange auf unser Date«, sagte er mit einer Stimme, die erkennen ließ, dass es bei ihm genauso war. »Ich kann jetzt nicht Knall auf Fall absagen. Sie würde sich fühlen, als wäre sie versetzt worden, und das verkraftet man schon im gesunden Zustand nur schwer!«
Ich nickte unwillentlich.
»Und deswegen musst du für mich da hingehen. Das ist deine leichteste Übung. Im Gegensatz zu mir haben dir die Frauen schon immer zu Füßen gelegen. Du wirst sie zum Lachen bringen, ihr eine gute Zeit bereiten, ihr Hoffnung schenken. Bitte, tu es für mich. Nenn es meinen letzten großen Wunsch, den ich an dich als meinen allerbesten Freund habe!«
3. Kapitel
Ich stand auf und setzte mich auf seine Liege, die noch bis vor wenigen Monaten nicht einmal sein Gewicht allein ausgehalten hätte. »Ich danke dir. Für deine Worte, deine Liebe, deine Ehrlichkeit. Aber ich hasse dich auch. Für deine Erpressung. Mann, ernsthaft, du kommst mir mit der ›Das ist mein letzter Wunsch‹-Keule?«
»In meinem Zustand muss man zu jedem Mittel greifen, um sein Ziel zu erreichen. Außerdem …«, er atmete schwer, »… außerdem bist du uns beiden etwas schuldig. Immerhin haben Exupéria und ich dich auf deine nächste Geschäftsidee gebracht.«
Womit er recht hatte. Als Raphael mir erzählte, dass die beiden sich über ihr gemeinsames Lieblingsbuch kennengelernt hatten, kam mir ein Gedanke, der mich elektrisierte. Was, wenn es eine Datingplattform gäbe, auf der Menschen ihre Bücherregale abfotografierten und online stellten? Eine Software überprüfte dann die Regale der Liebessuchenden. Und die Kandidaten, die die größte Übereinstimmung in der Auswahl ihrer Lieblingsbücher hatten, wurden verkuppelt. Keine schlechte Idee für jemanden, der weniger Bücher in seiner Wohnung hatte als ein Papierallergiker, oder? Auch in den Namen, der mir spontan für das Datingportal in den Sinn gekommen war, war ich schockverliebt: Das Lesen ist schön!
Der hatte im Übrigen auch Dr. Hartmuth von Vierlaken überzeugt, seines Zeichens Multimillionär und bauernschlauer Bauunternehmer, den ich letzte Woche zu einem Gründungsinvestment hatte überreden können.
»Mit TWD schreibst du eine schwarze Null. Aber mit DLIS kannst du dir den Porsche endlich auch leisten, den du fährst«, sagte Raphael.
Ich seufzte und signalisierte mit meiner nächsten Frage, dass er mich geschlagen hatte. »Und wie zum Teufel soll ich das Jessica erklären?«
Raphael verzog das Gesicht. Er hatte noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er meine Verlobte nicht leiden konnte, die ich in drei Wochen heiraten würde. »Jessy ist zwar nicht besonders eifersüchtig, aber ich fürchte, sie wäre auch nicht besonders amüsiert zu erfahren, dass ich mir die Zeit vor der Hochzeit mit Speed-Datings vertreibe.«
Raphael zog die rechte Augenbraue hoch. »Glaub mir, wenn es jemanden gibt, der das versteht, dann sie!«
»Was willst du damit andeuten?«, fragte ich, obwohl ich natürlich genau wusste, dass er nichts andeutete, sondern mit dem Holzhammer um sich schlug. In seinen Augen ging Jessica viel zu oft ohne mich feiern, gab viel zu viel Geld für Unnötiges aus und war eine viel zu sehr nach außen gerichtete Persönlichkeit. Als ich ihm erzählte, wie sie mir auf dem Pariser Eiffelturm einen Antrag gemacht hatte, tat er nicht eine Sekunde so, als würde er sich für mich freuen – wie meine anderen Freunde, die Jessica dafür bewunderten, dass sie so selbstbewusst war, nicht auf den Mann zu warten. Stattdessen hatte Raphael es folgendermaßen kommentiert: »Sie hat dir die perfekte Falle gestellt. Ein Antrag in der Öffentlichkeit vor Zuschauern, womöglich einem halben Dutzend mit Smartphone bewaffneter Zeugen? Sie weiß, wie du tickst. Es wäre dir viel zu peinlich gewesen, ihn abzulehnen.«
Meinen Einwand, dass ich pure Freude empfunden hätte, nahm er schweigend zur Kenntnis; mit ebenjenem spöttischen Blick, den er mir jetzt wieder zuwarf, nur aus gelbstichigeren Augen.
»Wieso sagst du Jessica nicht die Wahrheit? Deiner Meinung nach ist sie die Richtige. Dann wird sie es wohl verstehen, dass du mir einen Gefallen tust.«
»Ich würde es Jessica ja sagen, aber sie feiert mit ihren Freundinnen einen Detox-Junggesellinnenabschied auf Hiddensee.« Eine Woche Ostseeinsel-Einsamkeit ohne Kohlenhydrate, ohne Internet und ohne Handy.
»Und das glaubst du?«
»Natürlich.«
»Bestens, dann wird sie es ja auch nicht mitbekommen«, sagte er. »Du gehst auf das Date, ihr habt eine gute Zeit, und niemand wird je davon erfahren. Es wird nicht das geringste Problem geben.«
Tja, was soll ich rückblickend dazu sagen? Außer:
Auch Sterbende können sich in ihren Einschätzungen dramatisch irren, wie ich in den folgenden Stunden, die mein Leben für immer veränderten, auf drastische Art und Weise erfahren sollte. Das hätte mir schon in der Sekunde klar sein müssen, als Raphael auf meine Frage »Also gut, wann soll das Date denn steigen?« auf die Uhr sah und mir mit müder Stimme antwortete: »In knapp zwanzig Minuten etwa.«
4. Kapitel
Dafür, dass es bei diesem ersten erzwungenen Blind Date bleiben würde, sorgte ich schon mit meinem Outfit, in dem ich im Restaurant aufschlug und das sich mit einem einzigen Wort treffend beschreiben lässt: peinlich!
Ich schämte mich bereits auf dem Weg vom Parkplatz bis zu dem Lokal in der Damaschkestraße, das ich natürlich zehn Minuten zu spät betrat. Aber hätte ich zuvor noch einen Umweg zu mir nach Hause gemacht, hätte ich noch einmal eine halbe Stunde dranhängen müssen, um den Weg von Zehlendorf über Schöneberg nach Charlottenburg zu schaffen. Wenigstens wäre ich dann frisch geduscht und in anständigen Klamotten aufgetaucht und nicht in Flipflops und einem mir seit der letzten Wäsche viel zu kleinen, weil eingelaufenen schwarz-gelben Trainingsanzug. Den hatte ich aus meiner Fußballtasche im Kofferraum gekramt und ihn nach kurzer, verzweifelter Abwägung für grauenhaft, aber immer noch für besser befunden als die durchgeschwitzte kurze Khakihose, die ich mir beim Aufstehen von Raphaels Gartenliege an einer rostigen Kante am Hintern aufgerissen hatte.
Irgendwie paradox.
Obwohl sich alles in mir sträubte, überhaupt zu diesem Date zu gehen, legte ich seltsamerweise Wert auf einen guten ersten Eindruck. Dass ich den bei Exupéria eher nicht erzielte, erkannte ich an ihrem überraschten Gesichtsausdruck, als ich das Lokal betrat.
Das Restaurant hieß Maya-Grill und lag unweit vom Kurfürstendamm. Es sollte eine »Neuinterpretation europäischer Küche« servieren und erinnerte mich an ein Gewächshaus mit Bistrotischen. Die Wände waren mit Efeuflächen und Moosbildern tapeziert. Statt Parkett wandelte man auf echtem Rollrasen. So gesehen hätte ich mir Stollenschuhe anziehen können, um mein Fußball-Outfit zu komplettieren. Die irritierte Miene des einzigen allein sitzenden weiblichen Gastes hätte das kaum noch mehr verstärken können.
Sie saß in der hintersten linken Ecke des Restaurants mit dem Rücken zur Mooswand am Fenster und sah mich aus großen schwarzen Augen an. Ihre ebenso dunklen wie dicken Haare trug sie zu einem losen Zopf, aus dem ihr vereinzelte Strähnen ins ebenmäßige Gesicht fielen.
»Exupéria?«, fragte ich, als ich in Hörweite war. An dem Tisch neben ihr sah mich ein blond gescheitelter Mittdreißiger erschrocken an und wandte sich sofort wieder ab, als könnte mein Outfit ansteckend sein.
Die Angesprochene, die sich für ihre Verabredung deutlich besser zurechtgemacht hatte als ich, nickte. Es gibt ja Modedesigner, deren Kunden offensichtlich eine enorme Sehschwäche haben, weswegen sie ihre Markenlabel so groß auf T-Shirts, Pullover oder Handtaschen drucken, dass man sie selbst von der ISS aus noch erkennen könnte. Mama (Gott hab sie selig) hatte sich gern über die lebendigen Reklametafeln lustig gemacht; besonders über die, die mit einer Handtasche von Louis Vuitton den dicken Maxe markierten, anstatt sich zu schämen, für einen Plastikbeutel im Wert von zwei Euro fünfzig das Zweitausendfache berappt zu haben. Zu dieser Sorte zählte mein Blind Date schon mal nicht. Sie trug das, was meine Verlobte Jessica den »Old Money Style« nennen würde: ein schlichtes, aber sicher teures Sommerkleid mit Wildblumenornamenten, dazu helle Segelsneaker. Eine auf ihr Outfit abgestimmte Handtasche baumelte an ihrer Stuhllehne. Ich hingegen sah in meinem schwarz-gelben Trainingsanzug wie Willi aus, der aus allen Nähten platzende beste Freund von Biene Maja.
»Sorry«, sagte ich und setzte mich. »Ich weiß, ich bin zu spät, und ich sehe unmöglich aus, aber ich hab im Stau gesteckt (Notlüge) und es nach dem Sport nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft (immerhin eine Halbwahrheit).«
»Kein Problem.« Sie lächelte. Exupéria sah hundemüde aus, aber nicht krank. Hätte mich Raphael nicht über ihre Diagnose aufgeklärt, hätte ich vermutet, sie wäre eine frischgebackene Mutter, die letzte Nacht nur drei Stunden Schlaf abbekommen hatte – und die nicht am Stück.
»Julius«, stellte ich mich ihr vor und reichte ihr die Hand über den Tisch, die sie mit erstaunlich festem Händedruck ergriff.
»Nala.« Sie lächelte noch immer. »Super, dass du wieder angefangen hast.«
»Womit?«, fragte ich irritiert.
»Mit dem Sport. In deiner letzten Nachricht hast du doch geschrieben, du wärst oft zu schwach dafür.«
Ach ja, stimmt. Ich war ja nicht ich, sondern Raphael. Na, das fing ja gut an. Keine zwanzig Sekunden, und ich hatte meine Rolle schon vergessen.
»Hatte heute einen positiven Schub. Den wollte ich nutzen. Ich hoffe, du hast hier nicht zu lange gewartet?« Ich deutete auf ihr leeres Wasserglas.