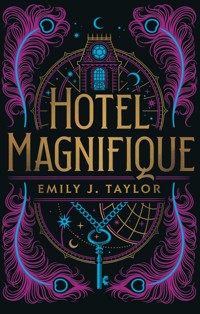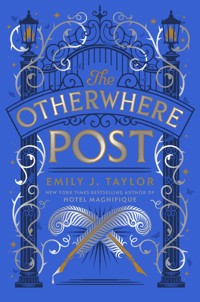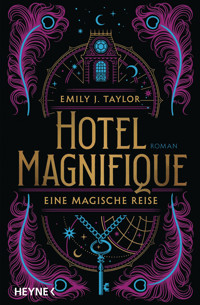
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Früh zur Waise geworden, schuftet Jani in einer Gerberei, um sich und ihre kleine Schwester Zosa durchzubringen, und träumt davon, aus ihrem tristen Leben in der Hafenstadt Durc auszubrechen. Ihr Wunsch scheint sich zu erfüllen, als eines Tages das legendäre Hotel Magnifique nach Durc kommt. Dort gibt es nicht nur allerlei Fantastisches zu bestaunen, nein, das Hotel selbst reist nachts, wenn seine Gäste schlafen, an die spektakulärsten Orte. Kurzerhand heuern Jani und Zosa dort als Dienstmädchen an. Doch irgendetwas scheint mit dem Hotel nicht zu stimmen. Als Zosa eines Tages spurlos verschwindet, ist Jani fest entschlossen, das Geheimnis des Hotel Magnifique zu ergründen, um ihre Schwester zu retten. Noch ahnt sie nicht, dass sie sich dabei in tödliche Gefahr begibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Seit dem frühen Tod ihrer Eltern schuftet die siebzehnjährige Jani Tag für Tag in einer Gerberei, um für sich und ihre kleine Schwester Zosa zu sorgen. Nachts träumt sie davon, das elende Leben in der grauen Hafenstadt Durc hinter sich zu lassen und auf ihre Heimatinsel Aligney zurückzukehren. Als das reisende Hotel Magnifique in Durc Station macht, scheint für die beiden Schwestern die Chance gekommen, sich ihren Traum zu erfüllen. Kurzerhand heuern sie im Hotel an – Zosa mit ihrer wunderschönen Stimme als Sängerin, Jani als Dienstmädchen – und trauen ihren Augen kaum: das magische Hotel ist noch viel spektakulärer als gedacht. Dort hängen mit Kerzen bestückte Glaskugeln wie riesige Trauben von der Decke des Foyers, goldene Blütenblätter tanzen wie im Wind und in einer riesigen Voliere tummeln sich die farbenprächtigsten Vögel.
Doch mit dem Hotel und vor allem mit seinem rätselhaften Direktor stimmt etwas nicht. Dessen ist sich Jani sicher und beginnt heimlich Nachforschungen anzustellen. Hilfe bekommt sie dabei von dem gut aussehenden Portier Bel, der keine Gelegenheit auslässt, mit Jani zu flirten. Dann verschwindet Zosa spurlos. Können Jani und Bel das dunkle Geheimnis des Hotel Magnifique lösen und Zosa retten?
»Eine wunderbares Abenteuer für alle, die sich nach etwas Magie im Leben sehnen.«
Kirkus
Die Autorin
Emily J. Taylor wurde in Kalifornien geboren. Nachdem sie ihre Kindheit und Jugend im Sonnenstaat der USA verbrachte, führten ihre Reisen sie nicht nur in vier verschiedene Länder und zwei Kontinente, sondern lieferten ihr auch einen reichhaltigen Schatz an Ideen für ihre Geschichten. Wenn sie nicht gerade schreibt, arbeitet Emily J. Taylor als Creative Director. Sie lebt inzwischen in Minneapolis. Mit ihrem Debütroman Hotel Magnifique erreichte sie die Top Ten der New York Times-Bestsellerliste.
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Bettina Spangler
Titel der amerikanischen Originalausgabe
HOTELMAGNIFIQUE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 10/2022
Redaktion: Uta Dahnke
Copyright © 2022 by Emily Taylor Creative LLC
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe undder Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung des Motivs von Jim Tierney
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-28787-0V001
www.heyne.de
Für Eric
Prolog
Die Kurierin erhielt eine einzige Anweisung: Liefere den Jungen vor Schlag Mitternacht aus. Ganz einfach, nur dass sie normalerweise Pakete überbrachte, tagsüber, nicht kleine Jungen mitten in der Nacht.
Der Auftrag war ordentlich bezahlt, aber das war nicht der eigentliche Grund, warum die Kurierin sich einverstanden erklärte. Sie nahm ihn aus Neugier an.
Sie wunderte sich, warum dieses gut situierte Paar damit ausgerechnet zu ihr kam. Warum der Vater des Jungen sich weigerte, die Adresse aufzuschreiben, und sie ihr stattdessen ins Ohr flüsterte. Warum die Mutter weinte. Aber vor allem trieb sie die Neugier, wer den Jungen in Empfang nehmen würde, denn die Lieferadresse war kein gewöhnliches Wohnhaus und auch sonst kein Bauwerk, sondern der Raum zwischen zweien – eine unbewohnte Gasse auf der anderen Seite der Stadt.
Der Junge machte einen gewöhnlichen Eindruck auf sie, mit makelloser kupferbrauner Haut, ein wenig dunkler als die ihre. Als sie losgingen, ließ er allerdings den Kopf hängen, als würde die undurchdringliche Dunkelheit der Nacht seine Schultern niederdrücken.
Die Kurierin reckte ihre Laterne der Finsternis entgegen, wehrte mit wachsendem Unbehagen nach allen Seiten hin Schatten ab. Die Geschichten ihres Großvaters kamen ihr in den Sinn: geflüsterte Worte über magische Dinge, die in den dunklen Winkeln dieser Welt lauerten, und über kleine Kinder, denen ein schauriges Schicksal widerfahren war.
Sie war zu alt, um noch an solche Märchen zu glauben, und doch beschleunigte sie ihre Schritte.
Einen Häuserzug von ihrem Ziel entfernt, fing der Junge an zu schlurfen und drosselte sein Tempo. Entschlossen packte sie ihn an der knochigen Schulter und zerrte ihn so die letzte Straße entlang. Dann blieben sie stehen.
Die Gasse war verschwunden. Ein sonderbares schlankes Gebäude ragte stattdessen vor ihnen auf. In die Lücke gezwängt, fügte es sich nahtlos an das bröckelnde Mauerwerk zu beiden Seiten.
Eine Gestalt schälte sich aus dem Schatten unweit der Eingangstür.
Die Kurierin schleifte den Jungen die letzten Meter hinter sich her. »Seid Ihr die Person, die ich hier treffen soll?«
Wer auch immer es war, den sie da vor sich hatte, hob ihr ein schmales, längliches Objekt entgegen. Eine blutrote Stabkerze flammte auf und warf ihren Schein auf das blasse Gesicht eines jungen Mannes mit blauen Augen.
Die Kurierin hielt verblüfft nach einer Streichholzschachtel Ausschau, um die Flamme zu erklären; kein Mensch konnte eine Kerze aus dem Nichts entzünden. Es sei denn …
Golden glitzernder Rauch quoll aus der Kerze, ergoss sich auf das Pflaster der Straße, schlängelte sich um die Kurierin. Winzige Pünktchen umschwirrten sie, flackerten wie Glühwürmchen oder Staubpartikel, in denen sich das Mondlicht fing. Oder etwas anderes. Verschiedene Gerüche wehten vorüber: von Pfefferminzöl, dann von verbranntem Zucker, als hätte man Karamell zu lange auf dem Herd stehen und Blasen werfen lassen, gefolgt von einem Hauch verrotteter Zitrone.
Der Mann trat durch den goldenen Rauch auf den Jungen zu und ergriff seine Hand, ganz wie ein Vater es machen würde. Für einen kurzen Moment stolperte der Junge unsicher, doch dann lief er bereitwillig neben dem Mann her auf das schmale Gebäude zu.
Die Kurierin griff sich an die Brust. Sie spürte, wie ihr Herz unregelmäßig schlug und heftiger denn je zuvor. Das ging alles nicht mit rechten Dingen zu. Sie tat einen beherzten Satz und wollte den Mann aufhalten, doch der goldene Rauch wand sich um ihre Fußknöchel und hielt sie zurück. Sie öffnete den Mund zum Schrei, aber es kam kein Laut über ihre Lippen, nicht einmal das leiseste Wimmern.
Panisch führte sie die Hände an die Kehle, als der Mann am Eingang zu dem Gebäude stehen blieb. Mit vor Schreck geweiteten Augen sah sie, wie er sich zur Seite drehte und lächelnd zwei Reihen spitzer Zähne entblößte. Dann brachte er sein markantes Gesicht auf eine Höhe mit dem des Jungen. »Komm mit«, sagte er. »Ich habe die perfekte Aufgabe für dich.«
Der Mann öffnete die Tür und riss den Jungen nach drinnen.
Kaum hatte sich die Tür hinter ihnen geschlossen, begann der Rauch sich zu verflüchtigen. Die Kurierin kämpfte gegen die unsichtbaren Fesseln an, bis sie ihre Füße wieder frei bewegen konnte. Sie stürzte auf das Gebäude zu und kam schlitternd zum Stehen, als es sich vor ihren Augen vollständig in Luft auflöste und nichts zurückblieb als eine von Unkraut überwucherte Gasse, über der tiefer Schatten lag.
1
Oft hörte ich meine Schwester, bevor ich sie sah, so auch an diesem Abend. Zosas samtweiche Stimme strömte durch das geöffnete Fenster der Pension Bézier und klang wie die unserer Mutter – zumindest, bis sie eine etwas schlüpfrigere Weise anstimmte, in deren Zeilen die delikateren Teile der männlichen Anatomie mit einer gewissen Frucht verglichen wurden.
Ich schlich unbemerkt ins Haus, mischte mich unter die Menge der Kostgängerinnen. Zwei der jüngeren Mädchen drehten sich im Tanz mit unsichtbaren Partnern, doch ansonsten waren aller Augen auf meine Schwester gerichtet, das talentierteste Mädchen im Raum.
Es war eine besondere Sorte junger Frauen, die die Zimmer der Pension Bézier bewohnten. Sie hatten fast ausnahmslos Stellen inne, die zu ihren losen Mundwerken passten, als Hausbedienstete, Fabrikarbeiterinnen, Fettkocherinnen, oder verrichteten beliebige andere schlecht bezahlte Arbeit an den Vieux Quais – den alten Kaianlagen von Durc. Ich arbeitete in der Gerberei Fréllac, wo Frauen den lieben langen Tag über verkrustete Alutöpfe und Färberbrunnen gebeugt standen. Aber Zosa war anders.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, rief ich, als sie ihr Lied beendet hatte.
»Jani!« Freudig kam sie auf mich zugesprungen. Ihre riesigen braunen Augen hoben sich glänzend von ihrem blassen olivfarbenen Teint ab. Ihr Gesicht war schrecklich schmal.
»Hast du schon zu Abend gegessen?« Ich hatte ihr etwas übrig gelassen, denn bei den vielen Mädchen hier im Haus neigte Essen dazu, einfach so zu verschwinden.
Sie seufzte. »Ja, hab ich. Frag mich doch nicht jeden Abend.«
»Muss ich aber. Ich bin deine große Schwester. Es ist die wichtigste Pflicht in meinem Leben.« Zosa zog die Nase kraus, und ich verpasste ihr einen Nasenstüber. Dann kramte ich in meiner Tasche, zog die Zeitung heraus, die mich einen halben Tageslohn gekostet hatte, und drückte sie ihr in die Hand. »Dein Geschenk, Madame.« Hier bei uns waren Geburtstage nicht mit Puderzucker bestäubt; sie waren hart erarbeitet und kostbarer als Gold.
»Eine Zeitung?«
»Die Stellenanzeigen.« Mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen griff ich nach der Zeitung und schlug sie auf.
Darin fanden sich Anzeigen für Stellen in schicken Boutiquen, Patisserien und Parfümerien – Stellen, die man niemals einer Dreizehnjährigen geben würde, die keinen Tag älter als zehn aussah. Zum Glück waren es nicht diese Annoncen, denen mein Interesse galt.
Ich bewegte den Zeigefinger über die Seite und deutete auf eine Anzeige, die vor etwa einer Stunde in sämtlichen Tageszeitungen der Stadt aufgetaucht war.
Die Tinte schimmerte leuchtend violett, wie der Blutmohn in Aligney oder amethystfarbener Pannesamt. Sie stach aus dem Rest hervor, ein eigenartiges Leuchtsignal in einem Meer von Schwarz und Weiß.
Die Mädchen scharten sich um uns und reckten die Köpfe, um etwas zu sehen. Die violette Tinte schillerte so bunt, dass sie mit poliertem Mondstein hätte konkurrieren können.
Eine Adresse war nicht angegeben. Das war bei dem legendären Hotel nicht nötig. Ungefähr alle zehn Jahre tauchte es in derselben Gasse in der Innenstadt auf. Vermutlich waren bereits sämtliche Bewohner der Stadt dort versammelt, getrieben von der närrischen Hoffnung auf einen Aufenthalt darin.
Vor Jahren, als das Hotel das letzte Mal erschienen war, war der Großteil der Einladungen bereits vorab an die wohlhabendsten Bürger der Stadt überbracht worden. Dann, am Tag seiner Ankunft, war noch eine Handvoll der begehrten Einladungen an beliebige Personen in der Menge der Schaulustigen verteilt worden. Unsere Matrone, Minette Bézier, war eine der wenigen Glücklichen gewesen.
An jenem Tag um Punkt Mitternacht hatten die Gäste das Hotel betreten und sich zusammen mit dem Gebäude in Luft aufgelöst. Zwei Wochen später sollen sie dem Hörensagen nach aus dem Nichts wieder in der Gasse erschienen sein, als wären sie einfach zur Tür rausspaziert.
Meine Finger zuckten, als ich mir ausmalte, wie ich das Siegel an meinem eigenen Umschlag löste. Doch selbst wenn wir das große Glück haben sollten, eine der begehrten Einladungen zu ergattern, würden wir immer noch für den Aufenthalt bezahlen müssen – und die Zimmer waren bekanntermaßen nicht gerade billig.
Zosa runzelte die Stirn. »Du willst, dass ich mich dort vorstelle?«
»Nicht ganz. Ich werde mich dort vorstellen. Und ich nehme dich mit für ein Vorsingen.«
Es war vier Jahre her, dass ich sie zu einem Vorsingen begleitet hatte – und dieses erste Mal war nicht gerade zu ihren Gunsten verlaufen. Ich hatte den Gedanken, das alles noch einmal durchzustehen, nicht ertragen, deshalb hatten wir es danach nie wieder versucht. Aber heute war ihr Geburtstag, und es ging um das Hotel Magnifique. Mein Gefühl sagte mir, dass es diesmal anders laufen würde. Irgendwie schien mir alles stimmig zu sein. »In Hotels werden laufend Sängerinnen gesucht. Was sagst du dazu?«
Sie antwortete mit einem Lächeln, das ich bis in die Zehenspitzen spürte.
Eins der älteren Mädchen schob sich eine fettige blonde Haarsträhne hinter ihr rosa Ohr. »Diese Anzeige ist doch bloß ein Köder. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn eine von uns dort eine Anstellung bekäme.«
Ich richtete mich kerzengerade auf. »Das ist nicht wahr.«
Mit einem herablassenden Schulterzucken drehte sie sich weg. »Mach doch, was du willst. Ich würde meine kostbare Zeit nicht darauf vergeuden.«
»Denkst du, sie hat recht?«, fragte Zosa, deren Mundwinkel enttäuscht nach unten wanderten.
»Ach was«, sagte ich, vielleicht ein wenig zu hastig. Als die Falten auf Zosas Stirn tiefer wurden, fluchte ich in Gedanken und strich mit der Daumenkuppe über die alte Halskette unserer Mutter.
Das wertlose Schmuckstück bestand aus verdannischem Gold, hart wie Stahl. Maman hatte immer Witze darüber gemacht, dass auch mein Rückgrat aus dem Zeug gemacht sei. Ich tastete oft danach, wenn ich ihren Beistand im Umgang mit Zosa brauchte. Nicht, dass es mir jemals wirklich half; tote Mütter waren nun mal keine große Unterstützung.
»Das Hotel würde doch keine Anzeige schalten, wenn von vornherein keine Chance bestünde. Morgen zeigen wir denen, was wir zu bieten haben. Wenn die sehen, wie fantastisch wir beide sind, verabschieden wir uns für immer von hier.«
Der Gedanke fühlte sich an wie ein Stück Kohle, das in meiner Brust schwelte.
Mit zitternden Fingern zog ich eine von Zosas dunklen Locken glatt, genau wie Maman es getan hätte. »Zeigen wir Bézier die Anzeige. Sie kann uns sicher mehr über das Hotel erzählen.«
Zosa nickte mit leuchtenden Augen. Ich riss ihr die Zeitung aus den Händen und machte mich auf und davon. Ein paar von den Mädchen jagten hinter mir her die Treppe hinauf, bis in mein Lieblingszimmer, das Wohnzimmer im zweiten Obergeschoss, in dem früher Seefahrer hausten, bevor Bézier das Haus übernahm. Es war vollgestopft mit Regalen voller antiquierter Seekarten und Atlanten mit entlegenen Orten, in denen ich oft blätterte.
Bézier saß vor dem brennenden Kamin, die bestrumpften Füße auf ein Fenstersims gelegt. Draußen prasselte der Regen auf den Hafen von Durc nieder und verwandelte die verhasste Stadt jenseits der Scheibe in ein verlaufenes Aquarell.
Sie kniff den Mund zusammen, als wir alle ins Zimmer drängten. »Was ist denn nun wieder los?«
Wortlos reichte ich ihr die Seite aus der Zeitung. Der flackernde Schein des Feuers fing sich in der lila Tinte, und ein ernster Ausdruck legte sich auf Béziers bleiche Züge.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte eins der Mädchen hinter mir.
Bézier hob den Blick zur Wand über der Feuerstelle, zu dem zehn Jahre alten Stück Pergament, das dort hinter Glas gerahmt hing, ihrer Einladung. Im schwachen Schein schillerte die violette Tinte ähnlich wie die der Anzeige. »Das Hotel Magnifique kehrt also zurück, verstehe.«
Eine weitere Tür ging auf, und einige Nachzügler strömten ins Zimmer und drängelten sich vor, um einen Blick zu erhaschen.
»Ich habe gehört, die Gäste schlürfen dort schon zum Frühstück flüssiges Gold aus Champagnerflöten«, bemerkte ein Mädchen in der hinteren Reihe. Jetzt taten weitere Mädchen Gerüchte kund, die ihnen zu Ohren gekommen waren.
»Man sagt, die Kissen seien nicht mit Federn, sondern mit gesponnenen Wolken gefüllt …«
»Und die ganzen adretten Portiers sind Prinzen aus einem fernen Land …«
»Ich wette, ihre Küsse sind ebenso adrett.« Ein Mädchen mit sandfarbenem Teint und rosigen Wangen machte eine vulgäre Geste mit der Zunge. Zum Glück bekam Zosa davon nichts mit. Stattdessen trat nun ein breites Grinsen auf ihr Gesicht.
Es war eine Schande, dass es keine Möglichkeit gab herauszufinden, ob an den Gerüchten etwas dran war; die Gäste mussten beim Auschecken alle ihre Erinnerungen an ihren Aufenthalt im Hotel zurücklassen, besiegelt mit ihrer Unterschrift. Abgesehen von ihrem Gepäck, kehrten sie mit nichts als einem Gefühl verheerenden Glücks zurück. Bézier hatte einmal zugegeben, ihr Kiefer sei ganz steif gewesen vom vielen Lächeln.
Neugierig geworden, sah ich zu Bézier. Ihr Blick war verschleiert, als hätte die Rückkehr des Hotels eine Erinnerung freigelegt. Ich öffnete den Mund, um sie danach zu fragen, als Zosa sich vor mich schob. »Haben Sie je den Maître gesehen?«
Der Maître d’hôtel war der Eigentümer und fast so berühmt wie das Hotel selbst.
Bézier nickte mit selbstgefälliger Miene. »Das Hotel kam einmal in die Stadt, als ich noch ein blutjunges, bildhübsches Ding war. Der Maître hatte das strahlendste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Er leuchtete förmlich, als er die wartende Menge begrüßte. Er pflückte einfach so eine Blume aus der Luft und warf sie mir zu.« Sie tat so, als würde sie die Blume auffangen. »Sie roch nach Blaubeerkuchen und zerbröselte zwischen meinen Fingern, bis nichts mehr übrig war. Ein ganzes Jahrzehnt verstrich, bevor das Hotel zurückkehrte, und als es dann so weit war, sah der Maître immer noch genauso aus.«
»Sie meinen, er trug dieselbe Kleidung?«, hakte jemand nach.
»Nein, du Dummerchen. Er sah genauso aus. Dasselbe Gesicht. Derselbe Charme. Er war nicht um einen Tag gealtert. Aber kein Wunder. Er ist der weltgrößte Suminaire.«
Bei der Erwähnung des Wortes Suminaire schnappten die Mädchen nach Luft: Es war das alte verdannische Wort für Magier.
Außerhalb des Hotels stellte ein Suminaire eine große Bedrohung dar. Es hieß, die Magie staue sich während der Kindheit und Jugend dieser Leute im Blut an, bis sie völlig unkontrolliert aus ihnen hervorbrach und das Potenzial besaß, alle, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Nähe aufhielten, zu verletzen – oder zu töten.
Manche behaupteten, die Magie würde bei ihnen schon als Kind als eine dunkle Wolke aus den Nasenlöchern hervorquellen. Andere meinten, es sähe aus wie kohlrabenschwarze Finger, die sich klauenartig aus den Kehlen der Kinder schoben. Und es gab keine Möglichkeit, ein gewöhnliches Kind von einem Suminaire zu unterscheiden, ehe sich die Magie offen zeigte.
Natürlich gab es Gerüchte, auf welche Anzeichen zu achten sei. Kuriose Eigenheiten wie eine Gier nach Blut oder geschwärzte Zungen zum Beispiel. Angeblich seien sogar schon Kinder nach einer tödlichen Verletzung wieder zum Leben erwacht, nur um festzustellen, dass sie Magie im Blut hatten. Aber Beweise für all das hatte niemand.
Wie auch immer, jedenfalls war diese Magie so brandgefährlich, dass man in Verdanne jahrhundertelang Kinder, die im Verdacht standen, Suminaires zu sein, entweder ertränkte oder auf dem Scheiterhaufen verbrannte.
Im Hotel dagegen galt Magie als sicher. Es war weithin bekannt, dass der Maître das Gebäude selbst verzaubert hatte, was es den bei ihm angestellten Suminaires ermöglichte, Erstaunliches zu vollbringen, ohne einer Menschenseele zu schaden. Niemand konnte genau sagen, wie er es geschafft hatte, aber jeder wollte es mit eigenen Augen sehen.
Bevor noch weitere Fragen kamen, klatschte Bézier in die Hände. »Es ist spät, Mädchen. Alle auf eure Zimmer.«
»Einen Moment noch«, sagte ich. »Erinnern Sie sich an irgendetwas, jetzt, da das Hotel zurück ist? Ist es so magisch, wie die Gerüchte behaupten?« Kaum waren die Worte aus meinem Mund, kam ich mir dumm vor.
Bézier aber blieb ernst und schien meine Frage gar nicht so abwegig zu finden. Stattdessen starrte sie wehmütig auf ihre Einladung.
»Ich bin mir sicher, dass noch mehr dahintersteckt, aber ich erinnere mich nicht«, sagte sie mit einem verbitterten Unterton in der Stimme. Ich würde mich auch betrogen fühlen, wenn ich mich nicht an die aufregendste Zeit in meinem Leben erinnern könnte. Sie warf die Anzeige kurzerhand ins Feuer und wich taumelnd zurück. »Du lieber Himmel.«
Das Papier fing Feuer, brannte erst dunkelrosa, dann grün, dann karmesinrot und verwandelte die Flammen in einen grellbunt flackernden Regenbogen. Sie züngelten höher, loderten wütend in den Schornsteinschacht empor und bildeten einen noch viel fesselnderen Anblick als die Ladenfronten des prächtigen Boulevard Marigny.
»Es ist Magie«, flüsterte Zosa.
Ich spürte ein Prickeln im Nacken. Es gab einen Grund, weshalb das Hotel Magnifique die Menschen reihenweise nach Luft schnappen und große Augen machen ließ. Denn normalerweise war Magie etwas Seltenes, Gefährliches und musste um jeden Preis gemieden werden. Doch unter dem Dach dieses Gebäudes war aus irgendeinem Grund genau das Gegenteil der Fall. Und morgen hätten wir vielleicht endlich die Chance, Zeugen dieses Wunders zu werden.
2
Am nächsten Morgen bedeckte ein nasskalter Südwind die alten Kaianlagen mit glitschigen Algen. Ich nahm Zosa fest bei der Hand, während wir Seite an Seite entlang der Piers schlitterten, vorbei an Fischern, die Paletten entluden, und an Müttern, die ihre Söhne zum Abschied küssten, bevor diese in See stachen.
»Jani, sieh mal.« Zosa deutete auf eine Fähre, die in den Hafen einfuhr. »Denkst du, das war unsre?«
»Schwer zu sagen.«
Vor vier Jahren, als unsere Mutter verstarb, hatte ich einen absurden Betrag in Dublonen bezahlt für die Überfahrt auf einer ähnlichen Fähre von Aligney, unserer kleinen Insel, ein Stück die Küste aufwärts.
Die Reise dauerte ganze fünf Tage. Zosa vertrieb sich die Zeit damit, von all den frivolen Dingen zu träumen, die sie sich in Durc kaufen würde, so was wie fingerlose Spitzenhandschuhe und die gestreiften Döschen mit Crème de Rose, die Maman sich immer ins Gesicht geschmiert hatte. Ich konnte damals nicht aufhören zu grinsen, überzeugt, dass mein Leben nun endlich beginnen würde.
Doch kaum hatten wir die Fähre verlassen, veränderte sich mein Gefühl schlagartig. Die Docks wimmelten von Menschen. Zosa war erst neun, deshalb behielt ich sie dicht bei mir. Und dann hatte mich die Erkenntnis getroffen: Alle, die mir je etwas bedeutet hatten, waren entweder tot oder in Aligney. Wir waren mutterseelenallein in einer fremden Stadt, und es war alles meine Schuld.
Es war ein Riesenfehler gewesen, unser Zuhause zu verlassen. In den vergangenen Monaten hatte ich jede Münze gespart, um für unsere Rückreise nach Aligney zu bezahlen. Aber bei dem zähen Tempo wollte ich lieber nicht darüber nachdenken, wie lange es noch dauern würde, bis ich genügend beisammen hätte. Das Hotel würde uns hoffentlich schneller dorthin bringen.
Bei diesem Gedanken beruhigte sich meine Atmung, und frische, goldene Erinnerungen an unser Zuhause stürzten auf mich ein. Ich konnte die unebenen Pflastersteine, über die ich als kleines Kind gelaufen war, förmlich unter meinen Füßen spüren, den Bauch mit Erdbeeren vollgeschlagen, die wir von sommerlich prall behängten Pflanzen gepflückt hatten.
»Aus dem Weg mit euch!«, blaffte eine bleichgesichtige Dame, die ihre Stola aus Otterfell umklammert hielt, und riss mich aus meinen Gedanken. Sie machte einen großen Bogen um uns, als wollte sie uns ja nicht zu nahe kommen.
Zosa betastete verschämt die Löcher in ihrem guten Rock. »Sie muss denken, wir wären unter den Piers hervorgekrochen. Alle sehen heute so glamourös aus.«
Ich nahm meinen schäbigen violetten Hut ab. Er war schrecklich altmodisch, aber das Hübscheste, was ich besaß. Ich beugte mich vor und setzte ihn Zosa wie eine Krone auf den Kopf.
»Niemand ist so glamourös wie wir, Madame«, sagte ich, und als sie grinste, wurde mir leichter ums Herz. »Und jetzt beeilen wir uns. Der Maître d’hôtel höchstpersönlich erwartet uns zum Tee.«
Seite an Seite eilten wir an den alten Hafenanlagen vorbei ins Herz der Stadt. Violette Girlanden hingen von Erkern, die Eingangstüren der Häuser waren mit rosa und grünen Nelken dekoriert. Die Feierlichkeiten waren mit Abstand das Beeindruckendste, was ich je erlebt hatte, und wurden allein zu Ehren des Hotels abgehalten.
»Hier sind so viele Menschen.« Zosa gluckste, als wir unweit der berühmt-berüchtigten Gasse um die Ecke bogen. »Ich kann meine Füße nicht mehr sehen.«
Ich schob sie beiseite, als uns eine größere Gruppe entgegenkam. »Wenn du nicht aufpasst, tritt dir noch jemand auf deine hübschen Zehen, und dann kann ich mir dein Gejammer anhören.«
Sie drehte eine Pirouette. »Mir egal. Es ist wundervoll.«
»Bis wir uns aus den Augen verlieren.« Der Gedanke, im Gedränge von ihr getrennt zu werden, machte mich nervös.
»Du willst dir doch den Spaß nicht verderben lassen.«
»Ich habe es mir zur Regel gemacht, niemals vor dem Mittagessen Spaß zu haben«, neckte ich sie.
»Im Ernst?«
»Komm schon, du.« Ich knuffte sie lachend und lotste sie zu einem Areal, wo Straßenkünstler in Satinleibchen auftraten, die Gesichter hinter Pappmascheemasken verborgen. Zosa zuckte zurück, als eine der Artistinnen auf sie zusprang, herabtropfende Tränen aus Blut auf ihrer Maske, die zum Glück nur aufgemalt waren. Singend bettelte sie um Kleingeld.
»Ein Suminaire beschwor die Magie,
seine Frau ins Feuer zu jagen,
ihre Augen verkohlt, die Knochen geknackt,
Ihr Schicksal war zu beklagen!«
Ich hatte diese Zeilen bereits vielfach gesungen gehört. Hier in dieser Stadt waren Suminaires nach wie vor Thema vieler Lieder und Geschichten, auch wenn seit einer Ewigkeit niemand mehr welchen begegnet war. In den letzten Jahrzehnten waren die Sichtungen so selten geworden, dass die Leute sich nicht länger Sorgen machten, die Magie könnte irgendjemandem Schaden zufügen. Stattdessen waren sie nur neugierig, und auch die Gesetze in Verdanne waren lax geworden. Das Hotel erhöhte diesen Reiz noch. Die Menschen waren inzwischen so versessen darauf, Magie hautnah zu erleben, dass alle Ängste vergessen waren, so wie man die Gefahr vergaß, dass einen auf dem freien Feld ein Blitz treffen und töten konnte.
»Denkst du, wir bekommen heute Abend einen Suminaire zu Gesicht?«, fragte Zosa.
»Hoffentlich nur drinnen. Wo der Maître für unser aller Sicherheit sorgt.«
»Ich wette, der Maître sieht gut aus.«
»Er ist zu alt für dich«, brummte ich und kniff sie in die Backe. »Los, lass uns weitergehen.«
Kurz darauf kamen wir an zwei ausgelassen herumalbernden Männern mit gebräunten Gesichtern vorbei. Sie hielten jeder einen Packen dicker Umschläge in der Hand. Die Einladungen.
»Sechs Gewinner sind es diesmal!«, rief jemand.
»Wurden die Gewinner bereits ausgewählt?«, fragte ich mit bestürzter Miene. Ich fand das Auswahlverfahren gut – so bekam jeder eine Chance. Trotzdem versetzte es mir einen Stich, und ich verspürte einen Anflug von Neid, den ich nicht abzuschütteln vermochte.
Bevor ich einen weiteren Schritt tun konnte, zupfte Zosa mich so vehement am Ärmel, dass sie mir beinahe den Arm auskugelte. »Hey!«, rief ich protestierend.
»Würdest du dich endlich mal umdrehen, du Dickkopf?« Sie deutete mit dem Finger in die Gegenrichtung.
Dann sah ich es.
Man bekam den Eindruck, als hätte das Hotel schon immer in der engen Gasse zwischen dem Apothicaire Richelieu und dem Maison du Thé gestanden. Die Fassade war vollständig mit Brettern verkleidet, und eine einzelne Reihe von Fenstern zog sich senkrecht über fünf Stockwerke. Es konnte nicht mehr als zehn kleine Zimmer umfassen, maximal. Über der Eingangstür hing ein Schild, das übertrieben prunkvoll wirkte für das schäbige Gebäude. In Perlmuttintarsien prangten zwei Wörter in schnörkeliger Schrift darauf: HOTELMAGNIFIQUE.
»Wie eigenartig«, bemerkte ich mit einem enttäuschten Unterton in der Stimme. Das Hotel war vollkommen unscheinbar.
Ein einzelnes rundes Fenster, zweimal so groß wie der Rest, saß ganz oben im Giebel, dahinter einige Sukkulenten. Geldbaum-Exemplare. Nur dass ich nicht recht verstand, wie sie von einem Ort zum anderen gelangten. Geschweige denn das Gebäude selbst.
Das Hotel tauchte angeblich früher oder später an jedem Ort der Erde auf. Ich kannte mich aus in Geografie – Verdanne war das größte Land auf dem Kontinent, begrenzt von den schroffen Bergen von Skaadi im Norden und dem windumtosten Preet im Osten. Dahinter lagen noch viel größere Länder und noch etwas weiter Ozeane voll endloser Orte, die es zu entdecken gab. Die Welt war unvorstellbar groß und voller Wunder, und doch stellte dieses schlichte Gebäude alles in den Schatten.
Der Ruf einer Frau ließ uns beide die Köpfe recken. »Es ist der Maître!«
Ein junger Mann war in der Tür erschienen.
»Ich habe gesehen, wie er Einladungen verteilt hat«, fuhr die Frau aufgeregt fort. »Er hat der ersten Gewinnerin beim Betreten des Hotels einen Strauß Duchesse-Rosen in die Hand gedrückt.«
»Ich wusste es. Er ist einfach wunderbar«, schwärmte Zosa.
Ich stutzte. Im hellen Sonnenlicht glitzerte der Maître wie eine Silberdublone frisch aus der Münzpresse. Er trug eine schwarze Livree, die in starkem Kontrast zu seiner blassen Gesichtshaut stand.
Bézier hatte recht. Der größte Suminaire der Welt war nicht wesentlich älter als ich. Neunzehn. Zwanzig vielleicht. Unerhört jung jedenfalls. Oder zumindest sah er so aus.
Dieser Mann hatte das gesamte Gebäude verzaubert und es für die bei ihm beschäftigten Suminaires sicher gemacht. Hier konnten sie ihre Magie wirken, während die Hotelgäste Zeugen dieses Wunders werden konnten, ohne sich dadurch in ernstliche Gefahr zu begeben.
»Willkommen.« Der Maître pflückte eine Tulpe aus der Luft und reichte sie einer älteren Dame mit gebräuntem Teint und einem breiten Lächeln, die humpelnd das Hotel betrat, eine Einladung an die Brust gepresst. »Gern geschehen, gern geschehen«, sagte er zu einer hellhäutigen jungen Frau, die ebenfalls eine Einladung in der Hand hielt, und dann: »Ein außergewöhnlicher Hut, Mademoiselle«, zu ihrer kleinen Tochter, als sie gemeinsam durch die Tür schritten, gefolgt von den beiden heiteren Männern.
Der Maître räusperte sich. »Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen. Bitte beehren Sie uns beim nächsten Mal wieder, wenn das Hotel Magnifique in der Stadt ist.«
Er machte einen tiefen Diener. Als er sich wieder aufrichtete, lugten eine Handvoll Lilien zwischen seinen langgliedrigen Fingern hervor. Er warf sie hoch in die Luft. Die Blumen falteten sich zu winzigen Vögeln zusammen, die sich mit jedem Flügelschlag mehr und mehr in violett schimmernden Rauch auflösten. Als ich den Blick wieder senkte, war der Maître verschwunden.
Unglaublich. Nur dass an der Stelle, an der er gestanden hatte, jetzt ein Seil war, das die Tür abriegelte, mit einem Schild daran, auf dem stand: Zutritt nur für Gäste und Angestellte.
»Denkst du, die Vorstellungsgespräche finden drinnen statt?«, fragte Zosa.
»Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden.« Nachdenklich betrachtete ich das Schild. Sicher konnte ich einen kurzen Blick wagen. »Warte hier auf mich.«
Ich kämpfte mich mithilfe meiner Ellbogen durchs Gedränge, stieg die Stufen hinauf und schlüpfte unter dem Seil hindurch. Drei Worte, nicht viel größer als ein Daumen, waren in den schwarzen Lack der Eingangstür geritzt: le monde entier.
Die ganze Welt.
Die Worte rührten an etwas in meinem Unterbewusstsein, riefen nach mir.
Ich zog die Tür auf, aber es war unmöglich, irgendetwas zu erkennen. Also machte ich einen Schritt vorwärts. Doch statt einzutreten, prallte ich mit der Nase gegen eine Wand.
Benommen taumelte ich zurück, streckte den Arm aus und strich mit den Fingerkuppen über etwas Festes. Es schien eine Glasscheibe zu sein, die die Tür vollständig ausfüllte. Zumindest nahm ich an, dass es sich um Glas handelte, bis sich eine fremde Hand hindurchschob und mich am Handgelenk packte. Mit einem spitzen Schrei stellte ich fest, dass die Hand zu einem jungen Portier gehörte.
Blinzelnd versuchte ich die geöffnete Tür mit der Wand und diesem Jungen zu vereinbaren, der nun einfach hindurchspazierte.
Nein, kein Junge. Viel zu groß und mit Muskeln, die sich deutlich unter seiner Livree abzeichneten. Der Maître war erschreckend blass gewesen, aber dieser junge Mann war genau das Gegenteil. Sein warmer, kupferfarbener Hautton betonte die lebhaften braunen Augen, die auf mich herabstarrten.
»Kann ich dir helfen?«, fragte er auf Verdannisch mit einem mir völlig unbekannten Akzent.
Ich blickte am Gebäude empor und stellte mir all die Atlanten vor, die die Wände von Béziers Wohnzimmer säumten, die kleinen Kleckse Land, die ich so oft mit den Fingerkuppen nachgefahren hatte. Für mich war nicht nachvollziehbar, wie ein so altes Bauwerk derart weit reisen können sollte.
»Wo waren Sie gestern?«, fragte ich.
»Eine einminütige Wegstrecke von hier«, antwortete er knapp. Als ich die unsichtbare Wand genauer in Augenschein nehmen wollte, schlug er die Tür zu. »Zutritt nur für Gäste und Angestellte.«
Ach so, ja. Dieses dumme Schild. »Wo finden die Einstellungsgespräche statt?«
»Du willst dich für eine Stelle im Hotel bewerben?«
Er war sichtlich überrascht, was mich wiederum schlagartig in Rage versetzte. Ich durchbohrte ihn mit einem finsteren Blick. »Sieht ganz so aus.«
Wir zuckten beide zusammen, als die Tür zum Hotel noch einmal aufschwang. Eine Gruppe von Leuten kam herausgeschlendert. Auf der tiefbraunen Haut einer zierlichen Frau leuchtete eine Lapis-Halskette. Ihr folgte ein weiterer Gast, dessen Haut so weiß war, dass sie unter der Sommersonne von Durc binnen einer Minute verbrutzeln würde.
Sie lachten, und ein vorbeiziehender schwerer Duft löste einen wohligen Schauer in mir aus. »Was ist das für ein Geruch?«
»Wüstenjasmin. Recht gewöhnlich.«
Gewöhnlich war nicht gerade das Wort, das mir als Erstes in den Sinn kam. Am liebsten hätte ich diesen herrlichen Duft zum Dessert verschlungen. »Er ist exquisit. Woher kommt er?«
»Tut mir leid, aber ich hab’s eilig. Ich habe keine Zeit für dumme Gören wie dich.«
»Entschuldigung?«
»Du nimmst mir die Worte aus dem Mund«, sagte er mit einem Grinsen und versuchte sich an mir vorbeizuducken.
Ich konnte das Gebäude nicht allein betreten, und auch wenn dieser Kerl schrecklich nervtötend war, war er der einzige Angestellte weit und breit, dem ich außer dem Maître begegnet war. Ich packte ihn am Arm. »Wo finden die Bewerbungsgespräche statt?«
»Bist du wirklich so schwer von Begriff? Ich bin beschäftigt.«
»Dann mach es kurz und beantworte meine Frage.«
Er bedachte mich mit einem langen Blick und spähte dann prüfend die Straße hinunter. Ich versuchte auszumachen, wonach genau er Ausschau hielt, sah aber nichts als ein Meer von Menschen. Mir stockte der Atem, als er sich vorbeugte und eine einzelne Strähne seitlich an meinem Hals zurückstrich.
»Wenn ich du wäre, würde ich zusehen, dass ich schleunigst nach Hause komme. Tu so, als sei das Hotel nie aufgetaucht«, raunte er mir zu. Dann schob er sich an mir vorbei und verschwand in der Menge.
3
In den folgenden beiden Stunden wollte mir dieser Portier nicht mehr aus dem Sinn gehen. Die Art, wie seine lebhaften braunen Augen mich prüfend angesehen hatten. Wie er mich abserviert hatte. Vermutlich hatte er diese seltsame Warnung nur ausgesprochen, weil er fand, dass ich an einem Ort wie dem Hotel Magnifique nichts verloren hatte.
Ich knibbelte an meinen grün gefleckten Fingern herum. Die Farbe aus der Gerberei stank nach Hafenmief wie fast alles hier in Durc. Manche behaupteten, Seepocken würden einem zwischen den Rippen wachsen, wenn man nur lange genug an diesem Ort lebte. Ich hatte nie daran gezweifelt. Selbst nach einem der seltenen Wannenbäder stank meine Haut nach verrottetem Fisch. Aber ich weigerte mich, so schnell aufzugeben. Maman war immer der Meinung gewesen, ich sei viel zu halsstarrig und tue mir selbst keinen Gefallen damit, aber ich konnte nicht anders. Dieser Portier brachte mich mit seiner herablassenden Art dazu, dass ich diese Stelle gleich noch dringender haben wollte.
»Geht es vielleicht noch ein bisschen langsamer?«
»Gott, ich hoffe nicht.« Zosa wischte sich unter der Krempe ihres violetten Huts den Schweiß von der Stirn.
Die Schlange vor dem Maison du Thé, dem alten Teehaus neben dem Hotel, wo die Bewerbungsgespräche stattfanden, wie wir schließlich erfahren hatten, war schrecklich lang. Zum größten Bedauern meiner armen Beine waren wir die Letzten in der Reihe.
Als wir endlich vor dem Eingang zum Teehaus standen, deutete Zosa auf ein vergoldetes Schild, auf dem die offenen Stellen aufgelistet waren: Bühnenkünstlerin tauchte zwischen Musiker und Hausmädchen auf. Ein hellhäutiger Mann im Anzug, der für die brütende Hitze viel zu elegant gekleidet war, hatte nicht das leiseste Lächeln für uns übrig. Wortlos öffnete er uns die Tür und schob uns förmlich hinein.
Auf den marmornen Oberflächen der Verkaufstresen standen schwere silberne Waagen. Jedes einzelne Regalbrett war mit hohen Glasgefäßen zugestellt, die bis zum Rand mit Teeblättern in den leuchtendsten Farben gefüllt waren.
»Nächster!«, rief eine weibliche Stimme aus dem Hinterzimmer. Es war so weit. Das Vorstellungsgespräch.
»Gehst du als Erste?« Zosas Stimme zitterte vor Aufregung, genau wie bei diesem ersten Vorsingen vor einigen Jahren.
Ich richtete eine Feder an ihrem Hut. »Selbstverständlich.«
In dem Hinterzimmer begrüßte mich eine statuenhafte Frau mit olivfarbenem Teint. Ihr kurz geschnittenes braunes Haar passte zu ihrem eleganten Hosenanzug aus glänzendem Samt. Sie war gekleidet wie ein Mann, hatte allerdings viel mehr Elan als alle Kerle, die ich kannte. Ich mochte sie auf Anhieb, bis sie mich mit gerümpfter Nase musterte.
»Nicht gerade eine Augenweide, wie?«, sagte sie und hielt einen großen Kompass aus Bronze mit einer leuchtenden grünen Jadenadel hoch. »Und jetzt stillhalten.«
Die Kompassnadel drehte sich in schwindelerregender Geschwindigkeit im Kreis und hielt nicht ein einziges Mal still. Die Frau ließ den Kompass wieder in der Anzugtasche verschwinden.
»Wofür war das gut?«
»Ich stelle hier die Fragen.« Sie fasste mich am Kinn. »Dein Name?«
Ich schluckte. »Janine Lafayette. Aber alle nennen mich Jani.«
»Was für ein langweiliger Name.« Sie spitzte die Lippen. »Ich bin übrigens Yrsa.« Sie ließ mein Kinn wieder los. »Lebst du schon immer in dieser Stadt?«
»Ich stamme aus einem Inseldorf ein Stück die Küste hinauf. Es heißt Aligney«, sagte ich mit zittriger Stimme.
»Mochtest du dein kleines Dorf?«
Als wir noch Babys waren, richtete Maman unsere Wiegen zum Dorfmittelpunkt von Aligney hin aus, damit unsere Füße stets den Weg zurückfinden würden, ein alter Aberglaube in Verdanne, den ich verinnerlicht hatte.
Selbst nach all den Jahren konnte ich mir die engen Häuserzeilen, die sich im Licht der untergehenden Wintersonne zitronengelb verfärbten, immer noch bildlich vorstellen. Ich hatte immer genau gewusst, wann der Mohn blühte und woher unser nächstes Abendessen kommen würde. Ich hatte Freunde dort – Menschen, die sich um mich sorgten. Manchmal fühlte es sich an, als hätte ich seit vier Jahren nicht mehr richtig frei durchgeatmet. In Aligney hingegen hatte mein Atem immer jeden Winkel meiner Lunge gefüllt.
Die einzige Konstante dieser Tage war der schmerzliche Wunsch, dorthin zurückzukehren.
»Ich habe mein Dorf sehr geliebt. Nach dem Tod unserer Mutter bin ich zusammen mit meiner Schwester hierhergekommen. Ich wollte eigentlich zurückkehren, sobald …«
»Deine Mutter ist also tot«, unterbrach sie mich unsanft. »Was ist mit deinem Vater?«
Maman hatte uns nie Genaueres erzählt. »Er war Bauer.«
»Und wo wohnst du jetzt?«
Ich fing an, ihr von der Pension Bézier zu erzählen, bis sie mit einer flatternden Handbewegung abwinkte. »Ich habe genug gehört. Schick die Nächste rein.«
Zosa sprang auf, als sie mich herauskommen sah. »Alles in Ordnung?«
»Alles bestens«, log ich. »Los, lass die Dame nicht warten.«
Meine Schwester beeilte sich, in das Hinterzimmer zu kommen, während ich mir verstohlen eine Träne fortwischte. Es war dumm von mir, noch zu hoffen. Mit dem Daumen fuhr ich die harten Umrisse einer Münze in meiner Tasche nach. Sie war von meinem Zeitungskauf übrig. Wenigstens konnte ich Zosa damit noch ein Döschen Pastillen kaufen, sobald sie fertig war, um ihr die herbe Enttäuschung ein wenig zu versüßen.
Die Minuten verstrichen. Ich hörte ihren gedämpften Gesang durch die geschlossene Tür. Schließlich kam Zosa herausgestürmt, die Miene seltsam leer.
»Und?«
Wortlos hielt sie ein Stück Pergament hoch, und mein Mund wurde staubtrocken. Die Seite rollte sich an den Ecken ein, wirkte archaisch im Vergleich zum heutigen Papier. Eine schwarze Linie unten auf der Seite verriet mir, worum es sich genau handelte.
Es war ein Vertrag. Für eine Anstellung.
Yrsa kam aus dem Zimmer geschlendert. »Ich habe deiner Schwester eine Stellung angeboten. Die Bezahlung liegt bei zehn verdannischen Dublonen pro Woche. Sie wird für unsere Gäste singen.«
Zehn Dublonen! Das war dreimal so viel wie das, was ich verdiente. Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht vor Neid auszurasten. Natürlich musste Yrsa Zosa ganz außergewöhnlich finden, erst recht, nachdem sie zuvor ihre unscheinbare Schwester kennengelernt hatte.
Aber Zosa konnte nicht allein weggehen. Wäre Maman noch hier gewesen, hätte sie mich gedrängt, etwas zu unternehmen. Doch Zosa strahlte mit der Sonne um die Wette, und mir fiel beim besten Willen nichts ein, was ich sagen könnte, ohne dass es ihr das Herz brechen würde.
Yrsa platzierte einen Füller mit bronzener Schreibfeder sowie ein Fass violetter Tinte auf einem Tisch. Dann brachte sie eine goldene Nadel zum Vorschein und pikste meiner Schwester damit in den Zeigefinger. Ein perfekter rubinroter Blutstropfen quoll aus der Kuppe hervor.
Ich riss empört die Hände hoch. »Was tun Sie da?«
»Das ist Teil des Vertrages. Alle unsere Gäste und Angestellten müssen ein vergleichbares Dokument unterzeichnen.« Yrsa führte Zosas Finger über das Fass und ließ den Tropfen hineinfallen. Die Tinte zischte, als das Blut sich darin auflöste. Dann tauchte Yrsa die Feder ein und drückte meiner Schwester das Schreibgerät in die Hand.
Mein Blick wanderte zu dem Vertrag. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Seite auf Verdannisch verfasst wäre – in der Sprache, die auf dem gesamten Kontinent am häufigsten gesprochen wurde. Dieser Vertrag jedoch enthielt zwar Bruchstücke des Verdannischen, war ansonsten aber überwiegend in Sprachen verfasst, die mir völlig unbekannt waren. Ganz unten auf der Seite prangte ein X.
Zosas Wangen waren gerötet. »Mir ist noch nie etwas so Aufregendes passiert. Jani, ich habe es geschafft!«
Eifersucht durchflutete mich. Meine Finger krümmten sich, gepackt von dem Bedürfnis, mir den Vertrag zu schnappen und ihn selbst zu unterzeichnen. Verzweifelt wandte ich mich an Yrsa. »Meine Schwester ist erst gerade so dreizehn. Sie kann nicht allein gehen. Wir könnten uns ein Zimmer teilen, ich könnte verschiedene Arbeiten übernehmen, wo immer Bedarf herrscht.« Bitte, lassen Sie uns beide gehen.
»Tut mir leid, aber das ist nicht möglich«, entgegnete Yrsa. »Ich habe ihr eine Stelle angeboten. Nur Gäste und Angestellte dürfen die Schwelle zum Hotel übertreten.«
Die Schwelle: Damit war wohl diese Wand gemeint, die aus nichts bestand. Es gab also keine Möglichkeit für mich, sie hineinzubegleiten.
»Schon gut«, sagte Zosa. »Wir reden mit jemandem. Sicher löst sich das Problem von allein.«
Sie begriff offenbar nicht, dass ich nicht mitkommen konnte, es sei denn, man stellte mich ebenfalls ein. Ich schlug die Hände vors Gesicht. Als ich wieder aufsah, hatte Zosa die Feder zum Pergament geführt und kritzelte ihren Namen unten auf die Seite.
Ich machte einen Satz nach vorn und stieß dabei das Tintenfass um. Eine violette Pfütze breitete sich auf dem Tisch aus, während ich mir den Füllfederhalter schnappte und ihn Yrsa hinhielt. Dann sah ich nach unten und hätte um ein Haar hörbar nach Luft geschnappt. Die violette Tinte war gar nicht verschüttet oder verlaufen. Das Fass war fest verschlossen, der Deckel saß auf der Öffnung. Aber ich hatte doch mit eigenen Augen gesehen, wie die Tinte herausgeschwappt war, ich war mir vollkommen sicher.
Da musste Magie im Spiel gewesen sein.
»Deine Schwester soll sich um sechs Uhr abends beim Hotel einfinden.« Damit ließ Yrsa den von Zosa unterzeichneten Vertrag in der Innentasche ihres Jacketts verschwinden und rauschte davon.
»Du gehst unter keinen Umständen allein«, sagte ich und stellte den Fuß auf das alte Nachthemd, nach dem Zosa sich gerade bückte. Der Saum riss, als sie es sich schnappte und dabei so tat, als wäre ich gar nicht anwesend. »Hallo? Ich stehe direkt vor dir!« Erst als ich ihr mit dem Zeigefinger gegen die Stirn stieß, funkelte sie mich wütend an. »Siehst du. Ich bin doch nicht so unsichtbar, oder?«
Mich stur ignorierend, stopfte sie Mamans alte Notenblätter in einen alten Getreidesack, in dem bereits einige Erinnerungsstücke an Maman steckten. Eine Spinne ließ sich von dem groben Sackleinen auf ihre Hand herab. Kreischend schüttelte sie das Tierchen ab, dann wirbelte sie zu mir herum und sah mich direkt an. »Du lässt mich nie das tun, was ich tun will.«
»Das stimmt nicht. Außerdem habe ich hoch und heilig versprochen, auf dich aufzupassen.«
Meine kleine Schwester rollte mit den Augen. »Das war vor Mamans Tod. Jetzt bin ich dreizehn. Du warst auch nicht viel älter, als du die Stelle in der Gerberei angenommen hast.«
»Denkst du, mir blieb irgendeine Wahl? Jetzt bin ich siebzehn und schlauer.« Ich wies mit einer ausholenden Geste auf den beengten Raum, in dem wir standen. »Ich bezahle für all das hier. Also habe ich ein Wörtchen mitzureden.«
»Für den Ruß, meinst du? Für die Käfer und den Gestank nach fauligen Zähnen? Du verbringst deine Tage nicht damit, dir die Haare zu raufen und dir zu wünschen, du könntest dir die Haut abziehen, damit du den ganzen Dreck, den Juckreiz nicht mehr spüren musst. Von den zehn Dublonen in der Woche könnte ich dir einen Anteil schicken. Du könntest spätestens zum nächsten Winter von den alten Kaianlagen wegziehen.«
»Und wie willst du mir von der anderen Seite der Welt Geld zuschicken?«
»Es gibt sicher eine Möglichkeit.«
»Wenn, dann habe ich noch nie davon gehört.«
»Wäre Maman noch am Leben, würde sie mich diese Stelle annehmen lassen.« Zosas Unterlippe bebte. »Jani, ich dachte, du möchtest, dass ich singe.«
»Ich will auch, dass du singst«, entgegnete ich und verspürte einen Stich im Herzen, wusste mir aber trotzdem nicht zu helfen. »Aber nicht so, nicht ohne mich. Es tut mir leid.«
Zosa riss sich den violetten Hut vom Kopf und schleuderte ihn wütend zu Boden. Ich machte einen Schritt, um ihn aufzuheben, hielt dann aber inne. Eine Perle schimmerte aus Zosas Leinensack hervor.
Mamans Perlenohrringe.
Als wir beide noch klein waren, klipste Zosa sie sich gern an die Ohrläppchen und tat so, als würde sie auf einer Bühne auftreten. Sie sang, während ich dazu blökte wie ein Schaf mit Gehörschaden. Ich hatte den Schmuck nicht mehr gesehen, seit Zosa zu ihrem ersten Vorsingen in Durc gegangen war. Ihrem einzigen Vorsingen bis heute.
Knüppelhart traf mich die Erinnerung. Ich hatte damals geglaubt, die Ohrringe würden sie älter wirken lassen, deshalb hatte ich sie ihr angelegt und sie in mein altes rosa Kleid gesteckt. Sie hatte ausgesehen wie ein nervöses kleines Blümchen, aber wir brauchten damals dringend Geld, und Zosa hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als zu einem Vorsingen zu gehen.
Jetzt wünschte ich, ich könnte diesen Tag aus unseren Erinnerungen löschen.
Ich griff nach der Perle und rollte sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Die schillernde Farbe blätterte ab, und eine billige Holzperle kam darunter zum Vorschein. Nachdem das Vorsingen nicht wie geplant verlaufen war, hatte ich versucht, die Ohrringe an einen Schmuckhändler zu verkaufen, der mich lachend wieder fortschickte. Ich hatte Zosa nie verraten, dass sie wertlos waren.
»Hör zu. Sobald ich genügend gespart habe, buche ich die Überfahrt nach Aligney.« Ich nahm Zosas Hand. Sie versuchte sich von mir loszureißen, aber ich hielt sie entschlossen fest. »Was, wenn du nicht rechtzeitig zurück bist, um mit mir zu kommen? Oder wenn etwas geschieht, was mich zwingt, anderswo hinzugehen? Was, wenn das Hotel erst in zehn Jahren wieder hier auftaucht?« Ich malte mir aus, wie ich abends nach der Arbeit in ein leeres Zimmer zurückkehrte. Bei dem Gedanken schnürte sich mir die Kehle zu. »Ich will nicht allein hierbleiben«, gab ich schließlich mit dünner Stimme zu und seufzte.
Eine Träne glitt über Zosas Wange. Nach einigen schweigsamen Sekunden drückte ihre kleine Hand die meine. Sie setzte sich. »Meine Haare sind völlig verfilzt wegen diesem blöden Hut. Hilfst du mir, sie wieder auszukämmen?«
Ich atmete erleichtert auf.
An diesem Abend schlief Zosa sehr früh ein, während ich noch lange wach lag und kein Auge zutat. Als die große Uhr von Durc elf Uhr schlug, begann mein Magen zu knurren; es war Stunden her, dass ich das letzte Mal etwas gegessen hatte. Also schlich ich die Treppe hinunter und klaubte auf dem Weg den violetten Hut vom Boden auf, der staubig und zerknautscht war – zum Glück das einzige Opfer dieses Tages.
Auf Zehenspitzen stahl ich mich in Béziers Küche, legte den Hut auf der Arbeitsplatte ab und plünderte alles, was noch an Resten da war. Gerade griff ich – mit dem Kopf im Brotfach – nach einem trockenen Kanten, als ich die Tür zur Küche knarzen hörte. Ich war wie versteinert. Es war spät, von den Mädchen sollte eigentlich keins mehr auf sein. Meine Finger schlossen sich um eine Dose mit Holzlöffeln. Damit bewaffnet, drehte ich mich um.
In der Tür stand ein Mann.
»Da bist du ja. Du bist spät dran, das ist dir hoffentlich klar.«
Er inspizierte erst den ramponierten Hut und dann mich. Es war der junge Portier von heute Mittag. Seine Mütze war verschwunden, bedeckte seine schulterlangen schwarzen Haare nicht mehr. Als er sich eine einzelne Haarsträhne, die ihm ins Gesicht hing, hinters Ohr strich, hielt ich den Atem an. Einer seiner Finger war gar kein echter Finger, sondern ein naturgetreu nachgeschnitztes und poliertes Stück Holz.
Es hatte sogar ein Gelenk.
Gefährlich, schwirrte es mir durch den Kopf. Ich hob die Dose mit den Löffeln hoch. Er hob eine Augenbraue. Ich nahm den Arm zurück und holte aus. »Was willst du?«
»Sofern du diesen Hut heute Nachmittag nicht unter deinem Rock versteckt hattest, bist nicht du es, derentwegen ich hier bin.« Er befingerte eine der violetten Federn. »Ich bin auf der Suche nach der Eigentümerin dieses … Dings. Einer jungen Dame, die einen Vertrag unterzeichnet hat.«
Er meinte Zosa. »Sie ist nicht hier.«
Zweifelnd trat er in den Raum. Er kam mir für meinen Geschmack viel zu nah. Ich warf mit der Dose nach seinem Kopf. Sie verfehlte nur knapp ihr Ziel und traf stattdessen die Wand, sodass die Holzlöffel auf seine Schultern herabregneten.
»Ausgezeichneter Wurf.« Er zog sich einen der Löffel aus dem Kragen. »So sehr ich es zu schätzen weiß, ich habe im Augenblick keine Zeit für solche Spielchen. Ich bin gekommen, um die Eigentümerin dieses Hutes ins Hotel zu bringen.«
»Wer bist du?«
»Mein Name ist Bel. Also, wo ist sie?«
Ich traute ihm nicht so weit über den Weg, wie ich spucken konnte. »Sie kommt nirgendwo mit dir hin.«
»Sie ist also doch hier.«
Ich verbiss mir einen Fluch.
Er wandte sich zum Gehen. Ich musste ihn aufhalten. Blitzschnell griff ich unter die Hackbank und zog ein breites, rostiges altes Küchenmesser hervor. Dann schoss ich auf ihn zu und warf mich zwischen ihn und die Tür. Mit einer Hand am Türrahmen richtete ich das Messer auf seine Leibesmitte. Ein Nervenkitzel durchrieselte mich. »Und, hältst du mich immer noch für ein dummes Gör?«
»Klar.«
»Oh … tja … Noch einen Schritt, und du wirst es bereuen.«
»Aber sicher doch.« Er ließ seinen Holzfinger vorschnellen. Mit einem leisen Klicken klappte eine Klinge daraus hervor. Ein Schnappmesser.
Er stürzte sich auf mich. Das Küchenmesser fiel klappernd zu Boden, als er mich gegen das Türblatt drängte und dort fixierte, sein Gesicht nur wenige Zentimeter von meinem entfernt. Ich spürte seinen heißen Atem an meiner Wange. Wenn jetzt jemand reinkäme und uns so sähe, würde er garantiert den falschen Eindruck gewinnen.
Bei dem Gedanken kroch mir die Röte ins Gesicht. Ich wehrte mich aus Leibeskräften, aber er hielt mich eisern fest. Die Klinge an meine Kehle gepresst, beugte Bel sich herab und schnupperte an meinem Hals. Er rümpfte die Nase. »Kennt ihr in Durc keine Seife?«
Ich zog den Kopf zurück und spuckte ihm ins Gesicht. Er wischte sich das nasse Kinn an der Schulter ab. Die große Stadtuhr schlug zur halben Stunde. Elf Uhr dreißig.
»Hast du nichts Besseres zu tun?«
Fluchend klappte er seine Klinge wieder ein. »Ich tu dir nicht weh.«
»Das bezweifle ich.«
»Hör zu. Ich begleite deine Freundin um Schlag Mitternacht durch die Eingangstür des Hotels in die Lobby. Der Vertrag ist unterzeichnet. Finde dich damit ab.«
In dem Moment sah ich es in seinen Augenwinkeln. Ich kannte diesen Ausdruck von mir selbst, wenn ich mich im Spiegel betrachtete: Verzweiflung. Und ich wusste aus eigener Erfahrung, dass verzweifelte Menschen dumme Entscheidungen trafen.
»Hier gibt es unzählige Zimmer. Du wirst sie niemals rechtzeitig finden. Gib mir auch eine Beschäftigung im Hotel, dann bringe ich dich auf der Stelle zur Eigentümerin des Hutes.«
Er kickte das Küchenmesser außer Reichweite und trat noch näher auf mich zu, bis meine Schultern die Wand berührten. »Du verstehst nicht. Es ist schon bald Mitternacht.«
Dieses Mitternacht sprach er mit großer Ehrfurcht aus: Es war die Stunde, zu der das Hotel wieder verschwinden würde.
»Ich will dir nicht wehtun«, sagte er noch einmal mit Nachdruck.
Ich glaubte ihm. Er wollte mir nicht wehtun. Aber der Ausdruck in seinen Augen verriet mir, dass er notfalls zu allem bereit wäre.
»Wirst du bestraft, wenn du sie nicht rechtzeitig ins Hotel bringst?«, fragte ich. Es musste einen Grund geben, warum er bis Mitternacht zurückkehren musste, zusammen mit Zosa, koste es, was es wolle.
»Ich werde nicht bestraft. Aber denkst du nicht, es wäre unfair, dem Mädchen seine Arbeitsstelle zu verweigern?«
Unglaublich. »Wie kannst du ernsthaft wollen, dass meine Schwester dort arbeitet, nachdem du mich davor gewarnt hast?«
»Deine Schwester?«, fragte er. »Die kümmert mich keinen Deut.«
»Wenn das stimmt, dann gib mir auch eine Stelle.«
»Nein.«
»Dann lass uns gefälligst in Frieden.«
Ein tiefes Knurren entrang sich Bels Kehle. »Genug. Ich muss sie finden. Also gehst du mir jetzt besser aus dem Weg.« Er schlang mir einen Arm um den Rücken und den anderen um meinen Hals, wobei sich sein Daumen an Mamans Halskette verfing, sodass sie zu reißen drohte.
Ich schlug mit den Nägeln nach ihm. Dabei verhakten sich meine Finger an etwas an seinem Schlüsselbein. Ein jäher Schmerz durchzuckte mich, und ich hielt mir das Handgelenk.
Eine dünne Kette mit einem Schlüssel am Ende war unter seinem Jackett zum Vorschein gekommen. Ich hatte noch nie etwas Magisches berührt, aber es gab keine andere Erklärung für das, was ich spürte. Trotzdem hatte ich Mühe zu verstehen. Alle Welt wusste, dass die Magie den Suminaires im Blut lag, nicht in Objekten beheimatet war. Er musste den Schlüssel folglich verzaubert haben.
»Bist du ein Suminaire?«, fragte ich.
Bels Mund verzog sich zu einem schelmischen Grinsen, und mir rutschte das Herz in die Hose. Hastig schob er den Schlüssel zurück unter sein Hemd und sah auf meine Finger, die immer noch mein Handgelenk umklammert hielten.
»Gib mir eine Anstellung«, sagte ich noch einmal. Zum Glück brachte ich die Worte mit mehr Zuversicht hervor, als ich empfand.
Diesmal huschte ein seltsamer Ausdruck über sein Gesicht, als würde er es ernsthaft in Erwägung ziehen. »Bist du immer so schrecklich stur?«
»Bei dir ja.« Ermutigt durch seine Verunsicherung, bleckte ich die Zähne zu einem falschen Grinsen. »Und, nimmst du mich jetzt mit?«
»So einfach ist das nicht. Ich trage keine Tinte bei mir, und ohne einen unterzeichneten Vertrag oder eine Einladung darf niemand das Hotel betreten.«
Ich machte große Augen. »Was, wenn ich es auf eigene Faust reinschaffe?«
»Wie willst du das denn hinbekommen?«
»Mit einer Einladung.«
Unvermittelt ließ er mich los. »Bring mir eine Einladung, und ich verspeise auf der Stelle diese Scheußlichkeit von einem Hut.«
»Dann besorg dir schon mal eine Gabel und gib mir fünf Minuten.«
»Du hast eine Minute.«
Ich raste die Stufen hinauf in Béziers Wohnzimmer im zweiten Stock. Dort riss ich die gerahmte Einladung von der Wand über dem Kamin. Ich zerschmetterte das Glas und zog das Pergament mit spitzen Fingern heraus. Dann stürzte ich wieder nach unten in die Küche und wedelte damit vor Bels Nase herum, völlig außer Puste. »Und, genügt dir das?«
Er nahm mir das Schriftstück ab. »Wie alt ist dieses Ding?«
»Wird es damit klappen?«
»Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand versucht hätte, mit einer so alten Einladung reinzukommen.« Er reichte mir das Pergament zurück. »Und, wo steckt jetzt deine Schwester? Wir hätten schon vor zehn Minuten aufbrechen sollen.«
Mein Puls raste. »Du gibst mir den Job?«
»Mir bleibt ja wohl keine Wahl.« Was so nicht richtig war, aber aus irgendeinem Grund schien er nicht ohne Zosa von hier weggehen zu wollen. Sein Blick heftete sich wieder auf die Einladung. »Wenn dieser alte Wisch dir wirklich Zutritt verschafft, kannst du probeweise für mich arbeiten.«
»Was soll das heißen?«
»Du arbeitest zwei Wochen lang unbezahlt, genauso lang, wie ein Gast bei uns bleibt. Wenn du was taugst, bekommst du den Posten.«
»Zu zehn Dublonen in der Woche?«
»Fünf.«
Das war weniger, als Zosa bekam. Aber fünf waren immer noch mehr, als ich gegenwärtig verdiente. »Du bestimmst also über mein Schicksal?«
»Lass mich raten. Du hast ein Problem damit.«
»Hab ich nicht«, presste ich zähneknirschend hervor, auch wenn mir bei dem Gedanken fast der Kragen platzte. »Und was, wenn irgendwas schiefläuft?«
»Dann bist du den Posten los.« Was im Klartext hieß: Dann schickte er mich hierher zurück. Ohne Bezahlung und ohne Zosa. »Das ist ein äußerst großzügiges Angebot.«
»Davon bin ich überzeugt.« Vor drei Jahren war ich in die Gerberei spaziert, verzweifelt auf der Suche nach Arbeit. Wegen meines Alters hatte man mich probehalber arbeiten lassen, woraus sich dann eine Festanstellung ergeben hatte. Genau wie Bel es mir jetzt anbot. Es bestand also die Chance, dass es klappte. Entschlossen blickte ich auf. »Wie soll ich dir vertrauen?« Er konnte mich jederzeit an der Nase herumführen.
»Ich bin die Vertrauenswürdigkeit in Person.«
»Und das soll ich dir abnehmen?«
»Das bleibt dir überlassen.«
Ich wünschte, Maman wäre noch da. Sie hätte gewusst, was zu tun war. »Schwöre es bei deiner Mutter«, sagte ich, einer spontanen Eingebung folgend.
Ein gequälter Ausdruck überschattete sein Gesicht. »Ich erinnere mich nicht an meine Mutter.«
»Oh … tut mir leid«, erwiderte ich betreten, während mein Herz sich ebenfalls zusammenkrampfte. Ich hatte nur verschwommene Erinnerungen an meinen Vater. Ich senkte den Blick auf diesen Schlüssel, den er um den Hals trug. »Dann schwöre es bei deiner Magie.«
»Na schön. Ich schwöre bei meiner Magie, dass ich dir den Posten gebe. Und jetzt müssen wir uns sputen, wenn wir es noch rechtzeitig schaffen wollen.«
Ich malte mir bereits aus, wie Zosa und ich Seite an Seite aus dem Hotel traten und mitten in Aligney landeten, um endlich nach Hause zurückzukehren. Bel warf mir einen schiefen Blick zu, als ich vor mich hin kicherte, weshalb ich mir die Hand vor den Mund schlug. Ich drehte mich zur Treppe um, zögerte dann aber. Wenn wir gleich losrannten, würde Zosa nicht mithalten können.
»Du wirst sie tragen müssen«, sagte ich und flog die Stufen hinauf. Bel folgte dicht hinter mir. Sekunden später warf er sich Zosa über die Schulter wie einen Sack Winterrüben. Blinzelnd wachte sie auf und wollte sich wehren, bis ich ihr unseren Plan ins Ohr raunte.
»Wer ist er?«, formte sie tonlos mit den Lippen, dann spähte sie auf seinen Rücken und zog die Brauen zusammen.
Gott. »Hör auf damit.« Ich kniff sie in die Nase.
Bel ließ den Blick zwischen uns beiden hin und her wandern.
»Was ist denn?«, fragte ich betont unschuldig.
»Du hättest niemals zugelassen, dass ich nur sie
mitnehme, stimmt’s?« Er klang ernsthaft überrascht.
»Wie du schon festgestellt hast: schrecklich stur.«
Seine Mundwinkel zuckten, als müsste er sich ein Lächeln verkneifen. »Verlier die Einladung nicht, zumindest nicht, bevor wir durch die Eingangstür sind.« Er setzte sich in Bewegung und eilte mit langen Schritten den Flur entlang.
Zosas gepackter Sack lag immer noch auf dem Boden, vollgestopft mit Mamans Sachen aus ihrer Zeit als Musiklehrerin. Inklusive der Perlenohrringe.
Und da wurde mir klar: Zosa würde schon bald vor echtem Publikum auftreten, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Jetzt machten sich all die entbehrungsreichen Jahre also endlich bezahlt.
In einigen Monaten würden wir genügend Ersparnisse beisammen haben, um uns in Aligney lange Zeit über Wasser zu halten. Aber zuerst würden wir mit dem Hotel rund um den Erdball reisen, etwas von der Welt sehen. Das war alles viel zu wunderbar, um wahr zu sein.
»Würdest du dich jetzt bitte beeilen?«, rief Bel mir über die Schulter zu.
Das Knarzen von Schritten war zu hören. Die Mädchen wachten auf.
Also schnappte ich mir Zosas spinnenverseuchten Leinensack und rannte hinter dem Portier her, der meine Schwester auf dem Rücken trug.
4
Maman sagte einst zu mir, wahres Talent zeige sich früher oder später von allein. In dem Jahr, in dem ich elf wurde, verstand ich endlich, was sie damit gemeint hatte.
In Aligney fand jedes Jahr zu Beginn des Herbstes die Fête de la Moisson statt. Dann kippten die Erwachsenen unter freiem Sternenhimmel Unmengen vin de framboise in sich hinein und trieben Tauschhandel mit der spätsommerlichen Ernte. Maman ließ zu diesem Anlass immer ihre Schülerinnen auftreten und Geld für die Musikschule sammeln.
In diesem Jahr hatte Zosa wieder und wieder gebettelt, bei der Fête ebenfalls singen zu dürfen. Noch nicht, ma petite pêche, hatte Maman sie sanft zurückgewiesen. Du bist noch zu jung. Ich aber war der Meinung gewesen, meine Schwester sei gut genug, um ein paar Dublonen hinzuzuverdienen, und außerdem wollten wir unbedingt diese Dose Butterkaramell haben, die wir in der Auslage eines Ladens entdeckt hatten. Sie sahen unheimlich köstlich aus, eingewickelt in goldenes Stanniolpapier und mit kleinen Abenteuergeschichten unter der Banderole. Wild entschlossen, diese Bonbons zu kaufen, flocht ich Bänder in Zosas Haar und klaute eine Apfelkiste aus unserem Vorratsschrank. Kaum war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, liefen wir an den Stadtrand, wo die Festivitäten stattfanden.
Zahlreiche Besucher tummelten sich vor kunstvoll bemalten Ständen, die von flackernden Laternen erhellt wurden. In deren Gehäuse waren Märchenszenen geschnitzt. Beschämt wegen unserer alten Kiste, hätte ich am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht. Aber Zosa blieb hartnäckig, und ich hatte mir beim Tragen Splitter eingezogen. Das sollte schließlich nicht umsonst gewesen sein.