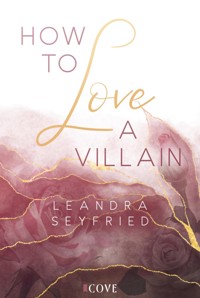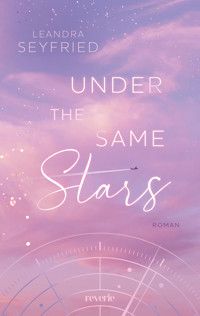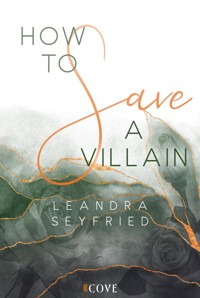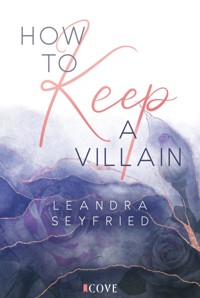
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Sprache: Deutsch
**Was ist, wenn dich nur ein Very Bad Boy beschützen kann?** Niemals hätte Devon sich träumen lassen, einmal in der Chicagoer Unterwelt ein und aus zu gehen. Doch seit sie den gefährlich attraktiven Tyler Fox im Gefängnis interviewt hat, ist nichts mehr wie zuvor. Ihr bisheriges Leben liegt in Trümmern und am liebsten würde Devon sich mit dem charismatischen Bad Boy vor der ganzen Welt verstecken. Stattdessen muss sie sich der Tatsache stellen, dass ihr Vater nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Zusammen mit einem Gangboss macht er Jagd auf Devon – und nun ist es einzig Tyler, der sie noch retten kann. Zusammen fliehen sie nach Kanada, doch die Vergangenheit macht auch vor den Landesgrenzen keinen Halt und schließlich muss Devon sich entscheiden, was für sie am meisten zählt: ihr Leben oder das von Tyler … //Dies ist der zweite Band der knisternden New Adult Romance »Chicago Love«. Alle Bände der Reihe bei Impress: -- How to Love a Villain (Chicago Love 1) -- How to Keep a Villain (Chicago Love 2) -- How to Save a Villain (Chicago Love 3)//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
COVE Story
More than a feeling.
COVE Story ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische E-Books und Prints. Wenn du süchtig machende Romance- und Romantasyromane deutschsprachiger Autor*innen suchst, ob von Newcomer*innen oder Vielschreiber*innen, wirst du hier garantiert fündig. Jede COVE Story lässt dich durch die Seiten fliegen und ist auf ihre eigene Art und Weise einzigartig.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Leandra Seyfried
How to Keep a Villain (Chicago Love 2)
**Was ist, wenn dich nur ein Very Bad Boy beschützen kann?**Niemals hätte Devon sich träumen lassen, einmal in der Chicagoer Unterwelt ein und aus zu gehen. Doch seit sie den gefährlich attraktiven Tyler Fox im Gefängnis interviewt hat, ist nichts mehr wie zuvor. Ihr bisheriges Leben liegt in Trümmern und am liebsten würde Devon sich mit dem charismatischen Bad Boy vor der ganzen Welt verstecken. Stattdessen muss sie sich der Tatsache stellen, dass ihr Vater nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Zusammen mit einem Gangboss macht er Jagd auf Devon – und nun ist es einzig Tyler, der sie noch retten kann. Zusammen fliehen sie nach Kanada, doch die Vergangenheit macht auch vor den Landesgrenzen keinen Halt und schließlich muss Devon sich entscheiden, was für sie am meisten zählt: ihr Leben oder das von Tyler …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Playlist
© Christian Franke
Leandra Seyfried wurde 1999 in Süddeutschland geboren und lebt heute in München, wo sie Medien- und Kommunikationsmanagement studierte. Zeitgleich zum Studium begann sie mit dem Schreiben ihres ersten Buches. Sie ist eine Optimistin, liebt das Lesen, Serien und Filme und lässt sich gern bei Städtereisen zu neuen Geschichten inspirieren.
Für meine Schwester Alisa.Wir mussten durch den dunkelsten Wald, doch du hast meine Hand niemals losgelassen.
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell sensitive Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Inhaltswarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Leandra Seyfried und das Cove Story-Team
Playlist
How Villains Are Made – Madalen Duke
The Best of You – Isak Danielson
River – Ochman
Runaway – Skylar Grey
Break My Broken Heart – Winona Oak
Shadow of Mine – Alec Benjamin
For Me Formidable – Charles Aznavour
Two Evils – Bastille
Chicago – Frank Sinatra
The Scene – Wolfie’s Just Fine
Heaven is a Place – Amber Run
Light – Jon Bryant
Without You – Ursine Vulpine, Annaca
One may smile, and smile, and be a villain. – William Shakespeare
Kapitel1
Wasser.
Es war über mir, unter mir, erstreckte sich zu allen Seiten ins scheinbar Endlose. Sämtliche Luft war aus meinen Lungen gepresst worden und ich erstickte. Nein, ich ertrank. Was war der Unterschied? War das nicht im Endeffekt dasselbe? Ich ertrank im Chicago River und zugleich in dem allumfassenden Schmerz, der meinen Körper durchströmte.
Luft. Ich brauche Luft!
Der Druck in meinem Brustkorb wurde größer und fühlte sich an, als würde jemand einen Ballon in meinem Inneren aufpusten. Ich werde sterben, schoss es mir durch den Kopf. Dieser Fluss wird mein nasses Grab sein.
Ich strampelte wie wild mit den Beinen und schwamm – wie ich hoffte – auf die Wasseroberfläche zu. Doch es konnte genauso gut sein, dass ich mich dem Grund des Flusses weiter näherte. Alle Seiten waren gleich dunkel und ich hatte meinen Orientierungssinn verloren.
Und dann durchbrach ich die Oberfläche. Sauerstoff strömte in meine Lungen, ließ den Ballon darin schmerzhaft zerplatzen. Ich riss die Augen auf und sah Bruchstücke des dunklen Himmels, der Wellen um mich herum und der Lichter der Stadt, die sich darin spiegelten.
Ich bin am Leben. Ich habe den Sprung überlebt.
Ich hustete das Wasser aus und rang zwischendrin japsend nach Luft, wobei ich ein beunruhigendes Rasseln von mir gab. Um nicht erneut in die verschluckende Dunkelheit des Flusses gezogen zu werden, ruderte ich mit den Armen.
Tyler.
Der Gedanke traf mich wie eine Kugel und ich sah mich hektisch um. Aus dem Augenwinkel sah ich Sebastians Boot – zehn Meter weiter links und wir wären darauf aufgeprallt.
Ich tauchte unter, schwamm umher, griff in das Wasser, ohne etwas zu sehen.
»Tyler!« Mein Schrei wurde von den Wellen davongetragen. Es handelte sich um bloße Sekunden, und dennoch fühlte es sich an wie volle Stunden, bis ich Tylers Arm zu fassen bekam.
Ich riss meine brennenden Augen auf und zog ihn aus der Dunkelheit des Flusses, die ihn zu sich ziehen wollte wie meine Mutter damals. Meine Mutter. Hatte Ian die Wahrheit gesagt? Lebte sie tatsächlich noch?
Ich schaffte es, Tylers Kopf über Wasser zu ziehen, und klopfte ihm auf die Wangen. Nichts. Seine Lider waren geschlossen und aus seinem Mund tropfte Wasser.
O nein. Nein, nein, nein!
Panik breitete sich in mir aus, wurde jedoch augenblicklich von Kampfgeist abgelöst. Denn dieses Mal hatte ich die Chance, ins Geschehen einzugreifen. Und dieses Mal würde ich nicht zulassen, dass die Liebe meines Lebens ertrank.
Also schwamm ich.
Ich wusste nicht wie, aber irgendwann erreichte ich das Boot.
Ich kämpfte damit, Tyler über Wasser zu halten, rüttelte ihn verzweifelt. Warum zur Hölle atmete er nicht?
Doch dann bebte sein Körper. Er hustete, spuckte Wasser, seine Augen blieben allerdings geschlossen. Erleichterung durchströmte meinen Körper und ich schluchzte laut, vergaß beinahe, dass wir uns nach wie vor im Wasser befanden.
Ich umklammerte Tyler wie eine Rettungsboje, als ich einen Blick nach oben auf das Dach warf, auf dem mein Vater und Ian noch immer stehen mussten. Blanker Hass rauschte durch meine Adern, ließ mich die Zähne so fest aufeinanderbeißen, dass sie knirschten. In diesem Moment schwor ich mir, mich an meinem Vater zu rächen. Er hatte mir nicht nur meine Mutter, sondern beinahe auch Tyler genommen. Bisher hatte ich mich nur verteidigt. Ich hatte reagiert und war ausgewichen, wann immer er zu einem Schlag angesetzt hatte. Doch damit war es vorbei. Ich würde ihm alles nehmen, was ihm jemals etwas bedeutet hatte, und erst aufhören, wenn er vor mir kniend um Gnade flehte.
Kapitel2
»Wir sind hier unten!«, rief ich atemlos, um Sebastian und Wes auf uns aufmerksam zu machen. Es kostete mich all meine Kraft, Tyler über der Oberfläche des eiskalten Wassers zu halten. Ich zappelte mit den Beinen und verstärkte den Griff um seine Arme.
»Tyler, wir haben es geschafft«, keuchte ich, doch er reagierte nicht. Ich versuchte verzweifelt an der glatten Außenseite des Bootes Halt zu finden, rutschte jedoch ständig aufs Neue ab. Inzwischen war es genauso dunkel, wie es kalt war.
»O mein Gott, Devon!«, rief Sebastian. Ich blickte nach oben und sah ihn neben Wes an der Reling stehen. »Wie –«
Wasser schwappte mir ins Gesicht. »Tyler zuerst«, brachte ich zwischen klappernden Zähnen hervor, als Wes und Sebastian nach ihm griffen und ihn keuchend an Deck zogen.
Wir hatten es tatsächlich geschafft zu entkommen.
»Devon.« Sebastian beugte sich zu mir herunter. Strähnen seiner kinnlangen, dunklen Haare fielen ihm ins Gesicht und er sah mich mit einem Ausdruck an, der eine Mischung aus Sorge und der Frage war, ob wir von allen guten Geistern verlassen waren. »Halt dich an mir fest«, rief er, bekam mich über den Ellbogen zu fassen und zog mich nach oben. Durchnässt und bis auf die Knochen durchgefroren, sackte ich schließlich in seinen Armen zusammen.
»Alecto«, hustete ich.
»Sie ist hier«, versicherte er mir und die Erleichterung durchströmte mich so heftig, dass ich geräuschvoll aufatmete. »Aber wir müssen sofort ins Krankenhaus. Fahr los«, wies Sebastian Wes an, der über Tyler gebeugt stand. Dieser hatte den Kopf zwischen den Knien und hustete Wasser hervor.
»Scheiße, Devon! Was ist passiert?« Das Boot setzte sich in Bewegung. »Kannst du allein stehen?«, fragte Sebastian und ich nickte, obwohl ich mir dessen nicht sicher war. Wasser rann an mir hinab und färbte die Holzdielen des Decks um mich herum dunkel. Er ließ mich los, woraufhin ich erst etwas schwankte, bevor ich mein Gleichgewicht wiederfand.
Ich strich mir meine nassen Haare aus dem Gesicht und suchte Sebastians Blick. Seine Augen waren weit aufgerissen und der Horror stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Es war der einzige Weg«, begann ich, während sich meine Gedanken wild überschlugen. Wie zum Teufel hatten wir diesen Sprung überleben können? »Wir haben das Video wie geplant abgespielt, doch Ian hat mich entdeckt und gefasst. Alecto wollte mich retten …« Tränen stiegen mir in die Augen, aber ich machte mir nicht die Mühe, sie wegzublinzeln. Sie waren regelrecht heiß auf meiner kalten Haut. »Ian hat auf sie geschossen. Daraufhin hat er mich aufs Dach gebracht und kurz danach kam Tyler dazu.« Ich schloss die Augen und schüttelte meinen Kopf, versuchte meine wirren Erinnerungen zu ordnen. »Elliott hat mir gedroht, dass er Tyler umbringt, wenn ich nicht mit ihm komme und den Mord an Louise Ryan gestehe. Wir saßen fest, da ich im Gefängnis gelandet wäre, und Tyler …« Ich konnte den Satz nicht zu Ende sprechen, sah zu ihm, um mich zu vergewissern, dass er tatsächlich mit mir auf diesem Boot war.
Sebastian verstand und nickte grimmig. Die Lichter Chicagos zogen an uns vorbei und mein Kopf drehte sich mit ihnen.
»Letztendlich gab es nur einen Ausweg. Das einzige Schlupfloch, an das sie nicht gedacht haben. Wir sind gesprungen.« Ich rieb mir mit den Händen über das Gesicht und merkte, dass meine Fingerspitzen taub waren. »Es war riskant, doch wir mussten es versuchen.«
Sebastian berührte meine Schulter. »Das ist … ich kann es nicht fassen. Ich muss einen Anruf tätigen. Fühlst du dich in der Lage, nach Alecto zu sehen? Sie …« Er nickte zur anderen Seite des Decks. Sie saß in eine Decke gewickelt an die Reling gelehnt und starrte gen Himmel. Bei dem Anblick gaben beinahe erneut meine Beine unter mir nach. »Wir haben die Schusswunde mit einem Stück Stoff verbunden, doch die Blutung stoppt einfach nicht.«
Das klang gar nicht gut.
Ohne zu zögern setzte ich mich in Bewegung, während Sebastian sein Telefon hervorzog. Keuchend ließ ich mich neben ihr auf die Knie fallen. »Alecto«, krächzte ich. Behutsam schob ich die Decke zur Seite und erschrak: Ihr weißes Hemd war vollständig rot eingefärbt. Ich wickelte sie wieder in die Decke ein und strich über ihre Arme. Sie hatte mich retten wollen. Das war alles meine Schuld.
Sie atmete flach, als sie ihre Augen öffnete. »Du bist hier«, wisperte sie. »Tyler?«
Ich nickte. »Er ist auch hier, alles ist in Ordnung.« Klar, Devon, alles ist prima. Bis auf die Tatsache, dass wir von einem Dach gesprungen, knapp dem Tod entronnen und Tyler und Alecto vermutlich lebensbedrohlich verletzt waren. Dass alles in Ordnung war, war eine gnadenlose Lüge, doch ich wollte ihr in diesem Zustand keine Angst machen.
»Was ist passiert? Wie habt ihr …« Sie hustete und verzog dabei das Gesicht. »… es rausgeschafft?«
Ich strich ihr eine leuchtend rote Strähne aus dem Gesicht und schob sie hinter ihr Ohr. »Wir sind vom Dach gesprungen«, erklärte ich und konnte es selbst immer noch nicht glauben.
Ein schwaches Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. »Ihr seid was? Das ist ’ne ziemlich krasse Nummer, Dev.«
Ich schüttelte den Kopf. »Du hast mich retten wollen und dir dafür eine Kugel eingefangen. Wenn etwas eine ziemlich krasse Nummer ist, dann das.«
Sie hob ihre Hand, um eine abwinkende Geste zu machen, war aber nicht stark genug, weshalb diese mit einem dumpfen Geräusch zurück aufs hölzerne Deck fiel. Als ihre Lider sich flatternd schlossen, durchströmte eine Mischung aus Panik und Adrenalin meinen Körper, die mich energiegeladener machte, als ich sein sollte.
»Hey«, sagte ich laut und klopfte ihr auf die Wange. »Du wagst es nicht, jetzt zu sterben. Hast du gehört?«
Sie sah mich mit glasigem Blick an und ihre Lider zuckten. »Ich bin die Rachegöttin, vergessen? Kugeln können mir nichts –« Ihr Satz endete in einem Hustenanfall und der dunkle Fleck auf der grauen Decke wurde größer. O Scheiße. Was war, wenn sie es nicht schaffte?
»Eben«, meinte ich und versuchte so zuversichtlich wie möglich zu klingen. »Es kann dir nichts etwas anhaben, hast du gehört?« Wenn es doch bloß so wäre. »Du darfst nicht einschlafen, in Ordnung?« Mein Herz krampfte sich zusammen und die Panik schnürte mir den Hals zu.
Alecto nickte schwach und ergriff meine Hand, während wir unter einer Brücke hindurchfuhren und das Deck für einen kurzen Moment in vollständige Dunkelheit getaucht wurde. Ihre Hand war eiskalt, obwohl ich diejenige war, die gerade bei Minusgraden ein Bad im Chicago River genommen hatte. Und das machte mir eine Heidenangst. Wenige Sekunden später flutete das sanfte Licht der umliegenden Gebäude und Straßenlampen erneut das Boot.
»Wie sehe ich aus?«, fragte Alecto.
Ich stieß ein ersticktes Lachen hervor und wischte mit der freien Hand über ihr mit kalten Schweißperlen bedecktes Gesicht. »Blutig, blass und ein bisschen gruselig.«
Sie lächelte schwach. »Genau das wollte ich hören. Klingt vielversprechend.«
Ich hob meinen Kopf und sah zu Tyler, der zwar aufrecht saß, allerdings leichenblass war. Seine Lider waren nur halb geöffnet und seine Kiefer waren fest aufeinandergepresst.
Wassertropfen aus meinen Haaren vermischten sich mit meinen Tränen und fielen auf das Deck hinab.
Mein Körper zitterte, doch ich spürte weder Kälte noch Schmerz. Alles, was zählte, war, dass Tyler und Alecto am Leben blieben.
»Wir sind gleich da«, erklang Sebastians Stimme neben mir. Ich zuckte heftig zusammen, da ich ihn nicht hatte kommen hören. Höchstwahrscheinlich hatte ich Wasser im Ohr. Er kniete sich von der anderen Seite neben Alecto und begann leise mit ihr zu reden.
Ich erhob mich zitternd und knickte beinahe um, als ich den stechenden Schmerz in meinen Fußgelenken spürte. Das Adrenalin schien nachzulassen, doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um schwach zu werden. Ich überbrückte die wenigen Meter und kniete mich neben Tyler.
»Tyler«, flüsterte ich, doch er hob seinen Kopf nicht an. Stattdessen tastete er nach meiner Hand und drückte sie schwach. Mit meiner freien Hand fuhr ich durch seine nassen Haare, strich ihm Strähnen aus dem Gesicht. »Alecto ist hier und wir fahren ins Krankenhaus«, sagte ich, da ich nicht wusste, wie viel Wes ihm bereits gesagt hatte.
»Ich bringe ihn um«, knurrte er. »Dieses Mal wirklich.« Seine Worte gingen beinahe in dem Geräusch des Motors unter. »Was bin ich nur für ein Scheißidiot. Ich hätte dich niemals in Gefahr bringen sollen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wir haben es geschafft, okay? Wir haben das Video abgespielt und sind Elliott und Ian entkommen.« Immer mehr Schmerzen fanden ihren Weg in mein Bewusstsein und feuerten die Wut auf meinen Vater stärker an.
Er drückte meine Hand etwas fester und ich sah, dass seine Knöchel bluteten. Das war die Hand, mit der er auf Ian eingeschlagen hatte. Ich blickte zu Wes, der das Boot über den Fluss lenkte. Dann zu Sebastian, der seine Stirn an Alectos gelegt hatte und verzweifelt auf sie einredete.
Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Die Worte hallten in meinem Kopf wider, nahmen mir die Luft zum Atmen.
»Wie lange noch?«, fragte ich laut genug, damit Wes mich über das Geräusch der Motoren hinweg hören konnte.
»Fünf Minuten«, antwortete er. »Haltet durch.«
Ich strich immer wieder über Tylers Oberarm, seine Wangen und Finger, musste ihn spüren, während ich versuchte meine Wut im Zaum zu halten. Ich hatte mich getäuscht. Es war naiv gewesen zu denken, dass ich Elliotts Handlungen vorhersehen konnte. Der heutige Abend hatte mir gezeigt, wie unberechenbar er war. Würde er die Verfolgung sofort aufnehmen? Oder würde er Kräfte sammeln, Pläne schmieden und dann angreifen, wenn wir es am wenigsten erwarteten?
»Alecto! Hey!«
Mein Kopf fuhr herum. Sebastian rüttelte Alectos Schultern und mein Herz setzte einen Schlag aus. »Sie hat das Bewusstsein verloren«, rief er verzweifelt und es fühlte sich an, als ob mich der Fluss ein weiteres Mal in seine Tiefen zöge.
Kapitel3
Als wir das Boot an der Anlegestelle befestigt hatten und das Krankenhaus bereits in Sichtweite war, setzte das Klingeln in meinen Ohren ein. Wes hatte ein Klinikum ausgesucht, das nah am Flussufer lag, damit wir nicht weit laufen mussten. Und obwohl ich den von Eichen gesäumten Eingang bereits sehen konnte, hatte ich plötzlich das Gefühl, es nicht mehr zu schaffen. Es gab keine Stelle meines Körpers, die nicht schmerzte, und ich konnte mir nur mit Mühe ein Humpeln verkneifen.
Wenn ich mir Alectos blasse Hand ansah, die neben Sebastians Bein baumelte, kam eine überwältigende Übelkeit hinzu, die rein gar nichts mit dem Sturz zu tun hatte. Es war blanke Angst. Dass wir uns der Gefahr aussetzten, in ein Krankenhaus zu gehen, zeigte, wie ernst die Situation tatsächlich war und wie schlecht es um Alecto stand.
Wie hatte alles derart aus dem Ruder laufen können?
Sebastian trug Alecto auf dem Arm, ihre Haare waren ein einziges Durcheinander aus Rot und Schwarz. Seit drei schrecklichen Minuten war sie nicht mehr ansprechbar und meine Panik stieg mit jeder Sekunde. Ich musste den Impuls unterdrücken, ihr Handgelenk zu nehmen, um ihren Puls zu überprüfen.
Kurz nachdem wir das Boot verlassen hatten, hatte Tyler sich übergeben. Ich betete, dass es das Symptom einer Gehirnerschütterung und nichts Schlimmeres war. Er lief hinter Sebastian, gestützt von Wes und den Blick auf den Boden gerichtet. Abgesehen davon, dass Tyler und Alecto dazu nicht in der Lage waren, sagte keiner von uns ein Wort.
Der Wind zog an meinen nassen Kleidern und es fühlte sich an, als würden sie an mir festfrieren. Ein Blick auf meine blauen Finger verriet mir, dass ich wahrscheinlich auf dem besten Weg zu einer Unterkühlung war. Doch das war unser geringstes Problem.
»Devon«, sagte Sebastian und durchbrach damit die Stille. Sein Gesichtsausdruck war gequält und es kam mir vor, als vermied er es, Alecto anzusehen. »Kannst du vorgehen und uns am Empfang ankündigen? Dann geht es etwas schneller. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher …« Er stockte.
Wie viel Zeit uns noch bleibt. Mein Magen verkrampfte sich.
Ich nickte, schluckte meine Angst und den Schmerz hinunter und rannte auf den Eingang zu. Denn Verletzungen hin oder her – ich würde all das und viel mehr in Kauf nehmen, um meine Familie zu retten.
Die Schiebetüren öffneten sich mit einem leisen Zischen und die Wärme des Raumes traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. War es hier tatsächlich so warm wie in einer Sauna oder war ich bereits derart stark unterkühlt?
Ich joggte auf den breiten Empfangstresen zu, hinter dem eine weiße Frau mit blondem Zopf saß. »Wir brauchen Hilfe«, erklärte ich außer Atem. »Eine Frau mit einer Schusswunde und ein Mann, der …« Ich unterbrach mich selbst. Wie zum Teufel sollte ich das formulieren? »Er … er ist aus einem Fenster gefallen. In den Chicago River.«
Fenster klang ein wenig mehr nach Unfall als Dach. Ich konnte wohl schlecht sagen, dass er vom Dach gesprungen war, ohne dass ihn jemand für selbstmordgefährdet hielt.
Die Frau hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne, fing sich allerdings sofort wieder und nickte gefasst. Sie rief zwei ihrer Kollegen herbei und rannte in dem Moment auf den Eingang zu, in dem Sebastian mit Alecto auf dem Arm das Krankenhaus betrat. Ein Mann schob eine Liege herbei, auf die Sebastian Alecto vorsichtig ablegte, wobei die graue Decke von ihren Schultern auf den Boden fiel und den Blick auf ihr blutdurchtränktes Hemd freigab.
»Patientin nicht ansprechbar«, rief eine Krankenschwester und schnallte ein Blutdruckmessgerät um Alectos Arm, während eine andere mit einer kleinen Taschenlampe in ihre Augen leuchtete. »Blutdruck und Körpertemperatur niedrig.«
Ein Mann in weißem Kittel riss ihr Hemd auf und betrachtete die Wunde für eine einzige Sekunde, ehe er ein Zeichen gab und sagte: »OP, sofort.« Ohne Zeit zu verschwenden, fuhren sie die Liege durch eine Schiebetür aus Milchglas und verschwanden mit Alecto im hinteren Bereich des Krankenhauses.
Ich drückte meine Handflächen aneinander und presste sie an meine Lippen. Sie musste es schaffen. Sie musste einfach.
Ich nahm meine letzten Kräfte zusammen und ging zurück zur Schiebetür, durch die Tyler und Wes gerade das Krankenhaus betraten. Tyler war blass – seine dunklen Haare bildeten einen zu starken Kontrast zu seiner Haut und seine Augen waren nur halb geöffnet. Ich zog die Augenbrauen zusammen und ging auf ihn zu. Kurz bevor ich bei ihm angekommen war, verfing sich sein Fuß in dem Teppich am Eingang und er stolperte.
»Tyler!«, rief ich panisch und griff nach seinem Arm, versuchte gemeinsam mit Wes ihn zu stützen.
Jemand schob eine zweite Liege herbei und zwei Männer halfen Tyler, sich daraufzulegen. Ich stellte mich neben das Kopfende und umklammerte seine Hand.
»Tyler, bitte.« Ich wusste nicht, um was ich ihn bat. Vermutlich, dass er am Leben blieb. Mich nicht allein ließ. Tränen fanden ihren Weg über meine Wangen und tropften von meinem Kinn.
»Devon«, hauchte er. »Alles ist gut.« Er strich mit dem Daumen schwach über meinen Handrücken.
Ich schluchzte auf. Nichts war gut, doch ich wusste, dass Tyler es nicht ertragen konnte, mich so zu sehen.
Eine Ärztin mit roter Brille berührte mich an der Schulter. »Wir haben alles unter Kontrolle, Miss«, versicherte sie mir und schob mich sanft beiseite. Bevor ich Tylers Hand widerwillig losließ, drückte ich sie einmal. Eine letzte stumme Bitte, ein Versprechen und ein Liebesgeständnis in einem.
»Keine äußerlichen Verletzungen«, stellte ein Mann mit blonden Haaren fest.
»Können Sie mich verstehen?«, fragte die Ärztin Tyler. Auch bei ihm überprüften sie den Puls, die Körpertemperatur und die Reaktion seiner Pupillen, während sie ihn aus der Eingangshalle schoben. »Wir bringen ihn ins CT, um innere Blutungen ausschließen zu können«, war das Letzte, was ich hörte. Ich versuchte es nicht als schlechtes Zeichen zu deuten, dass sie rannten.
Warum ging es ihm schlechter als mir? Es war ungerecht. Schließlich war es mein Vater, der uns bedroht hatte. Wenn ich könnte, würde ich unsere Plätze auf der Stelle tauschen.
Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld.
Die Gefühle übermannten mich und ich schloss für einen kurzen Moment die Augen. Was auch immer da oben ist, Tyler und Alecto darf nichts geschehen, ich flehe dich an.
Ich glaubte fest daran, dass das Gute siegte. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit. Doch wenn Tyler oder Alecto etwas passieren sollte, während Elliott und Ian unversehrt blieben, würde ich den Glauben für immer verlieren.
Ich schluckte mehrmals, um die Tränen zurückzudrängen, und atmete tief ein und aus, was rein gar nichts zu meiner Beruhigung beitrug. Wie unrealistisch es doch war, dass Menschen in Filmen in solchen Situationen die Fassung bewahren konnten. Dass sie mit Ärzten sprachen und sich ins Wartezimmer setzten. Am liebsten hätte ich gleichzeitig geweint, geschrien und die Glasvase mit den weißen Lilien von der Empfangstheke genommen, um sie gegen eine der Wände zu werfen.
Ich sah mich hilfesuchend nach Wes und Sebastian um. Noch nie zuvor hatte ich mich derart klein und hilflos gefühlt. Sebastian entdeckte ich ein paar Meter entfernt neben einer halb vertrockneten Zimmerpalme. Ich konnte durch das Klingeln in meinen Ohren nicht hören, was er zu der blonden Frau sagte, doch da er auf mich zeigte und sie wenige Sekunden später auf mich zukam, hatte ich eine Vermutung.
»Sie sind ebenfalls gefallen«, stellte sie mit großen Augen fest. »Warum haben Sie nichts gesagt?«
Ich blinzelte. Wenn sie nicht zufällig eine Kollegin hatte, die genauso aussah wie sie, sah ich jetzt wohl auch noch doppelt. Großartig. »Bitte legen Sie sich auf die Liege.«
Scheiße, das ging nicht. Was hatte sich Sebastian dabei gedacht? Ich konnte mich nicht in einem Krankenhaus behandeln lassen. Nicht, solange ich noch von der Polizei gesucht wurde. Denn trotz allem lag ein Haftbefehl gegen mich vor und wenn ich jetzt gefasst werden würde, wäre alles umsonst gewesen.
»Nein«, meinte ich eilig und schüttelte den Kopf, was das Schwindelgefühl nur verstärkte.
»Nein?« Sie sah mich verwirrt an.
»Ist schon in Ordnung, Amanda«, sagte Sebastian zu mir. »Ich habe alles unter Kontrolle, vertrau mir.«
»Legen Sie sich bitte auf die Liege, Miss«, bat die Frau erneut und schob mich sanft nach hinten, bis ich das Gestell in meinen Kniekehlen fühlte. Wes und Sebastian bedachten mich beide mit einem besorgten Blick, auch wenn ich mir dessen nicht ganz sicher sein konnte, da ich beide sowohl verschwommen als auch doppelt sah.
Ehe ich noch etwas erwidern konnte, wurde ich ebenfalls durch die Schiebetür in den hinteren Bereich des Krankenhauses geschoben. Die Decke zog an mir vorbei und ich betrachtete den Abstand zwischen den grellen Deckenlampen. Wie hatte alles so dermaßen schiefgehen können, dass drei von uns in der Notaufnahme landeten? Ich musste zu Tyler, musste wissen, wie es ihm und Alecto ging. Meine Gedanken kreisten und blieben schließlich bei Ians Worten stehen: Deine Mutter ist am Leben, Devon. Sie ist nie gestorben. Ein Schauer durchfuhr mich. Ich hatte keinen Grund, Ian Glauben zu schenken, und dennoch hatte ich das Gefühl, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Warum, konnte ich mir nicht erklären.
Ich schloss die Augen und versuchte, wie Mom es mir damals beigebracht hatte, etwas Positives zu finden. Wir hatten das Video abspielen können. Wir waren nicht tot. Zumindest noch nicht. Ich spürte die Welle der Panik in mir aufbranden und schüttelte den Kopf. Nein, denk nicht ans Sterben! Schnell, denk an etwas anderes. Weihnachten, Regenbögen, Wolken … Himmel, Jenseits, Tod. Ich seufzte auf. Na toll.
»Ist sie ansprechbar?«, fragte der Arzt, der im Laufschritt neben die Liege getreten war.
»Ja«, antworteten die Krankenschwester und ich gleichzeitig.
»Was ist passiert?«
Wenn meine Zähne nicht so geklappert hätten, wäre mir vielleicht ein hysterisches Lachen herausgerutscht. Wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde, würde er mir nicht glauben. Ich öffnete ein Auge und sah einen der beiden identisch aussehenden Ärzte an. »Ich bin aus dem Fenster in den Chicago River gefallen«, entgegnete ich und trotz meiner Sehstörungen entging mir der Blick nicht, den sich die beiden zuwarfen.
»Wann?«, fragte er, als wir zwischen weißen Vorhängen zum Stehen kamen.
»Vor etwa zwanzig Minuten«, antwortete ich, während mir jemand mit einer kleinen Taschenlampe in die Augen leuchtete. Ich kniff sie zusammen und zuckte zurück.
»Körpertemperatur und Puls niedrig«, hörte ich eine weibliche Stimme sagen.
»Prellung am rechten Handgelenk«, murmelte der Arzt vor sich hin, während mir jemand eine Beatmungsmaske auf das Gesicht legte. »Ich nehme an, Sie werden mir weder erzählen, wen Sie geschlagen haben, noch, wie Sie aus diesem Fenster gefallen sind?« Er klang beinahe genervt.
Entkräftet schloss ich meine Augen und schüttelte vorsichtig den Kopf. Auf gar keinen Fall.
Er seufzte hörbar. »Chicago …«
***
»Ich habe Ihnen etwas gegen die Schmerzen und die Übelkeit gegeben. Die Gehirnerschütterung wird sich von allein bessern, allerdings nur – und das sage ich Ihnen im Guten – wenn Sie sich Ruhe gönnen.« Die Ärztin schob sich ihre Brille in die Haare. »Den Verband am Handgelenk lassen Sie bitte in zwei Wochen erneuern«, erklärte sie.
Die Sauerstoffmaske, die Wärme und die Schmerzmittel hatten Wunder bewirkt: Ich fühlte mich – rein körperlich gesehen – um einiges besser. Doch innerlich waren die letzten Stunden die reinste Qual gewesen. Immer und immer wieder war ich die Szenen auf dem Dach durchgegangen, hatte Ians Worte gehört und Tyler bewusstlos im Chicago River treiben sehen.
»Wie geht es dem Mann, der mit mir reingekommen ist?«, fragte ich hastig und verschluckte dabei einige Silben. »Und der Frau mit der Schussverletzung?« Ich hielt die Luft an, derart fürchtete ich mich vor ihrer Antwort. Mein Herz flatterte so schnell in meiner Brust, dass ich mir sicher war, es würde jeden Moment stehen bleiben. Wenigstens lag ich bereits im Krankenhaus und war damit am richtigen Ort.
»Ich weiß nicht, zu welchen Göttern Sie und Ihre Freunde beten, aber es scheint zu wirken.« Sie sah von ihrem Klemmbrett auf. »Solches Glück hat man nur einmal im Leben.«
Mir stiegen Tränen in die Augen.
»Der Mann hat in etwa dieselben Verletzungen wie Sie, auch wenn seine Gehirnerschütterung etwas stärker zu sein scheint. Innere Blutungen konnten wir im CT keine feststellen.« Sie seufzte tief und sah mich streng an. »Er wird wieder, aber vielleicht können Sie ihm einreden, dass er noch nicht gehen sollte. Diesen Wunsch hat er nun schon mehrmals geäußert und er hört auf keinen Arzt, der ihm anordnet, über Nacht zu bleiben.«
Ich lachte kurz auf und wischte mir die Tränen von der Wange. Das klang ganz nach Tyler. »Und Alec– … ähm, die Frau?«
»Die Kugel hat ihre Milz getroffen, weshalb sie laparoskopisch entfernt werden musste.«
Was bedeutete das? Sie hatte keine Milz mehr? Ging es ihr gut?
Sie schien die Fragezeichen in meinem Gesicht zu sehen, weshalb sie sagte: »Man kann ohne Milz leben. Und dass sie laparoskopisch entfernt wurde, bedeutet für sie, dass sie schneller wieder fit sein wird«, erklärte sie.
Mir entfuhr ein Schluchzer, bevor ich mir die Hand auf den Mund pressen konnte. »Danke«, keuchte ich. »Wirklich. Danke.« Dann setzte ich mich auf und platzierte die Füße vorsichtig auf dem Boden.
»Halt.« Sie berührte meine Schulter. »Was tun Sie da?«, rief sie und sah mich mit weit aufgerissenen Augen an.
»Ich kann doch gehen, oder?«
Sie blinzelte. »Ich sage Ihnen jetzt dasselbe, was ich Ihrem Freund schon erklärt habe: Ich rate Ihnen entschieden davon ab, das Krankenhaus heute zu verlassen.«
Und zu warten, bis Ian oder Elliott meinen Aufenthaltsort ausfindig machten? Niemals. Außerdem musste ich Tyler sehen. Um jeden Preis.
»Mir geht es schon um einiges besser. Es wird nicht nötig sein, länger hierzubleiben.«
Eine Weile stand sie ausdruckslos vor mir. Dann seufzte sie tief und entfernte mit einem strengen Blick die Infusionsnadel aus meinem Arm. »Unterschreiben Sie die Entlassungsformulare, bevor Sie gehen.«
***
Das Quietschen meiner nassen Schuhe hallte in dem Gang wider, dessen Wände und Decken vollständig weiß gestrichen waren. Der Boden wiederum war dunkelgrün und ich konzentrierte mich auf die Abstände zwischen den darauf aufgeklebten Pfeilen, als ich zurück in Richtung Eingang lief.
Ein dumpfer Schmerz pochte in meinem Hinterkopf – dank der beachtlichen Menge an Schmerzmitteln das letzte Überbleibsel des Sprunges in den Fluss. Na gut, das und die feuchte Kleidung, die mir am Körper klebte. Wenige Stunden zuvor hatten wir Witze über die Kellnerkleidung gemacht. Nun wollte ich nichts lieber, als sie mir vom Körper zu reißen. Ich spürte Ians Hand noch immer an meinem Arm. Spürte seinen zu festen Griff, seinen Atem an meinem Hals. Ich höre nicht auf, bis ich dich zurückhabe.
Die Intensität und Lautstärke der Bilder und Wortfetzen in meinem Kopf schwollen an, bis ich nichts anderes hörte. Meine Augen brannten und mein Mund wurde trocken. Abrupt blieb ich im Gang stehen und hielt mich an dem Geländer an der Wand fest, als mich der Schwindel ein weiteres Mal übermannte. Dieses Mal hatte es jedoch nichts mit meinen Verletzungen zu tun. Bis auf einen Pfleger, der ein Bett von einem Zimmer ins andere schob, war der Gang leer. Ich ging neben der Wand in die Hocke und blickte zur Decke. Direkt über mir prangte ein Wasserfleck.
Atme, Devon. Du bist entkommen. Tyler und Alecto sind am Leben. Doch der Gedanke daran, wie knapp es gewesen war, das Wissen, dass es noch nicht vorbei war, presste mir die Luft aus den Lungen. Ich gab mir zehn Sekunden, in denen ich mich der Angst, der Schuld und der Sorge hingab. Zehn Sekunden, in denen ich die Panik, die in meinem Inneren tobte, nicht unterdrückte.
Schließlich schniefte ich, wischte mir die Tränen von den Wangen und erhob mich. Reiß dich zusammen. Niemand durfte sehen, dass ich die Grenze des Aushaltbaren schon längst überschritten hatte. Ich räusperte mich, öffnete die Milchglastür und ließ den Moment der Schwäche hinter mir im Flur.
Das Erste, was ich sah, als ich die Eingangshalle betrat, war Tyler. Er saß zwischen Wes und Sebastian, das weiße Hemd zerknittert. Doch bis auf die Müdigkeit, die seine Augen umgab, und den Verband um seine Hand, sah er aus wie immer. Er hob seinen Kopf, und als sich unsere Blicke trafen, wurde ich für den Bruchteil einer Sekunde an unsere Treffen im Gefängnis erinnert. Getrennt von einem Raum voller Menschen und nur Augen füreinander.
Ich dachte an den Moment auf dem Dach, als wir beide sicher gewesen waren, wir müssten sterben. An den Moment im Wasser, als ich geglaubt hatte, dass der Fluss ihn verschluckt hatte. Wie von selbst setzten sich meine Füße in Bewegung, und erst als er mich in seine Arme schloss, konnte ich wieder richtig atmen.
»Ich hatte eine solche Angst, dich zu verlieren«, schluchzte ich und vergrub mein Gesicht an seiner Brust. Die Personen im Warteraum warfen verwunderte Blicke in unsere Richtung, doch ich schloss die Augen und blendete sie aus.
»Ich werde dich nicht allein lassen«, raunte er in meine Haare und drückte mich fester an sich. »Das habe ich dir versprochen. Ich wollte zu dir, doch sie haben mich nicht gelassen. Die Ärztin war ziemlich sauer, dass ich nicht über Nacht bleibe«, entgegnete er, und als ich zu ihm hochsah und die vertrauten Lachfältchen entdeckte, durchströmte mich eine neue Welle der Erleichterung. Wie ich das vermisst hatte.
»Das hat sie mir auch gesagt.« Ich lächelte durch meine Tränen hindurch. »Ich glaube, sie mag uns nicht besonders.«
Tyler lachte heiser, nahm mein Gesicht zwischen seine Hände und gab mir einen langen, sanften Kuss auf die Lippen. Als er sich von mir löste, umfasste er meine Hand mit seiner, als könnte er keinerlei Distanz zwischen uns ertragen. »Ist alles in Ordnung?«, fragte er und sah an mir herunter. »Geht es dir gut?«
Ich nickte stumm, ehe ich mich umdrehte und Sebastian, Wes und zu meiner Überraschung auch Gia gegenüberstand.
»Himmel, Devon«, meinte Sebastian und schüttelte den Kopf. »Bin ich froh, dass alles gut gegangen ist.«
»Und ich erst«, warf Wes ein, die Hand auf das Herz gepresst. »Ich glaube, ich muss mir ein paar blutdrucksenkende Tabletten stehlen.«
»Ist alles so weit geregelt?«, fragte ich. »Wegen des …« Ich senkte die Stimme. »Haftbefehls?«
»Ich habe alles geklärt, mach dir keine Gedanken darum. Die Chefärztin ist die Freundin eines Freundes …« Sebastian scannte die Eingangshalle. »Aber jetzt lasst uns gehen.«
»Was ist mit Alecto?«, fragte ich.
»Wes und ich bleiben hier, bis sie wach wird«, erwiderte Gia, die eine graue Jogginghose und ein langärmliges Batman-Shirt trug. Sie machte einen Schritt auf mich zu und drückte mich fest an sich. »Ich bin so dankbar, dass euch nichts passiert ist.«
Ich erwiderte ihre Umarmung. »Ich auch«, hauchte ich. Nachdem wir uns voneinander gelöst hatten, umarmte mich auch Wes und strich mir über den Rücken. Für einen kurzen Moment vergaß ich Ian, Elliott und all die Gefahren, die uns umgaben. Ganz gleich, wie viel Hass uns entgegenströmte – Liebe war immer stärker.
Und dennoch flüsterte eine leise Stimme in meinem Kopf, dass das erst der Anfang gewesen war. Ich versuchte mit aller Kraft sie auszublenden.
Leider sollte sie recht behalten.
Kapitel4
Für jemanden, der auf der Autofahrt mehr als fünfmal betont hatte, dass er sich munter fühlte, war Tyler überraschend schnell eingeschlafen. Nachdem er die feuchten Kleidungsstücke ausgezogen und sich ins Bett gelegt hatte, hatte es nur wenige Sekunden gedauert. Obwohl ich mir sicher war, dass er auch dann nicht aufwachen würde, wenn jemand die Schlafzimmertür mit einem Hammer einschlüge, gab ich mir beim Umziehen die größte Mühe, so leise zu sein wie möglich. Als ich die Hose auszog, die feucht an meiner Haut klebte, erschrak ich: Meine Haut war von blauroten Blutergüssen überzogen. Ich fuhr vorsichtig über meine Beine. Ich wollte gar nicht wissen, wie das wehtun würde, sobald die Schmerzmittel nachließen.
Nachdem ich eine weiche Jogginghose und ein weites Shirt angezogen hatte, öffnete ich leise die Zimmertür. Sebastian, der an der Wand gegenüber der Tür lehnte, sah von seinem Handy auf. »Alecto ist aufgewacht«, flüsterte er und die Erleichterung in seiner Stimme war beinahe spürbar. »In zwei Tagen kann sie wieder nach Hause.«
Ich schloss die Augen. Danke. Wer auch immer meine Bitte erhört hat – danke. Ich rieb mit der Hand über den Schmerz in meiner Brust. »Ich weiß nicht, wie ich ihr jemals danken soll. Sie hätte das nicht tun sollen, ich …«
Sebastian schüttelte den Kopf. »Es ist nicht deine Schuld, falls du das denkst.«
Ich presste die Zähne aufeinander. »Es ist mein Vater, der uns gedroht hat. Mein ehemaliger Verlobter, der auf sie geschossen hat.« Ich sah zu Boden. »Ich hätte niemals zulassen sollen, dass ihr mich begleitet.«
»Wir sind eine Familie, Devon.«
Ich blickte auf die glitzernden Lichter Chicagos, die den Flur in bläuliches Licht tauchten. »Ich will seine Wiederwahl verhindern«, sagte ich und meine Stimme hörte sich fremd an. »Ich will, dass er niemandem mehr Schaden zufügen kann. Es ist mir egal, was ich dafür tun muss.«
»Und das werden wir, das verspreche ich dir«, entgegnete er eindringlich. Unsere Blicke trafen sich. »Aber wir müssen langsam vorgehen und uns exakt überlegen, was wir tun. Damit er uns nie wieder einen Schritt voraus ist.«
Ich lehnte meinen Kopf gegen die Tür. Jetzt, da der Adrenalinpegel minütlich weiter sank, dachte ich mehr und mehr an Ians Worte und ihre Bedeutung. »Ian …« Der Satz erstarb auf meinen Lippen, da ich die Wahrheit nicht aussprechen konnte. Ich konnte mir nicht einmal annähernd vorstellen, was es bedeuten würde, wenn er tatsächlich die Wahrheit gesagt hatte.
Sebastian hob erwartend die Augenbrauen.
Ich räusperte mich. Noch war ich schlichtweg nicht bereit, es auszusprechen, weshalb ich stattdessen sagte: »Ian darf seinen Job nicht behalten. Wir müssen uns darum kümmern, dass auch er keine Macht mehr innehat.«
Sebastian nickte ernst. »Das werden wir. Ich verspreche es dir.« Dann strich er sich eine Strähne hinters Ohr. »Aber jetzt gehst du schlafen. Heute Nacht werden keine Pläne mehr geschmiedet.«
Elliott schmiedet garantiert Pläne, dachte ich. Und so, wie Sebastian mich ansah, dachte er dasselbe.
Er klopfte mir behutsam auf die Schulter. »Geh schlafen, ich meine es ernst. Morgen ist ein neuer Tag, in Ordnung?«
Ich nickte und fühlte ihm gegenüber eine Welle der Dankbarkeit. Er war wie der Vater, den ich mir stets gewünscht hatte. Jemand, der sich um mich sorgte und wollte, dass es mir gut ging. Aber mein Vater war nun mal Elliott Turner, der es höchstwahrscheinlich nicht mehr erwarten konnte, mich umzubringen.
Als ich hörte, wie die Eingangstür ins Schloss fiel, ging ich zurück ins Schlafzimmer, legte mich neben Tyler und drehte mich auf die Seite, damit ich ihn beobachten konnte. Seine vollen Lippen zuckten im Schlaf und seine Atmung ging tief und gleichmäßig. Ich wusste nicht, was ich getan hätte, hätte ich ihn heute verloren. Ich fühlte mich schwach und hilflos und jetzt, da mich keiner mehr sehen konnte, ließ ich meinen Tränen freien Lauf. Sie flossen meine Wangen hinab und sickerten in die Matratze. Ich kniff die Augen zusammen und holte schwerfällig Luft. Es fühlte sich an, als läge eine physische Last auf meiner Brust.
»Warum weinst du?«
Ich erstarrte und blickte zu Tyler, der mich mit einem besorgten Gesichtsausdruck betrachtete. »Habe ich dich geweckt? Es tut mir leid.« Ich wischte mir über das Gesicht. »Es ist nur … der Stress, der nun von mir abfällt. Du sollst schlafen.«
Er atmete tief ein, drehte sich auf die Seite und strich mit seiner Hand über meine tränennasse Wange. »Sag mir, was in dir vorgeht.«
Ich schüttelte den Kopf. »Du brauchst Schlaf, ich meine es ernst.«
Eine Falte bildete sich zwischen seinen Augenbrauen. »Du weißt genau, dass ich nicht einschlafen werde, bis du mir gesagt hast, was los ist.«
Das stimmte. Tyler stellte das Wohl der Menschen, die er liebte, stets über sein eigenes. Es war eine der Eigenschaften, die ich an ihm liebte.
Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen. »Du hast damals gesagt, dass wir alles schaffen werden und jedes Hindernis bewältigen können.« Ich sah ihn an. »Aber trifft das noch zu? Ich habe schreckliche Angst, Tyler. Das heute ist knapp gewesen. Zu knapp. Doch die ganze Zeit über hatte ich keine Angst um mich.« Ich schluckte. »Sondern um dich.«
Tyler zog mich sanft näher an sich heran. »Das ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir Menschen lieben. Ich wünschte, es wäre leichter. Du hast das nicht verdient. Ich hätte Elliott vom Dach stoßen sollen, als ich die Chance dazu hatte.« Er biss fest seine Zähne aufeinander.
»Wie kann es sein, dass uns so viel Chaos und Hass umgibt?«, fragte ich resigniert.
Ein leichtes Lächeln umspielte seine Mundwinkel. »Weil es sonst langweilig wäre, schon vergessen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Langweilig hört sich gut an. Ich will langweilig. Ich hatte genug Aufregung für ein ganzes Leben. Ich will jeden Tag neben dir aufwachen und einschlafen, ohne dass ich um dein Leben fürchten oder Pläne schmieden muss, wie ich meinen Vater am besten stürze.«
Er nickte. »Ich weiß. Aber du siehst nicht, wie stark du bist. Jeder andere wäre unter diesem Druck bereits eingeknickt.«
Ich schnaubte. Das bin ich doch längst. »Ich bitte dich. Siehst du nicht, dass ich damit nicht besonders gut umgehe?« Ich wies auf die Tränen, die ununterbrochen meine Wangen hinunterliefen. »Und ich habe so viel Angst in mir, dass ich gar nicht weiß, wohin damit.«
Tyler sah mich für einen kurzen Moment einfach nur an. Dann nahm er meine unverbundene Hand und führte sie an seine Stirn. »Diese Narbe hier«, sagte er und fuhr mit meinem Finger daran entlang, »hat mich stärker gemacht. Und zwar nicht, weil ich es überlebt habe, sondern weil ich mir eingestanden habe, dass ich Angst habe.«
Er ließ meine Hand los und fuhr über die Narbe an meiner Wange. »Jede Narbe macht uns stärker, schöner, besser. Sie sind der Beweis dafür, dass wir etwas Schlimmes erlebt und es lebendig rausgeschafft haben. Starksein heißt, die Angst zu spüren, sie willkommen zu heißen – und dennoch weiterzumachen.«
Ich schluckte, nahm seine Hand und drückte sie, ohne den Blick von seinen Augen abzuwenden. »Ich liebe dich«, sagte ich, doch es kam so leise heraus, dass es kaum mehr als ein Flüstern war.
»Und ich liebe dich. Ich verspreche es dir, Devon. Wenn wir das alles hinter uns haben, fängt unser gemeinsames Leben erst an.«
Kapitel5
Kurz nachdem Alecto im Krankenhaus aufgewacht war, hatte sie bereits nach Hause gewollt. Nur über meine Leiche bleibe ich zwei ganze Tage in diesem Höllenloch, hatten ihre genauen Worte gelautet. Unsere Argumente und Bitten hatten in etwa so viel ausgerichtet wie Nieselregen bei einem Waldbrand, und letztendlich hatten sich Sebastian und Alecto auf eine Nacht geeinigt.
Nachdem sich Tyler den gesamten gestrigen Tag ausgeruht hatte, schien es ihm deutlich besser zu gehen. Seine Haut war zwar genau wie meine von Blutergüssen übersät, doch er hatte seine normale Gesichtsfarbe zurück und seine Beine zitterten nicht mehr unkontrolliert.
Sturheit schien jedoch in der Familie zu liegen, da ich ihn beim besten Willen nicht davon überzeugen konnte, Alecto von jemand anderem abholen zu lassen. Am liebsten hätte ich mich selbst hinters Steuer gesetzt, doch nachdem ich jahrelang nicht mehr gefahren war und meine Ängste nach dem Sprung in den Fluss ohnehin verstärkt waren, wäre das vermutlich keine gute Idee gewesen. Wegen des Haftbefehls würde ich das Krankenhaus kein weiteres Mal betreten, aber zumindest konnte ich Tyler bei der Fahrt begleiten.
»Du bist blass«, stellte er nun fest, als er auf den Lake Shore Drive abbog. »Ist alles in Ordnung?« Vor uns ragten die Wolkenkratzer in die dichten Wolken hinein und links breitete sich der Lake Michigan bis zum Horizont aus. Ich vermied den Blick in die Richtung des Wassers und fragte mich, ob ich den See und den Chicago River jemals wieder ansehen und mich daran würde erfreuen können, statt an Tod und Angst zu denken.
Ich wandte den Blick von den Wolkenkratzern auf der rechten Seite ab, deren Lichter trotz der Nachmittagsstunde bereits angeschaltet worden waren. Zwischen Tylers Augenbrauen hatte sich, wie so oft in den letzten Tagen, eine Falte gebildet. Seine rechte Hand umfasste das Lenkrad und ich musterte die aufgeplatzte Haut.
»Es geht schon«, erwiderte ich und lächelte schwach. Tyler wusste, dass es gelogen war. Ich wusste es auch. Dennoch ließ er mir den Schutzwall, den ich aufgebaut hatte, um die Angst nicht hindurchzulassen. Ich wusste nicht, wie ich die Emotionen, die ich empfand, in Worte fassen sollte. Doch irgendetwas sagte mir, dass er mich auch so verstand.
Wir hatten am Tag nach unserem Sprung über alles gesprochen, doch Ians Bekenntnis, dass meine Mom noch am Leben sei, hatte ich noch immer nicht über die Lippen gebracht. Ich wollte es Tyler sagen, doch die Angst hielt mich zurück. Ich wusste nicht, wovor ich mich mehr fürchtete: dass es stimmte oder dass es gelogen war.
***
»Gib mir den Schlüssel, Tyler«, forderte Alecto und streckte ihre Hand aus. »Ich kann meine Wohnungstür selbst aufschließen.«
Tyler überreichte ihr stumm die Schlüssel, trat beiseite und warf mir einen kurzen Blick zu. Schnell hatten wir bemerkt, dass Alecto tun wollte, als wäre sie nicht angeschossen worden. Spätestens als Tyler ihr die Tasche abgenommen und sie ihn angesehen hatte, als wollte sie ihm eine Ohrfeige verpassen. Ich wusste, dass ihre Wut nicht gegen Tyler oder mich gerichtet war. Ich wusste es, da ich denselben Groll in mir verspürte und es Momente gab, in denen ich am liebsten das ganze Apartmenthaus meines Vaters in Schutt und Asche legen würde.
Sie drehte den Schlüssel im Schloss und wandte sich dann zu uns um. Ihre schulterlangen Haare hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden. »Das ist nicht meine erste Schussverletzung und ich verbiete euch, mich mit mitleidigen Blicken anzusehen.« Sie sah zu mir und verengte ihre bernsteinfarbenen Augen.
Ich hob beide Brauen. »Was? Warum schaust du mich jetzt an?«, fragte ich. »Ich habe dich nicht –«
»Schuldbewusste Blicke zählen auch«, unterbrach sie mich.
Okay. Punkt für sie. Ich konnte es schlichtweg nicht abstellen. Es war unerheblich, wie oft Tyler, Sebastian und sogar Alecto mir versicherten, dass mich keine Schuld traf – es fühlte sich an, als trüge ich eine Last in Größe des ganzen Capital Hotel auf den Schultern.
Sie seufzte und öffnete die schlichte schwarze Eingangstür. In der Zeit, seit der ich bereits in der Unterwelt wohnte, war ich kein einziges Mal in Alectos Wohnung gewesen. Es wäre gelogen zu behaupten, dass ich trotz allem nicht gespannt sei, wie sie aussieht.
Alecto ging voraus und gab sich offenbar größte Mühe, nicht zu humpeln. Tyler ließ mir mit einer Geste den Vortritt. Ich schenkte ihm ein kurzes Lächeln, machte einen Schritt nach vorn …
… und blieb wie angewurzelt im Türrahmen stehen.
Ich hatte Bilder im Kopf gehabt, doch die Wirklichkeit übertraf jegliche Vorstellungen.
Genau genommen bestand die Wohnung aus einem einzigen Raum – eine Eisentreppe in der Mitte des Zimmers führte auf eine zweite Ebene, die lediglich von einer Art Zaun begrenzt wurde. Dominiert wurde die Wohnung von der großen dunkelroten Couch, die in Richtung der loftartigen Fenster zeigte und auf einer wilden Mischung aus Teppichen stand, die nicht hätten zusammenpassen sollen, es aber doch taten. An der großen Wand auf der rechten Seite hingen unzählige Schwarz-Weiß-Fotos und dazwischen fand sich hin und wieder ein abstraktes Gemälde. Auf die hüfthohe Wand, die Küche und Esszimmer voneinander trennte, war außerdem mit Graffiti ein großer Drache gesprayt worden. Was darüber hinaus am meisten auffiel, war die Unordnung im Raum. Pinsel steckten in einem Messerblock, Leinwände in verschiedenen Größen standen auf dem Boden herum und über den Staffeleien hingen Kleidungsstücke. Ich musste lächeln, als ich eine Wand aus Kork entdeckte, in der schätzungsweise fünfzig Messer steckten. Das Innere der Wohnung war ein Abbild von Alectos Wesen. Und ich liebte es.
»Deine Wohnung ist wirklich sehr …«
»Alecto?«, bat Tyler an und ich erwiderte sein Grinsen.
»Ganz genau.«
Sie nickte mit leuchtenden Augen. »Ja, oder?« Dann nahm sie die Reisetasche, die ihr Gia ins Krankenhaus gebracht hatte, und leerte den Inhalt auf dem Boden aus.
»Ordentlich wie immer«, merkte Tyler schmunzelnd an, als er sich auf die Couch fallen ließ.
Alecto pustete sich eine rote Strähne aus der Stirn. »Alles, was du hier siehst, ist Teil einer ausgeklügelten Dekoration.«
Ich setzte mich neben Tyler auf die Couch und zog ein schwarzes Stück Stoff unter seinem Bein hervor. Als ich erkannte, was es war, musste ich grinsen. »Aha«, begann ich. »Also ist Gias Iron-Man-Shirt auch Teil der Dekoration?«
Alecto wirbelte herum. »Das ist nicht Gias. Das ist meins.«
Ich musterte ihre schnell blinzelnden Lider. So gut sie im Kämpfen war, so schlecht war sie im Lügen.
»Hm, ich weiß ja nicht«, fuhr ich fort. Sie wollte nicht wie jemand behandelt werden, der angeschossen wurde? Das sollte sie bekommen. »Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie im Krankenhaus nicht von deiner Seite gewichen ist?«
»Hörst du, was du da sagst? Gia ist zu fröhlich und enthusiastisch und … sie erinnert mich an einen Flummi.«
Jetzt musste auch Tyler grinsen. »Ach so? Und was ist bitte sonst dein Typ? Traurig und mysteriös?«
Sie funkelte ihn böse an und warf einen Bleistift nach ihm, den er mit einer Hand auffing. »Wenn du so fragst: ja. Genau das ist mein Typ.« Sie trat an die Couch heran und stützte sich schnaufend an der Lehne ab.
Das Lächeln rutschte mir vom Gesicht und ich hatte den Eindruck, als wäre uns allen dreien im selben Moment wieder eingefallen, in welcher Situation wir uns befanden. Die Ereignisse der letzten Tage holten uns ein und saugten die Unbeschwertheit aus dem Raum wie bei einem Vakuum. Eine Weile sagte keiner etwas, ehe ich die Stille durchbrach und meinte: »Wie soll es weitergehen?«
»Außer, dass ich deinen Ex umbringe, weil er auf mich geschossen hat?«, knurrte Alecto.
Tyler sah sie mit hochgezogenen Brauen an. »Du weißt, dass du ihn nicht umbringen kannst. Wenn das so einfach wäre, hätten wir das längst getan.« Eine kurze Pause, dann: »Und wenn ihn jemand umbringt, dann bin ich das.«
»Seht ihr das?«, fragte sie, hob ihr Shirt an und zeigte auf ihre Schusswunde. Zwar klebte ein Verband darüber, doch es war eindeutig zu sehen, dass die Kugel ihr Drachentattoo getroffen hatte. »Er hat Tisiphone angeschossen.«
»Vielleicht kann Mai-Lin über die Narbe tätowieren, sobald es verheilt ist?«, fragte ich, als sie sich vorsichtig neben mich auf die Couch setzte, ihren Kopf auf der Lehne ablegte und an die Decke blickte.
»Ich werde sie fragen, ob das geht«, murmelte sie. »Ich bezweifle es allerdings.«
Ich schloss die Augen. »Wünscht ihr euch auch manchmal, die Zeit würde anhalten?«, fragte ich. »Nur für eine Woche, in der rein gar nichts passiert und in der man … durchatmen kann?«
»Mehr als alles andere«, erwiderte Tyler mit dunkler Stimme. »Aber immer, wenn man denkt, man hat seine Ruhe, steht die nächste Katastrophe bereits vor der Tür und hebt die Hand, um zu klingeln.« Er räusperte sich. »Morgen ist ein Treffen im Büro geplant«, fuhr er fort. »Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen eine völlig neue Herangehensweise für Elliott.«
Zum millionsten Mal in den letzten zwei Tagen gingen mir Ians Worte durch den Kopf. Deine Mutter ist am Leben, Devon. Sie ist nie gestorben.
»Ich muss euch etwas erzählen«, platzte es aus mir heraus, bevor ich darüber nachdenken konnte. Ich konnte es nicht länger für mich behalten, dafür nahm es zu viel Platz in meinem Inneren ein.
Alecto setzte sich auf und Tyler sah mich erwartungsvoll an. »Ian hat etwas zu mir gesagt, als wir im Treppenhaus waren.« Ich schluckte und Tylers Kiefer spannten sich an. »Er meinte, dass meine Mutter … also … dass sie am Leben sei.« Es laut auszusprechen, hörte sich seltsam an.
»Er hat was?« Tylers Blick verfinsterte sich. »Meinst du nicht, dass er dich nur manipulieren wollte?«
Alecto nickte zustimmend. »Er wollte, dass du mit ihm aufs Dach kommst. Er hätte alles gesagt, um das zu erreichen.«
Ich dachte darüber nach. Natürlich war es naheliegend, doch mein Bauchgefühl überzeugte mich vom Gegenteil. »Ich kann es euch nicht erklären. Ich hasse und misstraue Ian mit jeder Faser meines Körpers, aber irgendetwas gibt mir das Gefühl, dass er nicht gelogen hat.«
»Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass da etwas dran ist, werden wir dem nachgehen«, versicherte er mir. »Ich will nur nicht, dass du enttäuscht wirst, falls es sich als Lüge entpuppt.«
»Falls sie noch lebt«, fügte Alecto hinzu, »werden wir sie aufspüren. Egal, wo auf der Welt sie sich befindet.«
Ich schluckte. Wenn sie tatsächlich am Leben war … Nein. Es war absurd und ich würde mir nicht erlauben, auch nur die leiseste Hoffnung zu verspüren. Was leichter gesagt war als getan. Wie oft hatte ich sie mir zurückgewünscht, obwohl ich wusste, dass es nicht möglich war? Ich senkte den Blick und verschränkte meine Hände in meinem Schoß. Mom war tot. Ich hatte gesehen, wie sie in den Fluss gestürzt war – und kurz darauf das Auto. Ich verstärkte den Griff, bis meine Knöchel weiß hervortraten. Mom war gestorben und hatte mich mit Dad allein gelassen. Ein kleiner Teil von mir, den ich bisher stets unterdrückt hatte, nahm es ihr übel, obwohl sie nichts dafürkonnte.
Tyler legte seine Hand auf meine, und als ich zu ihm aufsah, sprachen Schmerz und Mitgefühl aus seinen Augen. Erst jetzt lockerte ich meinen Griff.
»Wie war ihr Name?«, fragte Alecto und sprach leiser als zuvor.
»Mabel«, hauchte ich und bemühte mich, meine brennenden Augen zu ignorieren. Wie lange hatte ich ihren Namen nicht mehr laut ausgesprochen?
Tyler malte mit seinem Daumen kleine Kreise auf meinen Handrücken. »Hast du ein Foto von ihr? Das wäre ein Anfang.«
Ich nickte stumm und holte mein Handy hervor. Bisher hatte ich Tyler keines von ihr gezeigt und er hatte nicht gefragt. Womöglich, um mich nicht an meinen Schmerz zu erinnern. »Ich habe eins. Es war das einzige Foto, das ich damals retten konnte, bevor mein Vater alle ihre Sachen aus der Wohnung geschafft hat.«
Ich musste nicht durch die Fotos scrollen, um das Bild zu finden, da ich es in einem separaten Ordner abgespeichert hatte. Damit ich es jedes Mal, wenn ich Trost brauchte, sofort fand. Als ich es öffnete, lächelte sie mir vom Bild freundlich entgegen. Ihre blonden Haare umrahmten ihr herzförmiges Gesicht und die moosgrünen Augen strahlten. Wie oft ich dieses Bild bereits angesehen hatte, konnte ich nicht zählen. Es hatte sich in meine Netzhaut gebrannt.
Ich schluckte, ehe ich Tyler das Handy in die Hand drückte. »Das ist meine Mom.«
Ich hatte mit vielen unterschiedlichen Reaktionen gerechnet. Er hätte zum Beispiel sagen können, dass ich ihr nicht ähnlich sah. Er hätte meine Hand nehmen oder bedächtig nicken können. Doch was er als Nächstes tat, ließ das Blut in meinen Adern gefrieren.
Er wurde still. Äußerst still.
»Was ist?«, fragte ich. Mein Herz schien mir aus der Brust springen zu wollen.
Er zoomte das Foto mit zwei Fingern heran und schüttelte einmal kaum merklich den Kopf.
»Ty?« Alecto lehnte sich rüber, um einen Blick auf das Bild zu erhaschen. Als sie es sah, weiteten sich ihre Augen und sie legte sich eine Hand auf den Mund.