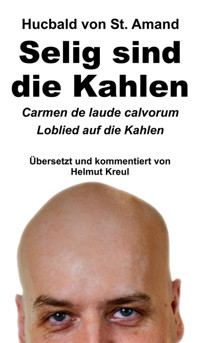
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Endlich müssen sich die Träger eines kahlen Kopfes nicht länger grämen. Der mittelalterliche Mönch Hucbald von St. Amand hat ihnen zu Ehren ein großartiges Loblied verfasst. Für ihn sind die Kahlen nicht nur die Größten und Besten auf allen Gebieten – sei es in der Medizin, der Kriegskunst, der Jurisprudenz, der Literatur oder Politik –, sondern vor allem ist ihnen das ewige Seelenheil im Jenseits beim Jüngsten Gericht gewiss. Hucbald wurde zu diesem lateinischen Poem, in dem jedes Wort mit demselben Buchstaben beginnt, durch ein Schmähgedicht angeregt. Ein unbekannter Verfasser hatte darin seinen Landesherrn, König Karl »den Kahlen«, seiner Glatze wegen aufs Übelste verunglimpft. Der Zorn auf diesen Schmähdichter übermannt Hucbald immer wieder und er hielt die von König Karl verhängte Strafe der »Blendung« für gerechtfertigt. Im zweiten Teil ist der lateinische Text mit Übersetzung angefügt, damit sich der Leser ein Bild von diesem sensationellen Gedicht machen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hucbald von St. Amand
Selig sind die Kahlen
Carmen de laude calvorumLoblied auf die Kahlen
Übersetzt und kommentiert von Helmut Kreul
Copyright: © 2016 Helmut KreulUmschlag & Satz: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg978-3-7345-3639-7 (Paperback)978-3-7345-3640-3 (Hardcover)978-3-7345-3641-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Teil IHucbald und die Kahlen
Selig sind die Kahlen!
Die Jagd nach dem Glatzen-Gen
Ist kahl cool?
Wer ist Hucbald?
Hucbald als Kind seiner Zeit
Wer ist Karl der Kahle?
Ist Gott kahl?
Teil IIDie Kahlen sind auf allen Gebieten überlegen
Teil IIILateinischer Text und Übersetzung
Teil IVSchreiben an Hatto
Nachwort
Literaturverzeichnis
Teil I
Hucbald und die Kahlen
Selig sind die Kahlen!
Das is tjeden falls diefeste Überzeugung des karolingischen Mönches und Gelehrten Hucbald (840 – 930) aus dem flandrischen Kloster St. Amand. In einem sensationellen Poem hatte er ein Loblied auf die Kahlköpfigkeit in 136 lateinischen Hexametern verfasst: 'carmen de laude calvorum'. Die außergewöhnliche Leistung liegt darin, dass jedes Wort mit dem Buchstaben 'c' beginnt und ausnahmslos wie das deutsche 'k' gesprochen wird. Dieser Buchstabe hat für ihn eine besondere Bedeutung: es ist der Anfangsbuchstabe für 'centum', für 'calvus' (kahl), es bildet die Form des Mondes und des Theaters nach. Und der wichtigste Grund war wohl, dass mit ihm der Name 'Carolus Calvus' (Karl der Kahle) beginnt, der in jener Zeit als König des westfränkischen Reiches herrschte. Ihm zu Ehren und aller anderen Kahlen hat Hucbald diese mühselige Arbeit auf sich genommen.
Den Kahlen ist der Platz im Paradies gewiss, wenn beim Jüngsten Gericht die finale Abrechnung stattfindet, da 'ohne Haare zu sein', gleichbedeutend ist wie ohne Sünden zu sein.1
Aber ihre Auserwähltheit zeigt sich auch schon im diesseitigen Leben; sind sie doch auf fast jedem Gebiet die herausragenden Vertreter ihrer Zunft – ob in der Politik, in der Rechtsprechung, in dem Metier der Kriegskunst, in Kunst und Wissenschaft und vor allem im kirchlichen Dienst. Danach unterteilen sich die einzelnen Strophen, die alle mit einer identischen Anfangszeile beginnen.
Es liegt nahe zu glauben, dass Hucbald selber einen sehr schütteren Haarwuchs oder gar eine ausgebildete Glatze hatte, wie es eine zeitgenössische Quelle mitteilt. Zumindest trug er die seit 633 für alle Geistlichen vorgeschriebene Tonsur. Es findet sich auch die Meinung, dass er sich 'Huc baldus' genannt habe, nach dem englichen Wort 'bald' für kahl.
Da ich diesen 'seltsamen' Mönch näher kennenlernen wollte und im deutschsprachigen Raum keine neuere Übersetzung fand, habe ich mich selber an die Arbeit gemacht und diese 'ecloga de calvis' möglichst textgetreu, aber auch mit der nötigen Freiheit, versucht zu übersetzen. Es war jedenfalls überraschend, welche Einblicke in Charakterzüge und die Gesamtpersönlichkeit Hucbalds sich auftaten. Darüber im folgenden mehr.
Ein besonderes Anliegen ist es mir, auf eine überaus interessante Nachdichtung in englischer Sprache hinzuweisen. Der Autor2hat sich daran gemacht, die lateinischen Hexameter in solche in englischer Sprache zu übertragen. Es war aber nicht möglich, Hucbald komplett zu imitieren. Doch wo immer möglich, hat er Wörter mit den Anfangsbuchstaben 'b' und 'c' benutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese zahlreichen Tautogramme überaus mühevoll gewesen sein müssen und große Anerkennung verdienen. Über manche dichterische Freiheiten kann man natürlich streiten, so zum Beispiel, wenn er tagesaktuelle Personen erwähnt, die heute kaum noch jemand kennt.3
Die Jagd nach dem Glatzen-Gen
Es gibt für die Mehrzahl der Männer eine gleichermaßen schockierende Entdeckung – der beginnende Haarausfall. Anfangs schleichend mit immer schütterer werdendem Haar, dann immer auffälliger mit der Bildung von Geheimratsecken und einer größer werdenden freien Fläche am Hinterkopf. Schließlich vereinigen sich die freien Stellen zu einer durchgehenden Glatze mit kleinen Rändern an den Seiten und einem Rest des Haarschopfes, der hartnäckig am Hinterkopf Widerstand leistet.
Im Laufe der Zeit bleiben nur die Resignation und das Hinnehmen des Unvermeidlichen, denn aufhalten lässt sich dieser Prozess mir Shampoos, Pillen und Tinkturen nicht.
Die Frage nach dem Warum haben sich die Betroffenen zu allen Zeiten gestellt und ebenso die Frage: Warum nicht die anderen?
Es seien dafür zwei Beispiele angeführt, die mehr als tausend Jahre voneinander entfernt sind:
Da haben wie zunächst das Lorscher Arzneibuch, eine mittelalterliche Textsammlung mit allerlei Rezepturen, entstanden um 800 n. Chr.
Dort finden wir die zu den Problemata des Pseudo-Aristoteles gehörende wichtige Frage Nr.19:
„quare seneces aliqui calvi fiunt et aliqui non?“
„Warum werden von alten Menschen die einen glatzköpfig, die anderen aber nicht?“
Der herrschenden medizinischen Lehre entsprechend gab es eine kurze und lapidare Antwort:
„Weil der eine von Natur aus wärmer ist als der andere; ersterer lässt die Haare wachsen, dem anderen fallen sie vor Kälte aus“.
Diese Erkenntnis geht zurück auf die Vier-Säfte-Lehre des antiken Arztes Galen4, der das ganze Mittelalter hindurch die bestimmende Autorität in allen medizinischen Fragen war. Er unterschied vier Körperflüssigkeiten: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Diese würden sich in unterschiedlicher Weise vermischen und bildeten die Ursachen für alle Krankheiten. Ihr Mischungsverhältnis sei verantwortlich für das Entstehen von Wärme oder Kälte im Körper.
Dieselbe Frage wie das Lorscher Arzneibuch stellte sich 1200 Jahre später das Hamburger Abendblatt vom 16. 10. 2012:
„Warum bekommen manche Männer eine Glatze, andere aber nicht?“
Die Antwort ist viel komplizierter; ich werde versuchen, den gegenwärtigen Forschungsstand in wenigen Worten darzustellen. Heutzutage wird für alles eine genetische Veranlagung postuliert. Und seit Jahren findet die Jagd nach dem einen oder mehreren verantwortlichen Genen in vielen Laboren statt. Von Zeit zu Zeit wird behauptet, das Glatzen-Gen gefunden zu haben. Das allein reicht aber als Erklärung für eine saubere Glatzenbildung noch nicht aus.
Es muss noch der Einfluss eines Hormons hinzukommen, und zwar des Dehydrotestosterons, in das sich das männliche Hormon Testosteron verwandelt und das die Haarwurzeln, die Follikeln, verkümmern lässt, so dass die Haare ausfallen und keine neuen mehr nachwachsen können. Doch damit dies möglich sei, müsse ein bestimmter Gendefekt vorliegen. Nur dann kann sich die wissenschaftlich so genannte 'androgenetica alopecia' vulgo Glatze herausbilden.
Dieser Gendefekt befindet sich allerdings nur auf dem weiblichen X- Chromosom, das von der Mutter vererbt wird, deren Gene somit entscheidend sind, ob sich eine Glatze bilden kann. Die Mutter hat dieses schadhafte X Chromosom von ihrem Vater. Und damit schließt sich nach heutiger Theorie die Ursachenkette. Man sollte also einen Blick auf den Kopf des Großvaters mütterlicherseits werfen, um seine eigenen Aussichten einschätzen zu können.
Ist kahl cool?
Für Hucbald natürlich keine Frage. Für ihn sind ja die Kahlen auf allen Gebieten des Lebens unbedingt die großartigsten Vorkämpfer und leisten Vorbildliches. Dementsprechend ergeht er sich in überschwänglichen Lobeshymnen.
Aber wenn im Abstand eines halben Jahres sowohl der STERN als auch DIE ZEIT mit identischer Überschrift:„Kahl ist cool“5





























