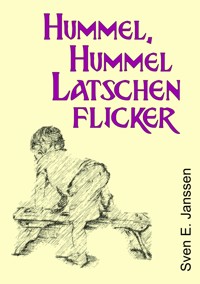
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon mit 16 Jahren ist Jan Lübben ist ein wahres Schwein: exzessiv rauchend und saufend, gerät er bald zum hemmungslosen, sexsüchtigen Bonvivant, zum lediglich auf schnellen Konsum fokussierten, stinkfaulen Egoisten, der nie ans Morgen denkt. Wirklich verstanden fühlt er sich nur von seinem Busenfreund Johann Redepenning, der all seine Laster und Seelennöte inbrünstig teilt. Gemeinsam sind sie der gesellschaftliche Schrecken des in der tiefsten süddeutschen Provinz gelegenen Industriestädtchens Ludwigshausen der 1980er-Jahre. Sven Eberhard Janssens Roman "Hummel, Hummel, Latschenflicker" wird so auch zum Spiegelbild des typischen Lebensgefühls jener Zeit, dem Jahrzehnt der sogenannten Baby-Boomer, die hier auf eine wilde Zeitreise in die eigene Jugend entführt werden: Plötzlich spürt man wieder den einst so lang herbeigesehnten Fahrtwind auf dem ersten Mofa im Gesicht, während man zur verhassten Schule fährt, fühlt das flaue Gefühl im Magen vor dem "ersten Mal", durchlebt erneut den ersten Kater nach dem ersten Vollrausch, hört allenthalben die damals noch aus dem Walkman dröhnende Musik von Kultbands wie AC/DC, Depeche Mode, Queen oder Police. Das Buch versteht sich somit auch als eine – sehr respektvolle – Verbeugung vor dem experimentellen, dokumentarisch-naturalistischen Stil eines Émile Zola oder eines Jerome David Salinger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sven E. Janssen
Hummel, Hummel, Latschenflicker
Roman
Für meine beiden Mütter &
In liebevoller Erinnerung an Katrin und Jörg
„Heimat ist für mich nie ein politischer Begriff gewesen, sondern ein rein menschlicher. Wo wir Kinder gewesen sind und die ersten Bilder von Welt und Leben empfangen haben, da ist unsere Heimat, und ich habe die meine stets mit Dankbarkeit geliebt.“ Hermann Hesse
„Freundschaft ist das tiefste Wesen der Partnerschaft.“ Aristoteles
DIE HINDENBURG-STRASSE
In der Wohnküche von Maria Dieffenbach roch es immer ganz besonders gut, eine unverwechselbare Mischung aus Kernseife, Bohnerwachs und Lavendel. Anstelle einer Küchentür hing ein dicker, kratziger, dunkelgrauer Vorhang im Türrahmen. Jan Lübben hatte sich nie gefragt, warum Omi Dieffenbachs Küche keine Tür hatte. Aber der Vorhang war toll, man konnte sich, als kleiner Knirps, ganz darin einrollen, um sich hernach, wie in einem Karussell, wieder aufwickeln zu lassen. Alles hier roch herrlich sauber, aber nicht wie im Krankenhaus oder wie auf der Amtsstube, sondern eher wie auf einer Lichtung, nach einem heftigen Frühlingsgewitter. Ansonsten stand da in der Küche noch ein alter hölzerner Geschirrschrank mit Sprossenfenstern. Das Holz des Schrankes war bereits an zahlreichen Stellen vom Gebrauch ganz hell gescheuert und abgegriffen, trotzdem war er noch immer ein wirklich schönes Stück. Das Glas der Sprossenfenster war milchig und aufgeraut, ganz als ob es aus abertausenden winzigen Diamanten bestünde. Jan Lübben liebte es, mit Daumen und Zeigefinger über die Scheiben zu fahren, um sich anschließend über das Kribbeln zu freuen, das ihm dann durch den ganzen Körper fuhr. Daneben, am Küchenfenster, das zum Garten hin lag, fand sich der ebenfalls hölzerne Küchentisch, auf dem sich immer ein blitzsauberes Wachstuch mit Blümchenmuster erstreckte. Der Küchentisch hatte auf der rechten Seite eine Schublade, die immer etwas klemmte, und in der Omi Dieffenbach ihre schneeweißen, stets stramm gestärkten Damastservietten aufbewahrte. Der Küchenherd war Kohle betrieben und dennoch strahlte die glatte weiße Emaille-Front immer so, als sei das gute Stück gerade erst aus der Fabrik gekommen. An der Vorderseite hatte er eine Klappe, hinter der sich eine Einbuchtung auftat, in die man auch die Kaffeekanne zum Warmhalten einstellen konnte. Oben fand sich eine kreisrunde Öffnung, die mit einem ebensolchen eisernen Deckel versehen war, den man mit einer speziellen kleinen Zange anheben musste, um sodann Briketts oder auch Holzscheite nachzufüllen. Öffnete man den Deckel, so loderten die im Innern unermüdlich werkenden Flammen heiß und blau über den Rand hinaus. Maria Dieffenbach buk in dem altmodischen Ofen Dampfnudeln, dazu kochte sie Vanillesauce, die beste Vanillesauce der Welt, ganz ohne Klümpchen. Der Bodenbelag der gemütlichen Wohnküche bestand aus graubraunem Linoleum mit schwarzem, kaum noch sichtbarem Muster; an einigen Stellen war er schon geflickt worden. Der Boden selbst war nicht mehr ebenerdig, hatten doch einst die Weltkriegsbomben dafür gesorgt, dass sich das ganze Haus vor Schmerz krümmte und so eigentlich kein Stein mehr wirklich akkurat auf dem anderen saß. Vom Fenster der Küche aus, die sich im zweiten Stockwerk der Vorkriegsvilla befand, hatte man einen herrlichen Blick auf weite Teile des kleinen Städtchens Ludwigshausen, das sich über sieben Hügel erstreckte. Im Krieg konnte man von hier aus sogar die französischen Kanonen im Westen donnern hören, wie Opa Gundermann stets beschwor. Sogar das schlechte Wetter kam, nach Meinung der Alten, immer aus dem ehemaligen Feindesland herüber. Direkt vor dem Fenster stand ein riesiger Kirschbaum, der das ganze Haus überragte. Im Frühling hatte er ein dichtes Dach aus weißen Blüten, und im Sommer kam Maria Dieffenbachs Sohn, Friedrich, aus der Nachbarstadt herüber, um die Kirschen abzumachen. Dann durften auch die Kinder – Jan Lübben sowie Maria Dieffenbachs Enkel, Karoline und Tim, – den Baum über eine große hölzerne Leiter erklimmen, um sich, oben im dicken Geäst, den Bauch mit den prallen, süßen Früchten vollzuschlagen. Das Schönste an Omi Dieffenbachs Küche war aber jene kleine Ecke, die gleich gegenüber dem Eingang lag und die vom Geschirrschrank und einer schräg gegenüberstehenden Kommode gebildet wurde. Auf der Kommode stand noch ein alter Volksempfänger, daneben eine winzige Spieluhr mit handgetriebenem Walzwerk, die, wenn man die filigrane Kurbel auf der rechten Seite betätigte, eine traurige Melodie von sich gab, an der sich Jan Lübben nicht satthören konnte. In dieser Ecke fristete ein kleiner flacher Holzschemel sein Dasein, so, wie man ihn früher zum Stiefel ausziehen benutzte, und dem Jan Lübben, kaum sprechen könnend, den Namen Es Bänkl verpasste. Es Bänkl (Dialektal: Schemel) wurde bald sein fest angestammter Lieblingsplatz. Dort saß er stundenlang, von Omi Dieffenbach mit Erdnussflips und Zitronenlimonade versorgt, der alten Frau, voll kindlichem Glück, voller Sorglosigkeit, bei der unermüdlichen, fleißigen Küchenarbeit zuschauend. Manchmal gab es auch Veilchenpastillen aus einer runden, im fernen Lyon gefüllten, Dose, die, wenn man den Deckel öffnete, ein betörendes Aroma entfaltete. Das direkt links neben der Wohnküche gelegene Esszimmer war die gute Stube des Hauses. Dort standen ein großer runder Esstisch mit sechs Stühlen, ein wuchtiger Geschirrschrank mit Sprossenfenstern und Marmorservierplatte sowie eine weitere, flache Geschirrvitrine ohne Fenster. Es waren alte, teure, kunstvoll geschreinerte Möbel aus Tropenholz, die Maria Dieffenbach stets auf Hochglanz gewienert hielt. In diesem Zimmer hing, zwischen der Geschirrvitrine und dem zur Hindenburgstraße hin liegenden Fenster, ein kleines, vielleicht aktentaschengroßes Ölgemälde, das einen alten, nachdenklich nach unten dreinblickenden Mann mit Pfeife zeigte und das Jan Lübben, ebenfalls kaum des Sprechens fähig, Frau Göller taufte, auch wenn sich keine Erklärung dafür finden ließ, wie ihm ausgerechnet dieser Titel eingefallen war. Dabei konnte sich Jan, aus einem ebenfalls unerfindlichen Grunde, beim Betrachten von Frau Göller regelrecht vergessen, ja ganz und gar ins Träumen geraten. Manchmal, wenn im Sommer eines jener typischen, schweren aber regenlosen Gewitter bedrohlich grollend über die weiten Felder im grünen Niemandsland zwischen Ludwigshausen und der französischen Grenze heranzog, zündete Maria Dieffenbach dicke Wachskerzen an, die sie Gewitterkerzen nannte. Dann ließ sie die Rollläden herunter und begann mit dem kleinen Jan Lübben zu beten, denn sie war – trotz ihrer großen Intelligenz und überdurchschnittlichen Auffassungsgabe – auch ziemlich gläubig und jenseitsbedacht. Viel später konnte er sich noch genau daran erinnern wie es war, wie sie einmal, kurz bevor sie starb, im Treppenhaus vor ihm stand, und ihm, wie in Trance und mit erhobenem Zeigefinger, eine Art Predigt über den Weltuntergang hielt. Feuerstürme, so beschwor die alte Frau, würden eines Tages vom Himmel über das Antlitz der Erde brausen und alles Leben dort vernichten. Das Schlimme daran war, dass sie dabei überhaupt nicht wie eine Verrückte wirkte.
Etwas ganz Besonderes war es stets, wenn er mit in den dritten Stock, also die dritte Etage, der 30er-Jahre-Villa durfte. Dort fand sich nicht nur die Schlafkammer von Maria Dieffenbach, sondern auch jene ihrer Tochter, Maxi. In Maxis Zimmer stand, gleich hinter der Tür, eine Truhe, die mit den tollsten Schätzen gefüllt war, zum Beispiel dem Bilderbuch „Klas und sein Bagger“, in dem Virginia Lee Burton die Geschichte eines in die Jahre gekommenen Dampfbaggers erzählt, der von seinen modernen, benzinbetriebenen und elektrischen Kollegen verdrängt werden soll, dann aber doch noch von seinem treuen Baggerführer und Freund gerettet wird. Neben einer ganzen Reihe anderer Kinderbücher fanden sich in der Truhe auch eine Familie von Steiff-Tieren sowie die schönsten bunten Glasmurmeln, die man auf der ganzen Welt finden konnte. Ganz besonders liebte er einen kleinen rotbraunen Stoffhund mit kurzem Fell und Stummelschwanz, der auf seinen Hinterfüßen hockte und, den Kopf leicht zur Seite geneigt, einen mit seinen treuen schwarzen Knopfaugen anblickte, ganz, als ob er lebendig wäre. Dann war da im dritten Stock noch eine Vorratskammer, aus der Omi Dieffenbach noch jedes Mal irgendeine Überraschung hervorzauberte. Mal gab`s einen rotwangigen, herrlich nach Garten duftenden Apfel, mal ein Tütchen mit Lakritz-Schnecken und, manchmal, gab es auch ein Stück Seife. Jan war ganz verrückt auf Seife. Maria Dieffenbachs Lieblingsmarke steckte in einer rechteckigen Kartonfaltschachtel, die das Foto einer jungen blonden, langhaarigen Frau mit gütigem Gesicht zierte. Das Stück Seife selbst war dann nochmal in ein ganz feines, glattes Papier eingewickelt. Oft saßen Omi Dieffenbach und Jan auch in der Küche und sie las ihm dann vor, meistens Gedichte. Sein Lieblingsgedicht war „Herr Ribbeck von Ribbeck auf Havelland“, von Theodor Fontane, das sie ihm wieder und wieder vortragen musste. Das kleine illustrierte Büchlein, in das sie fein säuberlich und in schönster Sütterlinschrift seinen Namen eingetragen hatte, bewahrte er, zeit seines Lebens, eifersüchtig auf. Im Grunde hätte sie die Gedichte nicht vorlesen müssen, denn sie konnte sie alle auswendig; heute würde man sagen, dass Maria Dieffenbach ein Gedächtnis wie ein Computer hatte. Auf jeden Fall aber hätte sie eigentlich Professorin werden müssen oder wenigstens Lehrerin. Sie wäre bestimmt eine außergewöhnlich gute Lehrerin geworden. Maria Dieffenbach, die Jan Lübben immer nur Omi nannte, war jedoch nicht wirklich dessen Großmutter, sondern die Hauswirtin seiner Großeltern mütterlicherseits, Gerlinde Gundermann, geborene Kinzel und deren Ehegatten, Wilhelm Gundermann. Aber weder war die Hindenburgstraße 267 eine normale Hausgemeinschaft, noch war Omi Dieffenbach eine normale Hauswirtin. Schon lange vor dem Krieg wohnten Jan Lübbens Großeltern bei den Dieffenbachs, damals lebte noch Maria Dieffenbachs Mann, Johannes Dieffenbach, und der Weltkrieg hatte die Nachbarn eng zusammengeschweißt, enger als manche echte Familie. Noch in den letzten Kriegstagen wurde das Haus von den Amis ausgebombt, dabei gingen weite Teile des Daches zu Bruch. In dieser Zeit flog auch die Küchentür in Maria Dieffenbachs Wohnküche aus den Angeln und wurde seither nie wieder ersetzt. Im Winter 1945/46 waren die Wände dann dick mit Eis zugefroren und das Eis brachte den Hunger mit sich. Die Dieffenbachs und die Gundermanns kochten Kaffee aus Baumrinde und Suppe aus Brennnesseln. Oft begaben sich die Frauen des Hauses dann auf stundenlange Hamstermärsche, nur, um an etwas zu essen heranzukommen. Manchmal marschierten sie sogar bis weit ins benachbarte Wallachtal hinein, denn dort lagen einige Höfe im satten Wiesengrün eines kleinen Flüsschens. Nachdem die amerikanische Luftwaffe den sowohl strategisch als auch industriell nahezu unbedeutenden Ort noch in den letzten Kriegstagen bald dem Erdboden gleichgebombt hatte, ließ sich die US-Army dauerhaft mit einem riesigen Stützpunkt in Ludwigshausen nieder. Der kleinen Hausgemeinschaft in der Hindenburgstraße waren die Amis freilich eher suspekt, schon gar nicht sah man sie als Befreier. Man hatte den Krieg verloren, scheiße halt. Obendrein kamen mit den US-Soldaten auch noch die ersten Neescha (Dialektal/despektierlich: Dunkelhäutiger) in das Städtchen, das war den Alten einfach zu viel. Nur die bislang eher unterbeschäftigten lokalen Huren freuten sich und lernten Englisch in Rekordgeschwindigkeit. Letztendlich war man dennoch froh, dass die Amerikaner und nicht die Russen nach Ludwigshausen gekommen waren. Die Amis mochte keiner leiden, aber sie störten auch niemanden wirklich, vor den Russen aber hatten die Leute Angst.
Maria Dieffenbachs Tochter, Marianne – kurz Maxi –, war sieben Jahre älter als Jan Lübbens Mutter, doch wuchsen die beiden, zusammen mit Onkel Friedrich, Maxis Bruder, wie Geschwister auf. Onkel Friedrich ist dann nach dem Krieg in die Nachbarstadt ausgewandert, um dort, als Bankdirektor, eine Offizierstochter zu heiraten und mit dieser eine Familie zu gründen. Natürlich war auch Friedrich Dieffenbach nicht Jan Lübbens echter Onkel, doch er nannte ihn halt einfach so. Maxi Dieffenbach, die als kaufmännische Angestellte in einer Schuhfabrik arbeitete, hatte nie geheiratet oder Kinder bekommen. Vielleicht deshalb, weil sie die Intelligenz ihrer Mutter geerbt hatte und möglicherweise daher nicht dazu bereit war, irgendeinem faulen Idioten die Socken zu waschen oder sich am Wochenende irgendein besoffenes Fußball-Gebrabbel anzuhören. Aber wer wusste das schon, und schließlich ging’s ja auch keinen was an. Jan Lübbens Mutter, Juliane Lübben, geborene Gundermann, hatte sich, mit harten Ellenbogen und viel Schweiß, vom einfachen Kaufmannslehrling zur Personalchefin der größten Fabrik des Städtchens hochgekämpft, Herrin über 2000 Industriearbeiter. Die Fabrik war ihre Familie, ihr Kind, ihr Messias, ihr Alles. Dort verbrachte sie zwölf Stunden täglich, nur mittags kam sie manchmal vorbei, um sich ein Essen abzuholen, das sie dann eilig am Schreibtisch verschlang. Und so ergab es sich, dass Maxi Dieffenbach, im Laufe der Jahre, zu Jan Lübbens Ersatzmutter, ja zu seiner Seelenmutter wurde. Sobald sie nachmittags, so gegen kurz vor halb fünf, von der Arbeit nach Hause kam, lief er ihr schon auf der Straße entgegen, um sich ihr an den Hals zu werfen. Dann musste sie ihn bis an das kleine grüne Gartentor, schließlich durch den fein säuberlich gepflegten Vorgarten, bis hin zum gläsernen Windfang und durch die Haustür hinein, die Treppe hinauf, in den zweiten Stock, bis in die Wohnküche hineinschleppen. Dort löste sie ihre Mutter ab, mit dem Spielen, dem Gedichte lesen, den Umarmungen, dem Lachen und Singen, der grenzenlosen, liebevollen Geduld. So ging das jeden Nachmittag, bis dann, abends, Juliane Lübben kam, um ihn abzuholen, was ihr, nach ihrem langen, harten Tag im Büro, meist nur unter wildem Geschrei und zornigen Kindertränen möglich war.
Morgens brachte ihn seine Großmutter, Gerlinde – kurz Gerli – Gundermann zu Fuß in den nahen gelegenen Kindergarten. Seine Großeltern waren, an modernen Maßstäben gemessen, bettelarm, ein Auto war undenkbar. Opa Gundermann hatte nicht mal einen Führerschein, und im Krieg ist er immer nur geritten oder auf dem Panzer mitgefahren. Dennoch fehlte es dem kleinen Jan an nichts, ganz im Gegenteil, er wurde verwöhnt und verhätschelt wie ein Prinz. Seine Oma Gerli liebte er abgöttisch; nichtsdestotrotz machte er ihr, als kleiner verzogener, schon früh jähzorniger, Teufel das Leben zur Hölle. Der ganze Weg zum in der Innenstadt liegenden Kindergarten war ein zorniges, ungezogenes Geplärr, denn bereits als Kleinkind hatte Jan Lübben eine wunderliche Abneigung gegen Autorität, in diesem Falle gegen jene der katholischen Kirche, verkörpert durch die Kindergartenschwestern, fast ausnahmslos überaus boshafte, schwarzverschleierte Nonnen mit ausgeprägtem Hang zum Sadismus. Hatte Oma Gerli es endlich geschafft, ihn in der Krippe einzuliefern, fing er auch schon an, den schwarzen Schwestern ins Bein zu beißen, sie zu treten oder sich, vor lauter Zorn, in die Hose zu pissen. So zog sich der Fußmarsch von der Hindenburgstraße – unter normalen Umständen höchstens 20 Minuten – bis zu dem katholischen Waisenhaus, dem sein Kindergarten angegliedert war, bald eine dreiviertel Stunde hin, tagaus, tagein. Noch schlimmer war für Gerlinde Gundermann freilich der Rückweg, denn der führte zwangsläufig an dem dann geöffneten zweitgrößten Kaufhaus des Ortes und dessen Spielwarenabteilung vorbei. Schon als Kleinkind war Jan Lübben ein Autonarr, und so zerrte er sie mindestens zwei, dreimal die Woche in die erste Etage der ´Kaufhalle´, zu den Matchbox-Autos; kaufte sie ihm keins, biss er sie ins Bein oder plärrte, wie ein Besessener, mit knallrotem Kopf. Und so kam es, dass sich die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung seiner Großeltern in einen regelrechten Spielzeugladen verwandelte, in allen Ecken standen seine automobilen Schätze, füllten bald ganze Kisten. Noch mehr als Autos liebte er schon als kleines Kind das Weibliche Geschlecht. Und so blieb den bigotten, säuerlichen Kindergartenschwestern nichts anderes übrig, als ihn jeden Morgen wenigstens für eine viertel Stunde in eine der Mädchenklassen des benachbarten Waisenhauses zu führen, wo er dann den Clown mimte. Auf die Frage, was er werden wollte, sagte er meistens „Astronaut“, „Rennfahrer“ oder „Verbrecher“. Manchmal sagte er auch „Daiwel“ (Dialektal: Teufel), nur um die Nonnen zu ärgern, die dann immer ganz weiß im Gesicht wurden. Gerlinde Gundermann stammte aus dem Frankenland. Im Laufe der Jahre entwickelte sie so einen recht exotischen linguistischen Cocktail aus der distinguierten Mundart ihrer neuen Wahlheimat und dem fränkischen Dialekt ihres bajuwarischen Geburtsortes. Sie kam aus einer ziemlich wohlhabenden Familie, der Vater war nicht nur Metzgermeister, sondern auch Bürgermeister des Kleinstädtchens Stiefelstein und als solcher eine Art Hoflieferant. So wuchs Oma Gerli wohlbehütet und sorgenfrei auf, von einer Klosterschule zur anderen wechselnd. Doch als der Vater nach einem schweren Autounfall erblindete, verlor die Familie alles, an eine Unfallversicherung dachte damals noch kein Mensch. Ihren Mann, Wilhelm Gundermann, hatte sie hingegen schon vorher kennengelernt und mit ihm wanderte sie, noch vor dem Krieg, ins abgelegene Ludwigshausen aus.
Auch Wilhelm Gundermann entstammte einer gutsituierten Familie. Sein Vater betrieb eine florierende Baufirma, die Mutter war eine belesene Intellektuelle, die fließend auf Englisch und Französisch fluchen konnte. Wilhelm Gundermann zeigte sich schon in jungen Jahren als wilder, jähzorniger, stolzer Rebell und er dachte überhaupt nicht daran, sich in das Familienunternehmen zu integrieren. So kam es, dass er bereits mit 17 Jahren von zu Hause fortlief, um sich freiwillig bei der Wehrmacht zu melden. Später, als die Nationalsozialisten kamen, wurde er begeisterter SA-Mann, um dann schließlich im Kriege als Unteroffizier mit den „Panzern“, wie er zu sagen pflegte, vor Stalingrad zu landen. Zum Offizier hatte er es nicht gebracht, denn auch dafür war er zu frech und zu rebellisch. Doch vielleicht war es gerade diese unverschämte, rotzfreche Art, die ihm das Leben gerettet hatte und ihn sogar vor der Gefangenschaft bewahrte. Nach dem Kriege wurde er dann Beamter auf dem Sozialamt, was damals als etwas Besseres galt. Dennoch, das junge Ehepaar landete in einer Situation stetiger Geldknappheit, denn Opa Wilhelm wurde bald zur Strafe enterbt und Oma Gerlis Familie verlor fast alles durch die Behinderung des Vaters. Das Wenige, was übrigblieb, rissen sich die raffgierigen Verwandten aus dem Frankenland unter den Nagel, Gerlinde Gundermann hatte das Nachsehen und war außerdem viel zu gutmütig, um sich um das liebe Geld zu balgen. Oma Gerli und Opa Wilhelm waren die liebevollsten Großeltern, die man sich vorstellen konnte. In der winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Hindenburgstraße hatten beide ihr mit unsichtbaren Grenzen versehenes Revier; so war Opa Wilhelm der uneingeschränkte Herrscher des Wohnzimmers, wo er, ursprünglich wegen seiner furchteinflößenden Schnarcherei, auch meistens auf dem Sofa schlief. Dieses war ein wundervoll weiches, bequemes Sofa mit fuchsfarbenem Samtbezug, in den Streifen eingewirkt waren. Oft blieb Opa Wilhelm, in mehrere Pyjamas gehüllt und stets mit einer schwarzen, grobwollenen Mütze versehen, bis mittags liegen. Er schlief für sein Leben gerne, vielleicht weil er im Krieg fünfeinhalb Jahre lang nicht schlafen durfte. Stets litt er unter Kopfschmerzen, was von allen als Verrücktheit eines Kriegsveteranen abgetan wurde, der im Felde den Verstand verloren hatte, während in seinem Schädel tatsächlich bereits ein bösartiger Tumor sein heimtückisches Vernichtungswerk trieb. Oma Gerli hingegen regierte in der gemütlichen Wohnküche und hatte auch das kleine Schlafzimmer ganz für sich. Sie verwöhnte ihren Enkel nach Strich und Faden, kochte ihm nach dem Munde, kaufte ihm, trotz ihrer stets knappen Kasse, seine geliebten Modellautos, später die Micky-Maus-Hefte, dann die Bravo und noch später sogar die Zigaretten, denn schon als 14-Jähriger fing Jan mit dem Rauchen an. Seine ersten Zigaretten rauchte er bereits mit vier, aus einem kleinen gelben Plastikpfeifchen mit rotem Pfeifenkopf. Die Glimmstängel klaute er seinem Vater aus einer runden hölzernen Dose mit Zinndeckel, die stets auf dem elterlichen Wohnzimmertisch stand. Einmal erwischte ihn sein Vater, wie er sich, ebenfalls als Vier- oder Fünfjähriger, gerade über eine Flasche Bier hermachen wollte. Oma Gerli verzieh ihm alles, jede Dummheit, jede Garstigkeit, was er ihr, als kleiner Knirps, durch zahlreiche Bisse ins Bein und allerlei ungezogenes Geschrei mit knallrotem Kopf und zornigen Tränen dankte. Wenn Jan ihr, meist in aller Öffentlichkeit, eine seiner Szenen machte, dann schämte sich Gerli Gundermann in Grund und Boden, denn der Gedanke, ‚die Leute’ könnten denken, sie behandle ihren Enkel schlecht, war ihr ein absoluter Graus. Später, Jan Lübben war schon Oberschüler, war sie stets der einzige Mensch, der ihm immer wieder alle Sünden vergab, an den er sich immer, ganz gleich, was er ausgefressen hatte, wenden konnte. Sie war eine einfache und nicht eben belesene Frau, hatte aber das größte Herz und die reinste Seele, die man sich vorstellen konnte. Was Opa Wilhelm anbelangte, so war er das glatte Gegenteil von dem, was man allgemeinhin als guten Christenmenschen bezeichnet: Arrogant, jähzornig, unendlich stolz, ein schlechter Vater und ein noch schlechterer Ehemann. Darüber hinaus trauerte er, bis zu seinem Tode, dem Großdeutschen Reich und dessen siegreichen Eroberungsfeldzügen nach. Er schiss auf Juden, Araber, Neger, Franzosen, Amis, Schwule und Zigeuner. Nur die Russen mochte er recht gut leiden, denn die hatte er im Krieg als tapfere Soldaten kennen- und somit – nach seinem Weltbild – schätzen gelernt. Der Zweite Weltkrieg war für ihn nie zu Ende gegangen, nie verloren worden. Und dennoch war er ein überaus liebevoller Großvater, der seinen Enkel Jan behütete, wie ein rohes Ei. Vor Weihnachten verbrachte er Wochen im Keller, um ihm Holzspielzeug zu basteln, denn er war ein begnadeter Handwerker, ja ein regelrechter Künstler. Einmal drechselte er ihm so eine Lokomotive, ein andermal ein Ritterschwert, wie es schöner aus keiner Fabrik hätte kommen können. Als Jan Lübben in die Schule kam – er war von Beginn an ein hoffnungsloser Faulpelz – begleitete ihn Opa Wilhelm bis ins Klassenzimmer, schrieb ihm sogar die Hausaufgaben, die man seinerzeit noch mit einem Griffel auf eine kleine Schiefertafel kritzeln musste, von der Tafel ab. Zu Hause übte er dann mit ihm Rechnen und Schönschrift, beides vergebliche Liebesmüh, denn Jan wollte einfach nichts lernen. Das Mittagessen, das Oma Gerli täglich für sie zubereitete, nahmen die beiden gemeinsam in der gemütlichen Wohnküche ein. Im Winter loderten dann die Briketts im weiß emaillierten Kohleofen, auf dem auch gekocht wurde. Wilhelm Gundermann war dabei meist noch in seine Pyjamas und seine schwarze, grobwollene Mütze gehüllt. Jan hatte den Eindruck, sie sei ihm auf dem Kopf festgewachsen. Er war ein überaus hagerer, jedoch recht drahtiger Mann, dem man die Strapazen des Weltkriegs noch immer deutlich ansah. Seine Haut war weiß, fast durchsichtig, dazu bildeten seine blau-grünen, stechenden Augen und das feuerrote Haar einen seltsamen Kontrast. Seine dünnen, schneeweißen Beine waren mit wurzeldicken Krampfadern überzogen, die er sich ebenfalls im Krieg gezüchtet hatte. Die Mittagsstunde etwa nutzte er sehr gerne, um seinen Enkel Jan politisch und weltanschaulich zu unterrichten; So baute er einmal auf seinem Teller ein KZ: Die aufgeraute Verzierung des mit blauem Blümchenmuster handbemalten Porzellantellerrandes war dabei der Stacheldraht, das Gulasch, das Oma Gerli gekocht hatte, war die SS. Das Kartoffelpüree, in der Mitte des Tellers, waren die gefangenen Juden. Dann stach Opa Gundermann, mit hervorquellenden Augen, wie wild mit seiner Gabel auf den Kartoffelbrei ein und rief dabei immer wieder laut und abgehackt: „Judd! Judd! Judd!“ Die wirklich leckere braune Gulasch-Sauce war dann das Blut. Anschließend steckte er sich seelenruhig, als sei nichts geschehen, eine HB an – er rauchte wie ein Schlot – lachte und klopfte seinem Enkel liebevoll auf die Schulter. Nach dem Mittagessen begaben sich Großvater und Enkel meistens ins Wohnzimmer. Dort legte Wilhelm Gundermann Marschmusik auf und dann spielten sie, bewaffnet mit stumpfen Fleischermessern oder Tortenhebern, Russenkillen in Stalingrad. Am liebsten hörten sie dabei den Radetzkymarsch, den sie stets volle Kanne aufdrehten. Jan Lübben war total verrückt aufs Krieg spielen, er konnte nicht genug davon bekommen, vom fiktiven ´Russen mit dem Flammenwerfer jagen´, ´Juden aufstöbern´ oder ´Franzosen mit dem Bajonett abstechen´, all dies begleitet vom wie irren Augenrollen sowie den abgehackten Gesten und Befehlen des Großvaters. Manchmal gingen die beiden auch ins Kino. Ihr Lieblingsfilm war „Steiner, das Eiserne Kreuz“, den spielten sie dann zu Hause nach, auf dem Wohnzimmerteppich, mit kleinen Metallpanzern, die winzige rote Plastik-Granaten verschossen. Das herrliche Kriegsspielzeug gab´s bei Siebenhüner, dem einzigen veritablen Spielwarenfachgeschäft der Stadt, wo beide Stammkunden waren. Sie hatten auch die tollste Spielzeugpistolen-Kollektion der Hindenburgstraße, und einmal kaufte Opa Gundermann bei Eisen-Silbermann sogar eine echte Schreckschuss-Pistole, mit der die beiden dann, vom Badezimmerfenster aus in den Garten, auf den imaginären Feind schossen, der natürlich aus Frankreich herüberkam. Schon als Fünfjähriger fand Jan Lübben Waffen total geil und liebte den kalten, metallischen Ölgeruch des großväterlichen Schießeisens.
Als Jan vielleicht knapp sechs Jahre alt war kaufte ihm Opa Gundermann einen knallblauen Polizei-Tretporsche, das schönste Spielzeug, das er, als Kind, jemals hatte. Dazu bekam er einen weißen Plastik-Helm und einen richtigen kleinen Gestapo-Mantel aus schwarz-braunem Vistram, über den Jan dann noch eine große Spielzeugpistole geschnallt trug. Zum Dank schmiss er seinem Großvater ein paar Tage später im Garten einen Stein an den Kopf, als dieser gerade dabei war, mit einem Holzrechen das Laub zusammenzuklauben. Opa Gundermann blutete wie verrückt und schaute seinen Enkel nur fassungslos an, wobei er immer bleicher wurde. Noch lange Zeit später konnte sich Jan Lübben genau daran erinnern, wie seine Eltern sich damals ernsthaft mit dem Gedanken trugen, ihn in die Kinder-Klapsmühle zu stecken. Freilich rächte sich das Schicksal auf dem Fuß, denn nur wenige Tage danach fuhr er mit seinem blauen Tretauto die steile Hoftreppe der Hindenburgstraße 267 hinunter, die den Vorgarten mit dem hinter dem Haus liegenden Obstgarten verband. Er wollte so, im Selbsttest, den weißen Polizei-Plastikhelm ausprobieren, das Experiment endete mit einem tiefen Loch im Hinterkopf. Manchmal ging Opa Gundermann auch mit seinem Enkel in den Ludwigspark, das war dann immer etwas Besonderes. Der Ludwigspark war ein am Stadtrand gelegener, wunderschöner dichtgrüner, bewaldeter Park, einst Privatgarten einer reichen Fabrikantenfamilie. Im ´Luddwich´, wie die Anlage von den Einheimischen nur genannt wurde, gab es, neben einem herrlichen Spielplatz, auch ein elegantes Kaffeehaus. Dort bestellten sich Opa Wilhelm und Jan stets Fanta und frischgebackene Salzbrezeln, denn im Kaffee Luddwich gab es die besten Brezeln der Welt. Meistens gönnten sie sich danach auch noch ein Stück Käsekuchen oder Sahnetorte.
Die Nachbarschaft in der Hindenburgstraße war strikt in Freund und Feind unterteilt. Rechts neben der Nummer 267 stand die Vorkriegsvilla der Bögerbergs, einer verarmten Ludwigshausner Großbürgerfamilie, die vor dem Kriege sogar ein Hausmädchen hatte. Die alte Frau Bögerberg, die noch alle, ob der alten glanzvollen Zeiten, die ‚Große Bögerberg´ nannten, war Oma Gerlis beste Freundin. Frau Bögerberg war ein ganz dürres, fragil wirkendes Persönchen mit blaugrauem kurzem Lockenkopf. Im Krieg waren ihr zwei Finger an der rechten Hand abgefroren. Dennoch strotzte die gescheite Frau nur so vor Energie. Manchmal musste Jan irgendwelches Zeugs zu den Bögerbergs rüberbringen, dann gab’s immer was für die Spardose, ein Bonbon oder wenigstens einen Keks. Besonders gern mochte er Willibert Bögerberg, den einzigen, schon erwachsenen Sohn der Familie; der machte immer Späße. Als Kind bekam Willibert beim Spielen einen Fußball ins Gesicht und zwar so doll, dass er am Schädel operiert werden musste und dadurch zum Frühinvaliden wurde. In dem Haus links neben der Nummer 267 wohnten die Wischnewkis. Die Wischnewkis waren Flüchtlinge, und so in den Nachkriegswirren aus Ostpreußen vor den Russen abgehauen, um dann irgendwann im Süden zu landen. Frau Wischnewki ging im Krankenhaus putzen, ihr Mann war Heizer bei den Amis. Die Wischnewkis hatten zwei Söhne, den älteren, Franz, den alle nur Bubi nannten, und den jüngeren, Peter. Die Wischnewkis waren einfache und ganz wahnsinnig nette Leute. Die Wischnewki-Söhne wurden zu Jan Lübbens Lieblingsspielkameraden in der Hindenburgstraße. Ein paar Häuser weiter, auf der anderen Straßenseite, wohnten die Kellermanns. Deren Sohn, Rudolf, war etwa so alt wie Jan Lübben und ein von allen Kindern gefürchteter Feind. Er war größer und stärker als alle anderen und konnte sagenhaft gut mit der Steinschleuder umgehen. Er war auch der erste, der ihm so richtig die Fresse blutig schlug. Noch weiter vorne in der Straße wohnten die Höfler-Buben, die eine eigene Fraktion bildeten, die mit keinem so richtig gutstand. Die Höfler-Buben waren gefürchtete Flitzbogenschützen. Sie hausten in einer düsteren, vierstöckigen, lindgrün gestrichenen Vorkriegsvilla, die auf einem Hügel stand. Von dort aus, im Gestrüpp versteckt, schossen sie auf alles, was sich bewegte. Vielleicht waren sie so zornig, weil es hieß, ihre Mutter sei Bordellvorsteherin in einem der zahlreichen Ami-Puffs, die sich rund um die Ludwigshausner US-Basis angesiedelt hatten. Alles in allem war es eine glückliche, sorgenfreie, rundweg schöne Kindheit, die Jan Lübben in der Hindenburgstraße verlebte.
Jan Lübbens Eltern wohnten damals in einer oberhalb der Hindenburgstraße gelegenen Parallel-Straße – ganz Ludwigshausen bestand aus einem Gewirr von Hügeln, ein jeder wie eine kleine Stadt für sich. Dort, in der Westendstraße, lebten sie Zaun an Zaun zu den Amis, einer riesigen US-Militär-Wohnsiedlung. Die Braddler (Dialektal/despektierlich: US-Amerikaner, bzw. GI) wie sie von den Ludwigshausnern nur genannt wurden, hatten einfach alles, ihre eigenen Supermärkte, Tankstellen, Kliniken, Spielplätze, Schulen, Hamburgerläden und Eisdielen. So waren denn auch ihre Nachbarn Militärangehörige, Jans bester Freund in Kindheitstagen John Meyers, der Sohn eines MP-Mannes aus Texas und einer Deutschen Krankenschwester. Wenn er nicht in der Hindenburgstraße war, hing er meistens in der Wohnung von Johns Eltern rum, dort spielten sie dann Superman und Batman oder mit den Matchbox-Autos, denn auch sein amerikanischer Freund war schon als Kind ein Autonarr. Manchmal gingen sie auch auf den Ami-Spielplatz, der gleich hinter der Wohnung anfing. Dann schaukelten sie auf Schaukeln aus grünem Marschgeschirrstoff. Am liebsten aber band sich John Meyers die riesige Knarre seines Vaters, inklusive Patronengurt, um. Die Kanone schliff auf dem Boden hinter ihm her, aber er war mächtig stolz und Jan Lübben mächtig neidisch. Damals wünschte er sich nichts mehr, als dass auch sein Vater MP-Mann wäre, insbesondere wegen der großartigen Pistole. Wenigstens hatte sein Vater, Wolfrath Lübben, ein Luftgewehr. Mit dem schoss er manchmal auf die Spatzen im hinter dem Haus gelegenen Garten, vom Fenster des Wintergartens aus. Im Handschuhfach seines orange-roten Renault 5 lag eine schwere Gaspistole, die so richtig doll echt aussah. Jan Lübben konnte sich später nicht mehr erinnern, warum sein Vater eine Gaskanone im Auto hatte, denn der war ein freundlicher, friedlicher Mensch, bei allen beliebt. Eigentlich sagten das alle, die ihn gekannt haben. Irgendwann war es dann aus mit dem Frieden. Das Schulamt lud Jan Lübben schriftlich zum Idioten-Test ein, um zu sehen, ob er mit seinen sechs Jahren reif war für die Bildungs-Maschinerie. Der Schulpsychologe war ein fetter, alter, geiler Glatzkopf, der die ganze Zeit wie ein Schleimwurm freundlich tat, wobei sich auf seinem glänzenden, rosigen Gesicht ein ebenso feistes wie falsches Lächeln eingegraben hatte. Auf einem Stück Papier sollte Jan ein Männchen malen. Doch er schiss dem amtlich bestallten Schulanwerber was. Nicht etwa, dass er nicht zeichnen konnte. Er zeichnete sogar recht gut für sein Alter. Nein, Jan Lübben wollte einfach nur diesem für ihn uralten, ihm widerlichen, Repräsentanten der Autorität mit seinem dümmlichen, verlogenen Lächeln eins auswischen, ihm Widerstand leisten. So kam es, dass er erst ein Jahr später, bereits mit Sieben, eingeschult wurde – freilich schon mit psychologischem Brief und Siegel und ohne Wissen seiner Eltern – als pennälerischer Halbidiot eingestuft. Die der Westendstraße nächstgelegene Grund- und Hauptschule war die Huckelsberg-Schule, im Dialekt kurz ´Huggelsbärch´, so ziemlich die asozialste Lehranstalt in der ganzen Stadt. Gut, da gab es noch die Sonderschule am Schmiednagelsberg, die die Einheimischen, in ihrer stets diplomatischen Art, als ´Treppengymnasium´ bezeichneten, fand sich doch die einzige Dummschuul (Dialektal/despektierlich: Sonderschule) der Kleinstadt in direkter Nachbarschaft einer steilen Treppe, die zwei Ortsteile miteinander verband. Der ´Huggelsbärch´ lag auf dem Huckelsberg, einem Stadtteil, in dem überwiegend Ludwigshausner Lumpenproletariat wohnte. Die Huckelsberg-Grund-und-Hauptschule wurde vornehmlich von kleinen Gewaltverbrechern, Dieben, Trinker-Kindern, Perversen sowie unheilbaren Dummköpfen jeglicher Couleur besucht. Und von Jan Lübben. Die Kinder der Besseren Leute gingen allesamt auf die Römerschänzer Schule, die im gleichnamigen Viertel am Stadtrand und schön im Grünen lag. Fast alle braven Akademiker-Bürger, die Jan Lübben später kannte, hatten ihre Karriere dort begonnen. Doch schon Jan Lübbens Mutter hatte den ´Huggelsbärch´ durchlaufen. Und so kam es, dass er der Klasse des Fräulein Kundelgau zugeteilt wurde, der ehemaligen Lehrerin seiner Mutter Juliane.
Das Fräulein Kundelgau war eine alte, überaus hässliche Jungfer, untersetzt, flachbrüstig, mit fetten, krummen, stark behaarten Beinen und pissblondem Lockenköpfchen. Auf ihrer Nase saß eine glasbausteindicke, leicht dunkel eingefärbte Brille, durch die ihre stets etwas triefenden, blassbraun-grünen Haifischaugen glotzten. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, machte sie, als junge Pädagogin, schnell Karriere beim BDM, brachte es schließlich bis zur KZ-Aufseherin. Dort war es ihre Spezialität, elternlos gewordene Juden- oder Zigeunergören in den Latrinen des Lagers in ihrer eigenen Scheiße baden und anschließend ersticken zu lassen. Nach ihrer Entlassung aus dem amerikanischen Umerziehungslager wurde sie gleich wieder freudig als Lehrerin eingestellt. Nie sollte Jan Lübben vergessen, wie sie, mit sichtlich sadistischem Vergnügen, am ersten Schultag laut und schmatzend seinen Namen von ihrer Liste vorlas, sich dabei stille schwörend, ihn, die Brut ihrer meistgehassten Ex-Schülerin, wenn schon nicht physisch, so doch zumindest psychisch zu vernichten. Sicherlich, Jan war manisch faul und damit der Antityp eines Lieblingsschülers. Hinzu kam, dass er, aufgrund seiner viel zu späten Einschulung, die anderen auch noch um gut einen Kopf überragte, was den Hass des Fräulein Kundelgau nur noch zusätzlich anstachelte. Die beliebteste pädagogische Disziplin des Fräuleins war die körperliche Züchtigung, die sie mit hemmungslosem, geradezu orgiastischem Eifer betrieb. Neue Quälmethoden testete sie grundsätzlich zuerst an Jan, zur Abschreckung aber auch zum schaurigen Entzücken von dessen Mitschülern. Auf das Nichtwissen eines Multiplizierergebnisses, beispielsweise, stand `Fingerspitzen blutig schlagen´ mit einem dünnen Rohrstöckchen, das beim Ausholen ein forsches Pfeifen von sich gab. Alternativ dazu gab es die Varianten ‚Ohrenverdrehen einfach´, `Ohrenverdrehen mit Bluterguss´, `Kopfnuss´, `Haarbüschel ausreißen´ oder auch nur den guten alten Schlag ins Gesicht, mit der flachen Hand. Die Königsdisziplin war jedoch der große Zollstock. Dabei handelte es sich um einen genau einen Meter langen vierkantigen Holzstab, auf den in roter, schwarzer und weißer Farbe die verschiedenen metrischen Einheiten aufgepinselt waren. So stand, beispielsweise, auf das Vergehen `schlampig geführtes Heft´ folgende Strafe: Der Gewinner musste sich, den Kopf Richtung Fußboden ausgerichtet, über eine der Holzbänke legen, das Hinterteil angespannt und nach oben gestreckt. Dann prügelte das Fräulein solange auf den Arsch ein, bis das Opfer vor Schmerzen schrie oder sich in die Hosen pisste. Wer sich freilich in die Hose pisste wurde auch dafür wieder verdroschen. Manchmal, wirklich nur manchmal, sozusagen als Besonderheit, gab´s auch einen scharfen, gezielten Schlag in die kleinen Weichteile der verhassten Pennäler. Nicht zu verachten waren die psychischen Foltermethoden des Fräulein Kundelgau. Sie hatte ein außergewöhnliches Talent, jegliche Art von Schülerschwächen regelrecht zu riechen, ganz gleich, ob diese körperlichen, familiären oder geistigen Ursprungs waren. Hatte sie erst einen Schwachpunkt entdeckt, ließ sie solange nicht locker, bis der betreffende sein lebenslanges Trauma weghatte. Schon nach den ersten zwei Grundschuljahren war Jan Lübben tüchtig verkorkst, jegliches möglicherweise vorhandene Talent war nachhaltig herausgeprügelt.
IN DER OBERSTADT
Bald stand im Hause Lübben ein großer Umzug an, denn Jan Lübbens Vater Wolfrath hatte die Schnauze endgültig voll von der lauten und schmutzigen Westendstraße. Und so mietete er, gegen den Willen seiner Frau, eine Drei-Zimmer-Wohnung in einem Neubau auf der Römerschanze, einem noch jungen Stadtteil im Grünen, am Rande von Ludwigshausen, wo sich nun, peu à peu, die Besseren Leute ansiedelten. Juliane Lübben schmeckte der Umzug überhaupt nicht, denn jetzt war sie nicht mehr in der Nähe ihrer Fabrik und auch ihre Eltern fanden sich nun plötzlich am anderen Ende der Stadt. Für Jan Lübben stand mit dem Umzug eigentlich ein Schulwechsel an, denn er gehörte jetzt, streng verwaltungstechnisch gesehen, auf die Römerschänzer Grundschule, eine Ganztagsschule, die als die beste der Stadt galt. Doch seine Mutter Juliane setzte alles daran, dass er trotzdem auf der Huckelsberg-Schule blieb, denn so konnte sie ihren Sohn weiterhin täglich bei den Großeltern abliefern, wo sie ihn besser aufgehoben wähnte. Es war nicht etwa so, dass Juliane Lübben ihren Jan nicht liebte, nicht stets das Beste für ihn wollte, ganz im Gegenteil; doch war ihr jedwedes akademische Denken einfach fremd. Und so kam es, dass Jan, trotz der neuen Wohnung und gegen den Willen seines Vaters, weitere zwei Jahre auf der alten Schule blieb. In der Umzugswoche hatten Juliane und Wolfrath Lübben ihren ersten großen Ehekrach. Die neue Wohnung der Familie Lübben lag in einem nagelneuen vierstöckigen Miethaus am Truffaud-Ring, einer ebenfalls nagelneuen Straße, im nagelneuen Nobel-Viertel Römerschanze. Hier wohnten die Ludwigshausner Gutbürger, die Chemiefabrikanten, die Bauunternehmer, die Anwälte, die Architekten, die Oberlehrer und die Ärzte. Blitzsaubere, ja aseptische Einfamilien-Bungalows in blitzsauberen, frischbepflanzten Gärten stehend. Das brave viergeschossige Miethaus, in dem sich die Wohnung der Lübbens fand, wirkte hier fast wie ein Fremdkörper, ebenso wie der orange-rote R5 von Wolfrath Lübben, der sich scheu zwischen den schweren Limousinen der Nachbarschaft duckte. Auch Jan Lübben war ein Fremdkörper auf dem, für Ludwigshausner Maßstäbe, feinen Truffaud-Ring. Die Fabrikanten- und Oberlehrer-Söhne aus der neuen Nachbarschaft rochen, geifernden, sabbernden, geilen Bluthunden gleich, dass er nicht aus dem gleichen Stall stammte, sie rochen, dass er in der Hindenburgstraße mit Schmuddelkindern gespielt hatte und sie rochen, dass er auf der Huckelsberg-Schule mit Geistesschwachen, Psychopaten und Trinker-Kindern die Bank teilte. Und so war Jan Lübben von Beginn an der von allen verachtete Außenseiter, der Sonderling, der Absonderliche, vielleicht sogar der Schmutzige, denn Armut ist ja auch immer Schmutz, Aussatz, für die Oberstädtler, macht jenen Angst, die, in parfümierte Watte gebettet, an der weichen Brust der sorglosen, seichten, glatten, ewig reibungslosen Bürgerlichkeit aufgewachsen sind. Die Lübbens wohnten in der zweiten Etage mit Hanglage, wo sie eine schöne helle Wohnung mit Terrasse und sogar einem kleinen Garten bezogen hatten. Unter ihnen gab es noch eine Kellerwohnung, wo eine halb verblödete, bösartige Alte hauste, die aber, zur großen Erleichterung Jan Lübbens, bald das Zeitliche segnete. In der Wohnung über den Lübbens wechselten die Mieter so häufig, dass Jan sich nicht mehr an Details erinnern konnte. Doch im vierten Stock waren die Ottos eingezogen. Auch Familie Otto bestand nur aus drei Mitgliedern, dem Ehepaar Richard und Hildegard Otto, sowie deren Sohn Thomas, der etwa zwei Jahre jünger als Jan Lübben war. Richard Otto betrieb ein kleines Transportunternehmen, Hildegard Otto widmete sich dem Haushalt. Zwischen den Ottos und den Lübbens entstand bald eine nachbarschaftliche, bald auch eine persönliche Freundschaft. Insbesondere Wolfrath Lübben und Richard Otto verstanden sich hervorragend. Beide waren Autonarren, beide waren Hobbyköche und, vor allem waren sie beide standfeste Trinker, ein Laster, dem sie regelmäßig mal in der einen, mal in der anderen Hausbar frönten, sehr zum Leidwesen ihrer jeweiligen Gattinnen.
Am Wochenende gingen die beiden jungen Familien oft gemeinsam zum Wandern. Das kleine Industriestädtchen Ludwigshausen lag mitten in einem riesigen Waldgebiet, mit fast unwirklich schönen, endlosen, dichten Pfaden, wo entsprechende sonntägliche Ausflüge als eine Art Nationalsport betrieben wurden. Richard Otto war nicht nur ein begeisterter und durchtrainierter Wanderer, mit den für die Männer der Region so typischen dicken Waden, sondern auch ein regelrechter Vergnügungswart, ein Clown, der gut mit Kindern umgehen konnte. Während der Wanderungen machte er stets unzählige Späße mit Jan und seinem Sohn Thomas, ersann sich die ulkigsten Phantasiefiguren, erzählte die komischsten Witze und sang kindische oder auch schlüpfrige Lieder. Stets schleppte er einen prall gefüllten Rucksack mit sich, aus dem er immer wieder Leckereien für die Kinder zauberte, dazu einen dicken, naturgewachsenen, gedrehten Wanderstab, in dessen Kopfende das Gesicht eines Walddämons geschnitzt war. Auch trug er die typischen Dreiviertel-Hosen aus grobem Wildleder, rote Kniestrümpfe, ein kariertes Hemd, einen grauen Spitzhut mit Feder und einen dichten schwarzen Vollbart, der das Bild vom lebenslustigen, romantischen Vagabunden vollends abrundete. Fast immer endeten die Exkursionen in einem der zahlreichen Waldheime der Gegend, einfachen Wanderhütten, die von freiwilligen Helfern mit deftiger Hausmannskost bewirtschaftet wurden. Dort gab´s dann Erbsensuppe mit Wiener oder Hausmacher Wurst mit Brot, anschließend frischen Kuchen oder Mohrenköpfe, dazu natürlich reichlich Weinschorle für die Erwachsenen und Fanta oder Malzbier für die Kinder. Das Einkehren auf den Wanderhütten, insbesondere im nicht allzu weit von der Stadt entfernten Wanderheim ´Drei Birken´, barg immer eine gewisse Gefahr, denn oft endete das Ganze in einem tüchtigen Besäufnis. So war es nichts Ungewöhnliches, dass ein erwachsener Ludwigshausner an einem normalen Sonntagnachmittag fünf oder sechs Schoppen Weinschorlen trank, dazu noch mal die gleiche Menge Schnaps. Einmal waren die Ottos so stark betrunken, dass sie ihren Thomas glatt in der gemütlichen Gaststube der ´Drei Birken` sitzen ließen, und sich erst Stunden später, verkatert, daran erinnerten, dass sie ihren Sohn im Wald vergessen hatten. Unterdessen machten sich Richard Otto und Wolfrath Lübben bald einen Ruf als hervorragende Hobbyköche am Truffaud-Ring. Richard Ottos Spezialität waren Pilze und Wildgerichte, Wolfrath Lübben war hingegen ein begnadeter Pizzabäcker. Und so kamen die beiden eines Tages auf die Idee, ein Mini-Straßenfest zu organisieren, mit Pizza, Bier vom Fass und reichlich Schnaps; eingeladen war, wer Lust hatte. Und so begab es sich, dass, an jenem Sonntagnachmittag im Spätsommer, Richard Otto und Wolfrath Lübben in die feine Gesellschaft ihrer akademisch gebildeten Nachbarschaft aufgenommen wurden, denn auch die Notare, Architekten und Ärzte soffen ihr Bier, ihren Schnaps und fraßen ihre leckere Pizza nach Herzenslust.
In der darauffolgenden Nacht wurde Jan Lübben durch laute Schreie brüsk aus dem Schlaf gerissen. Es waren die Stimmen von Richard und Hildegard Otto, dazwischen das Gewimmer von Thomas Otto. Im vierten Stock war ein überaus brutaler, gnadenloser Ehekrach ausgebrochen, die Worte flogen wie Projektile, tödlich, mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Jan Lübben hatte Angst, denn er konnte die Gewalt durch die Wände hindurch, bis unter seine Decke spüren. Doch war dies nur der Anfang. Der Speditionsfirma von Richard Otto ging es schlecht, die Schulden häuften sich. Bald fingen sowohl Richard, als auch Hildegard Otto damit an, bereits an normalen Wochentagen über das Maß hinaus zu trinken, um sich hernach im Suff brutal zu streiten, immer vor den Ohren ihres kleinen Sohnes. Zu seinem neunten Geburtstag im September hatte Jan Lübben von seinen Großeltern aus Hamburg ein Paar Rollschuhe geschenkt bekommen, die er stolz auf dem Gehsteig vor dem elterlichen Miethaus am ausprobierte, als plötzlich zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei mit kaltem Blaulicht, ohne Sirene, heranbrausten, gefolgt von einem Krankenwagen. Zu seinem Entsetzen hielt der Tross genau vor seiner Haustür, Polizisten und Sanitäter stürmten über den etwa zehn Meter langen Kieselweg bis hin zum Eingang, wo sie dann, im vierten Stock, an der Tür der Ottos Sturm läuteten. Etwa 40 Minuten später trugen die Sanitäter eine Bahre mit einem verhüllten Körper aus dem Haus. Erst am nächsten Tag sollte Jan Lübben auf dem Schulhof erfahren, dass es sich bei dem Leichnam auf der Bahre um die sterblichen Überreste Richard Ottos handelte, der sich mit seiner Jagdpistole in den Kopf geschossen hatte. Richard Otto, der singende, der lustige, der stets lachende und infantile Wandersmann, der Lieblingsnachbar und Bilderbuchvater. Doch Richard Otto hatte die Schnauze voll von allem, von den Schulden, vom Stress, doch vor allem auch vom ständigen Streit mit seiner Frau, und so soff er eine ganze Flasche Whisky aus, setzte sich anschließend im Badezimmer auf den Toilettendeckel, steckte sich seine 357-er Smith & Wesson Magnum Kaliber 38-P tief in den Hals, ganz nach oben, und drückte ab. Es war ein schöner, überaus meisterlicher, sauberer Schuss, der ihm quasi das ganze Hirn auf einen Schlag herausblies, alles gegen die blau-grünen Keramik-Plättchen der Badezimmerwand. Die Schädeldecke ging in tausend Stücke, die, winzigen Raketen gleich, in der blutig-klebrigen Gehirnmasse an der Badezimmerwand stecken blieben. Das stets so lustige, vollbärtige Gesicht Richard Ottos sank auf den Kachelboden, wo es, wie ein schlaffer Luftballon, liegen blieb. So fand ihn schließlich sein siebenjähriger Sohn Thomas, der von dem lauten Knall in seinem Kinderzimmer aus dem Schlaf gerissen wurde.
DIE SPÄTE RACHE DES KARL HUBERTUS BLAU
Immer dann, wenn in Ludwigshausen etwas schiefgelaufen war, wurde Jan Lübben zu seinen Großeltern väterlicherseits nach Hamburg verfrachtet, sozusagen ins heilsame Notexil. Natürlich konnte niemand etwas dafür, dass Nachbar Richard Otto beschlossen hatte, seiner physischen Existenz ein so unschönes Ende zu setzen. Dennoch löste die Nachricht bei der Verwandtschaft im hohen Norden fassungsloses Entsetzen und Kopfschütteln aus. Einmal mehr sahen sich Karl Hubertus Blau und dessen Frau Hildegard in ihrer Auffassung bestätigt, dass es sich bei Ludwigshausen um den Schmelztiegel des Abschaums der Menschheit handelte. Dass ihr Enkelsohn Jan in einer, nach ihren hanseatischen Maßstäben, solch grauenhaften Stadt aufwuchs, war für sie nicht nur ein Gräuel, sondern ein Quell ständigen Grams. Der Zufall wollte es, dass ohnehin die Herbstferien kurz vor der Tür standen, und so saß Jan Lübben schon zwei Tage später im Flugzeug Richtung Hamburg. Dorthin reiste er stets mit gemischten Gefühlen; einerseits liebte er seine Großeltern, zumal ihm seine Großmutter jeden Wunsch von den Lippen ablas. Hinzu kam das hotelgleiche Anwesen im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel, in dem die beiden lebten, das Ganze in einem riesigen Park mit eigenem kleinem Teich, ein regelrechtes Kinderparadies, wo es für ihn sogar eine Schaukel und eine Rutschbahn gab. Andererseits fürchtete er das im Hause Blau stets unterschwellig vorherrschende Ambiente protestantischer Strenge, das insbesondere durch seinen Stiefgroßvater, Karl Hubertus Blau, repräsentiert wurde. Sein leiblicher Großvater, Heinz Lübben, war bereits im Alter von 24 Jahren als Jagdflieger im Krieg gefallen. Schon während des Fluges nach Hamburg bekam Jan Lübben Magendrücken bei dem Gedanken an das Verhör, das ihm gleich nach seiner Ankunft durch seinen Großvater bevorstehen würde; nicht umsonst war Karl Hubertus Blau kurz nach Kriegsende Kriminalpolizist, bevor er sich entschloss, zunächst Schokoladenfabrikant und dann Schuhimporteur zu werden. Jan Lübben war natürlich völlig schleierhaft, warum der stets so nette und lustige Nachbar sich eine Kugel in den Kopf gejagt hatte. Mit all seinen neun Jahren war der Tod für ihn noch etwas völlig Abstraktes, zu Hause wurde über das Thema niemals gesprochen. Und so kam es, wie es kommen musste. Nachdem er, als ‚Alleinreisendes Kind´ am Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel von einer Stewardess seinen Großeltern übergeben worden war, diese ihn liebevoll begrüßt und ihn anschließend, nebst seinem Kinderkoffer, in Karl Hubertus Blauens silberfarbenen Mercedes verfrachtet hatten, begann noch auf der Fahrt in die Poppenbütteler Landstraße das gefürchtete großväterliche Verhör: „Mein Gott, mein Junge, was habt ihr denn da unten wieder ausgefressen?“ – „Ich wääß es nädd“ (Dialektal: „Ich weiß es nicht.“), antwortete Jan Lübben, in breitester Ludwigshausner Mundart. „Um Himmels Willen, Jan, sprich doch bitte Hochdeutsch, das ist ja furchtbar, wie Ihr da unten redet!“, fauchte Karl Hubertus Blau vom Fahrersitz zurück. Wohl liebte der nüchterne Hanseat und erzkonservative Kaufmann seinen Stiefenkel sehr, doch er hasste Ludwigshausen, und er hasste es, dass der Sohn seines Adoptivsohnes jetzt auch noch die widerwärtige Mundart dieser katholischen Barbaren annahm. „Aber Ihr müsst doch wissen, warum dieser Herr Otto sich das Leben genommen hat, so was gibt´s doch einfach nicht!“, ereiferte sich Karl Hubertus Blau weiter. Jan Lübben, der bereits mit den Tränen kämpfte, kauerte sich immer tiefer in das breite Rückpolster der Limousine und druckste nur sein bäurisches „ich wääß es nädd, ich wäaß es nädd.“ Doch jetzt intervenierte Hildegard Blau, die sich bereits ihre zweite Zigarette angezündet hatte, denn sie rauchte, trotz ihrer durchaus vorhandenen aristokratischen Eleganz, wie ein Schlot. „Hubertus, lass doch den Jung´ in Ruhe, siehst du nich´, dass er nichts von der Geschichte weiß!“ Und so schwieg Karl Hubertus Blau während der restlichen Fahrtzeit bis zum großelterlichen Domizil im Alstertal, bleich, immer wieder den Kopf schüttelnd, und, mit sorgenvollem Gesicht, von Zeit zu Zeit in den Rückspiegel blickend.
***





























