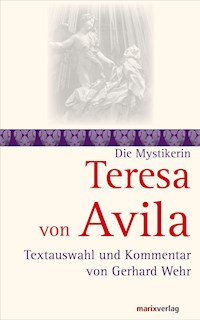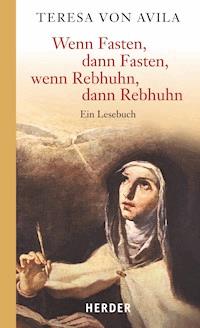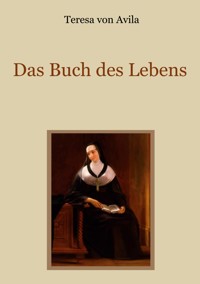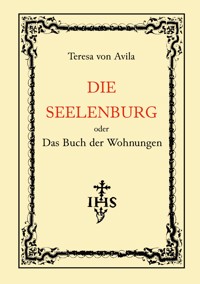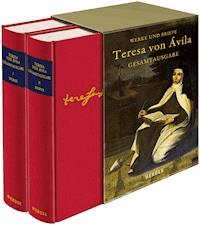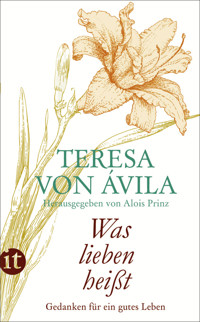Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Vom Ringen der jungen Teresa um gelebte Gottesnähe bis zur Lehre der reifen Frau vom wortlosen mystischen Gebet, von Klostergründungen bis zu menschlich bewegenden Begegnungen und Briefen ist dieses Buch eine Hinführung zu der großen Reformerin und Mystikerin, deren Faszination ungebrochen ist. Aus den Texten Teresas lässt Erika Lorenz das Bild einer vitalen, starken Frau mit Ecken und Kanten, voller Selbstbewusstsein und Kampfgeist entstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teresa von Ávila
»Ich bin ein Weib – undobendrein kein gutes«
Die schönsten Texte der großen Mystikerin
Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von Erika Lorenz
Die Herausgeberin
Erika Lorenz (1923–2003), Studium der Hispanistik, Literatur- und Musikwissenschaft. Promotion (1954) und Habilitation (1960) in Romanischer Philologie. Professorin an der Universität Hamburg (1969–1985), Hauptforschungsgebiet: spanische Spiritualität des 16. Jahrhunderts.
Erstmals erschienen 1982 in der Reihe »Texte zum Nachdenken«, herausgegeben von Gertrude Sartory
Neuausgabe 2021
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 1998, 2012
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Danussa/Shutterstock
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timisoara
ISBN E-Book (ePub) 978-3-451-81519-5
ISBN Print 978-3-451-03292-9
Inhalt
Hinführung zu den Texten
Hinweis für den Leser
Ich bin ein Weib – und obendrein kein gutes
Selbsterkenntnis – Selbstverständnis
Die Biene Demut
Gedicht
Umgang mit dem Freunde
Lebendiges Wasser
Man kann sich mit Dir über alles unterhalten
Inneres Gebet
Übergang zu anderen Arten des Betens
Gedicht
Mein Geliebter ist mein
Das Gebet der Ruhe
Gebet der Vereinigung und Menschheit Christi
Kreuz an allen Wegen
Mein Geliebter ist mein!
Die Heilige Dreifaltigkeit
Unio auf Erden
Gedicht
Werke, meine Töchter, Werke!
Marta und Maria
Erste Klostergründung
Johannes vom Kreuz, unterwegs, unterwegs
Der »Sturm« im Orden
Gedicht
Eine ziemliche Einsamkeit
Begegnung mit dem Pater Gracián
Briefe an den Pater Gracián
Gedicht
Memento: Der Schmetterling
Teresa von Ávila: Kurzbiografie
Schriften
In den Texten auftretende Personen
Anmerkungen
Meinem Lehrer Rudolf Grossmann
Hinführung zu den Texten
Wer von Teresa von Ávila spricht, spricht von Gott. Aber auch vom Mitmenschen, von sich selbst. Alles das enthält und umfasst die unfassbare Persönlichkeit der Teresa von Ávila. Unfassbar und handfest, sicher in der Banalität des Alltags, vertraut mit dem Wesen subtilster Transzendenz, und beides zugleich in der Selbstverständlichkeit der Erfahrung. Gründet Teresa ein Haus, so lässt sie zunächst Stroh aufschütten, damit man zumindest ein Lager habe. Betet sie, so unterhält sie sich mit dem Herrn, den sie als in ihrem Herzen anwesend erlebt. Sie spricht zu ihren Mitmenschen und von ihren Erfahrungen im Konjunktiv der Behutsamkeit, wenn nicht im Indikativ der Nüchternheit. Herzenstakt und maßvolle Klugheit kennzeichnen sie, aber ebenso die maßlose Liebe. Ein Genie der Liebe, das aus dem Du und für das Du lebt, das es am Quellpunkt der Gottverbundenheit findet.
Wie ist es möglich, ein Porträt zu entwerfen von der Strömenden, Flutenden, in aller Demut Grenzenlosen? Ihr Ordensbruder Fray Juan de la Miseria hat es als Maler versucht. Die Anekdote berichtet uns den Seufzer der Heiligen: »Gott verzeihe Dir, Bruder Juan!« Hässlich und triefäugig fand sie sich auf dem Bild: War es wirklich nur die weibliche Eitelkeit der Sechzigerin, die von ihrer – zumindest einstigen – Schönheit wusste? Mir scheint sich in diesen Worten eher das Unbehagen auszudrücken, dass der Maler das Geistige nicht einzufangen vermochte, die sprühende Lebendigkeit, die entschlossene Güte, den selbstkritischen Humor. Und vor allem: Gott lässt sich nicht malen, diese Ausstrahlung, dieses »lebendige Wasser« ihrer Seele. Nicht zufällig nennt sie das Wasser ihr Lieblingssymbol: strömend und tief, bewegt und still, stets angepasst und immer zielgerichtet, aber auch grenzenlos und ursprunggebunden.
Das Porträt dieser Texte ist als Selbstporträt angelegt, stets der Tatsache bewusst, dass dieses Wesensbild, wie ich es nennen möchte, erst dem Nachdenkenden seine ganze Tiefe und Weite erschließt. Der Leser muss also »mitmalen«, um bei der Porträtmetapher zu bleiben. Er wird dabei entdecken, dass Gott sich im Summen einer Biene verbirgt oder Teresas Anbetung im Gebrauch von Küchengeräten. Und vor allem: dass der Glaube erst das Geschaute zum Bilde fügt.[1] Ich habe die Auswahl aus allen ihren Werken getroffen, nur die klosterinternen ausgenommen (Satzungen und dergleichen). Als Hintergrund wird dabei die Lebensgeschichte sichtbar mit den inneren Entwicklungen dieser Frau, die kühn und dynamisch die Schwelle zur Neuzeit überschritt.
Unsere heutige Zeit vermag immer wieder in Teresa von Ávila eine Heilige nach ihrem Herzen zu erkennen, weil ihr die Gottesliebe zum »sozialen Engagement« geriet. Das ist einerseits richtig, es geht Teresa nicht um das persönliche Seelenheil, sondern um das ihrer Mitmenschen. Aber hier zeigt sich auch schon der Unterschied: Sie will nicht allgemeinen Wohlstand schaffen in der Welt, sondern die Gottverlorenheit, die Heillosigkeit dieses Lebens zurückführen, rückbinden an seinen in Ewigkeit rettenden Ursprung.
Teresas Einsatz, ihre Hinwendung zum Mitmenschen ist gerade in ihrer Absolutheit an eine Vorbedingung geknüpft: völlige Hingabe an Gott, für dessen Liebe die Heilige in dieser Welt Werkzeug und Medium wird.
Gerade weil Teresa tief um Gottes Transzendenz, seinen unbegreiflichen »Überstieg« weiß, erkennt sie die Unabdingbarkeit seiner Menschwerdung in der Heilsgeschichte. Ihre unbefangene Christozentrik entzieht sich jedem weltlichen Zugriff.
Schon 1587, fünf Jahre nach ihrem Tode, schreibt der Herausgeber ihrer Werke, der große Dichter, Theologe und Augustinermönch Fray Luis de León über Teresas Gegner:
»Sie meinen, Gott könne sich mit niemandem so menschlich einlassen. Dann haben sie aber ihren Glauben nicht durchdacht. Wenn man bekennt, dass Gott Mensch wurde, wie kann man dann die Möglichkeit bezweifeln, dass er zum Menschen spricht? Ist es mehr, einem seiner Knechte zu erscheinen und mit ihm zu sprechen, als sich zum Knecht aller zu machen und für sie den Tod zu erleiden?«[2]
Doch wäre es ein Irrtum zu meinen, Teresas Mystik bestehe aus »mystischen Phänomenen«. Diese treten eine Weile gehäuft auf und gehen dann gerade in der Unio mystica zurück. Wesentlich – nicht zuletzt ihrem eigenen Bewusstsein – ist einzig die bis zur Absolutheit angestrebte Hingabe an »den Willen Gottes«, wie man das in ihrer Zeit nennt. Dieser alte »Voluntas«-Begriff wird heute oft missverstanden, als gehe es darum, zu allem Schrecklichen und Absurden dieses Lebens Ja zu sagen. Nicht so Teresa und ihre christlich-augustinische Tradition. Hier ist der Wille jene strebende Gerichtetheit, die man bei Gott auch als Liebe bezeichnet. Sie schließt nach katholischer Auffassung den Heilswillen für alle ein. Teresas mystische Erfahrung bestätigt dies, denn je mehr sie sich dem Willen Gottes »eint«, umso stärker und liebevoller wendet sie sich ihren Mitmenschen zu. Dienst am Nächsten heißt das konkrete Merkmal ihrer Gottesliebe.
Die für sie so charakteristische Doppelheit, der Antagonismus oder die Paradoxie von kontemplativer Versunkenheit und unermüdlicher Aktivität, findet hier eine – freilich nur dem Glauben zugängliche – Erklärung. Aber auch das modern-rationale Denken kann die Tatsache nicht übersehen, dass Teresa in den dauerhaften Zustand der Unio mystica nicht zum Zeitpunkt größter Zurückgezogenheit eintritt, sondern inmitten höchster, von Reisen und Klostergründungen bestimmter Aktivität. Unterstützend tritt hier gewiss ihr Wesen hinzu: extravertiert und menschenzugewandt, aber auch gottsuchend, ewigkeitsbewusst und opferbereit »von Kindesbeinen an«: Sie selbst berichtet in ihrer Autobiografie vom Eindruck, den das Wort »ewig« auf sie machte, von der »erbärmlichen Furcht« vor ewiger Verdammnis, die ein wichtiger Grund zum Klostereintritt war (freilich nicht blieb!), und von ihrem kindlichen Aufbruch mit dem Bruder, um für Gott den Märtyrertod im Maurenland zu erleiden, wenn auch der Kreuzzug schon vor den schützenden Mauern von Ávila endete. Auch »Nonne spielen« war dem Kinde Teresa ein herrlicher Verkleidungsspaß, und es fehlte nicht an Stimmen, die meinen, sie habe auch im Kloster achtzehn Jahre lang nur Nonne gespielt.
Der »Mitmaler« ihres Porträts möge selbst urteilen. Sicher ist, dass hier ein Aspekt ins Blickfeld kommt, der das erste Kapitel und den Titel dieses Buches bestimmte: »Ich bin ein Weib und obendrein kein gutes« – dieser so aus der altbewährten Übersetzung des Pater Aloysius Alkofer OCD übernommene Satz[3] mag auf den ersten Blick erheitern oder schockieren. Er birgt jedoch entscheidende Wahrheiten. Als Frau war Teresa für die Kontemplation und absolute Hingabe an den immer wieder durch Christus erfahrenen Gott besonders geeignet. Als »Weib« hatte sie in ihrer Zeit aber auch große Schwierigkeiten. Sie musste ja nicht nur ihre Zeitgenossen, sondern auch ihr eigenes Bewusstsein davon überzeugen, dass sie mehr für Gott tun durfte, ja, musste, als einer Frau damals »zustand«. Ich möchte hier wieder Fray Luis de León zu Worte kommen lassen:
»So ist es wirklich etwas ganz Neues und Unerhörtes, dass eine schwache Frau den Mut zu so großen Unternehmungen aufbrachte. Und dass sie dabei so weise und geschickt vorging, dass sie die Herzen aller gewann, die ihr begegneten. So konnte sie diese Gott zuführen. Sie zog ganz einfach die Menschen hinter sich her, selbst gegen die Schwachheit der sich sträubenden Natur. In dieser unserer Zeit, da der Teufel in der Masse ihm verfallender Ungläubiger triumphiert, (…) will ihn Gott, so meine ich, in besonderer Weise demütigen und beschämen: darum sandte er keinen tapferen Mann von großer Gelehrsamkeit in den Kampf, sondern eine arme alleinige Frau, auf dass sie den Teufel herausfordere und ihr Banner gegen ihn aufpflanze.«[4]
Fray Luis de León, der schon dreiunddreißig Jahre vor Teresas Heiligsprechung schrieb, »die Mutter Teresa war heilig, überaus heilig«[5], spielt hier auf die vielfältigen Glaubensschwierigkeiten nicht zuletzt im Spanien Teresas an: Die Proteste und Abspaltungen von der Kirche, die durch die Spanische Inquisition nicht zu neuen Kirchenbildungen, wohl aber zu einem blühenden religiösen »Untergrund« mit mystischen, vor allem aber pseudomystischen Zügen führte (das heißt, wo man den Eigenwillen als Willen Gottes interpretierte); die neue Situation mit dem Heer scheinbekehrter Juden und Mauren, deren Verfolgung zugleich die Wirtschaft zum Erliegen bringt; und – für Teresas Bewusstsein besonders wichtig – mit dem erst dreiundzwanzig Jahre vor ihrer Geburt entdeckten amerikanischen Kontinent, dessen Millionen unschuldiger »Ungläubiger« Spanien vor Probleme stellt, aus deren Lösung sich unter anderem die »Menschenrechte« entwickeln.[6] Alles das spielt eine Rolle in Teresas religiösem Leben, in ihrem »Sendungsbewusstsein«, das von ihrem Frausein innerlich gefördert und äußerlich behindert wird. Hinzu kommt die ganz spezielle Situation der karmelitischen Frauenklöster in Spanien. Sie sind aus »Beaterios« hervorgegangen, frommen Gemeinschaften adeliger Frauen, meist mit Gelübden (nicht immer allen), jedoch stets ohne Klausur und mit nur teilweise geregeltem und gemeinsamem Gebetsleben. Es kann hier nicht die Ordensgeschichte berichtet werden[7], doch sei nicht vergessen, dass das Menschwerdungskloster, in dem Teresa 1537 Profess ablegt, aus solchem »Beaterio« hervorgegangen ist. Etwa von ihrem Geburtsjahr an bemüht man sich, aus dieser Art von »Drittem Orden« ein reguläres Klosterleben zu entwickeln, mit Stundengebet und allen Gelübden, jedoch noch gelockerter Klausur. Es ist kaum möglich in einer Gemeinschaft von 180 Nonnen, die an Gäste mit Dienerschaft reinen Gewissens gewöhnt sind, nun jene Anforderungen eines streng kontemplativen Ordens zu stellen, die seine Ursprünge als Eremitensiedlung auf dem Berge Karmel in Palästina gekennzeichnet hatten.
Auch war ein regulärer weiblicher Orden zur Zeit des Eintritts Teresas in Spanien noch nicht entwickelt. Sie traf im Karmel von Ávila also nicht, wie meist angenommen, auf ein verlottertes Frauenkloster, sondern auf eine im Werden begriffene Klostergemeinschaft voller guten Willens, aber mit geringen Möglichkeiten, die jedoch als »Norm« akzeptiert waren. Zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des niederen Adels in Spanien, der solche halb klösterlichen Gemeinschaften zugleich förderte und hemmte, gesellte sich bei den Karmelitinnen mangelnde Orientierung, da es eine greifbare Ordensgründung durch eine charismatische Persönlichkeit der Vergangenheit nicht gab, sondern nur wüstenfern dunkle, in den Städten Europas dann erheblich abgewandelte und nicht klar zu lokalisierende Anfänge. Weitgehend ungelöst war auch im Menschwerdungskloster das Seelsorgeproblem in einer so großen Gemeinschaft und bei dem allgemeinen Niedergang sowohl der männlichen Orden wie des Weltklerus zur damaligen Zeit, wovon die bitter satirische Literatur reichlich Zeugnis ablegt.
Es lag also nicht an Teresas »weltlicher Gesinnung«, wenn sie achtzehn Jahre lang menschliche Seelenführung nur in dem berühmten Kontemplationsbuch des Francisco de Osuna[8] fand – was freilich insgeheim ihre »Freundschaft« und ihr »Gespräch« mit Christus gefördert haben mag. Es bedurfte wirklich ungewöhnlicher, schon heiligmäßiger Energie und »heroischer Tugend«, um dieses ganz »normale« Maß klösterlicher Frömmigkeit und des Dienstes an Gott und den Menschen zu übersteigen.
Teresas zahlreiche Klagen, wie »schlecht« sie gewesen sei – ein Weib und obendrein kein gutes –, haben einerseits ihre Wurzel im tiefsten Gefühl, dass nichts genügt, weil »Gott allein genügt«: weil die Liebe und Heiligkeit Gottes dem ihm zugewandten Menschen in einem Maße die eigene Unzulänglichkeit, Lauheit und Schwäche ins Bewusstsein bringen, dass gerade der »gute Wille«, gerade die wachsende Gottesliebe den Blick auf die eigene Person zum verzagten Schrecken werden lässt. Darum traf Teresas berühmtes »Bekehrungserlebnis« vor der leidensgezeichneten Christusstatue keine Unvorbereitete: Es löste die noch fehlende letzte Entschlossenheit aus, den Mut, sich über Zeit, Situation und »Weib sein« hinwegzusetzen. Als dieser Entschluss mit Gottes Hilfe gefasst war, gestalteten sich auch die äußeren Umstände zumindest so weit günstig, als dass Teresa daran denken konnte, Widerstände zu überwinden. So wurde aus dem Gedanken der Klostergründung zugleich Ordensreform, beginnend bei den Frauen; wobei das erste sichtbare Zeichen, das winzige Kloster San lose, 1562 ganz Ávila in Aufruhr versetzte und Teresa die ersten großen Feindschaften im eigenen (Menschwerdungs-)Kloster und Orden einbrachte; Reform auch für die Mönche, die sie nötig hatten (wie alle durch Privilegien »aufgeweichten« Bettelorden). Teresa will jedoch nicht reformieren um des Ordens, sondern um der Ungläubigen willen, für die es im Orden durch Gebete und Nachfolge Christi einzustehen gilt.
Aber ehe es zu Reformen und Gründungen kommt, setzt Teresa, deren realistische Einschätzungsfähigkeit sich nicht zuletzt auf die eigene Person erstreckt, bei ihrem Gebetsleben an. Ist doch das Gebet, insbesondere das kontemplative, der königliche Weg zu Gott, zum Wachsenlassen des »Christus in uns«, das Aufgabe eines jeden christlichen Lebens ist. Lektüre, gute Beichtväter, am meisten jedoch die eigene, als Führung Gottes erlebte Erfahrung lassen Teresa eine nachvollziehbare Gebetslehre entwickeln.
Da alle Überschriften dieser Anthologie als »Selbstporträt« ihren Texten entnommen sind, wird der entscheidende Ausgangspunkt dieser teresianischen Gebetslehre mit der Überschrift des zweiten Kapitels »Umgang mit dem Freunde« angesprochen. Denn dieser Umgang ist nichts anderes als das berühmte und oft missverstandene »innere Gebet«. Teresa meint damit die vom Betenden aktiv zu leistende Vergegenwärtigung Gottes. Sie soll sowohl das einfache mündliche Gebet in die rechte Sinnsphäre heben wie auch den Übergang bilden zum späteren »Gebet der Ruhe«, das nun Gott die Aktivität überlässt.
Damit wird im nächsten Kapitel »Mein Geliebter ist mein« das Gebet der Ruhe zum eigentlichen Beginn der kontemplativen oder mystischen Stufe, da der menschliche »Wille« immer häufiger das Wirken des göttlichen »Willens« in sich bejaht, bis beide in absoluter Gleichrichtung ununterscheidbar sind. Modern ausgedrückt: dass der Mensch die Liebe Gottes immer häufiger erfährt und zugleich in sich verwirklicht, bis er lebt und liebt, so sehr und so weit ihn diese Liebe Gottes trägt. Die christliche Besonderheit dieses nicht weiter diskutierbaren mystischen Prozesses ist die Unabdingbarkeit eines personhaften Gegenübers. Hierin liegt das Geheimnis, die Paradoxie christlicher Mystik, aber auch des christlichen Trinitätsbegriffes, da auch Gott in sich nicht ohne liebende Zuwendung zum Du gedacht wird. Gewiss wird darum Teresas endgültiger Eintritt in die Unio mystica nicht zufällig von Trinitätsvisionen begleitet. Vor allem aber orientiert sich die Heilige mit ihrer Christozentrik am Hohen Lied, dessen »Mein Geliebter ist mein« von ihr nun in sowohl persönlicher wie paradigmatischer Weise erfahren wird. Im Gegensatz zum halb oder pseudomystischen Wesen ihrer Zeit endet nun aber Teresa nicht in Passivität und »Liebesgenuss«. Die Erfahrung der Einswerdung wird ihr ja zuteil inmitten ihres »sozialen Engagements«, wie wir heute sagen würden, und stärkt dieses derartig, dass nun im äußeren Erscheinungsbild ganz »Marta« bestimmend ist, in deren Innerem freilich »Maria« lebt. Hatte Teresa auf den ersten Stufen des geistlichen Lebens der äußeren Zurückgezogenheit bedurft, um innerlich zur Ruhe in Gott zu kommen, erlaubt nun die Ruhe in Gott größte äußere Aktivität: ja, sie zwingt dazu! Ist doch Gott der Schöpferische, der Liebende, der unermüdlich Wirkende. Aber bei aller »Zusammenarbeit«: Der Mensch ist nicht Gott, er steht auch in der Unio mystica in der Nachfolge des Kreuzes. Der »Gewinn des Geliebten« bringt Teresa verstärktes Leiden am niemals genug Vollbringenkönnen. Und nicht nur in ihrer Eigenschaft als Mensch oder gar »schlechtes Weib«: Das Kreuz kommt drohend und gewaltig auf sie zu in Gestalt ihres eigenen Ordens.
Die Marta, die im vierten Kapitel ausruft: »Werke, meine Töchter, Werke!«, muss die ganze menschliche Bosheit und Unzulänglichkeit genau in dem geistlichen Bereich erfahren, in dem zu wirken ihr aufgetragen ist, ja, mehr noch: Sie muss hinnehmen, dass man sie auf dem Höhepunkt ihrer Fähigkeiten fünf Jahre am praktischen Wirken hindert, »abschiebt«.
Dass sie es mit Humor, Gelassenheit und schriftstellerischer Glanzleistung trägt, darf nicht über die Schwere der Belastung hinwegtäuschen. Haben doch auch ihre geliebten Töchter und Söhne, ihre Mitarbeiter zu leiden (über ihre eigene Begegnung mit der Inquisition lacht sie).
Aber die »beschuhten Brüder«, die keineswegs reformiert werden möchten – schon gar nicht auf Betreiben einer Frau –, haben den Johannes vom Kreuz ins Gefängnis geworfen, aus dem er erst neun Monate später recht abenteuerlich entfliehen kann. Seine Leiden veranlassen Teresa, sich an König Philipp II. zu wenden, wie sie es schon einmal anlässlich geringerer Schwierigkeiten des P. Gracián getan hatte. Der König ist ein wichtiger Beschützer und Förderer der entstehenden neuen Kongregation der »Unbeschuhten Karmeliten« (eigener Orden erst nach Teresas Tod). Zwei wichtige Schritte auf dem Weg dieses zukünftigen Ordens sind 1579 die Einsetzung des P. Salazar zum Generalvikar der »Unbeschuhten Karmeliten« durch Zusammenarbeit des Königs mit dem päpstlichen Nuntius, wodurch die Hauptquerelen beendet sind, und 1581 die Tagung des ersten Kapitels in Alcalá de Henares, das den P. Jerónimo Gracián zum Provinzial für Kastilien und Andalusien, das heißt für alle Neugründungen in Spanien wählt. Damit ist die Trennung von Beschuhten und Unbeschuhten auch von der »Basis« her besiegelt.[9] Teresa selbst hatte die Satzungen ausgearbeitet, wobei sie auf die »ursprüngliche Regel« der Karmeliten, vor Einführung der Milderungen durch Papst Eugen IV., zurückgriff.
Wer aber war dieser Pater Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, der eine so entscheidende Rolle in der Ordensgeschichte und im Leben Teresas spielte, dass ihm in dieser Anthologie das Kapitel »Eine ziemliche Einsamkeit« gewidmet ist?
Als die Mutter Teresa ihn 1575 anlässlich ihrer Andalusienreise kennenlernte, war er dreißig Jahre alt, seit drei Jahren im Orden und schon Provinzialvikar. Er muss ein sehr starkes persönliches Charisma besessen haben, »da fast alle, die mit ihm zu tun haben, ihn lieben«, wie Teresa schreibt[10] – nicht zuletzt die Heilige selbst! Die Mischung seines Charakters – fröhlich wie ein Kind und streng wie ein Wüstenvater[11] – muss auf die reife gotterfüllte Frau eine unsagbare Anziehungskraft ausgeübt haben. Er wird während der zwanzig gemeinsamen Tage für immer ihr Beichtvater, Freund, Vertrauter. »Ohne Übertreibung: es waren, glaube ich, die schönsten Tage meines Lebens«, gesteht Teresa[12], die später die Schwestern andernorts »beneidet«, die Graciáns Predigten hören können.[13] Manchmal begleitet er sie auf ihren Reisen. Er bringt sie, die Heitere, aber mit Verantwortung überladene zum Lachen. Und er bringt sie am Ende auch zum Weinen, denn ganz kann und darf dieser so »vollkommene« Ordensmann wohl die ihm entgegengebrachte Liebe nicht verstehen.