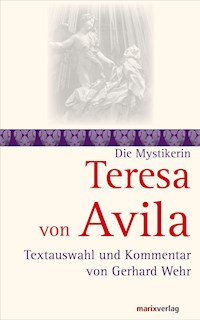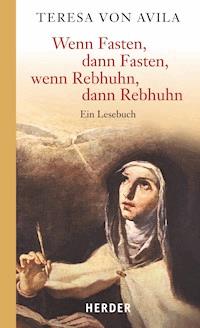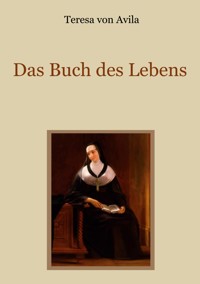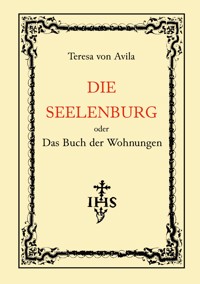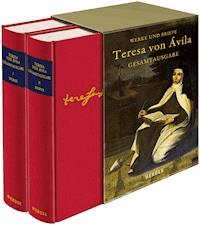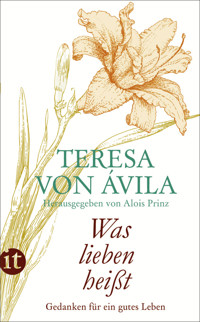9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In sich gehen – das Bild der inneren Burg als Metapher für die Seele ist heute so lebendig wie zu Lebzeiten Teresas von Avila. ›Die innere Burg‹ ist ihr Hauptwerk und gleichzeitig ihr reifstes – ein Klassiker der christlichen Mystik, der sich aber auch neu interpretieren lässt und damit ein Grundlagenwerk für eine moderne Spiritualität ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Teresa von Avila
Die innere Burg
Herausgegeben und übersetzt von Fritz Vogelsang
Diogenes
Einführung
Teresas Werk ist das Wasser, das aus dem Fels geschlagen wurde. Die Erfahrung des Unsagbaren ist darin literarische Kunst geworden. Unterm Zwang des Gehorsams beschrieb sie den Weg letzter Freiheit. Die Ruhe, die sie erstrebte, wurde zur Mitte historischer Bewegung. Die Mängel ihrer Person – so glaubte sie – waren ein Hindernis für die Glaubwürdigkeit ihrer Worte. Heute ist es der Ruf ihrer Heiligkeit, der vielen die Bedeutung ihrer Gestalt verdeckt. Doch die Verbannte, die ihr wahres Vaterland auf keiner Erdkarte verzeichnet fand, hat man zur Patronin Spaniens erhoben. Und die Stadt ihrer Geburt erscheint auch dem Fremden als Symbol ihres Wesens.
In Avila wurde sie am 28. März 1515 geboren. In dieser kastilischen Stadt, die mit den Türmen ihrer alten granitenen Mauern sich gegen die stumme Übermacht der sie umdrohenden Öde stemmt, wuchs sie heran, in einer Familie von Hidalgos. Hier erlebte sie die Jahrzehnte, die sie als qualvolle Folge immer neuen Fallens, neuen Aufstehens geschildert hat. Hier härtete sich unter den Schlägen furchtbarer Krankheit, der Enttäuschung, vielfachen Leids ihre Entschlossenheit zum radikalen Verzicht, mit dem sie die Erde, das Leben »unter die Füße« bringen wollte. Aus der schwankenden Nonne wurde hier das »ruhlose, streunende Weib« – wie der päpstliche Nuntius sie nannte –, das im Eselskarren auf staubigen, steinigen Wegen kreuz und quer durch die Halbinsel reiste, um der Askese, zu der sie ihren Orden zurückführen wollte, da und dort ein Obdach zu schaffen. Im Convento de la Encarnacion, draußen vor den Mauern, wo ein sandiger Weg sich in die Steinwüste senkt, hatte sie den Schleier genommen. Dort und in dem dürftigen, von ihr gegründeten Klösterchen San José, das eingekeilt zwischen kargen Adelshäusern steht, widerfuhr ihr, was die Verwandlung bewirkte und sie zur größten Mystikerin des Christentums werden ließ. Wer in den Nächten der Karwoche die Trommeln hört, die das hölzerne Bild des Gekreuzigten durch die steilen, roh gepflasterten Gassen begleiten, zwischen schweigend starrenden Menschen, glaubt einen dumpfen Nachhall ihres Lebens zu vernehmen.
Die Reformatorin des Karmels wäre uns jedoch nur eine ferne historische Gestalt, wenn nicht tausende von Blättern, die sie nachts und in den knappen Pausen eiliger Arbeit beschrieb, erhalten geblieben wären – Seiten, die den Lesenden, noch nach Jahrhunderten, mit der Gewalt unmittelbarer Gegenwart in das innerste Drama eines Lebens ziehen, das durch die Macht seines Wollens wie durch die Wucht des anstürmenden Erlebens die Bezeichnung des Exemplarischen verdient. Die dichtgefügten, von schneller, sicherer Hand gezogenen Schriftzeichen auf dem vergilbten Papier offenbaren mit beispielloser Direktheit, die der Ratio nicht selten peinlich ist, die wechselvolle Erfahrung eines Menschen, der mit bedingungsloser Rigorosität sich alles dessen zu entledigen suchte, was ihn hindern konnte, die Einigung mit der letzten Realität zu erlangen, und dem daher alles Handeln als nichtig galt, das nicht Gebet war.
Fünf ihrer Brüder kämpften auf dem Boden des weithin noch uneroberten Amerika, als Teresa de Ahumada in ihrer Zelle begierig, staunend, scharf beobachtend, schaudernd und mit der Hartnäckigkeit einer Verzweiflung, die kein Zurück erlaubte, in die unbekannte Welt ihres eigenen Inneren einzudringen begann. Widerstrebend aus Scham und dem Gefühl ihres Unvermögens, schrieb sie, auf Befehl ihrer Beichtväter, endlich die Geschichte dieses Irrens und Findens, der Verlorenheit und des Überwältigtseins, des Schreckens und der Beseligung nieder – nicht in literarischer Absicht, sondern zur Selbstkontrolle, zur Prüfung durch Gelehrte und als schlichte, um Klarheit besorgte Mitteilung an die Klosterschwestern. Mehrere Bände kamen so im Lauf der Jahre zustande: neben kleineren Schriften das Buch meines Lebens, Der Weg zur Vollkommenheit, die Chronik ihrer Klostergründungen und schließlich – als Summe ihres mystischen Erlebens – die Innere Burg.
Drei Jahre bevor der französische Edelmann Michel de Montaigne seine Essais zum ersten Mal veröffentlichte, verfasste Teresa – gleichsam als Ersatz für ihre Lebensbeschreibung, deren Handschrift seit Langem von der Inquisition beschlagnahmt war und als verloren galt – dieses Kompendium ihrer seelischen Erfahrung, wiederum dem Drängen eines Beichtvaters gehorchend. In Toledo, wo El Greco ein Jahr zuvor sich niedergelassen hatte, begann sie am 2. Juni 1577 mit der Niederschrift. Am 5. November desselben Jahres schrieb sie in Avila das Schlusswort, knapp einen Monat bevor Juan de la Cruz, der den Geist ihrer Reform in die Männerklöster des Karmeliterordens getragen hatte, von Anhängern der »milden Observanz« gewaltsam nach Toledo entführt und in den Kerker geworfen wurde, wo die Ersten Verse dieses einzigartigen »poeta a lo divino« entstanden.
Was Teresa mit dem ihr unbekannten epikureischen Einsiedler Montaigne verbindet, der im Turm seines abgelegenen Schlosses sich selber zum Stoff eines Buches zwangloser Meditation machte, ist der forschende Blick ins eigene Innere, die entsagende und zugleich entdeckungsfreudige Einkehr in die eigene Brust. Der stoische Franzose erklärte: »Ich studiere mich mehr als irgendeinen Gegenstand. Das ist meine Metaphysik, das ist meine Physik … Lasst uns nur hinhören, wir sagen uns alles, wessen wir bedürfen.« Die antigotische, entschlossene Genügsamkeit, die in diesen Sätzen zu spüren ist, wird offenkundig, wenn er anderswo sagt: »Nicht bergauf und voran zu streben ist die Größe der Seele, sondern sich fügen und bescheiden zu können.« Der Genuss der eigenen Vergänglichkeit in weltkluger Selbstbescheidung, der als Ziel solchen Philosophierens sichtbar wird, ist jedoch unvereinbar mit dem stärksten Impuls, der das Leben der Nonne von Avila bestimmt. Der Blick, den sie auf sich selber richtet, durchdringt das eigene Wesen, nicht um sich an der Kontur der Person zu genügen, sondern um auf dem Grund ihrer Seele jenes Bild zu entdecken, als dessen trübe Spiegelung sie sich fühlt; um durchzustoßen vom Schein zur Essenz, vom Wahn zur Wahrheit; um im Blitz tiefsten Erkennens eins zu werden mit dem Unermesslichen; um Augenblick und Ewigkeit zu verschmelzen zum Nunc aeternum.
Dass dies nicht Verlangen blieb, sondern Erfahrung wurde, ließ sie zur Autorin werden – wider ihren Willen, da sie sich stumm fühlte vor dem von ihr Erlebten, das aber zugleich für sie das Gebot der Mitteilung bedeutete. Es ist interessant zu vergleichen, wie die mystische Erfahrung, die ja kein Privileg des Christentums ist, zu allen Zeiten, da und dort, der Unzulänglichkeit aller Worte zum Trotz, sich Ausdruck zu verschaffen wusste. Aus der Lücke des Ungesagten, dem aufklaffenden Sprung des Paradoxons, das zwei Sätze zerreißt, steigt in der Wechselrede des »Kôan«, wie sie im Zen-Buddhismus zwischen Meister und Schüler geübt wird, jählings das gemeinte Geheimnis auf. Der Chassidismus bedient sich der legendarischen Anekdote, ebenso die islamischen Sufis. Durch gewaltsame Verrenkung, Umstülpung des konventionellen Vokabulars und mit genialen Neubildungen formte die Mystik des deutschen Mittelalters sich ein sprachliches Organ. Als Lyrik, die bedenkenlos die Elemente überkommener Liebesdichtung verzehrt, lodert das innerste Erleben bei Juan de la Cruz in Versen auf, in Strophen von unvergleichlicher Helligkeit, Reinheit und geistiger Glut. Der Dichter selber hat als gelehrter, philosophisch geschulter Theologe die Substanz seiner poetischen Melodik Zeile für Zeile genauestens kommentiert. Die theoretische Erklärung ist kein Ersatz für das im Vers Geborgene. Im Niemandsland zwischen beiden Arten des Sprechens, in der Blendung durch das zwiefache Licht ist das Gemeinte ahnend zu erfassen.
»Ich muss mich hier eines Gleichnisses bedienen« – schreibt Teresa in ihrer Vida –, »was ich freilich gern unterlassen würde, da ich ein Weib bin und einfach nur das zu schreiben habe, was man mir aufgetragen hat; aber für Leute, die wie ich keine Wissenschaft besitzen, ist es so schwer, diese Sprache des Geistes zu erklären, dass ich einen Ausweg suchen muss, der mir dies erleichtert.« Wie nahe ihr das Hilfsmittel lag, für das sie sich entschuldigt, und wie wenig Willkür bei seinem Erfassen beteiligt war, scheinen einige Sätze zu beweisen, die auf einer der letzten Seiten desselben Buches von einer Offenbarung berichten, deren Vorgang ihr selber zweifelhaft blieb: »Es schien mir zwar, als hätte ich nichts gesehen; ob dies aber auch wirklich so gewesen, kann ich nicht geradezu behaupten. Denn etwas muss ich doch wohl gesehen haben, weil ich sonst das, was mir gezeigt wurde, nicht mit einem Gleichnis, das ich gebrauchen will, erklären könnte; nur wird dieses Sehen auf eine so feine und zarte Weise geschehen sein, dass der Verstand es nicht erfasste.«
Nicht irgendeine Vision war der Anlass dieser Überlegung, sondern eine Einsicht von fundamentaler Bedeutung, die vielleicht zur wichtigsten Wegweisung ihres Lebens wurde. »Einmal, als ich mit den andern Schwestern die Horen betete, geschah es, dass meine Seele plötzlich in eine Sammlung versetzt wurde, in der sie mir wie ein klarer Spiegel erschien. An ihm war weder hinten noch an den Seiten, weder oben noch unten etwas, das nicht ganz klar gewesen wäre; in der Mitte aber zeigte sich mir Christus, unser Herr … Es wurde mir auch zu verstehen gegeben, dass dieser Spiegel, wenn die Seele sich in einer Todsünde befindet, wie mit einem dichten Nebel überzogen und ganz schwarz ist, sodass der Herr darin sich weder darstellen noch gesehen werden kann, obwohl er uns, indem er uns das Sein gibt, immer gegenwärtig ist.« Und ermutigt von der Erinnerung an Augustin, der von ähnlicher Erfahrung berichtet, folgert sie kühn: »Wir brauchen also nicht in den Himmel hinaufzusteigen, noch aus uns selbst hinauszugehen; denn dies wäre Ermüdung des Geistes und Zerstreuung der Seele …«
Damit war bereits das Grundmotiv angeschlagen, aus dem sich zwölf Jahre später ihr literarisches Hauptwerk entwickeln sollte. In ihrer Vida hatte sie die Reihe der locker aneinandergefügten Episoden ihres inneren und äußeren Lebensweges nur an einer, freilich entscheidenden Stelle aufgebrochen, um vier verschiedene Stadien des Gebets, des mystischen Erlebens, zusammenfassend, auf über hundert Seiten, im farbig geschilderten Gleichnis der vierfachen Bewässerung eines Gartens darzustellen. Ihr letztes großes Buch aber entwickelte sie aus einem einzigen allegorischen Bild, das als eine erweiternde Variante der vorhin genannten Vision erscheint und gleich an den Anfang des Werkes gestellt ist: »Wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden – weil ich nichts zu sagen fand und nicht wusste, wie ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe beginnen sollte –, da bot sich mir dar, was ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte: Nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleichwie im Himmel viele Wohnungen sind. Denn wenn wir es recht betrachten, Schwestern, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat … Ich finde nichts, mit dem sich die große Schönheit einer Seele, ihre Weite und ihre hohe Befähigung vergleichen ließe. Und wahrlich, unsere Einsicht und unser Verstand – so scharfsinnig sie sein mögen – reichen schwerlich aus, sie zu begreifen, genauso wenig wie sie Gott sich auszudenken vermögen.«
Sich selber zu erkennen ist für Teresa, die sich alle weltliche Ehre versagt hat, eine Frage der menschlichen Würde: »Erschiene es nicht als eine schreckliche Unwissenheit, wenn jemand keine Antwort wüsste auf die Frage, wer er ist, wer seine Eltern sind und aus welchem Lande er stammt? Wäre dies ein Zeichen viehischen Unverstands, so herrschte in uns ein noch unvergleichlich schlimmerer Stumpfsinn, wenn wir uns nicht darum kümmerten zu erfahren, was wir sind, sondern uns mit diesen Leibern zufriedengäben und folglich nur so obenhin, vom Hörensagen, weil der Glaube es uns lehrt, davon wüssten, dass wir eine Seele haben. Aber welche Güter diese Seele in sich bergen mag, wer in ihr wohnt und welch großen Wert sie hat, das bedenken wir selten, und darum ist man so wenig darauf bedacht, ihre Schönheit mit aller Sorgfalt zu bewahren. All unsere Achtsamkeit gilt der rohen Einfassung, der Ringmauer dieser Burg, das heißt: den Körpern.«
Das Tor aber, durch das der Mensch in sich selber einzudringen vermag, und der Schlüssel, mit dem die Seele, die kämpfend durch das langsam sich lichtende Dunkel vorwärts rückt, bis zu der strahlenden Mitte gelangen kann, »wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen« – dieser Schlüssel ist für Teresa das Gebet, jene absolute Hinkehr zum Höchsten in der Tiefe des eigenen Wesens, mit dem sie einen »Freundschaftsverkehr« erstrebt, der einen an Vermessenheit grenzenden Mut und zugleich die äußerste Demut der Selbstvergessenheit verlangt. Die Verwirklichung dieser Beziehung ist das große, das einzige Thema des Castillo interior – der Inneren Burg.
Dass das allegorische Leitmotiv dieses Werkes nicht zum beengenden Schema erstarrt, sondern vielmehr zum Quellmund immer neuer, sprudelnder Bilder, zum dämmenden, oftmals überfluteten Ufer eines drängenden geistigen Geschehens wird, ist der eindringliche Beweis für die Wahrhaftigkeit des Mitteilungswillens, der sich hier – unbesorgt um stilistische Perfektion oder logische Linearität – Gehör verschafft, und für die Fülle, die seine Formkraft zu bändigen hat. Vor einer perspektivisch allzu fixierten Auffassung des von ihr vermittelten Bildes warnt Teresa selber gleich zu Beginn: »Ihr dürft euch nicht vorstellen, dass diese Wohnungen wie aufgereiht eine hinter der anderen liegen. Richtet vielmehr eure Augen auf die Mitte, die das Gemach und der Palast ist, wo der König weilt, und stellt die Burg euch vor wie eine Zwergpalme, bei der viele Hüllen das köstliche Herzblatt umschließen. So liegen dort rings um diesen Raum viele andere Gemächer, und ebenso darüber. Denn die Dinge der Seele muss man sich immer in Fülle und Weite und Größe denken …«
Die Konsequenz aus solcher Erkenntnis ist ein Ratschlag, der eine kluge, schon psychologisch zu nennende Behutsamkeit verrät: »Sehr wichtig für jede Seele, die sich dem Gebet widmet, ist es, dass man sie nicht in einen Winkel pfercht oder einengt. Man lasse sie durch alle diese Wohnungen wandeln, aufwärts und abwärts und nach den Seiten hin; denn Gott hat ihr eine so große Würde verliehen. Auch dränge man sie nicht dazu, lange Zeit in einem einzigen Gemach zu bleiben, nicht einmal in dem der Selbsterkenntnis, so wichtig diese – wohlgemerkt – selbst für diejenigen ist, die der Herr in dieselbe Wohnung eingelassen hat, in welcher er selber weilt … Die Demut wirkt nämlich wie die Biene, die im Stock den Honig bereitet. Ohne sie geht alles verloren. Bedenkt aber, dass die Biene es nicht versäumt hinauszufliegen, um den Nektar der Blüten zu sammeln. Genauso muss es die Seele mit der Selbsterkenntnis halten. Glaubt es mir und fliegt zuweilen aus, um die Größe und Majestät eures Gottes zu betrachten …«
Wie hier, so geschieht es im ganzen Text: Vergleich wächst aus Vergleich, Bild überwuchert Bild. Vier allegorische Hauptmotive bestimmen jedoch die nicht erklügelte, unsystematische, aber vehemente Kontrapunktik dieses Werkes: die durchsichtige Burg, deren innerer Glanz nur durch die Schwärze der Sünde dem Auge verdeckt wird; der Kampf gegen die bösen Geister, an der Seite der treulosen Burgverwalter: der Sinne und Seelenkräfte (Verstand, Gedächtnis, Fantasie); die Metamorphose des Schmetterlings als Gleichnis dafür, wie die Seele sich selber einspinnen und ertöten muss, um beflügelt zur Freiheit aufzuerstehen; und endlich das Symbol der Liebesvereinigung, wie sie im Hohen Lied erscheint, wo der Bräutigam die Braut in seinen Weinkeller führt.
Die künstlerischen Höhepunkte des Buches sind – wie kaum anders zu erwarten – dort zu finden, wo die Darstellung Höhe und Art des ins Übernatürliche gehobenen Erlebens markieren muss, wo die Diskrepanz zwischen den Materialien der Wiedergabe und ihrem Gegenstand das bildnerische Verlangen zum Sprung über den eigenen Scheitel zu zwingen scheint. Kennzeichnend ist dabei, dass die Autorin noch in dem Augenblick, wo der Geist der Ekstase ihr die Feder führt, wo sie, hingerissen in der Verzückung, sich als Raub, als Tochter des göttlichen Adlers fühlt, sich nicht in der Häufung aufgesetzten Prunks, hingewischten Glanzes erschöpft, sondern immer besorgt um die Genauigkeit der unterscheidenden Wahrnehmung bleibt. So zum Beispiel, wenn sie zwei Stufen der geistigen Vereinigung – die mystische Verlobung und Vermählung – miteinander vergleicht: »Die frühere Vereinigung gleicht zwei Wachskerzen, die man so dicht aneinanderhält, dass beider Flamme ein einziges Licht bildet; und sie ist jener Einheit ähnlich, zu der der Docht, das Licht und das Wachs verschmelzen. Danach aber kann man leicht eine Kerze von der anderen trennen, sodass es wieder zwei Kerzen sind, und ebenso lässt sich der Docht vom Wachs lösen. Hier jedoch ist es, wie wenn Wasser vom Himmel in einen Fluss oder in eine Quelle fällt, wo alles nichts als Wasser ist, sodass man weder teilen noch sondern kann, was nun das Wasser des Flusses ist und was das Wasser, das vom Himmel gefallen; oder es ist, wie wenn ein kleines Rinnsal ins Meer fließt, von dem es durch kein Mittel mehr zu scheiden ist; oder aber wie in einem Zimmer mit zwei Fenstern, durch die ein starkes Licht einfällt: Dringt es auch getrennt ein, so wird doch alles zu einem Licht.«
Tirso de Molina hat ein halbes Jahrhundert später mit seinem Condenado por desconfiado (den Menéndez Pidal als das bedeutendste religiöse Drama der spanischen Literatur bezeichnete) gleichsam ein Standgericht über die von Zurbarán gemalten Helden asketischer Weltverachtung gehalten, über die abgezehrten Eremiten, die, vor dem Totenkopf kniend, die Augen starr an den Himmel geheftet, mit hochgereckten Armen ihre Erlösung zu ertrotzen scheinen. Die faustische Gebärde, mit der Tirsos »Heiliger« dem Himmel ein Zeichen seiner Rettung entreißen will, wird zum Fluch, als der Teufel – verkleidet als Engel des Lichts – ihm verkündet, dass er das ewige Schicksal eines Fremden zu teilen habe, in dem der Einsiedler einen gedankenlosen Gewaltmenschen und Verbrecher erkennt – eine sichere Beute des unterirdischen Feuers. Der kleinmütige Glaube des Asketen verwandelt sich in verzweifelten Trotz. Als Räuber rast er wider Gott und Welt und endet in der Hölle, während der vermeintliche Kettengefährte seines Schicksals im letzten Augenblick, naiv die Hand der göttlichen Gnade ergreifend, zur Seligkeit gelangt.
Der eigenmächtige Anspruch auf göttliche Belohnung war dem Denken Teresas immer fremd. »In diesem Werk des Geistes«, schrieb sie, »tut der am meisten, der am wenigsten zu tun denkt und tun will … Bei Dingen, vor denen Seine Majestät anscheinend eine Grenze gezogen hat und die er sich selber vorbehalten will, kann ich mich nicht zu menschlichen Anstrengungen überreden.« Wo die Liebe sie dem Höchsten entgegentrieb, verachtete sie die »Hühnerschritte«, zu denen ihre Beichtväter sie oft nötigten; aber sie war sich darüber klar, dass auch auf dem Weg des Gebets alles Erzwungene nur »Missbehagen« hinterlässt: »Es ist, wie wenn einer springen will, aber von hinten festgehalten wird.« Der Mut ihrer entschlossenen Hingabe an das Unbegreifliche, der sie nicht selten mit dem Kampfgeist eines ignatianischen Eifers erfüllte, war in ihr eins mit der Demut, die ihr gleichbedeutend war mit dem »Wandeln in der Wahrheit« und ihr die Überzeugung eingab, dass Gott oft die Schwächsten mit den höchsten mystischen Gaben beschenkt.
Mut und Demut, Kontemplation und Activitas, Liebe und kluge Nüchternheit – so glaubte sie – müssten beisammen sein wie Maria und Martha, damit der Herr sich wohl fühle. Die rechnende Skepsis des Lazarillo war ihr ebenso eigen wie der selbstlose Enthusiasmus eines Amadis. Als Inbild verzückter Hingabe hat Bernini sie in Stein gehauen; Rubens hat sie als Schreibende gemalt, mit einem Gesicht von strenger Bewusstheit, das den Strahl der Erleuchtung als ein Diktat der Klarheit empfängt.
Die Macht vereinigter Gegensätze, die Tanz und Geißelung umspannt, bezeugt der Duktus ihrer Schrift wie der Stil ihrer Sprache, in die sie die Essenz einer ungewöhnlichen, faszinierenden, unerschöpflichen Erfahrung gebannt hat. In ihrer Verbindung von Hoheit und Zärtlichkeit, Vorsicht, Bestimmtheit, Scheu und überschäumender Spontaneität sah Luis de León, der große Lyriker und Theologe (der 1588, sechs Jahre nach Teresas Tod, erstmals ihre Schriften veröffentlichte) »die Anmut selber« – lebendigste Anmut, die mit jedem Wort einen Brand entfacht. Sie beweist die Behauptung des Bernhard von Clairvaux: Verbo geniti verbum habent – wer vom Wort gezeugt ist, der hat das Wort.
FRITZ VOGELGSANG
Die innere Burg
JHS
Wenige Dinge, die mir der Gehorsam geboten hat, sind mir so schwergefallen wie jetzt die Aufgabe, über das Gebet zu schreiben. Einmal, weil ich nicht den Eindruck habe, dass der Herr mir dazu Geist oder Lust verleiht; und zum anderen, weil ich schon seit drei Monaten ein solches Dröhnen und eine solche Schwäche im Kopfe fühle, dass ich selbst die unumgänglichen Schreibarbeiten nur mühsam erledigen kann. Doch da ich weiß, dass die Kraft des Gehorsams Dinge zu bewältigen pflegt, die unüberwindlich erscheinen, so entschließt sich der Wille, es gern und mit herzlichem Eifer zu tun, auch wenn es der Natur hart anzukommen scheint. Denn der Herr hat mir nicht so viel Tugend verliehen, dass der Kampf mit der ständigen Krankheit und Beanspruchungen vieler Art ausgefochten werden könnte ohne heftigen Widerspruch der eigenen Natur. Möge er es tun, der andere, schwierigere Dinge vollbracht hat, um mir seine Gnade zu erweisen, und auf dessen Erbarmen ich vertraue.
Ich glaube zwar, dass ich nicht viel mehr zu sagen weiß, als ich bei anderen Gelegenheiten, da man mir zu schreiben befahl, schon gesagt habe. Ich fürchte vielmehr, dass es fast das Gleiche sein wird; denn es geht mir genau wie den Vögeln, die man das Sprechen lehrt: Sie können nichts anderes sagen, als was man ihnen beigebracht hat oder was sie gehört haben, und wiederholen es ein ums andere Mal. Will der Herr, dass ich etwas Neues sage, so wird Seine Majestät es mir geben, oder wird er sich damit begnügen, mir das ins Gedächtnis zu rufen, was ich früher gesagt habe. Ich wäre auch damit zufrieden; denn ich habe ein so schlechtes Gedächtnis, dass es mich freuen würde, einiges wiederzufinden, von dem man behauptet hat, es sei gut ausgedrückt gewesen – für den Fall, dass es verlorengegangen sein sollte. Wenn der Herr mir auch dies nicht gewähren sollte, so wird es mir dennoch ein Gewinn sein, um des Gehorsams willen mich abzumühen und meine Kopfschmerzen zu mehren, selbst wenn meine Worte zu gar nichts nütze wären. Und so beginne ich denn heute, am Tag der Allerheiligsten Dreifaltigkeit des Jahres 1577, hier im Kloster des heiligen Joseph vom Karmel in Toledo, wo ich derzeit weile, diese Pflicht zu erfüllen, mich in allem, was ich sage, dem Urteil derer unterwerfend, die mir zu schreiben befohlen haben, welches Personen von hohem Wissen sind. Sollte ich etwas sagen, was nicht dem Glauben der heiligen römisch-katholischen Kirche entspricht, so geschieht es aus Unwissenheit und nicht aus böser Absicht. Dessen kann man so gewiss sein, wie es sicher ist, dass ich durch Gottes Güte ihr immer ergeben bin und es sein werde und es stets gewesen bin. Ihm sei Ruhm und Ehre in Ewigkeit, amen.
Der mir zu schreiben befohlen hat, sagte mir, dass die Nonnen in diesen Klöstern Unserer Lieben Frau vom Karmel jemanden brauchten, der ihnen einige Zweifel wegen des Gebets zerstreue. Da er den Eindruck habe, dass Frauen die Sprache von ihresgleichen am besten verstehen, wären meine Worte – bei der Liebe, die sie für mich hegten – ihnen wohl am dienlichsten. Er sei daher der Meinung, dass es nicht belanglos wäre, wenn es mir gelänge, dazu etwas zu sagen. Mit dem, was ich im Folgenden schreiben werde, wende ich mich also an sie. Und da der Gedanke, es könne für andere Personen von irgendwelcher Bedeutung sein, töricht erscheint, so wird mir unser Herr Gnade genug erweisen, wenn meine Worte einer dieser Nonnen dazu dienen, ihn ein wenig mehr zu loben. Seine Majestät weiß wohl, dass ich nach nichts anderem strebe, und meine Schwestern werden ohne Zweifel erkennen, dass es nicht mein Werk ist, wenn etwas davon treffend ausgedrückt sein sollte, es sei denn, sie hätten so wenig Einsicht, wie ich Talent für dergleichen Dinge besitze, falls der Herr es mir nicht schenkt in seiner Barmherzigkeit.
Die erste Wohnung
erstes kapitel
Wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden – weil ich nichts zu sagen fand und nicht wusste, wie ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe beginnen sollte –, da bot sich mir dar, was ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte: Nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleichwie im Himmel viele Wohnungen sind. Denn wenn wir es recht betrachten, Schwestern, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat. Nun, was meint ihr, wie wohl die Wohnstatt sein mag, in der ein solch mächtiger, weiser und reiner König, der so reich an Gütern jeglicher Art ist, sich ergötzt? Ich finde nichts, mit dem sich die große Schönheit einer Seele, ihre Weite und ihre hohe Befähigung vergleichen ließe. Und wahrlich, unsere Einsicht und unser Verstand – so scharfsinnig sie sein mögen – reichen schwerlich aus, sie zu begreifen, genauso wenig wie sie Gott sich auszudenken vermögen; denn er selbst sagt, dass er uns schuf nach seinem Bilde. Ist dies wirklich so – und es ist so –, dann brauchen wir uns nicht abzumühen in dem Verlangen, die Schönheit dieser Burg zu erfassen. Obgleich zwischen ihr und Gott der Unterschied besteht, der den Schöpfer trennt vom Geschöpf – da sie ja etwas Erschaffenes ist –, so genügt doch das Wort Seiner Majestät, dass sie nach seinem Bilde geschaffen ist, um die große Würde und Schönheit der Seele uns als kaum fassbar erscheinen zu lassen.
Nicht wenig Elend und Verwirrung kommen daher, dass wir durch eigene Schuld uns selber nicht verstehen und nicht wissen, wer wir sind. Erschiene es nicht als eine schreckliche Unwissenheit, meine Töchter, wenn jemand keine Antwort wüsste auf die Frage, wer er ist, wer seine Eltern sind und aus welchem Lande er stammt? Wäre dies ein Zeichen viehischen Unverstands, so herrschte in uns ein noch unvergleichlich schlimmerer Stumpfsinn, wenn wir uns nicht darum kümmerten zu erfahren, was wir sind, sondern uns mit diesen Leibern zufriedengäben und folglich nur so obenhin, vom Hörensagen, weil der Glaube es uns lehrt, davon wüssten, dass wir eine Seele haben. Aber welche Güter diese Seele in sich bergen mag, wer in ihr wohnt und welch großen Wert sie hat, das bedenken wir selten, und darum ist man so wenig darauf bedacht, ihre Schönheit mit aller Sorgfalt zu bewahren. All unsere Achtsamkeit gilt der rohen Einfassung, der Ringmauer dieser Burg, das heißt: den Körpern.
Denken wir uns also, dass diese Burg – wie ich schon gesagt habe – viele Wohnungen hat, von denen einige oben gelegen sind, andere unten und wieder andere seitwärts, und dass sie ganz innen, in der Mitte all dieser Wohnungen, die allerwichtigste birgt: Jene, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. Es ist nötig, dass ihr auf dieses Gleichnis achtet. So Gott will, kann ich euch damit etwas von den Gnaden verständlich machen, die Gott nach seinem Belieben den Seelen verleiht, und von den Unterschieden, die zwischen ihnen bestehen (soweit dies nach meinem Verständnis möglich ist; denn alle zu verstehen vermag niemand, so mannigfaltig sind sie; und schon gar nicht jemand, der so armselig ist wie ich). Denn wenn der Herr euch solche Gnaden erweisen sollte, wird es für euch ein großer Trost sein zu wissen, dass dies möglich ist; und für die, denen dies nicht widerfährt, wird es ein Grund sein, seine große Güte zu loben. Es schadet uns ja nicht, darüber nachzusinnen, was im Himmel ist und was die Seligen genießen, vielmehr freut es uns und spornt uns an, dasselbe zu erlangen, was sie genießen – und genauso wenig wird es uns schaden, wenn wir sehen, dass schon hier in der Verbannung dieser Welt ein solch großer Gott sich mit Würmern abgeben kann, die voll üblen Geruches sind, und dass eine so vollkommene Güte, ein solch unermessliches Erbarmen uns liebt.
Wem die Erkenntnis der Möglichkeit, dass Gott diese Gnade hier in der Verbannung uns erweist, schaden sollte, dem müsste es – davon bin ich fest überzeugt – sehr an Demut und Nächstenliebe fehlen. Denn wie sollten wir uns sonst nicht darüber freuen, dass Gott diese Gnaden einem unserer Brüder erweist (was ihn ja nicht hindert, sie auch uns zu erzeigen) und dass Seine Majestät ihre Größe offenbart, an wem sie nun will? Manchmal wird der Herr es ja allein zu dem einen Zwecke tun, seine Größe sichtbar zu machen (wie er es sagte, als er dem Blinden das Augenlicht schenkte und die Apostel ihn fragten, ob dieser wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern erblindet sei). Er tut es also nicht, weil diejenigen, denen er solche Gnaden erweist, heiliger wären als die anderen, denen er sie nicht erweist, sondern darum, dass man seine Größe erkenne (wie wir es am heiligen Paulus und an der Magdalena sehen) und dass wir ihn preisen in seinen Geschöpfen.
Man könnte nun sagen, diese Dinge erschienen unmöglich, und es sei gut, den Schwachen kein Ärgernis zu geben. Doch es ist weniger verloren, wenn diese Zaghaften nicht glauben, als wenn diejenigen um den Gewinn gebracht werden, denen Gott solche Gnaden erweist und die sich darüber freuen und dadurch ermuntert werden, ihn mehr zu lieben, der so viel Barmherzigkeit erzeigt, obgleich seine Macht und Herrlichkeit so groß sind. Das sage ich mit umso größerer Gewissheit, als ich weiß, dass bei denen, mit welchen ich rede, diese Gefahr nicht besteht; denn sie wissen und glauben, dass Gott noch größere Zeichen der Liebe vollbringt. Auch weiß ich, dass niemand, der hieran nicht glaubt, es aus eigenem Erleben erfährt; denn Gott liebt es sehr, dass man seinen Werken keine Schranke setzt. Und darum, Schwestern, möget ihr, die der Herr nicht auf diesem Wege führt, nie in solchen Unglauben verfallen.
Doch kehren wir zu unserer schönen, beglückenden Burg zurück, und schauen wir, wie wir hineingelangen können. Es scheint, als sagte ich einen Unsinn; denn wenn diese Burg die Seele ist, so ist doch klar, dass man nicht hineingehen muss, da man ja selbst die Burg ist. Genauso närrisch erschiene es, wenn man jemandem sagte, er möge in ein Zimmer gehen, in dem er sich bereits befindet. Doch ihr müsst verstehen, dass zwischen Darinnensein und Darinnensein ein großer Unterschied besteht. Es gibt viele Seelen, die sich im Wehrgang der Burg aufhalten – also dort, wo die Wachen stehen – und denen nichts daran gelegen ist, ihre inneren Anlagen zu betreten. Sie wissen nicht, was an diesem wundervollen Ort zu finden ist, noch wer darin weilt, ja nicht einmal, was für Gemächer die Burg umschließt. In manchen Andachtsbüchern habt ihr gewiss schon den Rat vernommen, die Seele möge in sich gehen. Damit ist genau dasselbe gemeint.
Ein großer Gelehrter sagte mir unlängst, die Seelen ohne Gebet glichen einem gelähmten, bewegungsunfähigen Körper, der zwar Hände und Füße besitze, ihnen aber nicht gebieten könne. Und wahrlich, so ist es. Es gibt Seelen, die so krank sind, die sich so daran gewöhnt haben, in äußeren Dingen befangen zu sein, dass es völlig undenkbar erscheint, sie könnten jemals in sich gehen. Denn es ist ihnen schon so zur Gewohnheit geworden, ständig mit dem Gewürm und Viehzeug umzugehen, das rings um die Burg sich regt, dass sie schon fast ebenso tierisch geworden sind, obwohl sie von Natur aus so reich begabt und fähig sind, mit keinem Geringeren als Gott selber zu reden. Bemühen sich diese Seelen nicht, ihr Elend zu begreifen und ihm abzuhelfen, so müssen sie zur Salzsäule erstarren, weil sie den Blick nicht zurück auf sich selber richten (wie es – umgekehrt – dem Weibe des Lot geschah, weil es zurückschaute).
Nach meiner Erfahrung sind das Gebet und die Andacht das Tor, durch das man die Burg betreten kann. Damit meine ich das mündliche Gebet nicht minder als das Gebet im Geiste; denn um Gebet zu sein, bedarf beides der Ehrfurcht und Andacht. Ein Gebet, bei dem man nicht darauf achtet, mit wem man redet und was man erbittet, wer der Bittsteller ist und wer der Angeflehte, das nenne ich kein Gebet, mag man dabei auch noch so viel die Lippen bewegen. Wird manchmal, auch wenn man nicht mit dieser Aufmerksamkeit dabei ist, dennoch ein Gebet daraus, so nur deshalb, weil man bei anderen Gelegenheiten die nötige Andacht aufgebracht hat. Doch wenn jemand gewohnt ist, mit der Majestät Gottes so zu reden, als spreche er mit seinem Sklaven, ohne darauf zu schauen, ob er unrecht rede, sondern einfach so daherschwatzt, was ihm in den Mund kommt und was er von früher auswendig weiß, so halte ich das für kein Gebet, und Gott verhüte, dass irgendein Christ es dafür halte. Ich hoffe auf Seine Majestät, Schwestern, dass dies unter euch nicht geschehe; denn ihr seid es ja gewohnt, euch mit innerlichen Dingen zu befassen. Das ist ein recht gutes Mittel, um nicht in solchen Schwachsinn zu verfallen.
Doch wir wollen nicht mit diesen lahmen Seelen reden, die sich in argem Elend und großer Gefahr befinden, wenn nicht der Herr selber kommt und ihnen (wie jenem Manne, der dreißig Jahre neben dem Teich gelegen war) gebietet, sich zu erheben, sondern wollen zu den anderen Seelen sprechen, die schließlich in die Burg eingehen. Obwohl sie tief in der Welt stecken, haben sie doch ein gutes Verlangen, und zuweilen – wenn auch selten – empfehlen sie sich dem Schutze unseres Herrn und denken darüber nach, wer sie sind, sei es auch nicht sehr gründlich. Auch beten sie jeden Monat irgendwann einmal, von tausend Geschäften erfüllt, mit denen ihre Gedanken fast immer umgehen. Sie sind so daran gefesselt – denn »wo ihr Schatz ist, dahin geht ihr Herz« –, dass sie sich zuweilen vornehmen, sich davon frei zu machen. Von großer Bedeutung ist es da, wenn sie sich selbst erkennen und sehen, dass sie nicht auf dem rechten Wege sind, der zur Burgpforte hineinführt. Endlich treten sie in die ersten der unteren Gemächer ein; doch mit ihnen dringt so viel Gewürm ein, dass sie weder die Schönheit der Burg zu sehen vermögen noch zur Ruhe kommen können. Schwer genug ist es ihnen gefallen, überhaupt hereinzukommen.
Diese Schilderung wird euch unangebracht erscheinen, meine Töchter, da ihr durch Gottes Güte nicht zu diesen Menschen gehört. Ihr müsst Geduld haben, denn ich weiß nicht, in welcher Weise ich euch sonst verständlich machen könnte, wie ich gewisse innere Dinge des Gebets verstehe. Der Herr gebe, dass es mir gelingt, etwas zu sagen. Was ich euch gern erklären würde, ist nämlich recht schwierig zu verstehen, wenn man es nicht selbst erfahren hat. Habt ihr es erlebt, so werdet ihr erkennen, dass es unumgänglich ist, an das zu rühren, wovon wir – so der Herr will – verschont bleiben mögen, um seiner Barmherzigkeit willen.
zweites kapitel
Bevor ich fortfahre, möchte ich euch bitten, euch auszudenken, welchen Anblick diese schöne und strahlende Burg bieten mag, diese orientalische Perle, dieser Baum des Lebens, der inmitten der lebendigen Wasser des Lebens, also in Gott, gepflanzt ist, wenn die Seele in eine Todsünde fällt. Es gibt keine unheimlichere Finsternis, und es gibt nichts, was so dunkel, so schwarz wäre, dass sie daneben nicht noch viel finsterer erschiene. Begehrt nicht mehr zu wissen, als dass es so ist, als wäre die Sonne, die ihr so viel Glanz und Schönheit verlieh, die Sonne, die doch noch immer in der Mitte der Seele ist, nicht mehr vorhanden; als könne die Seele nicht mehr teilhaben an ihm, sie, die doch genauso dazu befähigt ist, sich Seiner Majestät zu erfreuen, wie der Kristall die Sonne in sich aufleuchten zu lassen vermag. Da hilft ihr nichts, und deshalb bleiben alle guten Werke, die sie vollbringt, solange sie in Todsünde lebt, unfruchtbar und dienen nicht dazu, dass sie die Seligkeit erlangt. Weil diese Taten nicht aus dem Urgrund stammen, welcher Gott ist, der unsere Tugend zur Tugend macht, sondern in der Trennung von ihm entstanden sind, können sie seinen Augen nicht gefällig sein. Wer eine Todsünde begeht, hat ja auch nicht die Absicht, ihn zu erfreuen, sondern dem Satan ein Vergnügen zu machen. Da dieser die Finsternis selber ist, so ist auch die arme Seele zur gleichen Finsternis geworden.
Ich weiß von einer Person, der unser Herr zeigen wollte, was aus einer Seele wird, die sich tödlich versündigt. Diese Person behauptet, ihrer Meinung nach könne einer, der dies wirklich begriffen hat, überhaupt nicht mehr sündigen. Lieber würde er alle erdenklichen Leiden auf sich nehmen, um so den Gelegenheiten zur Sünde zu entrinnen. Der Herr flößte dieser Seele zugleich den brennenden Wunsch ein, alle Menschen möchten dies begreifen. Und so möge er auch euch, Töchter, das Verlangen eingeben, viel zu Gott zu beten für jene, die in diesem Zustand leben und gleich ihren Werken zu völliger Finsternis geworden sind.
Wie die Bächlein, die einer sehr klaren Quelle entspringen, rein und lauter sind, so ist es auch die Seele, die in der Gnade lebt. Dass ihre Werke den Augen Gottes und der Menschen wohlgefällig sind, hat seine Ursache nur darin, dass sie jener Quelle des Lebens entspringen, in welcher die Seele wurzelt, eingepflanzt wie ein Baum, der nicht die Frische und Fruchtbarkeit besäße, wenn sie ihm nicht von dorther zuflössen. Dies erhält ihn und macht, dass er nicht verdorrt und gute Frucht bringt. Entfernt sich eine Seele aus eigener Schuld von dieser Quelle und senkt sich in eine andere mit pechschwarzem Wasser von widerlichem Geruche ein, so ist auch alles, was aus ihr hervorgeht, nichts als Schmutz und Unheil.
Hier ist zu bedenken, dass die Quelle, dass jene strahlende Sonne, die sich in der Mitte der Seele befindet, ihren Glanz und ihre Schönheit nicht verliert. Sie bleibt beständig darin, und nichts kann sie ihrer Schönheit berauben. Breitet man aber über einen Kristall, der in der Sonne liegt, ein tiefschwarzes Tuch, so wird freilich, auch wenn die Sonne auf ihn scheint, ihr Leuchten in dem Kristall keine Wirkung hervorbringen.
O Seelen, die ihr losgekauft seid mit dem Blute Jesu Christi! Erkennet euch und habt Erbarmen mit euch selbst! Wie ist es möglich, dass ihr dies versteht und euch nicht bemüht, dieses Pech von dem Kristall zu entfernen? Nie wieder werdet ihr euch an diesem Licht erfreuen, wenn so euer Leben endet. O Jesus, welchen Anblick bietet eine Seele, die von ihm geschieden ist! In welch erbärmlichen Zustand geraten die Gemächer der Burg! Wie verwirrt irren die Sinne umher, die darin wohnen! Und die Seelenkräfte, die zu Burgvögten, Verwaltern und Mundschenken bestellt sind – mit welcher Blindheit treiben sie ihr schlimmes Regiment! Welche Frucht kann auch ein Baum bringen, der in einen Grund gepflanzt wurde, welcher des Teufels ist?
Ich hörte einmal einen geistlichen Mann sagen, dass es ihn nicht vor dem schaudere, was einer, der in Todsünde lebt, tue, sondern vor dem, was er nicht tue. Gott bewahre uns durch sein Erbarmen vor einem solch schrecklichen Übel. Nichts in diesem Leben verdient es, ein Übel geheißen zu werden, außer diesem Unheil; denn es zieht ewige Übel nach sich, die kein Ende haben. Das ist es, Töchter, was wir auf unserem Wege zu fürchten haben. Wir müssen Gott in unseren Gebeten anflehen, dass er uns davor behüte; denn wenn er nicht die Stadt bewacht, so ist unser Tun umsonst, da wir die Vergeblichkeit selber sind. Jener Mann sagte mir, er verdanke der Gnade, die Gott ihm erwiesen habe, zweierlei. Erstens: eine ungeheure Furcht, ihn zu beleidigen; und deshalb flehe er, weil er ein solch entsetzliches Unheil vor Augen habe, den Herrn ständig darum an, ihn nicht fallen zu lassen. Und zweitens: einen Spiegel für die Demut; denn er sehe jetzt, dass eine Wohltat, die wir vollbringen, ihren Ursprung nicht in uns selber hat, sondern in der Quelle, in welche der Baum unserer Seele gepflanzt ist; in der Sonne, die unseren Werken ihre Wärme spendet. Er sagt, dies sei ihm so klar geworden, dass er stets, wenn er irgendetwas Gutes tue oder bei einem anderen gewahre, nach der Herkunft des Guten suche und dann erkenne, wie wir ohne diese Hilfe nichts vermöchten. Dies bewog ihn, Gott zu loben, sodass er meist gar nicht daran dachte, was er selber vielleicht Gutes getan hatte.
Die Zeit, Schwestern, die ihr mit dem Lesen dieser Worte zubringt und die ich aufwende, um sie zu schreiben, wäre nicht verloren, wenn sie uns diese zwei Dinge einbrächte. Den Weisen und Gelehrten sind sie wohl vertraut; doch unser weibliches Ungeschick bedarf dringend aller erdenklichen Hilfe. Darum will der Herr vielleicht, dass uns derartige Vergleiche zur Kenntnis gelangen. Möge es seiner Güte gefallen, uns dazu seine Gnade zu schenken.
Diese inneren Dinge sind so dunkel und schwierig zu verstehen, dass jemand, der so wenig weiß wie ich, zwangsläufig viele überflüssige und sogar unsinnige Dinge sagt, um das eine oder andere treffend auszudrücken. Wer es liest, bedarf derselben Geduld, die ich aufbringe, um etwas zu schreiben, was ich nicht weiß; denn manchmal greife ich nach dem Papier, als wäre ich ein Ding ohne Verstand, und weiß nicht, was sagen und wie anfangen. Dabei verstehe ich wohl, wie wichtig es für euch ist, dass ich euch, so gut ich kann, einige innere Erfahrungen erkläre. Wir hören immer, wie gut das Gebet sei; und unsere Regel schreibt uns vor, ihm bestimmte Stunden zu widmen. Doch man erklärt uns nichts, was wir uns nicht selbst erklären können. Und von dem, was der Herr in einer Seele bewirkt – dem Übernatürlichen, das in ihr geschieht –, wird uns wenig gesagt. Würde dies in vielfältiger Weise uns dargelegt und erläutert, so schenkte man uns damit den großen Trost, dieses himmlische Kunstwerk in unserem Inneren betrachten zu können, das von den Sterblichen so wenig verstanden wird, obgleich so viele darin umhergehen. In anderen Schriften, die ich verfasst habe, hat der Herr zwar einiges verständlich gemacht, doch ich erkenne, dass ich damals Verschiedenes – vor allem von den schwierigsten Dingen – nicht so gut verstanden habe wie später. Mühsam ist nun bloß, dass ich, ehe wir zu diesen gelangen, wohl viele sattsam bekannte Dinge sagen werde, da es meinem unbeholfenen Geist nicht anders möglich ist.
Kehren wir nun also wieder zu unserer Burg mit jenen vielen Wohnungen zurück. Ihr dürft euch nicht vorstellen, dass diese Wohnungen wie aufgereiht eine hinter der anderen liegen. Richtet vielmehr eure Augen auf die Mitte, die das Gemach und der Palast ist, wo der König weilt, und stellt die Burg euch vor wie eine Zwergpalme, bei der viele Hüllen das köstliche Herzblatt umschließen. So liegen dort rings um diesen Raum viele andere Gemächer, und ebenso darüber. Denn die Dinge der Seele muss man sich immer in Fülle und Weite und Größe denken. Damit erhöht man sie keineswegs, sie, die viel mehr vermag, als wir uns vorstellen können, und die überall durchdrungen ist von der Sonne, die in diesem Palaste strahlt.
Sehr wichtig für jede Seele, die sich – viel oder wenig – dem Gebet widmet, ist es, dass man sie nicht in einen Winkel pfercht oder einengt. Man lasse sie durch all diese Wohnungen wandeln, aufwärts und abwärts und nach den Seiten hin; denn Gott hat ihr eine so große Würde verliehen. Auch dränge man sie nicht dazu, lange Zeit in einem einzigen Gemach zu bleiben, nicht einmal in dem der Selbsterkenntnis, so wichtig diese – wohlgemerkt – selbst für diejenigen ist, die der Herr in die gleiche Wohnung eingelassen hat, in welcher er selber weilt; denn so hoch die Seele auch stehen mag – nie wird etwas anderes die Selbsterkenntnis ersetzen können, ob man dies will oder nicht. Die Demut wirkt nämlich wie die Biene, die im Stock den Honig bereitet. Ohne sie geht alles verloren. Bedenkt aber, dass die Biene es nicht versäumt, hinauszufliegen, um den Nektar der Blüten zu sammeln. Genauso muss es die Seele mit der Selbsterkenntnis halten. Glaubt es mir und fliegt zuweilen aus, um die Größe und Majestät eures Gottes zu betrachten. Da wird die Seele ihre Niedrigkeit eher entdecken als in sich selber, und sie wird weniger belästigt sein von dem Gewürm, das in die ersten Gemächer – eben die Selbsterkenntnis – mit eindringt. Obwohl es, wie gesagt, ein großes Erbarmen Gottes bedeutet, wenn man sich darin übt, so kommt es doch auf das rechte Maß an. »Nicht zu viel und nicht zu wenig« – wie man zu sagen pflegt. Und man glaube mir, dass wir mit der Kraft Gottes eine sehr viel höhere Tugend erwirken, als wenn wir zäh an unserer Erde kleben.
Ich weiß nicht, ob ich es recht verständlich gemacht habe; denn es ist eine so wichtige Sache, dieses Erkennen unseres eigenen Ichs, dass ich wünschte, ihr möchtet niemals darin ermatten, so hoch ihr auch in den Himmeln emporgestiegen sein möget. Solange wir uns auf dieser Erde befinden, gibt es nichts, was für uns wichtiger wäre als die Demut. Und darum sage ich nochmals, dass es sehr gut und ganz vortrefflich ist, wenn man danach strebt, zuerst in jenes Gemach zu gelangen, wo es um diese Tugend geht, ehe man zu den anderen fliegt. Denn dies ist der Weg. Und wozu sollten wir, solange wir auf sicherem und ebenem Gelände gehen können, uns Flügel zum Fliegen wünschen, anstatt zu sehen, wie wir auf diesem Wege weiterkommen?