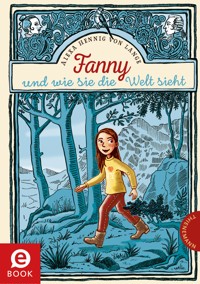9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der ganz normale Familienwahnsinn – hier kommt Lelle! Lelle ist fünfzehn und pubertiert. Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Cotsch brilliert sie in der Schule nicht, dafür ist sie aber das Lieblingskind ihrer hypochondrischen Mutter und des cholerischen Vaters. Als Cotsch eines Abends verschwindet, macht sich Lelle auf, sie wieder zu finden. Dabei hilft ihr der Nachbarssohn Arthur, den der Vater irrtümlicherweise für einen Stricher hält. Kein Wunder, dass Lelle ihre Familie einfach nur peinlich findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alexa Hennig von Lange
Ich habe einfach Glück
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Der ganz normale Familienwahnsinn – hier kommt Lelle!
Lelle ist fünfzehn und pubertiert. Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Cotsch brilliert sie in der Schule nicht, dafür ist sie aber das Lieblingskind ihrer hypochondrischen Mutter und des cholerischen Vaters. Als Cotsch eines Abends verschwindet, macht sich Lelle auf, sie wieder zu finden. Dabei hilft ihr der Nachbarssohn Arthur, den der Vater irrtümlicherweise für einen Stricher hält. Kein Wunder, dass Lelle ihre Familie einfach nur peinlich findet.
Über Alexa Hennig von Lange
Alexa Hennig von Lange, geboren 1973 in Hannover, hatte ihren ersten Romanerfolg 1997 mit »Relax«. Des weiteren schrieb sie die Theaterstücke »Flashback« (Volksbühne Berlin), »Faster Pussycat! Kill! Kill!« (Junges Theater Göttingen) und »Erinnerungen« (Autorentage Hannover) sowie die Romane »Ich bin’s« und »Woher ich komme«. 2002 erschien die Erzählung »Lelle«.
Inhaltsübersicht
Für Barbara und Andreas, in Freundschaft, Dankbarkeit und Liebe
And it was morning.
And I found myself mourning.
For a childhood that I thought had disappeared.
I looked out the window,
And I saw a magpie in the rainbow, the rain had gone
I’m not alone, I turned to the mirrow,
I saw you, the child, that once loved.
The child before they broke his heart,
Our heart, the heart that I believed was lost.
So I see it’s me, I can do anything
And I’m still the child,
’Cos the only thing misplaced was direction
And I found direction.
There is no Childhood’s End.
You are my childhood friend.
Marillion
1
In der Schule bin ich immer fröhlich. Alle denken, Lelle hat ein sonniges Gemüt. Wenn ich ins Klassenzimmer komme, sagen die Leute aus meiner Klasse: »Die Sonne geht auf!« In den kleinen Pausen mache ich Witze. Ich lache über meine Witze, bis ich vor Lachen heulen muss. Ich rutsche vor Lachen von meinem Stuhl, kugle mich unter meinem Tisch vor Lachen. Und alle lachen mit. Ich bin zu jedem freundlich. Ich mache Witze und alle lachen. Ich am meisten.
Nach der Schule fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Die schattige Allee mit den rosa blühenden Bäumen entlang. Den kleinen Berg hinunter. Den Fluss entlang. An den Wiesen vorbei. Über die Brücke, durch den kühlen Wald. Die Sonne scheint durch das grüne Laub. Auf dem Weg liegen leere, staubige Schneckenhäuser. Die Amseln zwitschern. Es ist Sommer. Und ich fühle mich so schrecklich allein. »Ich bin allein!« denke ich.
An diesem Sonntag ist es besonders schlimm. Schon am Morgen, als ich aufwache, und die Kirchturmglocken läuten, denke ich: »Ich bin allein!« Beim Mittagessen auf der Terrasse denke ich immer noch: »Ich bin allein!«
Am Nachmittag gehe ich in den Keller und hole mir ein bisschen von Mamas Ton. Der gammelt in dem grauen Plastikeimer neben Mamas Drehscheibe vor sich hin. Wenn Mama Zeit hat, töpfert sie Vasen. Solche mit runden Bäuchen und langen, dünnen Hälsen. Die verkauft sie dann beim Weihnachtsbasar in der Grundschule gegenüber. Da verkaufen alle Frauen aus der Siedlung ihre selbstgemachten Werke. Schamlos bauen sie ihre jämmerlichen Aquarelle, Zeichnungen, Räuchermännchen und Gestecke auf den kleinen Grundschultischen auf. Von der Decke hängt ein riesiger Adventskranz mit dicken roten Kerzen. Letztes Jahr ist das Monstrum plötzlich runtergekommen und der schmächtigen Frau Seidlitz auf den Kopf gesaust. Das gab ein Durcheinander! Jeder ist hingelaufen und wollte sehen, ob Frau Seidlitz in der Mitte durchgebrochen ist. War sie nicht. Die lag am Boden unter den Zweigen und hat gejammert: »Meine Lose, meine Lose!« Frau Seidlitz ist nämlich jedes Jahr für die Tombola zuständig, bei der es allerhand Haushaltsgeräte zu gewinnen gibt. Einmal gab es sogar eine Waschmaschine zu gewinnen. Die wollte aber keiner haben, weil den Leuten das Fabrikat nicht gut genug war. Mama hätte sie gerne gehabt. Aber Papa hat gesagt: »Kommt nicht in die Tüte! Sonst sieht das so aus, als könnten wir uns keine anständige Maschine leisten!« Darum ist die Waschmaschine nach Kalakamati in Simbabwe gegangen. Das ist unsere afrikanische Partnergemeinde. Ich frage mich, was die Menschen da mit einer Waschmaschine sollen. Haben die überhaupt eine Steckdose in der Wüste?
Auf dem Weihnachtsbasar essen alle Nachbarn Stollen, betrinken sich mit Glühwein aus Plastikbechern, und Mama verkauft ihre bunt glasierten Vasen. Das eingenommene Geld sortiert sie ganz schnell in ihre kleine rote Geldkassette, die sie in ihrer Stofftasche versteckt. Mama ist richtig gut gelaunt, wenn sie mal ein paar Pfennige dazu verdienen kann, weil Papa so mit dem Haushaltsgeld rumknausert. Da hat Mama aber Glück, die Leute mögen ihre Vasen. Ein paar Wochen vor Weihnachten gerät Mama deshalb immer unter Druck, weil sie befürchtet, dass sie nicht genügend Vasen fertig kriegt. Je mehr Vasen sie produziert, desto mehr Geld wird reinkommen. Ist ja klar! Neben dem Telefon im Wohnzimmer liegt sogar eine Liste für Vorbestellungen. Das ganze Jahr über rufen Leute an und wollen Mamas Vasen vorbestellen. Einmal haben meine Schwester Cotsch und ich noch ein paar Namen mehr dazu geschrieben. Mama hatte richtig was zu tun. Die ist gar nicht mehr aus dem Keller gekommen, und Cotsch und ich konnten ungestört auf dem braunen Wohnzimmerteppich liegen und fernsehen. Das war super. Aber in letzter Zeit ist Mama nicht mehr zum Vasentöpfern gekommen, weil es Cotsch nicht so gut ging. Vor ein paar Wochen hat Cotsch ihre neue Geige gegen den Türrahmen gehauen. »Scheiß Geige!« Es gab Probleme beim Geigeüben.
Nach dem Vorfall hat Mama nach einer Gesprächstherapie für Cotsch gesucht. »So geht das nicht weiter. Cotsch muss ihre Aggressionen besser unter Kontrolle kriegen!« Sie ist in der Nachbarschaft rumgelaufen und hat ihre Weihnachtsbasar-Freundinnen gefragt, wo ihre Töchter zur Therapie hingehen. Und so ist Mama auf Frau Thomas gestoßen. Da fährt meine Schwester jetzt einmal in der Woche mit der U-Bahn hin. Genau wie Corinna Melms, die Tochter von Frau Melms. Meine Schwester ist überhaupt nicht begeistert von dem Gedanken, dass sie ihre Therapeutin mit Corinna teilen muss. »Corinna ist so eine dumme Sau! Die ist so dumm! Die ist überhaupt nicht krank! Die ist nur dumm!« Aber Mama sagt: »Frau Thomas ist die Beste.« Und: »Jeder muss sich den Therapeuten mit anderen Leuten teilen!« – Na ja. –
Auf alle Fälle stehe ich an diesem verregneten Sonntagnachmittag in meinem Zimmer am Fenster und töpfere mir aus Mamas Ton einen Penis. Der Penis wird ziemlich dick, weil ich viel Ton mit hochgenommen habe. »Wenn schon, dann richtig!« denke ich. Draußen prasseln die Regentropfen auf die Blätter der Rosenbüsche, die Papa vor dem Mittagessen gegossen hat. Da hat es noch nicht geregnet. Ich habe vorsorglich die Zimmertür abgeschlossen. Und erst nach einer Stunde klopft Mama an die Tür.
»Lelle, was machst du da drinnen?«
»Nichts Besonderes!«
»Mach die Tür auf!«
»Nee, jetzt nicht!«
»Bitte mach die Tür auf!«
»Warum denn?«
»Ich will mit dir reden!«
»Ich kann jetzt nicht!«
»Was machst du denn da drinnen?«
»Nichts!«
»Lelle, mach bitte die Tür auf!«
Und schon hat es Mama geschafft, dass ich meine Töpferarbeit unterbrechen muss, um meinen Kopf gegen die Zimmertür zu schlagen. Das mache ich manchmal, wenn ich überfordert bin. Mama haut von außen mit der flachen Hand gegen das gelb lackierte Holz und drückt hektisch die grüne Plastikklinke rauf und runter.
»Lelle, was ist denn mit dir?«
»Lass mich endlich in Ruhe!«
»Lelle, mein Schatz, hör auf damit!«
»Dann lass mich endlich in Ruhe!«
»Ich kann dich aber nicht in Ruhe lassen! Ich mache mir Sorgen!«
»Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, bringe ich mich um!«
Mama lässt die Klinke los und geht. Ich bin verwundert. So etwas. Das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte mich eher darauf eingestellt, dass das Theater noch eine halbe Stunde weitergeht, bis meine Schwester aus ihrem Zimmer kommt und schreit:
»Hier geht es immer nur um Lelle! Wenn ich sage, dass ich mich umbringe, interessiert das keine Sau!«
Ich bin echt erleichtert. Ich stehe wieder von meinem flauschigen Kinderzimmerteppich auf und stelle mich zurück ans Fenster. Ich will, dass mein getöpferter Penis fertig wird. Ich habe nämlich einen Entschluss gefasst: Ich will mich selbst entjungfern. So eine Entjungferung tut bestimmt weh, und da ist es besser, man hat das erledigt, bevor man sich mit einem Jungen ins Bett legt, der einen auch noch lieben soll. Das ist definitiv zu viel auf einmal. Worauf soll man sich in so einem Moment denn noch alles konzentrieren?! Auf den Schmerz, und dass man sich nicht vor Schreck verkrampft? Oder auf die Liebe? Oder, dass der Junge das Loch findet, in das er seinen Penis stecken darf? Ich frage mich sowieso, wie das organisatorisch geregelt ist. Darum bin ich richtig stolz auf meinen Einfall. Mein dicker Penis muss nur noch ein bisschen glatt gestrichen werden. Dann ist er fertig. Als ich gerade mit dem Feinschliff beschäftigt bin, glotzt Mama plötzlich mit triefnassen Haaren und regendurchtränkter Bluse von der anderen Seite der Fensterscheibe direkt auf mich, meine Hände und den riesigen Penis.
»Geht es dir gut, mein Schatz?«
Mir bleibt das Herz stehen. Mama hat ihre Hände ums Gesicht gelegt, damit sie mich besser hinter der Scheibe sehen kann. Kann Mama mich nicht einmal in Ruhe lassen? Der feuchte Tonpenis flutscht durch meine Finger und landet auf dem Teppich. Wenigstens kann Mama ihn so nicht mehr sehen. »Ja!« kreische ich und lasse mich neben meinen fusseligen Penis auf den Boden fallen, während Mama über mir an die Scheibe hämmert.
»Lelle, bist du ohnmächtig?«
Ich werde sehr oft ohnmächtig. Erst neulich habe ich beim Packenspielen auf dem Schulhof die Besinnung verloren. Beim schnellen Weglaufen im Matsch bin ich ausgerutscht und habe mir meine Schulter an dieser albernen Kinderwippe gestoßen. Zuerst habe ich mich ganz schnell wieder hochgerappelt und so getan, als ob nichts passiert ist. Ich bin taumelig ein bisschen im Kreis marschiert. Dabei habe ich gegrinst und geschielt und zu mir gesagt: »Wehe, du kippst um!« Und schon bin ich in die weichen Arme von der dicken Bettina gesunken. Ich bin auf sie zugewankt und habe gehaucht: »Halt mich!« Und klapp, war ich auch schon weg. Bettina hat mich aufgefangen und nach Kaninchen gerochen. Bettina hat einen großen Kaninchenstall mit vier Kaninchen in ihrem Zimmer stehen. Mit der Kraft einer sorgenden Kaninchenmutter und unter dem Geleitschutz der gesamten Klasse hat sie mich zwei Treppen hoch ins Sekretariat geschleppt. Und die braun geschminkte Sekretärin kam sich nicht zu blöd vor, mich vor versammelter Mannschaft zu fragen: »Hast du deine Tage?« Mir ist der Schweiß den Rücken runtergelaufen. Aber ich war zu schwach, um angemessen zu reagieren. Ich habe nur den Kopf geschüttelt. Mehr ging nicht. Ich war einfach zu geschockt, vor allen Dingen, weil ich noch gar nicht meine Tage habe. Und darauf bin ich stolz. Das ist doch ein echter Grund zur Freude. Da könnte ich gleich noch eine Geschichte erzählen. Mach ich aber nicht. Vielleicht später, falls ich es nicht wieder vergessen sollte. Es hat auf jeden Fall etwas mit Schüleraustausch in England zu tun und mit einem Päckchen Damenbinden, das im Wohnzimmer vor den Augen der Gastfamilie ungeplanterweise aus der Tasche fällt. Die Binden hatte mir Mama vorsorglich mitgegeben.
»Falls du deine Regel das erste Mal in England kriegst!«
»Ich kotze!«
»Nimm sie trotzdem mit!«
»Danke!«
Meinen Tonpenis verstecke ich zum Trocknen im Kleiderschrank unter den Unterhosen. Den Rest von meinem Zimmer durchsucht Mama ständig, weil sie einmal in meiner Schublade einen vollen Teller Kartoffelsuppe entdeckt hat. Seitdem glaubt sie, dass ich ständig Nahrung in meinem Zimmer verstecke, anstatt sie zu essen. Aber so dumm bin ich nicht. Ich schütte den Scheiß lieber gleich ins Klo. Aber dann spaziert Mama plötzlich mit einem Stapel frisch gewaschener Wäsche in mein Zimmer, reißt die Kleiderschranktür auf und fingert in meinen dreckigen Unterhosen herum, die ich dort lagere. Mama kapiert nicht, dass das ab einem bestimmten Alter nicht mehr gemacht wird. Darum gehe ich mit dem großen Brotmesser auf sie los. Irgendwie muss man sich ja zur Wehr setzen! Schließlich will ich nicht, dass sie meine kleine Tonskulptur entdeckt. Mir ist klar, dass ich niemals zustechen würde, aber Mama findet »den Akt an sich schon so schrecklich!«
»Du sollst nicht immer in meinem Kleiderschrank rumwühlen!«
»Mache ich doch gar nicht!«
»Machst du wohl!«
»Ich nehme doch nur die dreckigen Unterhosen raus!«
»Siehst du?! Du wühlst in meinem Kleiderschrank rum!«
Papa putzt unterdessen im Keller seine Schuhe und tut so, als ob er von unserem Gezanke nichts mitbekommt. Vielleicht repariert er auch den Sitz von seinem Korbstuhl aus der Kolonialzeit, auf den meine Schwester und ich uns gerne stellen, wenn wir was vom Küchenschrank holen wollen. Mama versteckt nämlich da oben im Staub ihr Portmonee mit dem Haushaltsgeld. Da gehen meine Schwester und ich immer ran, wenn unser Taschengeld alle ist. Aber Mama merkt es gar nicht. Die sagt nur: »Papa ist so ein Geizhals. Der gibt mir viel zu wenig Haushaltsgeld!« Und Papa sagt: »Stellt euch doch verdammt noch mal nicht immer auf den Sitz! Der Stuhl steht in einem Museum für Möbel aus der Kolonialzeit!« Bei allem, was sich bei uns im Haus befindet, behauptet Papa, dass es in einem Museum für Möbel aus der Kolonialzeit steht. Darum ist Papas monopole Sorge, dass irgendwas von dem Kram kaputtgehen könnte. Aber um die Gemütsverfassung von Mama und uns kümmert er sich einen Dreck, als er schließlich aus dem Keller kommt. Er sagt nur zu Mama:
»Mensch, nun lass doch mal die Kinder in Ruhe!«
»Ich lass sie doch in Ruhe!«
»Nein, du lässt sie eben nicht in Ruhe!«
»Was soll ich denn machen, wenn sie sagen, dass sie sich umbringen wollen?!«
»Nichts!«
»Wie: Nichts?«
»Nichts!«
»Ja, aber die werden doch einen Grund haben, warum sie das sagen!«
»Ja, weil du sie nie in Ruhe lässt!«
Papa hat bei uns immer das letzte Wort, weil Mama dann aus der Küche geht und sich oben in ihrem Nähzimmer im ersten Stock, einen Sherry genehmigt. Und dann noch einen. Aber als ich mit dem geschärften Messer vor ihr rumhantiere, wandert sie nicht in ihr Nähzimmer ab, um sich einen zu zwitschern. Stattdessen legt sie sich direkt aufs Kolonialsofa im Wohnzimmer und behauptet, dass sie keine Luft mehr kriegt.
»Ich krieg keine Luft mehr!«
Papa gießt in der Küche den Tee auf und sagt durch den Durchgang:
»Stell dich nicht so an!«
Mama reagiert überhaupt nicht darauf. Sie sagt nur:
»Mein linker Arm ist ganz taub!«
»Blödsinn!«
Papa zwinkert mir zu, wie ich so erbärmlich auf dem kleinen Hocker neben dem Kühlschrank hocke und ein schlechtes Gewissen habe. Dann trocknet er sich die Hände ab und zwinkert weiter rum:
»Mama übertreibt mal wieder!«
In solchen Momenten tut Papa immer so, als ob er mein bester Kumpel ist. Aber Papa ist nicht mein Kumpel. Papa ist für mich ein undurchsichtiger Typ, der irgendwann auf die dumme Idee kommen könnte, lieber mit Cotsch und mir zu kuscheln als mit Mama. Über das Thema habe ich mal einen Bericht in der Mädchen gelesen. Da hat der Vater seine Frau links liegen gelassen, weil er mehr Verlangen nach seinen leibeigenen Töchtern hatte. An denen hat er immer heimlich rumgefuhrwerkt. Na ja. Und seit ich diesen aufschlussreichen Bericht gelesen habe, hege ich so meine Bedenken, dass Papa auch so eine Art von Mensch sein könnte. Darum zieht sich alles in mir zusammen, als ich Papa beim Teemachen zugucke. Ich habe Angst, dass ich mit ihm Konversation betreiben muss. Schließlich ist das ja auch schon eine Form von Intimität. Oder, dass er mir auf den Hintern klappst, wenn ich von meinem Hocker aufstehe. Also bleibe ich sitzen und höre, wie Mama auf dem Sofa liegend behauptet:
»Ich habe einen Herzinfarkt!«
Papa geht mit der Teekanne einfach wieder in den Keller runter und wirft hinter sich die Glastür zu. Ich kriege auf der Stelle einen Schreikrampf und haue meinen Kopf gegen die Seitenwand vom Kühlschrank. Und im Wohnzimmer schleppt sich Mama zum Telefon und ruft den Notarzt.
Als der Notarzt an der Tür klingelt, ist es draußen dunkel. Ich hocke auf meiner frisch gewaschenen, gelb-weiß gestreiften Bettüberdecke und heule heimlich. Ich will nicht Schuld daran sein, wenn Mama wegen mir einen Herzinfarkt bekommt. Ich höre, wie Papa den Notarzt reinlässt und sagt: »Meine Frau liegt im Wohnzimmer. Einfach geradeaus und durch die Glastür!« Dann klopft es an meiner Tür und die Klinke wird runtergedrückt. In diesem Haus wird nie gewartet, bis »Herein!« gerufen wird. Papa steht im hellen Schein des Flurlichtes, und zum Glück habe ich mich noch nicht ausgezogen und unter die Decke gelegt. Papa schließt die Tür hinter sich, macht ein paar Schritte auf mich zu, und das ist mir eindeutig zu intim.
»Mach dir keine Sorgen, Lelle. Mama spinnt!«
»Hm!«
»Du weißt doch, die übertreibt immer!«
»Hm!«
»Die braucht auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Gönnen wir sie ihr doch!«
»Hm!«
Papa platziert sich ungefragt auf meine Bettkante und ich höre sofort auf zu heulen. Das würde mir gerade noch fehlen, dass der seinen gelben Hemdärmel um mich legt. Papa beugt sich über mich und knipst die kleine gelbe Klemmlampe an meinem Kopfende an. Dann sehe ich, was Papa auf seinem Schoß liegen hat.
»Ich wollte dir mal was zeigen!«
»Was denn?«
»Mein Lieblingsbuch!«
»Aha!«
»Das ist ein Fotoband über die Antiapartheidskämpfe in Afrika Mitte der sechziger Jahre!«
»Hmh!«
»Das Buch habe ich mir gekauft, als ich mit dem Studieren angefangen habe!«
»Hm!«
»Du kannst dir das Buch ja mal ansehen, wenn du willst!«
»Ja, mache ich!«
Papa erläutert mir jedes Bild. Und ich höre nicht zu. Ich sehe zum Fenster hinüber. Dahinter ist es dunkel. Die Zweige des Rosenbusches kratzen über das Glas und ich frage mich, was der Notarzt mit Mama macht. Ich frage mich, ob Mama wirklich einen Herzinfarkt hat. Papa scheint das nicht zu interessieren. Er steht auf, gibt mir einen feuchten Kuss auf die Stirn. In Papas Familie geben alle feuchte Küsse. Seine Mutter auch. Wenn sie bei uns zu Besuch ist, gibt sie meiner Schwester und mir mit ihren weichen, zittrigen Lippen eine Menge feuchter Küsse. Und wir wischen mit der Hand heimlich den Speichel von unseren Wangen.
»Ich fahr noch mal ins Geschäft. Mama soll sich erst mal beruhigen!«
»Hmhm!«
»Schlaf schön, und guck dir das Buch an!«
»Mach ich. Danke!«
Papa geht, und das alberne Anti-Apartheids-Buch bleibt neben mir liegen. Ich trete es von der Überdecke und weiß nicht, was ich machen soll. Ich überlege, ob ich ins Wohnzimmer gehen soll. Ich traue mich nicht. Vielleicht sollte ich meinen Tonpenis aus dem Kleiderschrank holen. Aber das traue ich mich auch nicht. Mama ist schon ganz oft reingekommen, wenn es mir gerade überhaupt nicht gepasst hat.
»Schläfst du schon, Lelle?«
»Ja!«
»Soll ich das Fenster aufmachen?«
»Nein!«
»Ich mach lieber das Fenster auf. Hier muss mal frische Luft rein!«
»Hm!«
»Was liegt denn da auf dem Boden?«
»Meine Hose!«
»Schmeiß die bitte nicht immer auf den Boden. Ich wasche die doch nicht, damit die hinterher auf dem Boden landet!«
»Mach ich!«
»Schlaf gut!«
»Du auch!«
Manchmal kommt Mama noch mal an mein Bett und will die Decke durchschütteln.
»Ich schüttel noch mal deine Decke durch!«
»Nee!«
»Komm, ich schüttel sie eben durch!«
»Nein!«
»Warum denn nicht?«
Unter Fachleuten würde man so ein Verhalten bestimmt seelische Vergewaltigung nennen. Ich nenne es auch so. Mama vergewaltigt mich seelisch. Wenn ich im Bett liege, will ich meine Ruhe haben. Ich will liegen und träumen. Von einer Hand, die heimlich über meinen Rücken streicht. Von einem Jungen, der mich küsst. Von jemandem, bei dem ich nicht alleine bin.
2
Am nächsten Abend hocken meine Schwester und ich in der Küche auf dem Fensterbrett und sehen Mama zu, wie sie für das Abendbrot den Salat wäscht. Mama hat keinen Herzinfarkt. Dafür hat sie sich ein Handtuch in den Hosenbund gesteckt und noch eins um den Kopf gebunden. Das macht sie immer, sobald sie in der Küche steht. Und wie jeden Abend gibt es Neuigkeiten aus der Nachbarschaft zu erzählen. Mama sitzt direkt an der Quelle, weil sie mit dieser schrecklichen Rita Weidemann befreundet ist, die mit ihrer Familie in einem großen Haus auf der anderen Seite, außerhalb der Siedlung wohnt. Manchmal kommt Mama richtiggehend verwirrt nach Hause, wenn sie bei Rita zu Besuch war. Mit rotem Gesicht stürmt sie zur Tür rein, schmeißt ihren Schlüssel ins Schlüsselkörbchen und verschwindet für die nächste halbe Stunde oben in ihrem Nähzimmer, wo inzwischen auch ihr Bett drinsteht. »Ich leg mich mal kurz hin!« Cotsch und ich fragen: »Was war denn jetzt wieder los?« Und Mama sagt: »Rita spinnt!« Irgendwann kommt Mama wieder runter und fängt an, wie von Sinnen das Parkett zwischen den Teppichen im Wohnzimmer zu polieren. Wir sagen immer: »Mama, geh nicht zu Rita!« Aber Mama hört nicht auf uns. Und schon gar nicht auf Papa, der jedesmal einen Wutanfall kriegt, wenn er mitbekommt, dass Mama wieder bei Rita war. Heute hat Mama die dicke Rita bei Edeka beim Einkaufen getroffen. Plötzlich hat sie sich an der Kasse zu Mama umgedreht und gemeint: »Meine Töchter sind so hässlich. Deine sind viel hübscher!«
Solche Sätze gibt Rita ständig ab. Dass die sich nicht schämt. Würde Mama einmal so etwas über uns sagen, würde ich überall rum erzählen, dass sie nicht meine echte Mutter ist. Trotzdem finden meine Schwester und ich es ausgesprochen löblich, dass Rita uns viel hübscher als ihre Angeber-Töchter findet. Sie hat aber auch Recht. Susanna und Alice sehen nicht gut aus. Irgendwie so blass und mickrig. Über Susanna brauchen wir erst gar nicht zu reden. Ihre Nasenlöcher sind so groß, dass man da immer reingucken muss. Eigentlich wäre an dieser Stelle Mitgefühl angesagt. Trotzdem wollen Cotsch und ich wissen, was Mama auf Ritas kluge Einsicht erwidert hat. Ich glaube, das hat was mit angeborener Grausamkeit zu tun. Da können wir gar nichts gegen machen.
»Und was hast du zu Rita gesagt?«
»Ich hab gesagt: »Ach Rita, das stimmt doch gar nicht!«
»Und was hat sie dann gesagt?«
»Was?«
Selten ist Cotsch so gut gelaunt und vergnügt wie in diesem Moment.
»Was hat die fette Kuh dann gesagt?«
»Welche fette Kuh?«
»Na, Rita!«
»Weiß ich nicht mehr!«
»Los, erinnere dich!«
Leider hat Mama schon wieder keine Lust mehr, über die hässlichen Kinder von Rita zu sprechen. Vor allen Dingen, weil sie merkt, dass Cotsch ihr gestörtes Selbstbewusstsein mit solchen Nachrichten aufbaut.
»Ach nee. Das ist mir jetzt zu mühsam!«
»Los, konzentrier dich!«
»Rita hat dann von Susannas Akne angefangen!«
»Was ist mit ihrer Akne?«
»Rita hat gesagt, dass sie so viele Eiterpickel hat!«
»Igitt, ich kotze!«
Das macht mir wirklich Angst, über was sich erwachsene Menschen so alles unterhalten. Ich brauch echt nichts mehr hören. Aber Cotsch kann nicht genug kriegen. Solche Geschichten bauen so dermaßen ihr Selbstbewusstsein auf, dass man das schon keinem mehr erzählen kann. Erst, wenn alle anderen am Abspacken sind, geht es meiner Schwester richtig gut. Aber wehe, einer ist mal besser als sie in der Schule. Oder hübscher. Dann ist so richtig Totentanz angesagt. »Wie soll ich eine Eins in der Mathearbeit schreiben, wenn ihr mich nie lobt? Susanna und Alice werden immer gelobt. Nur ich werde nie gelobt. Ihr hasst mich doch alle! Ich bringe mich um!« Vorsichtshalber kriegt Cotsch in so einem Fall sofort eine Extra-Therapiestunde von Mama spendiert, um einem ihrer berüchtigten Wutanfälle vorzubeugen. Aber im Moment ist Cotsch ganz vorne mit dabei. Sie ist so richtig gut drauf. Vor allen Dingen, weil Susanna gerade ihr Abitur mit Sonderauszeichnung bestanden hat. Da ist es nur gut, dass endlich öffentlich bekannt wird, dass die Streber-Susanna hässlicher ist als Cotsch.
»Ja, und was hast du dann gesagt? Ich meine, die Tussi hat echt richtig viele Eiterpickel!«
»Ich habe gesagt, dass du ja auch ein paar Pickel hast!«
»Was hast du gesagt?«
Gratuliere, Mama! Du hast gerade den schlimmsten Fehler deines Lebens begangen. Und den wirst du nie wieder gutmachen können. Egal, was du zu deiner Entschuldigung anzubieten hast. Am besten, du holst gleich den nächsten Therapiegutschein aus deiner Tasche.
»Ich wollte Rita doch nur trösten!«
Das ist die lausigste Entschuldigung, die du dir hättest einfallen lassen können. »Ich wollte Rita doch nur trösten!« Mama, du hast wirklich noch viel zu lernen!
»Du bist so scheiße, Mama, ich hasse dich!«
Cotsch springt vom Fensterbrett runter, stürmt mit wehenden Haaren durch die Küche und knallt die Glastür hinter sich zu. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass bei uns schon einige Glastüren zu Bruch gegangen sind. Mama atmet tief durch, reißt die Glastür wieder auf und rast hinter meiner Schwester her.
»Es tut mir Leid. Sei nicht böse!«
Und schon geht im Flur das übliche Theater los. Ich bleibe auf dem Fensterbrett sitzen und starte mit dem Fingernägelkauen, während Mama an Cotschs Zimmertür hämmert.
»Mach die Tür auf. Sei nicht böse. Es tut mir Leid!«
»Ich hasse dich!«
»Bitte mach die Tür auf, dann können wir reden!«
»Ich will nicht mit dir reden. Ich will mit niemandem reden. Ihr kotzt mich alle an!«
»Komm wieder raus. Wir machen es uns in der Küche gemütlich!«
»Scheiß gemütlich! Mach’s dir doch mit deiner Rita gemütlich. Mit der fummelst du doch eh schon rum!«
Plötzlich ist es still. Ich höre auf an meinen Nägeln zu nagen und glotze durch die Glastür in den Flur. Mama lässt Cotschs Klinke los und bleibt für einen Moment bewegungslos im gedämpften Flurlicht stehen. Dann rupft sie die karierten Handtücher aus dem Hosenbund und vom Kopf, hängt sich im Windfang ihren Mantel über, öffnet die Haustür und marschiert mit ihren ausgefransten Hausschuhen auf die Straße. Das ist neu. Das hat Mama noch nie gebracht. Das hat was von Apokalypse. Ich glaube, Cotsch hat gerade Mamas wunden Punkt erwischt.
Was mache ich denn jetzt? Ich dachte, ich erfahre hier noch ein paar Details über das Intimleben von Weidemanns. So ein Mist. Dass Mama auch immer so unvorsichtig sein muss. Auf der anderen Seite verstehe ich überhaupt nicht, was Cotsch hat. Sie ist mit Abstand die Hübscheste aus ihrem Jahrgang. Die Jungs sind verrückt nach ihr. Ständig klingelt das Telefon bei uns: »Hallo, hier ist Guido, ist Cotsch zu Hause?« Manchmal wird Cotsch der Ansturm dieser liebestollen Jünglinge derart zu viel, dass sie mich zwingt, rumzulügen. »Tut mir Leid, Guido, Cotsch ist leider nicht da!« Dabei sitzt sie direkt neben mir auf dem Fensterbrett und schüttelt kichernd ihre blonden Locken. Cotsch ist wirklich wunderschön. Ich wünschte, ich wäre so schön. Sie hat diese hellen blonden Locken und tausend Sommersprossen im Gesicht. Außerdem hat sie im Gegensatz zu Susanna echt kaum Pickel. Nur ein paar auf dem Rücken. Die sieht sowieso keiner. Trotzdem ist Cotsch absolut empfindlich, was das Thema anbelangt. – Soll ich jetzt hinter Mama her rennen und meinen Arm um sie legen?
»Komm Mama, ist doch nicht so schlimm!«
Vielleicht fühlt sie sich alleine und hat wieder Panik, dass sie einen Herzinfarkt bekommt.
»Komm Mama, du weißt doch, dass Cotsch so empfindlich mit ihren Pickeln ist!«
Möglicherweise bekommt Mama einen Herzinfarkt. Kann doch sein. Mitten auf der Straße. Zu dieser Zeit sind nicht viele Nachbarn unterwegs. Die waschen alle zu Hause ihren Salat. Niemand würde Mama finden, wie sie in kalter Abendluft im Rinnstein liegt. Meine kleine Mama, ganz allein im Dunkel der Nacht mit schmerzendem Herzen. Mein Herz tut auch schon weh. Mein Brustkorb fühlt sich zusammengepresst an. Ich kriege kaum Luft. Ich spucke den letzten abgebissenen Nagel auf den grauen Linoleumboden und möchte weinen. Bestimmt weint Cotsch auch. Auf ihrem Bett sitzend, mit den Knien unterm Kinn und den Pullover darübergezogen. Da hätte Mama gleich wieder was zu melden: »Cotsch, beul deine Pullover nicht so aus!« Mama rennt im Zickzack durch die Nachbarschaft. Und Papa gießt im Geschäft seine Pflanzen und hat kein Bedürfnis, nach Hause zu kommen. Ich hätte jetzt nicht übel Lust, laut loszuschreien. Alles rauszulassen. Aber das ist nicht ratsam. Dann denken die Nachbarn wieder: »Oh, drüben werden die beiden Mädchen von ihren Eltern misshandelt!« Davor hat Mama am meisten Angst: »Kinder, schreit doch nicht immer so. Die Nachbarn denken sonst, wir misshandeln euch!« Bei dem Gekreische rufen die irgendwann noch mal die Polizei. Das muss ich ja nicht auch noch fördern. »Ihr misshandelt uns ja auch!« sagt meine Schwester dann immer. Am besten, ich wasche erst mal den Salat zu Ende und schleudere die grünen Blättchen in der roten Salatschleuder trocken. Die hat Mama vor zwei Wochen bei Edeka erstanden: »Guckt mal! Die Salatschleuder hat nur fünf Mark gekostet!« Bestimmt freut sich Mama, dass der Salat geschleudert ist, wenn sie wiederkommt. Hoffentlich kommt sie wieder. Nicht dass wir Mama das nächste Mal sehen, wenn sie aufgebahrt im Sarg liegt. Ich weiß nicht mal, ob Mama eingeäschert werden will. So wie Opa. Und der Salat ist fertig, wenn Papa kommt. Nicht dass Papa auch noch sauer wird, wenn der Salat nicht fertig ist.
»Kann mir mal jemand sagen, warum ich schon hier bin, wenn das Abendessen noch nicht fertig ist?«
»Tut mir Leid, Berni!«